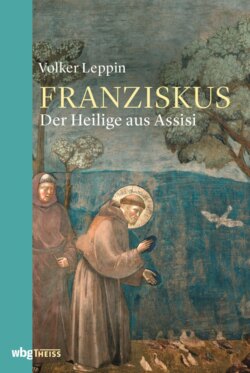Читать книгу Franziskus von Assisi - Volker Leppin - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Kapitel: Bruch
Оглавление1. Sohn aus gutem Haus
Franz
Franz hieß er. Francesco.1
Nichts scheint einfacher für den Beginn einer Biographie als der Name. Doch fangen hier schon die Probleme an. Denn Franz war, so berichtet es, den drei Gefährten folgend, Bonaventura in seiner Legenda minor, zunächst von seiner Mutter Johannes genannt worden, dann erst gab ihm der Vater Pietro Bernardone den Namen Franziskus.2 Dies war zwar kein ganz vorbildloser,3 aber doch eher ungewöhnlicher Name. Der Vater wollte damit wohl, so deutet es die Dreigefährtenlegende an, auf Frankreich anspielen.4 Dort nämlich hatte er sich gerade für eine Geschäftsreise aufgehalten, als um 1181/825 sein erster Sohn geboren wurde.6 Die Verbindung mit Frankreich wurde vielfach ausgemalt – tatsächlich scheint die französische Sprache eine gewisse Rolle im Hause Bernardone gespielt zu haben: In der Dreigefährtenlegende heißt es einmal, Franz habe gerne Französisch gesprochen, „auch wenn er es nicht recht zu sprechen wusste“.7 Als selbst sein eigener Bruder Angelo ihn einmal verspottete, soll Franz darauf auf Französisch reagiert haben,8 und ein andermal, so berichtet Celano, habe er, als er durch den Wald lief, in französischer Sprache Loblieder Gottes gesungen.9 Jacques Le Goff vertritt sogar die These, dass diese Vorliebe für das Französische der Grund dafür gewesen sei, dass Giovanni Bernardone von den Mitbürgern Francesco genannt wurde10 – dann wäre an der Geschichte von der Namensgebung durch den Vater nichts dran.
Assisi
Freilich ist der Bezug des Vaters auf Frankreich und das Französische nicht von der Hand zu weisen. Offenbar waren dessen Handelsbeziehungen dorthin intensiv – sie waren die Folge dessen, dass Pietro zu denen gehörte, die vom raschen sozialen Aufstieg der Stadt Assisi und Norditaliens insgesamt im frühen 13. Jahrhundert besonders profitierten. Der Handel und das Geldgeschäft nahmen in dieser Zeit einen rasanten Aufschwung, der nicht nur die italienischen Städte wachsen ließ, sondern auch zu Umschichtungen in der Gesellschaft führte. Traditionelle Rechte des Adels zählten weniger,11 bestimmende Kräfte waren nun Kaufleute wie Pietro Bernardone. Der spirituelle Weg, der Franz von Assisi in die leibliche und geistliche Armut führte, gewinnt sein besonderes Profil vor dem Hintergrund dieser sozialen Spannungen, in deren Verlauf Reichtum in Assisi Anerkennung als Grundlage von Recht und Macht erhielt.12 In Franz’ Kindheit waren die Verhältnisse noch klar und auch äußerlich sichtbar: Über der Stadt thronte die Rocca Maggiore, eine mächtige Burg, in welcher gelegentlich der Herzog von Spoleto residierte, zu dessen Herrschaftsgebiet Assisi gehörte. Noch unter Friedrich I. Barbarossa (1152–1190) hatte dieses Amt Konrad von Urslingen eingenommen (1176/77–1198/1202),13 dessen Herrschaft allerdings ins Schlingern geriet, als mit dem Tod König Heinrichs VI. (1191–1197) Unklarheit in der Thronfolge aufkam und der eben neu ins Amt gekommene Papst Innozenz III. (1198–1216) seinerseits machtvoll seine Interessen in Umbrien vertrat. Die Machtkonkurrenz nutzten die Bürger von Assisi 1197/98,14 um gegen die herrschende Nobilität aufzubegehren. Sie vertrieben Konrad aus seiner Burg, plünderten die Besitzungen der Adeligen und vertrieben diese – unter anderem auch die Ritterfamilie Offreduccio di Bernardino mit ihrer Tochter Klara, der späteren Gefährtin von Franz – aus der Stadt. Damit reagierten sie nicht zuletzt darauf, dass in Umbrien Rechtsvorstellungen aus dem nordalpinen Raum importiert wurden, durch welche tradierte Freiheiten beschnitten wurden.15 Es dauerte eine Weile, bis sich die Verhältnisse beruhigten: In zwei Etappen, 1203 und 1210, wurden Friedensverträge geschlossen,16 der erste ein „Diktat der Sieger“, nämlich der Adeligen, „über die Besiegten“, der zweite ein fairer Ausgleich, der die Rechte der Bürgerlichen steigerte17 – die Bekehrung des Franz also, zumal wenn man sie nicht auf einen Moment im Jahre 1206 festlegt (s.u. 39–61), fand genau in dieser Zeit massiver Auseinandersetzungen statt. Deren Ergebnis lautete in dem Friedensvertrag von 1210, dass die beiden sozialen Gruppen sich gemeinsam auf ein Verhalten zum Wohle der Stadt verpflichteten. Ihr Verhältnis zueinander sollte von nun an nicht mehr allein durch den Geburtsstand geregelt sein, der die Adeligen privilegiert hatte, sondern Geld spielte eine Rolle. Händler sollten sich ihre Freiheit vom Adel erkaufen können, und generell sollte das Bürgerrecht in Assisi nun vom jeweiligen Eigentum abhängen. Ausgerechnet das erste Aufkommen der Bezeichnung der unterschiedlichen sozialen Gruppen in Assisi als maiores und minores18 brachte so zugleich eine Neudefinition dieser Bezeichnungen mit sich: Zur Oberschicht, den maiores, sollte fortan gehören, wer über entsprechendes Einkommen verfügte. Geld regierte vielleicht nicht die Welt, aber in Assisi bedeutete es sozialen Aufstieg und Erfolg.19 Wie stark sich Bernardone selbst in diesen Auseinandersetzungen engagierte, ist nicht bekannt, doch gehörte er zweifellos zu denen, die hiervon profitierten. Franz’ Vater war Repräsentant ebenjener Aufsteigerschicht der Kaufleute, die ihr Leben dem Verdienen von Geld verschrieben – so sehr, dass es offenbar mindestens denkbar erscheint, dass er so lange in Frankreich verweilt haben könnte, dass er Geburt und Taufe seines ersten Sohnes verpasste. Helmut Feld nimmt an, dass eine solche Reise auch einmal ein Jahr dauern konnte20 – legt man dies zugrunde und geht davon aus, dass der Vater nicht allzu lang nach der Geburt seines Sohnes zurückgekommen ist, bedarf es keiner allzu blühenden Phantasie, sich auszumalen, dass in der Stadt Gerüchte über eine uneheliche Herkunft des Jungen aufgekommen sein könnten. Solche Gerüchte scheinen sich jedenfalls noch in Reflexen der Lebensbeschreibungen von Franz widerzuspiegeln: So berichtet Celano, die Menschen im Umfeld der Familie hätten gemeint, Franz stamme nicht aus der Sippe jener Eltern, die vermeintlich seine waren.21 In der Dreigefährtenlegende sind es sogar die Eltern selbst, die angesichts seines Lebenswandels den Eindruck gewannen, „dass er nicht ihr Sohn sei, sondern der eines bedeutenden Fürsten“.22 In dem Sinnzusammenhang, den die Legenden erstellen, haben diese Aussagen eine klare Funktion, nämlich Franz’ heiligen Charakter von früh an herauszustreichen, der über seine menschliche Herkunft hinausreichte. Allerdings zeigt sich in ihnen auch, dass dieser theologische Gedanke durchaus sozial durchgespielt wurde. Die Dreigefährtenlegende schwankt in der Zuordnung eigenartig. Während im Plural die Elternschaft beider Eltern infrage gestellt wird, ist die angenommene tatsächliche Herkunft nur im Singular benannt: ein magnus princeps, ein bedeutender Fürst. Folgt man dem juristischen Prinzip, dass die Mutter immer sicher ist, so reimt sich als Fragment hinter diesem Sinnzusammenhang möglicherweise die Unterstellung zusammen, Franz’ Mutter sei – angesichts der beschriebenen Konflikte in Assisi muss man wohl sagen: ausgerechnet! – von einem Adeligen geschwängert worden. Dann hätte die Namensgebung „Franziskus“ einen entweder hochironischen oder sehr demonstrativen Sinn: Entweder hätte der Vater damit ausgedrückt, dass der Sohn auf wundersame Weise aus Frankreich in den Schoß der Mutter geraten wäre, oder er hätte gerade darauf hinweisen wollen, dass allen Gerüchten zum Trotz er selbst der Vater war. Dass die Biographen eine uneheliche Geburt, deren Makel in mittelalterlichen Vorstellungen nicht allein die Eltern belastet hätte, sondern auch das Kind, kaum auch nur hätten andeuten wollen, ist klar. Mithin könnte es sich bei den Erwähnungen um eine Verschleierung im Sinne der Heiligkeit des Franz handeln – womit dieser spekulative Gedankengang allerdings auch an seine Grenzen stößt. Zum einen ist festzuhalten: Gerade weil die Hinweise auf eine nichteheliche Herkunft nicht als Bericht, sondern als Wahrnehmung der Beteiligten auftreten, käme man mit ihnen allenfalls zu der Annahme, dass es Gerüchte dieser Art in Assisi gegeben haben könnte. Und mit Gerüchten verhält es sich nun einmal so, dass sie die Wahrheit nicht ohne Weiteres wiedergeben, sondern sich zu ihr als Deutungen verhalten, noch dazu Deutungen, deren Anlass in der Abwesenheit des Vaters unmittelbar deutlich wird. Man könnte so also vielleicht rekonstruieren, was böse Zungen behaupteten – die Annahme, dass Franz tatsächlich unehelich geboren wäre, lässt sich solcherart nicht begründen. Das gilt umso mehr, als an dieser Stelle an die anfänglichen methodischen Überlegungen erinnert sei: Beide zitierte Äußerungen sind allenfalls fragmentarische Versatzstücke, die Anlass zum Nachdenken über alternative Erzählmuster geben. Zur Begründung eines anderen Sinnzusammenhangs, gar zur Schaffung eines Skandals um die Geburt von Franz von Assisi reichen sie nicht. Er war, das bleibt die glaubwürdigste Auskunft, der Sohn von Pietro Bernardone und seiner vermutlich Pica genannten Frau.23
Blick auf Assisi mit der gewaltigen Anlage der Basilika.
Johannes
Schon der Name Franziskus also löst allerhand Assoziationen und Erklärungsmöglichkeiten aus – noch schwieriger aber wird es, wenn man auf den Namen Johannes zu sprechen kommt. Stimmt die Beschreibung der frühen Viten, so wäre dies der Taufname von Franz gewesen – der Name, unter dem er dann über Jahrhunderte hinweg bekannt wurde, wäre wohl nicht formal an dessen Stelle getreten, sondern hätte als eine Art Beiname zu gelten, hinter dem der Giovanni fast verschwand. Freilich hält Celano fest, dass Franz selbst jedenfalls seine besondere Beziehung zu Johannes dem Täufer nicht vergessen habe: Unter allen Heiligenfesten habe er besonders das Fest des Johannes begangen.24 Dass sich in den erhaltenen liturgischen Schriften von Franz ein solcher spezieller Bezug auf den Täufer nicht findet, muss dies nicht grundlegend infrage stellen.
Dennoch gibt es Gründe, daran zu zweifeln, dass Franziskus wirklich auf den Namen Johannes getauft wurde.25 Die Geschichte gehört zu jenen Informationen, die erst nach dem Aufruf des Crescentius auftauchten. So berichtet die Dreigefährtenlegende hiervon.26 Sollte diese doch erst aus späterer Zeit stammen, wäre definitiv Celanos zweite Vita der erste Beleg für den Taufnamen Johannes.27 In der ersten Vita wusste er hiervon noch nichts. Das muss nichts heißen: Es wäre durchaus denkbar, dass der Name Giovanni tatsächlich gänzlich von Francesco überlagert worden war und dass allein die guten Freunde der ersten Stunde, die möglichen Autoren der Dreigefährtenlegende, noch die Erinnerung bewahrt und so an Celano weitervermittelt hätten.
Das kann sein, muss aber nicht.
Denn eines ist irritierend: Mit der Aufnahme bei Celano gewinnt der Name Giovanni einen eminenten theologischen Sinn. Während der Name Franziskus sich auf die Verbreitung des Rufes des Heiligen beziehe, weise der Name Johannes auf den ihm aufgetragenen Dienst hin.28 Wie genau Celano die Bedeutung des Namens Franziskus dabei versteht, ist nicht ganz klar: Möglicherweise will er andeuten, dass der Ruf des Franziskus sogar bis nach Frankreich erschollen sei. In der ersten Vita hatte er den Namen Franziskus noch im Sinne eines freimütigen („francus“) und vornehmen Herzens gedeutet.29 Sehr viel klarer ist hingegen die inhaltliche Deutung des Namens Johannes auf die Sendung des Franz: Johannes der Täufer hatte die Ankunft Christi auf Erden angekündigt – seitdem warteten die Christen auf die Wiederkehr Christi am Jüngsten Tag. Nun sollte offenbar Franz von Assisi die Rolle zufallen, ebendieses Kommen anzukündigen. Und er tat das genau mit dem Ruf zur Buße (s.u. 100), den auch der Täufer in den Mittelpunkt gestellt hatte. Franz erhielt so seinen Ort in der Heilsgeschichte – und dies in einer Vita, die auch den Zweck erfüllen sollte, divergierende Sichten auf das Erbe des Ordensgründers zusammenzuhalten oder wieder zusammenzuführen. Celanos zweite Vita diente so nicht allein der Erzählung vom Leben des Franziskus, sondern auch seiner Deutung im Rahmen von Gottes Plan mit den Menschen. So wie Johannes nach Mt 11,11 der größte unter den von Frauen Geborenen gewesen war, sollte Franz nun, so Celano, unter allen Ordensgründern der vollkommenste sein.30 Möglicherweise reagierte Celano damit schon darauf, dass genau in der Zeit, in der Crescentius nach Informationen über Franz suchte, im Orden die Schriften Joachims von Fiore († 1202) bekannt wurden,31 die wenig später in dem Sinne gedeutet wurden, dass mit Franz von Assisi das Dritte Zeitalter der Heilsgeschichte beginne: das Zeitalter des Geistes, das von den Mönchen und Orden geprägt sein sollte. Selbst wenn sich dieser Bezug nicht sichern lässt, böte Celano mit seiner Johannes-Franziskus-Analogie die moderate Fassung einer apokalyptischen Deutung des Franz von Assisi. Er konnte indes nicht verhindern, dass bald radikale Konzepte aufkommen würden, in denen mit der heilsgeschichtlichen Deutung die Erwartung einer bald einbrechenden zukünftigen Herrschaft Christi auf Erden verbunden wurde. In jedem Falle ist es offenkundig, dass zu dem Versuch, Franz eine heilsgeschichtliche Vorläuferfunktion für Christus zuzuschreiben, der Name Johannes besonders gut passt.
Das allein wäre kein Grund daran zu zweifeln, dass die Erzählung vom Taufnamen Johannes echte Erinnerung widerspiegelt. Doch es gibt ein weiteres Detail, das auffällig – und das heißt in solchen Fällen: Misstrauen erweckend – gut passt: Die Geschichte von zwei Namen zur Benennung des Kindes findet sich nicht nur bei Franz, sondern eben auch bei Johannes dem Täufer. Das Neue Testament berichtet davon, dass dessen Verwandte selbstverständlich davon ausgingen, dass der kleine Junge nach seinem Vater Zacharias genannt werden sollte. Dieser selbst konnte sich dazu nicht äußern – er war mit Stummheit bestraft worden, weil er angesichts seines hohen Alters der Ankündigung, einen Sohn zu bekommen, nicht geglaubt hatte. Seine Frau aber widersprach den Plänen, den Jungen Zacharias zu nennen, und beharrte darauf, er solle Johannes heißen. Daraufhin wurde Zacharias dazu gebracht, den gewünschten Namen auf ein Täfelchen zu schreiben – und auch er notierte den Namen Johannes (Lk 1,57–64). Während also die Eltern von Franz uneins in der Namensgebung waren, herrschte bei Johannes dem Täufer Einigkeit. Doch die seltsame Doppelung der Namen findet sich hier wie dort, ebenso die Thematisierung beider Elternteile als Namengeber – eine Parallele, auf die Celano selbst sogar ausdrücklich verweist.32 Überdeutlich ist diese Folie hinter Celanos Bericht erkennbar – und es drängt sich der Verdacht auf, dass der Name Johannes eine theologisch gesteuerte Erfindung ist. Franz hieß wohl tatsächlich von Anfang an nicht anders als genau so: Franz oder Francesco.
2. Wilde Jugend oder frühe Heiligkeit?
Mag die Frage der Namensgebung noch als ein weniger wichtiges Detail erscheinen, das zudem so ausgeht, dass eigentlich genau der Name gesichert bleibt, den man ohnehin als den in der Wirkung entscheidenden kennt, so liegt es mit den Schilderungen von Franz’ Jugend etwas anders. Hier ist nämlich gleichfalls der biographische Neuansatz der vierziger Jahre des 13. Jahrhunderts wirkungsvoll gewesen – so wirkungsvoll, dass Celano sich in der Schilderung der Jugend sogar selbst widerspricht. Liest man seine beiden Viten allein im Blick auf die Jugend von Franz, so könnte man den Eindruck gewinnen, es mit zwei ganz unterschiedlichen Personen zu tun zu haben: In der ersten Vita schrieb Celano über einen jungen Mann, der bis in sein 25. Lebensjahr seine Zeit auf unglückselige Weise verschwendete.33 Nach genauer Kenntnis klingen diese Schilderungen zwar nicht: Celano schreibt eher allgemein davon, dass Kinder dazu neigen, den schlechten Lebenswandel ihrer Eltern nachzuahmen, und dies so auch für Franziskus gegolten habe.34 Doch ist das Urteil eindeutig, und die individuelle Zuspitzung liegt für Celano darin, dass Franziskus, geradezu als Gegenbild zu seiner späteren Führungsrolle in geistlichen Dingen, schon als Jugendlicher in diesen schlechten Verhaltensweisen alle Gleichaltrigen überragte35 und zum Anführer einer Bande in Assisi wurde36. Und so wie er später Geld den Armen geben wollte, war er schon in seiner Jugend dafür bekannt, Geld mit vollen Händen zu verteilen, freilich offenbar ziel- und wahllos.37 Worin die Sünden genau bestanden, deren er sich schuldig machte,38 benennt Celano nicht, doch ist für den Leser deutlich, dass hier jemand nur seinen Lüsten und Begierden folgte. Franz’ Heiligkeit wurde so gerade als Gegenbild zu seiner früheren Sündigkeit verstehbar.
So sehr dieses Erzählmuster also dazu dienen mochte, die spätere besondere Heiligkeit herauszustreichen, so sehr brachte es doch auch eine Gefahr mit sich: Wer Celanos Vita las, war geradezu eingeladen, sich die Vergehen auszudenken, und man muss nicht viel spekulieren, um anzunehmen, dass, auch wenn Celano deren Erwähnung vermied, sexuelle Ausschweifungen zu dem gehörten, was man mit einem solchen Lebenswandel assoziierte. Daher sah Celano schon in seiner jüngst neu entdeckten Kurzfassung der Vita aus den dreißiger Jahren die Notwendigkeit, zu betonen, dass Franz sich trotz aller Sündhaftigkeit „von jenen übergroßen Sünden“ enthalten habe, durch welche die Menschen ihre eigene Herkunft schändeten.39 Das Erzählmuster sollte nicht die Vorstellung hervorrufen, dass Franz sich etwa durch Sünden in nachhaltiger Weise befleckt und seine lebenslange sexuelle Unberührtheit verloren hätte. In dieser Einschränkung kann man das Scharnier sehen, das zu einer Änderung des Erzählmusters führte, welches man dann sehr deutlich in der zweiten Vita findet: Nun zeichnet sich der junge Franziskus gar durch magnanimitas aus, Seelengröße, und durch Ehrenhaftigkeit der Sitten,40 und es waren gerade seine herausragenden Sitten, die den oben erwähnten Eindruck hervorriefen, er sei gar nicht Sohn seiner Eltern.41 Die Korrektur des Franziskusbildes war allerdings nicht durchgreifend. Insbesondere in der Dreigefährtenlegende spürt man noch das Schwanken: Zwar habe, so der Bericht, Franziskus auf Leute, die Unanständiges sagten, gar nicht mehr geantwortet, aber dennoch sei er seiner Natur nach jederzeit spaßbereit und mutwillig gewesen („iocosus et lascivus“),42 und auch seine Verschwendungssucht begegnet hier noch.43 Selbst Celano hat in seiner zweiten Vita das neue Bild von Franziskus nicht konsequent durchgehalten, ja konnte das gar nicht – denn wenn Franziskus nicht auch von Makeln belastet gewesen wäre, hätte sein Biograph letztlich auf die Vorstellung einer Bekehrung verzichten oder diese zumindest deutlich relativieren müssen. Das aber hätte die gesamte Architektur der Biographie durcheinandergebracht. So kommt es bei ihm dann doch zu einer grundlegenden Wandlung, in welcher Franziskus aus einer Person zu einer anderen wird („alter ex altero“)44 – und sogar die Erinnerung daran, dass Franz einstmals Anführer einer Jugendbande gewesen war, bleibt in dieser zweiten Vita wach.45 Diese offenkundigen Änderungen, der Versuch, Geschichte umzuschreiben, vor allem aber der mangelnde Erfolg dieser kosmetischen Bemühungen spräche bei der Suche nach der einen wahren Franz-Biographie zunächst einmal dafür, biographisch der älteren Version zu folgen und Franz als einen auf Geld und Abenteuer ausgerichteten Jugendlichen zu zeichnen. Das ist nicht ganz falsch, man muss sich allerdings auch bewusst halten, dass man damit letztlich wiederum einem hagiographischen Schema folgt: eben der Bekehrung von der Sünde zur Heiligkeit. Mindestens zwei ideale Vorbilder hierfür kennt die Geschichte des Christentums: Paulus, der sich vom Verfolger der Christen zum Anhänger Christi gewandelt hat, und Augustin, der in seinen Confessiones ausführlich schildert, wie er vor seiner Bekehrung zwar auf der Suche nach Gott war, aber doch einen durch und durch weltlichen Lebenswandel führte. Für Augustin gilt dabei etwas, was gleich noch bei Franziskus zu beobachten sein wird: Die Vorstellung von der einen großen Bekehrung löst sich historisch in eine Vielzahl von Bekehrungen auf. Das macht das Muster des Wandels von Böse zu Gut, vom Sünder zum Heiligen noch einmal fraglich. So bleibt auch hier: Eine eindeutige Schilderung der Jugend des Franz ist nicht möglich, zumal die greifbaren Elemente in den Erzählungen doch zu wenige sind.
Dass keine der beiden Erzählungen recht hat, kann aber auch heißen: Beide haben recht. Löst man sich von der Zeichnung der Wirklichkeit in Schwarz und Weiß, die für beide Varianten prägend ist, so wird das Bild vielfältiger und differenzierter: Unter einer Decke von religiösen Deutungen zeigt sich zunächst vor allem der einfache Umstand, dass Franz eben als Sohn seiner Eltern aufwuchs und den Normen folgte, die deren Leben ausmachten. Genau das ist ja der Hintergrund der Negativschilderung in der ersten Celano-Vita. Wenn Franz inmitten der Verschwendungssucht als „cautus negotiator“, als vorsichtiger Geschäftsmann, erscheint,46 so dürfte darin nachklingen, dass er, nachdem er an der Kirche San Giorgio lesen gelernt hatte,47 im väterlichen Geschäft angelernt wurde48 und hier durchaus erfolgreich war – dass er sich später selbst als idiota, als gänzlich ungebildet, bezeichnete,49 war eine Stilisierung seiner eigenen früh angelegten Armut. Seine Bildung war gewiss nicht herausragend, aber über elementare Kenntnisse in Grammatik und Mathematik dürfte er verfügt haben. Gelegentlich verfasste er auch Texte in lateinischer Sprache, die allerdings nicht nur bezeugen, dass er diese Sprache einmal erlernt hat, sondern auch, dass er sie nicht sehr gut beherrschte.50 Insofern ist die Selbstbezeichnung als idiota nicht einfach falsch, sondern vielleicht eine Übertreibung eines geringen Bildungsstandes.
Andere Aspekte, die man in den Jugenderzählungen erfährt, sprechen gleichfalls für eine solche Orientierung an den Verhaltensweisen der Eltern. Wenn es heißt, dass er kostbareren Stoff für seine Kleider verwandte, als ihm zustand,51 so muss man das nicht im Sinne einer wilden Verschwendungssucht verstehen, sondern kann es auch als Anzeichen dafür lesen, dass er sich ebenso wie seine Eltern an dem Aufstieg des Bürgertums freute und die sich auch in Kleidung ausdrückenden Standesgrenzen ignorierte. Möglicherweise wird man in dem Hinweis auf eine Bande, die er um sich scharte, nicht mehr zu sehen haben als Erinnerungen daran, dass er einen großen Freundeskreis hatte. Ob sich darin ein besonderes Charisma ausdrückte, das später unter ganz anderen Voraussetzungen förderte, dass er die franziskanische Bruderschaft gründen und um sich scharen konnte, wird man schwer sagen können – die Biographen wollen, dass wir ihnen dies abnehmen. Der spätere Verlauf der Geschichte des Franziskus spricht eher dafür, dass sich sein Charisma erst herausbildete, als sich seine Botschaft geformt hatte (s.u. 151f.). Ob es stimmt, wissen wir darum nicht. Zugleich mag aber in den Gegenbildern, die die Biographen auf seine Heiligkeit hin deuten, mitschwingen, dass Franz in seiner Jugend Diskrepanzerfahrungen machte, die das auf Geld und Gewinn ausgerichtete Normsystem, in dem er aufwuchs, erschütterten. Man braucht nicht viel Phantasie, um sich dies vorzustellen: Dass ein junger Mann gegen seinen Vater aufbegehrt, gehört zu den menschlichen Grunderfahrungen bis heute. Für Assisi kann man sogar noch mehr anführen, brachten es die oben beschriebenen Konflikte zwischen Bürgern und Adeligen doch mit sich, dass Selbstverständlichkeiten sehr fundamental infrage gestellt wurden. Die Erfolgsgeschichte von Geld und Reichtum, die sich in den Verträgen seiner Vaterstadt niederschlug, musste der Jugendliche, der dort aufwuchs, keineswegs zwingend nur positiv sehen. Mit ihr wurde auch eine vorhandene Ordnung erschüttert. Solche Diskrepanzerfahrungen dürften viele der Zeitgenossen in Assisi gemacht haben.52 Bei Franz legten sie die Grundlage für das, was dann als Bekehrung beschrieben wurde und durch Jahrhunderte hindurch prägend für eine ganz eigene geistliche Welt wurde. Und es ist letztlich diese Diskrepanz, die sich in den beiden unterschiedlichen Erzählungen seiner Jugend niedergeschlagen hat. Was bei ihm ineinander lag, versuchen sie, mit jeweils gegenteiliger Ausrichtung, zu vereindeutigen.
3. Unruhe
Bekehrung
Nicht nur die frühen Biographen wünschten sich, einen Moment festzumachen, an welchem die Bekehrung von Franz stattfand. Ihm selbst ging es nicht anders. In seinem Testament scheint er den Auslöser hierfür sehr präzise anzugeben:
„Der Herr verlieh mir, Bruder Franziskus, so mit dem Tun der Buße zu beginnen: Als ich in Sünden war, schien es mir allzu bitter, Leprose zu sehen. Und der Herr selbst führte mich mitten unter sie und ich übte Barmherzigkeit an ihnen. Und als ich mich von ihnen zurückzog, wandelte sich das, was mir bitter schien, in Süße der Seele und des Leibes; und später verharrte ich ein wenig und verließ die Welt“.53
Nach dieser Erinnerung war es die erschütternde Erfahrung mit den Leprosen im Abseits der Gesellschaft, mit der seine Kehrtwendung begann. In der neueren Forschung hat man diesen Hinweis gerne aufgenommen, um den Moment der einen und einzigen entscheidenden Bekehrung des Franz zu benennen.54 Die Bemerkung scheint frei zu machen von den hagiographisch überformten Erzählungen Celanos und anderer und doch die Möglichkeit zu eröffnen, eine klar nach dem Muster großer Bekehrungsgeschichten strukturierte Lebensgeschichte zu erzählen.
Doch wird man hier noch einmal Vorsicht walten lassen müssen: Auch der Interpret seiner selbst bleibt ein Interpret, und es ist durchaus typisch für autobiographische Erzählungen von Konvertiten, einen Moment des Bruchs festzumachen.55 In diesem Falle legt sogar Franz selbst nahe, dass es unangemessen wäre, seine Bekehrung allein an der Begegnung mit Leprosen festzumachen. Den eigentlichen Rückzug aus der Welt habe er ja, so wie er es beschreibt, erst später nach einer Zeit des Verharrens angetreten.56 So bedeutsam der Rückblick also ist, mit ihm ist noch nicht alles gesagt. Man wird ihn im Hinterkopf behalten müssen, wenn man schaut, welche Fragmente eines Bekehrungsweges sich in den biographischen Erzählungen sonst noch finden, und sie neu zu arrangieren sucht. Die Begegnung mit den Leprosen war ein erschütternder, wichtiger Schritt, aber er war vorbereitet durch die beschriebenen Diskrepanzerfahrungen zwischen vorgegebenen Normen und irgendwie anders Fassbarem. Sie spiegelt sich in den verschiedenen Erzählungen von Bekehrungen oder von Etappen der einen großen Bekehrung in den Viten: Celano und andere versuchten, die vielfältigen Erfahrungen in einen geschlossenen Erzählzusammenhang zu bringen, der aus Erfahrungen, die vermutlich nebeneinander standen, eine Abfolge von Ereignissen machen sollte. Daher also geht es hier eher um Unruhe als um Bekehrung – zumal nach allem, was man sagen kann, Franz in dieser Zeit noch weit von jener Klarheit entfernt war, die man einem Bekehrten unterstellen müsste.
Diskrepanzerfahrungen
So wird man die unterschiedlichen Aspekte von Lebensänderungen und Neuorientierungen als fragmentarische Überlieferungen aus einem komplexen Geschehen zu verstehen haben. Die grundlegende Diskrepanzerfahrung des jungen Kaufmannssohnes ließ sich im Nachhinein an verschiedenen einzelnen Episoden festmachen, die wohl in der Summe die große Frage aufwarfen, ob sein Leben im finanziell begründeten Wohlstand das richtige war – ohne dass Franz auf diese Frage schon gleich eine klare Antwort gehabt hätte. Als die Biographen die einzelnen Episoden sammelten, mussten sie zum Beispiel feststellen, dass Franz zwar offenbar grundlegende Erfahrungen gemacht hatte, sein Leben sich aber noch nicht geändert hatte. Auch dies versuchten sie erzählerisch einzufangen, indem etwa Celano erklärte, Franz sei schon sehr früh gewandelt gewesen, freilich nur seinem inneren Sinn nach, noch nicht leiblich.57 Manche Erzählungen projizieren das Wissen um die spätere Entwicklung von Franz in rätselhafte Worte, etwa indem sie von Gesprächen über eine mögliche Heirat berichten:
„Die Leute meinten, er wolle eine Frau heiraten, und fragten ihn danach: ‚Willst du eine Frau heiraten, Franz?‘
Der antwortete und sagte ihnen: ‚Ich werde eine edlere und schönere Braut heiraten, als ihr jemals gesehen habt, deren Gestalt die der anderen übertrifft und deren Weisheit die übrigen überragt‘“.58
Celano fügte gleich die Deutung an: Bei der Braut, die Franz hier ankündigte, habe es sich um das Leben im Orden gehandelt.59 Selbst wenn hinter der Erzählung eine echte Erinnerung stecken sollte, entstand diese Deutung erst sekundär, um einem Satz, der vielleicht nicht mehr war als die haltlose Prahlerei eines jungen Mannes, einen biographischen Sinn zu geben. Kaum anders steht es wohl mit der Erzählung, Franz habe einem Freund gegenüber von einem kostbaren Schatz gesprochen, den er gefunden habe60 – damit war natürlich nach Mt 13,44 der verborgene Schatz, das Himmelreich, gemeint,61 während der Freund, dem Franz dies erzählt haben soll, an einen realen Schatz glaubte. Auch dies soll nur unterstreichen, dass Franz, obwohl er nach außen noch in der Welt lebte, bereits „heilig durch sein heiliges Vorhaben“ war.62 Solche Erzählungen von Doppeldeutigkeiten sind nicht mehr als der Versuch, die vielen Facetten von Franz’ Leben in ein klares Schema von Schwarz und Weiß einzuzeichnen und umso mehr die dann auch äußerlich erfolgte Bekehrung herauszustreichen. Biographisch haltbar sind sie nicht. Gerade das feste Vorhaben, das immer wieder erscheint, hat es so früh wohl kaum gegeben. Es ist nicht Voraussetzung der äußeren Bekehrung, sondern ihr Teil, genau genommen: erst ihre Folge.
Gefangenschaft
Gleichwohl dringen aus manchen Erzählungen tatsächlich Lebenserfahrungen, die Franz in seinem selbstverständlichen Leben als wohlhabender Bürger von Assisi erschütterten, und zwar schon sehr früh, nach allem, was wir erkennen können, vor der Begegnung mit den Leprosen. Erschütternd und verunsichernd war die Erfahrung von Krieg, vor allem aber Gefangenschaft, die Franz mit etwa zwanzig Jahren machte: Assisi lag über Jahre hinweg im Krieg mit Perugia. Die beiden Städte liegen nur rund 25 Kilometer voneinander entfernt und stritten um die Vorherrschaft in Umbrien. Im November 1202 kam es bei Collestrada, einem zwischen beiden Städten gelegenen Ort, zu einer großen Schlacht, an welcher auch der junge Franz beteiligt war. In der Folge wurde er in Haft genommen und erst ein Jahr später – vermutlich aufgrund des (bald wieder revidierten) Friedensschlusses zwischen beiden Städten im November 1203 – wieder daraus entlassen. Zwölf Monate befand er sich in den Händen der Perugianer.
Die Berichte von dieser Gefangenschaft finden sich erst in der zweiten Celano-Vita und der Dreigefährtenlegende – sie dürften tatsächlich zu jenem Material über das Leben des Franz gehören, das man nun neu entdeckte und wertete. In der allerersten Phase hatte diese sehr frühe Erinnerung noch keine Rolle gespielt, vermutlich, weil sie allzu sehr ins Weltliche fiel. Nun, in der zweiten Vita, schildert Celano – ebenso wie die Dreigefährtenlegende – ausführlich die Gefangenschaft. Das Bemerkenswerte ist, dass Franz sich schon hier durch besonderes Verhalten ausgezeichnet haben soll: Übereinstimmend berichten Celano und die drei Gefährten von einer schwer zu erklärenden, für seine Mitgefangenen offenbar auch irritierenden Fröhlichkeit. Bei Celano ist diese schon gleich religiös aufgeladen: Franz habe sich im Herrn gefreut und so die Fesseln verlachen und verachten können.63 Recht konkret ist der Bericht, dass Franz sich einem Mitgefangenen zugewandt habe, der durch seinen Hochmut für die anderen unerträglich gewesen sei.64 Hierin zeigt sich für die Biographen ein Hinweis auf die spätere Zuwendung des Franz zu den Ausgegrenzten, allerdings sollte man nicht überlesen, dass die Dreigefährtenlegende nicht nur den Charakter dieses Ritters kritisiert, sondern ihm auch zuschreibt, er habe einem der Gefangenen gegenüber Unrecht begangen65 – worum es sich hier handelte, bleibt offen, aber es entsteht doch der Eindruck, dass Franz sich einer gewissen Solidarität der Gefangenen untereinander entzogen und damit womöglich selbst in eine Außenseiterposition gebracht hat. All dies taucht in den Quellen gut vierzig Jahre nach dem Geschehen auf – mit historischen Berichten hat dies wenig zu tun.66 Die Quellen lassen wohl erkennen, dass Franz unter den Gefangenen eine Sonderrolle zukam, was aber schlicht damit zu tun haben kann, dass er wohl als einziger Bürgerlicher im (erträglicheren) Gefangenenlager der Adeligen untergebracht war.67 Der Grund hierfür mag weniger sein höfisches Benehmen gewesen sein, wie die drei Gefährten es erklären,68 als seine angeschlagene Gesundheit. Das Ergebnis freilich war ganz von selbst eine Rolle jenseits der Gemeinschaft der Gefangenen, und so mag auch der erwähnte ausgegrenzte Ritter ihm die willkommene Gelegenheit gegeben haben, unter allen Fremden wenigstens einen Freund zu finden. Ob ihm die bürgerlichen Lebensgewohnheiten insgesamt das Ertragen der Gefangenschaft leichter gemacht haben, als dies bei Adeligen der Fall gewesen ist, kann allenfalls spekuliert werden: Insgesamt ist der Hinweis auf die Fröhlichkeit in der Gefangenschaft zu pauschal, um sie historisch greifen zu können. Denkbar ist, dass einzelne Szenen, in denen Franz den Qualen gut standhielt, sich zu einem allgemeinen Urteil verdichtet haben.
Umso interessanter ist, was auf die Gefangenschaft folgte. In der ersten Vita hatte Celano noch an der Stelle, an welcher später dann von der Gefangenschaft die Rede war, von einer schwerwiegenden und langwierigen Krankheit erzählt69 – das lässt die Vermutung zu, dass sich der Beginn seiner Krankheit mit der belastenden Gefangenschaft verbindet.70 Möglicherweise begann damit auch die Kränklichkeit, unter welcher Franz bis zu seinem Tode litt.71 In jedem Falle erscheint die Krankheit in einem noch viel stärkeren Maße als die Kriegsgefangenschaft als eine Grenzerfahrung, aufgrund deren Franz jedenfalls zu Teilen seine Welt- und Selbstsicht korrigierte. Aus Sicht Celanos handelt es sich in der ersten Lebensbeschreibung, dem Schema der schlimmen Jugend verpflichtet, um ein Einwirken Gottes, durch welches Franz gebessert werden sollte.72 Die Folgen sind also, vom Ergebnis der Heiligkeit her betrachtet, positiv gewertet – und das ist quellenkritisch interessant. Die Krankheit führte nämlich zunächst dazu, die eigene weltliche Gegenwart pessimistischer zu sehen. Diese neue Negativwahrnehmung aber richtete sich nicht, wie man angesichts des Gesamtduktus der Erzählung vermuten sollte, auf die gesellschaftlichen Umstände oder die schlechten Gefährten, sondern zunächst auf die Natur: Franz verlor, so heißt es, die Freude an den Äckern und Weinbergen73 rund um Assisi – gerade dies lässt die Überlieferung als einigermaßen vertrauenswürdig erscheinen, da gerade die Hochschätzung der Natur später zu den besonderen Merkmalen der Frömmigkeit des Franz von Assisi zählen sollte. Dass deren Verachtung Teil der Bekehrung gewesen sein soll, ist als Projektion aus den späteren Verhaltensweisen daher nicht erklärbar. So ist hier ein widerständiges Moment erkennbar, das eine Grundlage in echter Erinnerung haben dürfte.
Erst in einem zweiten Schritt folgte dann in Celanos Bericht eine allerdings wiederum sehr bemerkenswerte Neubewertung: „Von diesem Tag an begann er sich selbst als wertlos zu betrachten und nur noch Verachtung für das übrig zu haben, wofür er vorher Bewunderung und Liebe hatte“.74 Nicht nur die äußere Natur also wird verachtet, sondern auch das eigene Selbst, und, das dürfte entscheidend sein: die Neigungen dieses Selbst. Im Blick auf die spätere Entwicklung der Spiritualität von Franz wird man hier schon Elemente einer Bußgesinnung sehen können, vor allem aber lässt sich in dieser Andeutung die Diskrepanzerfahrung zu dem von den Eltern geprägten Lebensweg als Kaufmann vermuten – eine Diskrepanz, die umso deutlicher wird, da Celano betont, dass sich der Lebenswandel als solcher noch keineswegs grundlegend änderte, sondern Franz sich wieder auf Weltliches stürzte.75 Dass all dies so gut zueinander passt, lässt wiederum skeptisch werden – möglicherweise liegt das Geheimnis des Geschehens gerade darin, dass das vertrauenswürdig bezeugte Verzweifeln an der Natur sekundär dann im Sinne der Bußgesinnung gedeutet wurde. Daran dürfte so viel richtig sein, dass Franz vermutlich in der Krankheit noch diffus und ohne konkreten Bezug auf Lebensführung eine Erschütterung des Lebensrahmens erfuhr, in welchem er sich so selbstverständlich eingerichtet hatte. Vermutlich hat Julian von Speyer die Bedeutung der Episode treffend zusammengefasst: Franz „begann nun Dinge zu denken, die dem Gewohnten unähnlich waren“.76
Giotto di Bondone: „Die Mantelspende des hl. Franziskus“.
Ritterschaft
Spiegelt sich in diesen Beschreibungen eine sehr persönliche Krisenerfahrung, so dringt durch andere Episoden auch durch, dass Franz tatsächlich durch die oben beschriebenen sozialen Konflikte in Assisi mindestens verwirrt war. Verschiedentlich spürte er, dass das alte Gefüge nicht mehr stimmte – so heißt es etwa, er habe am Wegesrand einen armen Ritter getroffen und ihm seine Kleider geschenkt.77 Noch dem heutigen Leser wird, selbst wenn er wenig im Christentum sozialisiert ist, unmittelbar die Parallele vor Augen treten, die Celano denn auch aussprach. Was sich hier vollzog, ähnelte dem Urbild der Heiligkeit in der westlichen Christenheit: Martin von Tours,78 der für einen Armen seinen Mantel geteilt und in ihm dann Christus selbst erkannt hatte. Ironischerweise hatte er als Ritter so einen Bettler unterstützt, während nun der Bettler selbst ein Ritter war – eben darin zeigt sich das soziale Spannungsgefüge, in dem Franz sich bewegte: Der Vorrang des Reichtums gegenüber dem Adel wird in dieser Geschichte bildhaft, die allein schon deswegen nicht gänzlich erfunden sein dürfte, weil auf Martin zwar angespielt wird, die Episode aber nicht ganz nach diesem Vorbild gestaltet ist.
Wenig später soll dann ein Ereignis geschehen sein, in dem die sozialen Spannungen noch deutlicher erkennbar werden: Franz wollte, so heißt es schon in der ersten Vita Celanos, mit einem Adeligen aus Assisi nach Apulien ziehen, um dort Geld und Ehre zu verdienen.79 Zunächst ging es wohl schlicht darum, sich neuerlich im Kriegsdienst zu bewähren. Anfang des 13. Jahrhunderts versuchte Walter von Brienne mit dem Rückenwind des Papstes das Erbe seiner Frau in Apulien zu schützen.80 Offenbar gedachte Franz sich bei ihm zu verdingen, möglicherweise auch um die Scharte des kurzen erfolglosen militärischen Intermezzos gegen Perugia auszuwetzen.
Johannes von Perugia aber benennt noch eine andere Komponente, indem er diese Episode geradezu als einen Versuch von Franz beschreibt, einen sozialen Statuswechsel zu vollziehen:
„Als er über diese Sache nachdachte, beschloss er, Ritter zu werden, damit ein solcher Vorrang ihm als Ritter zuteilwerde. Daher richtete er sich, nachdem er sich, soweit er vermochte, mit kostbaren Gewändern ausgestattet hatte, darauf ein, zum Grafen Gentile in Apulien aufzubrechen, damit er durch diesen Grafen zum Ritter werden könnte.“81
Diese Notiz über die „zeitweiligen sozialen Aufstiegsphantasien“ (Dietmar Berg)82 von Franz ist nicht nur deswegen einigermaßen vertrauenswürdig, weil Johannes zu den vergleichsweise frühen eigenständigen Zeugen gehört, sondern vor allem, weil er noch den Namen des Grafen kannte, zu dem Franz ziehen wollte – bei Celano ist dieser namenlos, in der Dreigefährtenlegende schwankt die Überlieferung.83 Hier scheint eine etwas genauere Erinnerung durchzuschlagen, die auch den Standesehrgeiz von Franz mit betreffen könnte, einen Ehrgeiz, der sich in einer immer wieder berichteten Traumvision84 niederschlug, die er kurz vor seinem Aufbruch hatte: Sein ganzes Haus war in diesem Traum voll von ritterlichen Waffen, das bürgerliche Kaufmannsanwesen also wandelte sich in eine ritterliche Waffenkammer.
Dass über die Realität einer Vision mancherlei diskutiert werden kann, ist offenkundig – die Waffenvision entfaltete ihren Sinn gerade dort, wo der Bruch von Franz mit seiner früheren Existenz herausgestrichen und gleichwohl Gottes Leitung von Anfang an betont werden sollte: In seiner großen Legende erschien bei Bonaventura nicht nur statt einer Wandlung des Hauses der Bernardone von vorneherein ein Palast,85 sondern er ließ auch Gott selbst Franz wenig später mitteilen, dass die Vision „eine geistliche Wirkung anzeigt, die nicht nach menschlicher, sondern nach göttlicher Ordnung in dir erfüllt werden soll“.86 Diesen geistlichen Sinn, den die Biographen seit Celano87 im Auge gehabt hatten, legten sie offenbar über eine Erzählung, die so fest im Gedächtnis war, dass man sie weder auslassen noch umschreiben konnte, obwohl sie zunächst in ihrem Duktus die geistliche Deutung jedenfalls nicht vorbereitet. Wiederum spricht dies dafür, dass eine Begeisterung für Rittertum und Waffen früh in Franziskus wach geworden war, dass er also nicht, wie es die Bürger von Assisi im Laufe der Jahre erstreiten sollten, danach strebte, die bürgerliche Herkunft neben und zum Teil über der ständischen anzuerkennen, sondern selbst nach einem anderen, höheren Stand strebte.88 Auf seine Herkunft bezogen besagt dies auch, dass Franz schon hier auf eine durchaus nicht religiöse Weise von den Normen seiner Eltern abwich. Dass er versuchte, sozial aufzustreben, heißt, dass der junge Kaufmann die soziale Position seiner Eltern verachtete oder doch geringschätzte: Er blickte auf sie mit den Augen derjenigen hinab, gegen die die Bürgerlichen von Assisi ankämpften.
Dass der soziale Konflikt so beschrieben einen ausgeprägt existenziellen Konflikt im Hause Bernardone mit sich brachte, liegt nahe: Hier ging es um mehr als um das Austesten der Möglichkeiten im Krieg, hier ging es um die Lösung von den Bindungen des als zu gering empfundenen Elternhauses. Genau diese existenzielle Dimension der sozialen Diskrepanzerfahrung scheint nun auch einen Bekehrungsvorgang wenigstens mit veranlasst zu haben: Nach dem Erzählduktus der Biographien hat Franz gerade, indem er sich in diese soziale Gemengelage zwischen bürgerlicher Herkunft und adeligen Ambitionen bewegte, Umkehrerfahrungen im wahrsten Sinne des Wortes erlebt. Er hatte erst ein oder zwei Tagesreisen hinter sich gebracht, so berichtet es die Dreigefährtenlegende, als er in Spoleto, noch im Halbschlaf („semidormiens“), eine neue Gotteserfahrung machte, die nun präzise nicht als Traum-Vision zu bezeichnen ist, sondern als Traum-Audition, eine reine Hörerfahrung. Eine Stimme fragte ihn zunächst nach seinem Vorhaben, und nachdem Franz dies geschildert hatte, fragte sie: „Wer kann dir Besseres tun? Der Herr oder der Knecht?“89 Schon in der Fragestellung lässt sich absehen, dass die Stimme, die Franz als die des Herren, also Gottes selbst, identifiziert,90 den Reisenden auf einen Fehler in seiner Wertehierarchie hinweisen will: Das Bestreben, selbst Ruhm und Ehre, ja einen Vorrang („principatus“) zu erlangen, war offenkundig die Suche nach irdischem Herrendasein – nun erinnert die Stimme daran, dass alle irdische Herrschaft letztlich einem anderen und höheren Herrn unterworfen ist. Und so ruft Gott Franz zur Umkehr: „Kehr zurück in dein Land, und dort wird dir gesagt werden, was du tun wirst“.91 Die Konstruktion dieser Erzählung ist nicht allein durch diese Anweisung deutlich. Sie kombiniert die Mahnung an den Erzvater Jakob, aus Mesopotamien in sein Heimatland zurückzukehren (Gen 32,10), mit der Anweisung an Paulus, nach seiner Christusvision nach Damaskus zu gehen, um zu erfahren, was er tun solle (Apg 9,6). Auch die Aufnahme des Frage- und Gegenfragespiels lässt erkennen, dass die Erzähler dieser Vision in der Erfahrung des Franz eine Situation sehen, die der Wandlung des Paulus, dem Urtypus plötzlicher Bekehrungen zum Christentum, entspricht.92 Diese Vorstellung dürfte in der Erzählung schon festgestanden haben, ehe sie in die Viten integriert wurde, denn eine solche herausgehobene Bedeutung steht eigentlich quer dazu, dass die Viten andere Momente noch viel expliziter als Bekehrung sehen wollen. Die Erzählung hält die Erinnerung daran fest, dass der Bekehrungsprozess des Franz sich lang streckte und in mehreren Etappen vollzog. Sie ist aber zugleich schon in ihrer Entstehung eine offenkundige legendarische Einkleidung, denn ihr Sinn ergibt sich vor allem aus dem Schlusssatz Gottes: „Denn es ist nötig, dass du die Vision, die du gesehen hast, anders verstehst“.93 Sie setzt also bereits jene geistliche Deutung der Waffensaalvision voraus, die sich erst aus der Rückschau auf das ganze Leben des Franz als sinnvoll erweist. Die Audition von Spoleto macht in dieser Kombination mit der Waffenvision eine fundamentale Wende im Leben des Franz zu einem von Gott geleiteten Geschehen – und überspielt damit möglicherweise andere Gründe, die Franz von seinem Weg abgeschreckt haben.
Auffällig ist es jedenfalls, dass Celano in seiner ersten Vita von diesem Geschehen in Spoleto noch nichts wusste, sondern das Zurückschrecken des Franz von seinem Vorhaben unmittelbar mit dem Traum von dem zum Waffensaal gewandelten Elternhaus verband: Eigenartigerweise, so berichtet Celano, freute Franz sich beim Aufwachen nicht – wie es später die Dreigefährtenlegende behaupten würde94 – über den Traum und das darin vermeintlich angezeigte Ritterglück, sondern er musste sich mit Gewalt zwingen, sein Vorhaben zu vollenden.95 Um diesen Vorgang zu benennen, nutzt Celano eine Formulierung, die nicht ganz eindeutig ist: Die nächstliegende Deutung wäre, dass Franz sich selbst zum Aufbruch gezwungen hätte, man kann den Satz aber auch in dem Sinne verstehen, dass er gar nicht erst aufgebrochen wäre, so wie es dann auch im Folgenden heißt, er habe ganz der Reise nach Apulien entsagt96 – möglicherwiese also wäre er nicht einmal bis Spoleto gekommen. Jedenfalls fehlt diese Audition in der ersten Vita, und auch in der zweiten Vita, die von der Audition berichtet, wird sie weder in Spoleto lokalisiert, noch muss Franz, als sie ihm widerfuhr, schon zwingend aufgebrochen gewesen sein.97 Tatsächlich schildert es Julian von Speyer genau so: Franz habe seine Reisevorbereitungen unter immer größeren Mühen fortgeführt, binnen Kurzem aber schon die Reise gänzlich aufgegeben.98 Der Entschluss, zu bleiben, wäre dann noch vor dem Aufbruch gefallen, nach der ersten Vita Celanos wie auch nach Julian von Speyer ohne einen klar erkennbaren Eingriff von außen. Einen solchen kennt zwar die Dreigefährtenlegende, sie weiß auch um den Ort Spoleto, aber sie bietet noch eine weitere Information, die nicht ohne Weiteres verständlich ist: Franz sei bei der Ankunft in Spoleto krank gewesen.99 Ein weiteres Detail nennt Johannes von Perugia, der mit den drei Gefährten die Lokalisierung in Spoleto teilt: Noch ehe Franz hier die beschriebene Audition erfahren habe, sei er bei der Ankunft in Spoleto in Sorge über seinen Weg gewesen („sollicitus sui itineris“).100 Es gab also nach beiden Quellen Irritationen schon vor der Audition. Fasst man all dies zusammen, so wird man wohl festhalten können, dass Franz genug Gründe hatte, seine Reise abzubrechen, auch ohne dass er hierzu durch eine Audition aufgefordert wurde. Eine Erkrankung auf dem Weg mag jedenfalls einen plausiblen Anlass bieten – interessanter sind die diffusen, unerklärten Rückzugsbewegungen bei Celano und Johannes von Perugia. Es scheint, als habe Franz die Umkehr oder den Verzicht auf die Reise nach seiner ersten Begeisterung eben gerade nicht plausibel erklären können. Dann aber liegt es nahe, die Erklärung aus dem biographischen Zusammenhang zu gewinnen, in den die Episode fällt: Zu diesem Zeitpunkt haben die Erfahrungen der Gefangenschaft wohl kaum zwei Jahre zurückgelegen. Dass Krieg und Kriegsgefangenschaft als Traumen gesehen werden können, die posttraumatische Belastungen nach sich ziehen, ist den Menschen des 21. Jahrhunderts sehr bewusst.101 Eine solche Diagnose wird man nicht achthundert Jahre zurückprojizieren können. Aber es ist doch nicht ganz abwegig anzunehmen, dass Franz zwischen der erwähnten Hoffnung, wiedergutmachen zu können, was gegen Perugia nicht gelungen war, und der Angst vor einem erneuten Unglück schwankte.102 Nun allerdings dürfte die Blamage noch größer gewesen sein, zumal gegenüber dem eigenen Vater. Wenn es stimmt, dass Franz sich neue Kleider gekauft hat, wird das Groteske der Gesamtsituation und der sich mehr und mehr aufbauende Konflikt mit dem Vater überdeutlich: Franz dürfte als Kaufmann in einer familiären Wirtschaftsgemeinschaft mit den Eltern gelebt haben, die er durch seinen nicht unerheblichen Textilverbrauch belastete, auch wenn er das Tuch nicht teuer anderwärtig einkaufen musste, weil er selbst damit handelte.103 Genau diese Kleider aber sollten dazu dienen, gegenüber dem mitfinanzierenden Vater hervorzustechen und sich durch die Reise nach Apulien standesmäßig über ihn zu erheben. Angesichts dessen ist es wahrscheinlich eine erhebliche Verdichtung und doch eine irgendwie auch biographisch sinnvolle Erklärung, wenn Johannes von Perugia diese Episode unmittelbar hinübergleiten lässt in den zentralen Vaterkonflikt um das Geld, der zur Lossagung des Franz von seinem Elternhaus führte (s.u. 79–85). Das Geld, um das sich Franz mit seinem Vater streiten sollte, war nach dessen Bericht nämlich genau das Geld, das Franz als Erlös für das Pferd und die Kleider erzielt hatte, mit denen er sich für den Apulienzug geschmückt hatte.104 Das ist verkürzend – und doch ungeheuer treffend. Und Johannes steht nicht damit allein, in der abgebrochenen oder niemals angetretenen Apulienreise die erste und ganz entscheidende Wende im Leben des jungen Bürgersohns aus Assisi zu sehen.
Am weitesten geht Julian von Speyer, nach dessen Erzählung mit diesem Geschehnis Franz aus einem weltlichen Kaufmann zu einem Kaufmann des Evangeliums („evangelicus negotiator“) geworden sei105 – ähnlich treffend wie Johannes macht er so deutlich, dass es Franz in seiner Befassung mit dem Evangelium genauso um eine negative Antwort auf die Existenzweise seiner Eltern ging wie mit dem gescheiterten Vorhaben, ein Kriegsmann und Ritter zu werden. Dennoch dürfte die Verbindung mit einer klaren Evangeliumsorientierung zu früh sein, die Gesamtheit der Berichte spricht gerade in ihrer spannungsvollen Verschiedenheit dafür, dass Franz sich in einer Krise befand, in welcher er nach unterschiedlichen Sinnangeboten suchte, unter denen nun auch das Modell einer gegenüber der üblichen Religionsausübung radikal gesteigerten Frömmigkeit begegnet. Celano jedenfalls lässt mit dieser Phase eine Haltung exaltierter Frömmigkeit beginnen, die für ihn Ausdruck einer schon vollzogenen Sinneswandlung ist, welche sich bloß noch nicht im äußeren Leben niedergeschlagen hatte: Franz zog sich hiernach vom Umgang mit anderen und vom Geschäft zurück, um im inneren Menschen eine Begegnung mit Christus zu erfahren.106 Offenbar entwickelte sich in dieser Zeit auch eine Freundschaft mit einem anderen jungen Mann, über die man allerdings nicht viel weiß, außer dass Franz ihm seine Geheimnisse anvertraute. Selbst bei diesem Freund scheint er indes nur auf begrenztes Verständnis gestoßen zu sein, denn es ist ebender, der Franz’ Rede von einem Schatz für die Ankündigung weltlichen Besitzes hielt.107 Von der ekstatischen Gebetspraxis, die Franz in derselben Zeit entwickelte, war dieser Freund gleichfalls ausgeschlossen: Franz soll, berichten übereinstimmend Celano und die Dreigefährtenlegende, allein in eine Grotte gegangen sein und erfuhr dabei, so die Schilderungen, eine Art Gebetskampf, von dem er erschöpft zurückkehrte.108 Wie bei allen biographischen Schilderungen in den Viten gilt auch hier der Vorbehalt, dass es schwierig ist, aus dem Erzählten auf eine biographische Realität zurückzuschließen – ganz offenkundig ist dies für die Chronologie der Ereignisse: Während Celano die Gebetsekstase unmittelbar mit der Kriegserfahrung verbindet, begegnet sie bei den drei Gefährten erst nach weiteren Erfahrungen.
Bei den Leprosen
Diese Ereignisse jedenfalls bilden den Kontext für das, was für Franz später als das alles entscheidende Ereignis galt: die Begegnung mit den Leprosen.109 Sie hat die Krise in Franz’ Selbstverständnis, für die die Kriegsgefangenschaft ein erster Auslöser gewesen sein mag, zu der aber noch vieles andere beitrug, offenbar massiv verschärft und zugleich, zumindest im negativen Sinne der Abgrenzung von der Gesellschaft, geklärt. Das dürfte den Hintergrund dafür bilden, dass er seine Begegnung mit den Kranken so sehr betonte. Bei ihnen machte er Erfahrungen, die in eine radikale Distanz zu seiner bisherigen Existenz und damit zur ökonomisierten Welt seiner Herkunft insgesamt wiesen. Eine solche Erfahrung ließ sich kaum irgendwo intensiver machen als eben bei den Leprosen. Das im Deutschen früher übliche Wort „Aussätzige“ für diese Leprakranken lässt noch anklingen, dass es sich hier um eine Krankheit handelt, die ganz selbstverständlich mit sozialen Folgen einherging110: Wer von der oft mit starken Entstellungen verbundenen Krankheit befallen war, wurde aus den Städten verbannt und im günstigen Falle in eines der speziellen Hospitäler verbracht, die allerdings mehr der Verwahrung als der medizinischen Pflege dienten. Das Bewusstsein um die Gefahr der Ansteckung war hoch. So vermied der Rest der Gesellschaft nach Möglichkeit jeden Kontakt mit den Leprosen. Entsprechend weit waren die Hospitäler von den Städten entfernt – das Leprosenhospital für Assisi etwa, San Lazzaro dell’Arce, lag mehr als einen Kilometer außerhalb des Stadtgebietes.111 Wie der übliche Umgang mit den Kranken war, schildern die drei Gefährten im Lebenslauf von Franz: Man pflegte sich angesichts des Geruchs der schwärenden Wunden die Nase zuzuhalten und allenfalls durch eine dritte Person Almosen zu übermitteln112 – so war auf finanziellem Wege dem Auftrag der Nächstenliebe Genüge getan, ohne dass man mit ebendem Nächsten in direkte Berührung gekommen wäre. Dieses Verhalten ist in seiner Nüchternheit durchaus rational und entspricht, unter den medizinischen Voraussetzungen des 13. Jahrhunderts, modernen Vorstellungen von Seuchenschutz, welche ja auch in erster Linie darauf achten, eine Verbreitung durch Ansteckung zu vermeiden. Macht man sich dies bewusst, so ist unmittelbar deutlich, dass das Verhalten, das Franz mit einem Mal an den Tag legte, mehr als irritierend war: Er stieg vom Pferd, übergab dem Leprosen ohne Vermittlung selbst ein Almosen, küsste seine Hand – und empfing dann sogar das osculum pacis, den Friedenskuss.113 Dabei handelt es sich um ein Zeichen aus der eucharistischen Liturgie, bei welchem, so beschrieb es Augustin in der späten Antike, die Lippen der Christen, die sich so grüßten, einander zwar wohl nicht ganz berührten, aber doch nahe kamen.114 Die Handlung war spontan, aber nicht vorbildlos: Mit dem Kuss eines Leprosen folgte Franz offenkundig dem Vorbild Martins von Tours.115 Außerordentlich blieb die Geste – wenn denn der Bericht über sie stimmt – dennoch. Das medizinisch mehr als riskante Verhalten von Franz, bei dem er, darin sind sich die Biographen einig, eigene Ekelgefühle überwinden musste, mochte vonseiten der Leprosen als ein Hineinholen in die Gesellschaft empfunden werden – endlich kam einer, der sich ihnen ohne Not zuwandte. Für Franz bedeutete es umgekehrt einen Schritt aus der Gesellschaft hinaus, setzte er sich doch dem Ansteckungsrisiko und damit der Gefahr aus, bald selbst bei den Ausgestoßenen zu landen. Mochte der Verzicht auf militärische Abenteuer sogar als eine Rückkehr zu den seinem Stande zukommenden Normen erscheinen, da er damit ja auch den Wunsch aufgab, vom Bürger zum Ritter zu werden, so ging er mit der Hinwendung zu den Leprosen einen Schritt in die andere Richtung. Diese Logik mag auch dahinterstehen, dass die Biographien die Begegnung mit den Leprosen in der Regel nach der Aufgabe der ritterlichen Ambitionen und der darauf ausgerichteten Apulienreise erzählen. Ob dies den tatsächlichen Entwicklungen entspricht, wird man heute kaum mehr beurteilen können – statt beides in einen Erzählzusammenhang einander folgender Ereignisse zu bringen, wird man die Episoden gemeinsam als Ausdruck ebenjener Spannung zu den Werten des Elternhauses sehen dürfen. Das Streben nach dem Rittertum zeigte diese Unzufriedenheit innerhalb des gesellschaftlichen Systems der Zeit. Mit der Zuwendung zu den Leprosen drückte Franz vielleicht früher, vielleicht später, vielleicht in derselben Zeit eine Ablehnung selbst noch jener Werte aus, die der städtischen wie der adeligen Gesellschaft gemeinsam als verbindlich galten. Franz machte sich selbst zu einem Außenseiter. „Seit dem Aussätzigenkuß sind die Aussätzigen die eigentlichen Lebenspartner des hl. Franz“, so drückt es der Franziskaner Anton Rotzetter treffend aus.116 Man wird sich diese Wandlungsprozesse durchaus drastisch vorstellen müssen: Als Sohn eines reichen Kaufmanns hätte er alle Chancen gehabt, in der Mitte der Gesellschaft, sogar an ihrer Spitze anzukommen. Doch er erprobte andere Muster als die vorgeprägten Rollen, wandte sich dem Gegenteil zu, dem untersten Ende der sozialen Skala – was sich wiederum durchaus mit den üblichen Entwicklungsschritten in der Adoleszenz erklären lässt, bei Franz aber, so weit wird man die Leprosengeschichte interpretieren dürfen, an den Rand selbstzerstörerischer Maßnahmen führte. Die für die Interpretation schwierigste Frage ist wohl, ob man diese selbstdestruktiven Züge, die Franz nicht nur in einmaliger Spontaneität, sondern bei wiederholten Besuchen im Leprosenspital fortsetzte,117 mit dem gelegentlich auch heute selbstzerstörerischen Verhalten jugendlicher Drogensüchtiger vergleichen darf, also als bloßen Ausdruck des Neins zu den vorgegebenen Normen verstehen darf, oder schon als Ausdruck der Gestaltung einer neuen, anderen Normen verpflichteten Existenz. Das hieße dann im Falle des Umgangs mit den Leprosen, dass Franz schon den Versuch gemacht hätte, sich an den traditionellen Werken der Barmherzigkeit zu orientieren, die durch Jesu Rede vom großen Gericht in Mt 25 geprägt sind, wo der Weltenrichter zu denen, die heil durch das Gericht kommen, sagt:
„Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen; ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war krank, und ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen“ (Mt 25,35f.).
Nun fällt allerdings auf, dass von dieser Motivation in der Franziskustradition – anders als etwa bei seiner Zeitgenossin Elisabeth von Thüringen118 – wenig die Rede ist, ja dass ein ihr entsprechender Gedanke gar nicht die literarische Gestaltung der Leprosenepisode geprägt hat, und dies, obwohl bei Celano durchaus der Versuch zu sehen ist, diese Erzählung ins Wunderhafte zu ziehen. Nach seinem Bericht verschwand nämlich der erste Leprose, dem Franz sich zuwandte, plötzlich auf unerklärliche Weise119 – ein klassisches Indiz dafür, dass er nicht ein realer Mensch, sondern eine Erscheinung Gottes gewesen war. So kann man eine Überformung der Erzählung nach bestimmten hagiographischen Mustern feststellen, nicht aber eine Angleichung an das Verhalten Jesu. Und ebenso fällt auf, dass, wie oben angedeutet, die Entsprechung zu Jesus im Umgang mit Leprosen nicht vollständig greift. Beides spricht zum einen dafür, dass es sich hier nicht um Geschichten handelt, die zu einem bestimmten theologischen Zweck erfunden und geformt wurden, sondern um echte Erinnerungsstücke. Zum anderen aber lässt es annehmen, dass bei der Zuwendung zu den Leprosen mehr die negative Wendung gegen die zunehmend verachteten Normen der Eltern eine Rolle spielte als die Orientierung am christlichen Ideal der Fürsorge für die Schwächsten der Gesellschaft.
Fragwürdiger Reichtum
In diesen Zusammenhängen ist die Problematik von Geld und Reichtum, wie sie sich in der späteren Armutsexistenz niederschlagen sollte, nur ein Aspekt unter vielen und der Rolle der Leprosen gegenüber deutlich nachrangig – nicht umsonst hat Franz in seinem Testament allein die Begegnung mit Leprosen am Anfang seiner neuen religiösen Existenz in den Mittelpunkt gestellt. Die Nachfolger verschieben hier die Akzente. Johannes von Perugia etwa gibt der Armutsfrage einen prominenten Platz: Er stellt genau diese Frage an den Anfang, wenn er noch vor der Apulienepisode davon berichtet, Franz habe in seinem Tuchgeschäft einen armen Bettler abgewiesen – und sei danach ins Grübeln darüber gekommen, ob er diesen Bettler ebenso abgewiesen hätte, wenn er Geld für einen edlen Baron oder Grafen erbeten hätte.120 Diese Erzählung ist so durchgeformt und so sehr auf die Armutsfrage konzentriert, dass es schwer fällt, sie als historischen Bericht zu verstehen. Doch spiegelt sich auch in ihr in besonderer Weise jene Grundthematik der frühen Jahre von Franz: die Erfahrung einer Erschütterung über die vorgegebenen Werte, die mal, wie in dem Hinweis auf die Adeligen, Gestalt in Sozialformen gewinnen konnte, mal in religiösen Interpretationen – bis dahin, dass Johannes in den jungen Franz die Überlegung projizierte, dass ihm in dem Armen Jesus Christus selbst begegnet sei.121
Wenn und soweit Franz sich schon in dieser Zeit den Armen zuwandte, dürfte auch dies nicht einer konkreten Orientierung am Handeln und Gebot Christi gefolgt sein, sondern war Ausdruck einer Aussteigerexistenz, mit welcher der Kaufmannssohn zunehmend kokettierte, wenngleich sie nur gelegentlich öffentlich wahrnehmbar war. Celanos oben erwähnte Einschätzung, Franz habe sich nur in seinem Sinn, noch nicht leiblich122 verändert, reflektiert wohl auch, dass Franz lange Zeit keine allzu sichtbaren Folgerungen aus seiner Diskrepanzerfahrung zog – was mit daran gelegen haben dürfte, dass er in dieser Gärungsphase seines Lebens noch keine klare Konturierung für eine Alternative zu dem vorgegebenen Lebensstil seiner Eltern gefunden hatte. So wurden seine Irritationen vor allem dadurch spürbar, dass er sich von den anderen Jugendlichen des Ortes distanzierte. Auch wenn er nicht einer ihrer Anführer gewesen sein muss (s.o. 36), kann man durchaus annehmen, dass er sich lange Zeit ganz selbstverständlich als einer von ihnen empfunden und bewegt hat. Nun scheint er manchmal auf Distanz zu ihnen gegangen zu sein: Die Dreigefährtenlegende berichtet, er sei einmal mit Kameraden unterwegs gewesen, da sei er von Gottes Geist in einem solchen Ausmaß ergriffen worden, dass er sich nicht mehr bewegen konnte und plötzlich stehen blieb. Die Gefährten waren dann schon ein ganzes Stück vorausgelaufen, kehrten um und redeten auf ihn ein, was mit ihm sei – und spätestens hier beginnt die Stilisierung der Geschichte,123 denn als die Freunde ihn fragten, ob er etwa so von dem Gedanken ergriffen gewesen sei, eine Frau zu heiraten, dass er stehen geblieben sei, antwortete er, er wolle eine viel schönere Braut finden, als sie sich vorstellen konnten.124 Dem Leser, der dies Anfang der vierziger Jahre des 13. Jahrhunderts las, sollte gleich klar sein, dass diese Braut die Herrin Armut war, mit der sich Franz nach der Erzählung vom „geheiligten Bund des seligen Franz mit der Herrin Armut“125 verbinden würde. Und ebenso offenkundig ist es, dass die damaligen Freunde diese Ankündigung falsch verstehen mussten und über ihn lachten, weil sie ihm wohl kaum eine schöne Braut zutrauten. Versucht man unter diese prophetisch deutende Schicht zu tauchen, so bleibt wohl, dass Franz nicht bei allen Unternehmungen der Freunde dabei gewesen ist, vielleicht auch, dass er, bis an den Rand von Absencen, gedankenverloren war: Sein Sozialverhalten wurde zunehmend schwierig für die Zeitgenossen, und tatsächlich scheint er immer mehr Verhaltensweisen an den Tag gelegt zu haben, die seine eigene Diskrepanzerfahrung nach außen kehrten und so zur Irritation für andere wurden.
Im Zuge dessen dürfte ihm dann tatsächlich immer mehr zu Bewusstsein gekommen sein, dass sein eigener Reichtum nicht selbstverständlich war. Ohne dass in der frühesten Schicht eine klare christlichethische Motivation erkennbar ist, hat er ganz ähnlich wie im Falle der Leprosen auch Armen versucht Anteil an seinem Reichtum zu geben, noch ohne die Grenzen seiner Existenz zu sprengen. So zumindest berichten es die Viten seit den vierziger Jahren: Nach Celanos zweiter Vita habe Franziskus sich schon früh als „Liebhaber der Armen“ („pauperum amator“) erwiesen und seine eigenen Kleider abgelegt und den Armen angezogen126 – sehr konkret und damit vermutlich einigermaßen realistisch beschreibt dies die Dreigefährtenlegende:
„Wenn er auch schon lange ein Wohltäter der Armen war, nahm er sich von da an in seinem Herzen fester vor, künftig keinem Armen mehr, der um Gottes willen um ein Almosen bat, dies zu verweigern, sondern freigiebiger und reichlicher als üblich Almosen zu geben. Wann immer also ein Armer von ihm außerhalb des Hauses Almosen erbat, versorgte er ihn mit Geldstücken, wenn er vermochte. Fehlte es ihm an Geldstücken, so gab er eine Kopfbedeckung oder einen Gürtel, damit er den Armen nicht leer davonschickte. Wenn er aber davon nichts hatte, ging er zu einem verborgenen Ort, zog sein Hemd aus und schickte heimlich den Armen dorthin, damit er es sich um Gottes willen hole“.127
Aus der Rückschau liest sich dies als eine Vorwegnahme des späteren Entschlusses von Franz für die Armut, und gewiss konnte er hieran anknüpfen. Als Fragment einer Lebenserzählung gelesen, die noch nicht selbstverständlich auf die spätere Heiligkeit zusteuerte, zeigt sich hierin in einer ersten Stufe kaum mehr als eine Intensivierung der in seinem Elternhaus üblichen Erfüllung der allgemeinen Almosenpflicht. Schon im Zusammenhang der Fürsorge für Leprose war ja durchgedrungen, dass man im Hause Bernardone durchaus eine gewisse, freilich recht distanzierte Kultur der Almosengabe pflegte, und die drei Gefährten sagen zunächst nicht mehr, als dass Franz eben hieran anknüpfte, freilich mehr gab als üblich. Charakteristisch – und gerade in dieser Charakteristik wohl als historisches Zeugnis ernst zu nehmen – ist dann der Hinweis, dass Franz „außerhalb des Hauses“ begann, noch mehr zu geben. Offenkundig nutzte er den Freiraum jenseits des elterlichen Bereichs, die dort akzeptierten Normen der Armenfürsorge weiter auszudehnen, als es bei ihnen gängig war. Und dies tat er mal planmäßig durch Mitnahme von Geldstücken, mal aber offenbar auch sehr spontan, indem er Kleidungsstücke fortgab, deren Verlust entweder durch Schusseligkeit erklärbar war – Kopfbedeckung und Gürtel – oder nicht unmittelbar auffiel wie das Hemd, das gewöhnlich unter einem Obergewand getragen wurde. Und selbst wo er sich zu der spontanen Gabe des Hemdes hinreißen ließ, tat er dies nicht in einem Aufsehen erregenden öffentlichen Akt, sondern durch eine komplizierte Übergabe an einem geheimen Ort. Das Ganze macht den Eindruck, dass Franz Verhaltensweisen ausprobierte, die er aus Angst vor den Eltern, konkreter wohl vor dem Vater, nicht bekannt werden lassen wollte. Auch dies drückt Unzufriedenheit mit dem gegenwärtigen Status aus, zugleich aber den Wunsch, ebendiesen nicht zu verlieren. Er wollte sich innerhalb des elterlichen Rahmens bewegen, ihn nur stückweise ausdehnen. Was Celano als einfaches Schema des Gegensatzes von Sinn und Körper beschreibt, ist offenkundig eine Symptomatik massiver Unklarheit und Werteverwirrung auf der einen Seite, Angst vor einem Offenlegen seiner Gefühle vor dem Vater auf der anderen Seite.
Hierfür ist bezeichnend eine Erzählung, die die drei Gefährten zur Franziskuserinnerung beisteuerten128: Ausdrücklich beziehen sie sich auf Situationen, in denen der Vater abwesend war. Dann deckte Franz, selbst wenn auch seine Geschwister fort waren, den Tisch für die ganze Familie – und erklärte dies damit, dass die überzähligen Brote für die Armen gedacht seien. Die Mutter akzeptierte dies, „weil sie ihn mehr als die anderen Söhne liebte“.129 Leider ist diese Erzählung nur mit großer Vorsicht auszuwerten: Allzu typisch ist die Konstellation des ältesten Sohnes, der den Vater fürchtet und von der Mutter geliebt und behütet wird – biblisch reicht sie bis zur Geschichte von Jakob und Esau zurück und wurde mit unterschiedlichen Personen immer wieder neu erzählt. Dass auch noch bei anderer Gelegenheit die Liebe der Mutter betont wird, ändert daran nichts, dass hier erzählerisch ein gewisses Stereotyp wirksam ist. Vor allem aber lässt sich fragen, ob der starke Akzent, der hier auf die pauperes gelegt wird, nicht eher zu der späteren Rückschau passt als zu diesem relativ frühen Moment in Franz’ Biographie, in dem noch so viele Richtungen miteinander in Ausgleich zu bringen waren. Und doch gilt auch hier, dass sich hinter der unzweifelhaft zugespitzten Erzählung ein tatsächlicher Erinnerungskern verbergen könnte, nämlich der, dass der Konflikt im Hause Bernardone, ohne dass man Franz gleich als bevorzugten Sohn der Mutter sehen muss, zwischen Vater und Sohn ausgetragen wurde. Bei allen grundlegenden Änderungen von Familie und Hausgemeinschaft in den vergangenen Jahrhunderten130 kommt die in den Biographien geschilderte Konstellation doch heutigen Wahrnehmungen der Probleme der Adoleszenz erstaunlich nahe.
Zu den eigenartigen Formen einer Sinnsuche, mit der Franziskus beim Vater nicht anecken wollte, gehört ferner eine historisch freilich nicht ganz gesicherte Erzählung, nach welcher er experimenthaft Armut lebte. Den Anlass hierzu gab ihm nach den Viten eine Reise nach Rom. Angelegt war diese Reise als Wallfahrt.131 Franz lebte noch in einer Zeit vor der ganz großen Rombegeisterung, wie sie dann durch die Ausrufung des Jubeljahres im Jahr 1300 Europa erfassen sollte: Die Verheißung, durch einen Besuch der sieben Stationskirchen vielfältigen Ablass zu erhalten, lockte später die Massen in die Stadt. Doch auch Anfang des 13. Jahrhunderts war Rom als Grablege der beiden Apostel Petrus und Paulus schon ein außerordentlich beliebtes Ziel für fromme Pilger. Andere Bewohner von Assisi, wie etwa Ortulana Offreduccio, die Mutter von Franz’ späterer geistlicher Schwester Klara, reisten ebenfalls dorthin132 – schließlich liegt die Ewige Stadt keine zweihundert Kilometer von Assisi entfernt. Dass Franz dorthin zog, ist also nicht gänzlich unplausibel. Biographisch sieht es fast wie eine Antwort auf die fehlgeschlagene militärische Unternehmung in Apulien aus. Wieder machte er sich auf den Weg, nun aber nicht um zu kämpfen, sondern um die Gräber der Apostel zu besuchen, über denen sich gewaltige Kirchen aus der Zeit Kaiser Konstantins erhoben: St. Paul vor den Mauern und der Petersdom im Vatikan, der Vorgängerbau des heutigen Renaissancedoms. Sie zu besuchen, bedeutete eine Nähe Gottes in den Aposteln zu erfahren, führten die Gebeine, die man in diesen Gräbern verehrte,133 doch in die Anfänge des Christentums zurück. Da beide Apostel als Märtyrer gestorben waren, war in ihnen die Nachfolge Christi zu einer Vollkommenheit gelangt, die in ihnen einen Abglanz Christi selbst präsent machte. Im Rahmen einer für das Mittelalter über weite Strecken prägenden Frömmigkeitshaltung, der sogenannten Repräsentationsfrömmigkeit, waren auch ihre Gebeine noch materialisierte Repräsentationen ebendieser Gegenwart Christi: In den Gebeinen der Apostel verehrte man diese selbst und letztlich Jesus Christus. Das machte den eigentlichen spirituellen Sinn eines solchen Rombesuchs aus – wenn er denn stattgefunden hat.
In diesem Falle hätte Franz hier das Experiment der Armut gewagt und wäre ein „Bettler auf Probe“ geworden (H. Feld).134 Auch diese Episode beginnt eher mit einer Irritation als mit einem klaren Entschluss: Er sah, wie geringfügig die Opfergaben waren, die die Menschen in der Kirche hinterlegten, und zeigte seinerseits Großzügigkeit, ja Verschwendungssucht, indem er eine große Anzahl von Münzen vor den Altar warf. Als er dann die Kathedrale verließ, traf er davor eine Menge von Bettlern an – und wieder kam es zu einer spontanen Geste: Er zog seine Gewänder aus und tauschte sie mit den Kleidern eines Bettlers.135 In dieser Szene mag sich manches vermischt haben, denn wenn Franz tatsächlich nach Rom zur Pilgerfahrt aufgebrochen war, hat er wohl kaum seine sonst üblichen kostbaren Kleider angehabt, sondern eher ein Büßergewand. Das soll er übrigens nach einer kleinen Notiz auch sonst unter seinen reichen Kleidern getragen haben136 – auch dies eher ein Ausdruck dessen, dass er suchte, seine Diskrepanz mit dem elterlichen Leben zu verbergen, als dass ein schon vollzogener innerer Wandel in Spannung zum äußeren gestanden hätte. Für die Romreise aber hätte er das Büßergewand gar nicht verbergen müssen. Möglicherweise war allerdings selbst das, was er als Pilger trug, verglichen mit den Lumpen der Bettler noch kostbar, möglicherweise haben die drei Gefährten Erinnerungen an Geschehnisse in Assisi in diese Romepisode hineingewoben – was wiederum die Frage aufwirft, ob die Erzählung als ganze glaubwürdig ist. Franz hätte hiernach, nachdem er die Kleider eines Bettlers angenommen hatte, auch tatsächlich auf den Stufen des Petersdoms eine Zeitlang als Bettler gelebt.137 Dies blieb indes eine klar begrenzte Erfahrung, denn ehe er heimkehrte, hat er, so der Bericht der drei Gefährten, den Tausch rückgängig gemacht, dem Bettler seine Lumpen zurückgegeben und wieder seine eigenen Gewänder angezogen.138 Realistisch ist dies wohl nur unter der Voraussetzung, dass er ungeachtet aller Spontaneität seines Entschlusses Tausch und Rücktausch von vorneherein mit dem Bettler abgesprochen hatte. Wenn dem so war, unterstreicht das den Testcharakter dieser Phase umso mehr. Hierzu passt, dass die drei Gefährten es sogar zum Antrieb seiner Romreise erklärten, dass er an einem anderen Ort als in der Heimat einen Kleidertausch und den damit verbundenen Rollenwechsel vollziehen wollte139 – dem entspricht die Bemerkung Celanos in der zweiten Vita, dass Franz gerne schon früher mit Bettlern gelebt hätte, hätte er sich nicht vor seinen Bekannten geschämt.140 Ist an dieser Erzählung auch nur etwas dran, und der Gesamtkontext spricht dafür, so unterstreicht sie, dass Franz in dieser Lebensphase Erschütterung und Irritation über seinen bisherigen Lebenswandel verspürte und Erfahrung mit anderen, ganz gegensätzlichen Lebensmodellen sammeln wollte. Aus der Rückschau wäre dies schon eine Art Vorlauf zu der späteren Armutsexistenz gewesen. Verstanden als Rudiment realer Erinnerung wäre es Ausdruck des Versuchs, die Welt der Armut, die der seinen so fundamental widersprach, kennenzulernen, vielleicht auch nur mit ihr zu kokettieren. Vor allem aber wäre es Ausdruck dessen, dass er den Bruch mit dem Elternhaus vermeiden wollte, geradezu angepasst lebte, seine Neigungen zur Armutsexistenz nur in der Ferne auslebte, während er zu Hause wieder weitgehend in die alten Muster des Sohnes im reichen Kaufmannshaushalt zurückfiel. Die Spannung, die sich hier ausdrückt, war außerordentlich: Franz pendelte zwischen Gegensätzen, übertrieb hier, beim Küssen der Leprosen etwa, steigerte elterliches Verhalten dort, beim überreichen Almosengeben, oder kippte in die andere Existenzform, als er nach Rom ging. In der Summe macht dies den Eindruck eines nachhaltig in seinen Grundwerten erschütterten jungen Mannes – und der Verdacht, dass der Auslöser für all dies die Erfahrung von Krieg und Kriegsgefangenschaft war, legt sich jedenfalls nahe.
4. Vor die Füße geschmissen: der Bruch mit dem Vater
Adoleszenzkrise
Die bisher geschilderten Erfahrungen dürfte Franz mit etwa Anfang zwanzig gesammelt haben: Der junge Mann wusste in dem Zwiespalt seiner Gefühle zwischen Leben in der elterlich geprägten Existenz einerseits und deren Verachtung andererseits keine klare Orientierung zu finden. Das Gefühl, das ihn bestimmte, war dabei ein negatives: Etwas stimmte bei den Eltern nicht. Was den jungen Franz bewegte, erfahren die allermeisten Menschen, wenn sie aufwachsen. Sie gehen auf Distanz zu den Werten, die ihre Eltern ihnen vermittelt haben, begehren auf, oft noch ohne klare Orientierung, wohin es eigentlich gehen soll. Franz erging es nicht anders. Zunehmend aber deutete er das, was eine bloße Adoleszenzkrise hätte sein und bleiben können, in religiösen Kategorien. So gewann sie eine grundlegende Bedeutung, die über seine eigene Biographie weit hinausweist.
Durch alle Berichte, überlagert und gefiltert, wie sie auch sind, dringt dabei durch, dass sich diese Spannung zunächst immer wieder spontan entlud und dass es genau diese Spontaneität war, die sein Verhalten von dem sozial kompatiblen Verhalten eines reichen Spenders in Assisi unterschied. Es war ja durchaus nicht so, dass die mittelalterliche Gesellschaft den Leprosen und den Armen keinen Ort gegeben hätte. Das Hospital für die Leprosen war ebenso wie ihr Unterhalt durch Betteln nicht nur eine Form des Ausschlusses aus der Gesellschaft, sondern in gewisser Weise auch eine Integration, denn beides gab den Gesunden und Reichen die Möglichkeit, die Ausgegrenzten durch Almosen zu unterstützen und so im christlichen Sinne gute Werke zu tun. Ebendies scheint Franz, wenigstens in seinen spontanen Akten, als bigott empfunden zu haben, und genau in dieser Wahrnehmung liegt ein Stück seiner Modernität, denn dieser Eindruck der Bigotterie drängt sich auch heute auf: Das Almosensystem funktionierte gesellschaftlich integrierend gerade dadurch, dass es voraussetzte, dass Arme und Kranke zunächst einmal in die allgemeine gesellschaftliche Kommunikation eingeschlossen waren. Als Objekte der Wohltaten anderer waren sie integriert, nicht als Subjekte des Miteinanders aller. Diese Hürde suchte Franz zu überspringen. Beziehungsweise an dieser Hürde manifestierte sich seine Abscheu gegenüber der eigenen sozialen Herkunft: Hatte er sich zunächst sozial nach oben orientiert, um, zum Ritter geworden, das Bürgerliche hinter sich zu lassen, so orientierte er sich nun sozial nach unten, um in der Begegnung mit den Ausgegrenzten die bürgerlichen Normen zu hinterfragen, noch ehe er sie ganz aufgegeben hatte.
San Damiano
Dass der Aussteiger einen religiösen Weg gehen würde, war zunächst noch keineswegs absehbar – die Spuren, die darauf hinweisen, haben vermutlich in den meisten Fällen erst die Biographen gelegt, auch wenn sich dies im Einzelnen nicht beweisen lässt. So wird niemand widerlegen können, dass er, der später immer wieder den Friedensgruß gebrauchen würde, schon von einem Leprosen den Kuss des Friedens erhalten hat. Durch nichts ist es auszuschließen, dass die spätere Bettelei schon früh in Rom vorgeformt wurde – wie angedeutet, ist unter gänzlich anderer Perspektive vermutlich sogar gerade an dieser Episode etwas dran. Aber die Spuren, die man aus der Rückschau entdecken kann, und die Versatzstücke realen Lebens liegen unauflöslich ineinander. Das gilt auch für den am deutlichsten erkennbaren Zug zu religiösem Verhalten in dieser Zeit: die Verbindung des Franz mit dem Kirchlein San Damiano, wenige Gehminuten südlich von Assisi. Noch heute ist es merkwürdig abgeschieden, weil der Hauptstrom des Tourismus sich auf die große Grabeskirche mit den Fresken Giottos richtet.141 So vermittelt es noch einen Geist der Schlichtheit, von dem man in Assisi selbst kaum mehr etwas ahnen kann. Es sollte später noch eine bedeutende Rolle im Leben des Franz spielen – zunächst aber fällt Franz’ Begegnung mit diesem Kirchlein ganz in das Muster spontaner, überbordender Frömmigkeit: Celano berichtet in seiner ersten Vita, wie Franz sich auf den üblichen Handelsweg machte. Zu diesem üblichen Vorgehen gehörte auch, dass er sich vor dem Aufbruch bekreuzigte.142 Selbst noch in den Heiligenviten dringt solcherart durch, dass sein Leben als Geschäftsmann keineswegs einfach unfromm war, sondern eben anders fromm als sein späterer radikaler Weg. Auch der Kaufmann lebte ein Leben im Zeichen des Kreuzes. Das Kreuz änderte freilich dieses Leben nicht im Kern, sondern bildete seinen Rahmen und Schutz – in diesem Schutz verkaufte Franz in Foligno, gut vierzehn Kilometer von Assisi entfernt, kostbaren Scharlachstoff und gleich auch noch, weil sich offenbar eine günstige Gelegenheit dazu ergab, sein Pferd.143 Es war also ein beträchtlicher Geldbetrag, den er bei sich hatte, als er den Ort wieder verließ. Nach Celano überlegte er „religiosa mente“, „mit frommem Sinn“,144 was er mit dem Geld anfangen sollte. Celano meint sogar, Franz habe zu diesem Zeitpunkt ein bestimmtes Vorhaben („propositum“) verfolgt145 – ein Begriff, der von früh an immer wieder begegnet (s.o. 41), der aber vermutlich immer wieder dem Bemühen der Biographen geschuldet ist, die Fragmente des Lebens des Franz früher in eine zielgerichtete Ordnung zu bringen, als es dem tatsächlichen Verlauf entspricht. Planmäßig erscheint sein Verhalten auch jetzt noch nicht. Das durchgängige Verhaltensmuster in dieser Zeit ist von spontanen, wenig strukturierten Akten geprägt.
Der spätere Eindruck der Planmäßigkeit kann für dieses Geschehen jedoch daran anknüpfen, dass Franz sich nun explizit nicht nur seinen Nächsten zuwendet, sondern der Kirche, wenigstens einem Kirchengebäude. Die im Prinzip deutungsoffene – und wahrscheinlich tatsächlich nicht eindeutig auf die Motivation christlicher Nächstenliebe zurückzuführende – Fürsorge für Kranke und Arme scheint so eine klare Richtung zu gewinnen und noch dazu auf den späteren Lebensweg hinzuweisen, da die Kirche, der sich Franz zuwendet, eben San Damiano ist. Hier hat er die Bedürftigkeit des kleinen Gebäudes und seines Personals verspürt und dem dortigen armen Priester, der möglicherweise den Namen Pietro trug,146 sein Geld geradezu aufgedrängt.147 Dass er es ihm komplett überlassen wollte, wie Celano schreibt, dürfte näher am Geschehen liegen als das, was Johannes von Perugia berichtet, dessen Schilderung sonst im Großen und Ganzen nah an der von Celano ist: Ihm zufolge hätte Franz dem Priester das Geld nicht als Geschenk überlassen, sondern zur Aufbewahrung gegeben148 – das würde die Handlung noch planmäßiger machen. Sinnvoll wäre das allerdings kaum gewesen, da Franz als Kaufmann immer neu an Geldquellen kam und die entsprechende Summe kaum irgendwo deponieren musste. Dergleichen wäre nur nötig, wenn man – wie Johannes von Perugia – schon wusste, dass er bald reichlich Geld für den Kirchenbau in San Damiano verwenden würde. Damit wird die ursprüngliche Zuwendung ihrer Spontaneität beraubt, die bei Celano noch durchdringt und überdeutlich in das auch sonst zu erkennende Verhaltensmuster des jungen Franziskus passt: Wie den Leprosen, so küsste Franz auch dem Priester die Hände – bei aller äußeren Entsprechung des Verhaltens zeigt sich schon darin für den späteren Erzähler eine Wendung der Ausrichtung, denn den Händen eines Priesters haftete der Anspruch besonderer Reinheit an.149 Sie waren die Hände, mit denen das Opfer der Kirche vollzogen, mit denen in der Eucharistie Christus selbst berührt wurde – so wie Franz in den Leprosen als den geringsten Brüdern Christi Christus selbst berührte, berührte er nun die Hände des Priesters, der in einer sonst niemandem vergönnten Weise unmittelbar mit Christus zu tun hatte, ja im wahrsten Sinne des Wortes mit ihm hantierte.
Der Kreuzgang des Konvents San Damiano und ein Blick in das Dormitorium.
Das Anliegen, das Franz dem Priester nun vorbrachte, war, so Celano, ein doppeltes: Er wollte ihm sein ganzes Geld überlassen, und er wollte in San Damiano Wohnung finden. Wenn an dieser Erzählung etwas dran ist, so hätten wir hier einen zentralen Punkt im Leben des Franz von Assisi. Hier wäre aus jener Doppelexistenz, in welcher die Diskrepanz zur vorgegebenen Wirklichkeit immer nur momenthaft und meist im Verborgenen Gestalt gewonnen hatte, der Entschluss zu einer Lebenswende geworden, freilich auch dies wieder eigenartig unklar, denn San Damiano war kein Kloster, Franz kein Priester – seine Existenz wäre in keiner Hinsicht definiert gewesen. Und die Lebenswende wurde offenbar auch nicht erwartet, denn der Priester wehrte sich gegenüber dem doppelten Vorhaben, wie Celano schreibt, nicht zuletzt deswegen, weil der, den er da vor sich hatte, ja der reiche Bürgersohn war, von dessen großzügigem Lebensstil er wusste. Eine plötzliche Lebenswende war für ihn offenbar nicht plausibel. So weigerte der Priester sich standhaft, das Geld anzunehmen – mit einer interessanten Begründung: aus Angst vor der Familie Bernardone.150 Immerhin war er schließlich bereit, Franz bei sich aufzunehmen – und dieser schleuderte das Geld, so beschreibt es Celano, verächtlich in eine Fensternische und verachtete es, so Celano, wie Staub.151
Erstmals hätte Franziskus hier, wenn man der Erzählung trauen dürfte, seine Verachtung der sozialen Herkunft klar religiös konnotiert, erstmals wäre er bereit gewesen, sich auch in der Lebensführung von seinem Elternhaus zu lösen. Ganz so unkompliziert liegt die Sache allerdings nicht – allein schon deswegen, weil sich die Erzählung mit San Damiano, dem zentralen Ort im Franziskusgedächtnis, verbindet. Dessen Hervorhebung liegt erzählerisch nahe. Für die Franziskaner, die hiervon berichteten, stellte San Damiano einen Ort besonderer Heiligkeit dar: Dies würde der Ort sein, an dem Klara und ihre Schwestern dauerhaft Heimat gewinnen würden.152 Der Ort, an dem wenigstens Teile des berühmten Sonnengesangs entstehen würden. Dass genau hier die Lebenswende ihren Ausgangspunkt nahm, kann die folgende Bedeutung des Ortes erklären, aber es kann eben auch umgekehrt sein: Die spätere Bedeutung kann dazu geführt haben, eine frühe Erfahrung an diesem Ort mit besonderer Bedeutung aufzuladen. Dem entsprechend ist auch das Erzählgerüst, wie es sich bei Celano und mit Varianten bei Johannes von Perugia und Julian von Speyer findet, bereits voll von späterem Bewusstsein von dem heiligen Armen:
„Er verkaufte alles, was er hatte, und übereignete das eingenommene Geld einem armen Priester. Weil dieser aber aus Angst vor den Eltern zurückschreckte, es anzunehmen, warf er es ohne Zögern vor ihn, verachtete es wie Staub“.153
So fasste Celano seine Franz-Vita in der Chorlegende für den liturgischen Gebrauch der Brüder zusammen. Daran ist bemerkenswert, was fehlt und was darinsteht: Es fehlt zunächst einmal der Hinweis darauf, dass Franz das Geld in eine Nische warf – hier liest es sich, als hätte er es auf den Boden geworfen. Auch wenn nicht auszuschließen ist, dass Celano hiermit schlicht den Anforderungen rhythmischen Dichtens in der Chorlegende folgte, weist es doch darauf hin, dass diese Nische, die bis heute als äußerlich sichtbarer Haftpunkt von Franz’ Biographie in San Damiano gezeigt wird, noch nicht diejenige Bedeutung als Teil der Heiligenverehrung gewonnen hatte, die es nötig gemacht hätte, sie eigens zu erwähnen. Weitere Lücken fallen auf: Es fehlt der gleich noch auszuführende Auftrag durch Christus selbst, es fehlt jeder Gedanke an eine weitere Verwendung des Geldes. Durch die Aufnahme des Befehls „verkauf deinen Besitz und gib ihn den Armen“ aus Mt 19,21 ist schon eine weitere theologische Perspektive angedeutet, denn der Erlös des Geldes sollte hiernach den Armen zugutekommen – eine biblische Episode, die später noch von Bedeutung für Franz werden sollte (s.u. 107f.). Hier handelt es sich offenkundig um eine Rückprojektion durch Celano, der der Szene in San Damiano schon eine Spur abgewinnen wollte, die auf die spätere Armutsexistenz hinwies.154
Diese Fassung stützte die späteren Brüder in ihrer Lebensweise als Bettelmönche, reichte aber offenbar nicht für die Verehrung von Franz als Heiligen. Tatsächlich kann man an kaum einer Stelle der Franziskuserzählungen eine so intensive Formung durch die Biographen feststellen wie an dieser. Was in der ersten Vita des Celano noch als ein spontaner Akt des Franz selbst erscheint, gewinnt ab den Werken der frühen vierziger Jahre immer mehr eine ganz andere Gestalt. Es wird zum Teil einer Sendung durch Jesus Christus und zugleich zur Gründungslegende für eines der wichtigsten Erinnerungsstücke franziskanischer Heiligentradition: das Kruzifix von San Damiano, das heute in der Kirche Santa Chiara in Assisi gezeigt wird,155 ein beeindruckendes, unter dem Einfluss syrischer Kunst gestaltetes Kreuz der umbrischen Malerei aus dem 12. Jahrhundert.156
Die erste klare Fassung der Erzählung von San Damiano als Ort einer Christusoffenbarung findet sich in der Dreigefährtenlegende.157 Hiernach betrat Franz das Kirchlein nicht auf dem Heimweg vom Handel in Foligno, sondern nach einem der vielen Gespräche mit irritierten Freunden von Assisi aus. Als er in der Gegend der Kirche spazieren ging, ermunterte ihn, in einem ersten göttlichen Eingriff, der Geist Gottes, diese zum Gebet zu betreten – so weit bewegt sich das Geschehen, wie oben schon anhand des Kreuzschlagens beschrieben, ganz innerhalb der konformen bürgerlichen Frömmigkeit, für die selbstverständlich auch das christliche Gebet Teil des Alltags war. Das, was dann geschah, erscheint demnach in der Dreigefährtenlegende als wundersame Übersteigerung eines alltäglichen Geschehens: Franz betete dort vor ebenjenem hierdurch berühmt gewordenen Kruzifix158 – da fing der Gekreuzigte an zu sprechen: „Franziskus, siehst du nicht, dass mein Haus zerfällt? Mache dich also auf und stelle es für mich wieder her“.159 Franz willigte sofort ein – wenn auch, wie die drei Gefährten notieren, mit unvollständiger Erkenntnis: Er bezog den Reparaturaufruf ausschließlich auf das alte, zerfallende Kirchlein San Damiano und noch nicht auf die Kirche Jesu Christi insgesamt. Mit dieser Verwechslung deutet sich ein Grundmuster an, das im weiteren Verlauf noch einmal in der Begegnung mit Innozenz III. aufscheinen sollte, bei der es gleichfalls zu einer Doppeldeutigkeit kam, einem Schwanken zwischen Reparatur der gesamten Kirche Christi oder der Lateranbasilika (s.u. 126f.).
Schon dies lässt erahnen, dass hier mehr hagiographische Gestaltung am Werk ist als historische Erinnerung160 – zumal Franz selbst in seinem Testament diese Begegnung auffälligerweise nicht erwähnt,161 sondern vielmehr den prononcierten Begriff des Offenbarens mit einem späteren Ereignis, dem Kundtun des Lebenswegs für sich und seine Brüder, verbindet.162 Dabei muss man nicht annehmen, dass die drei Gefährten diese Geschichte erfunden hätten. Eineinhalb Jahrzehnte seit dem Tod des Franziskus reichten, um die Erinnerung in einer Weise zu formen, die der Sinnanforderung der Biographen genügte, denen zufolge das Leben des Heiligen von früh an von Christus geleitet sein sollte. Diese Leitung durch Christus gewann dann noch intensivere Züge. Dass es hier ein Kruzifix war, das mit Franz redete, ist für die entstehenden Erzählmuster nicht ohne Belang, zeigte es doch in einer in der Zeit durchaus typischen Weise die Wunden Jesu Christi und lud zur Identifikation mit ihm ein. In der compassio, dem Mitleiden, von welchem Celano in der zweiten Vita auch ausdrücklich spricht,163 erfahren nicht nur Heilige, sondern alle Christinnen und Christen, die sich in den Heiland versenken, eine Identifikation mit diesem selbst. Das Hinabsteigen des Sohnes Gottes zu den Menschen ermöglicht den Menschen den Aufstieg zu Gott selbst durch die Wunden und Schmerzen des Heilands. Bei Franz aber steigerte sich die allen Gläubigen zugängliche Christusidentifikation vor dem Kruzifix von San Damiano nach Celanos Bericht in einer Weise, die schon auf das spätere wunderhafte Geschehnis der Stigmatisation (s.u. 281–283) vorauswies: „Wer will zweifeln, dass Franziskus schon, als er in seine Heimatstadt zurückging, als Gekreuzigter erschien?“, fragt Celano nun im Anschluss an die Erzählung.164 So gesehen wäre von diesem Moment an das Leben des Franz christusgleich gewesen, er selbst schon als alter Christus, als zweiter Christus, erschienen.
Die Rückschau vom Ende her bestimmt bereits dieses frühe Geschehen. Ganz in diesem Sinne erzählt Celano dann auch in seinem Mirakelbuch, dem Bericht über die Wunder, die Franz widerfahren sind, mehr aber noch die Wunder, die er selbst ausgeübt hat, von dem sprechenden Kruzifix im Zusammenhang der Stigmatisation, um genau diese zu illustrieren.165 So gewinnt die Erzählung ihren Ort in der Franz-Biographie vor allem aus dem Bemühen, den Sinn seines Lebens von Anfang an durch den Bezug auf Christus zu erhellen – und knüpft allenfalls vielleicht daran an, dass Franz sich in seinem Gebet in San Damiano außer von der Ärmlichkeit des Kirchleins auch von dem Leiden Christi berührt fühlte. Im unmittelbaren Zusammenhang hingegen führt die Erzählung in eigenartige Spannungen: Statt eines hohen Geldbetrags hinterlegt Franz bei dem Priester in San Damiano nun nur Geld für eine Lampe und Öl.166 Man mag dies einerseits als realistisch einschätzen, weil es in ähnlicher Weise wie Kreuzschlagen und einfaches Gebet den üblichen Riten christlicher Frömmigkeit im Mittelalter entspricht – aber andererseits resultiert daraus die erzählerische Schwierigkeit, dass ein solcher konformer und keineswegs exorbitanter Betrag nicht begründen würde, was auch nach der zweiten Vita des Celano darauf folgt: die Verfolgung durch den Vater. Gerade der Versuch, die Lebenswende zu Christus hin besonders stark herauszustreichen, macht die Lebenswende gegen den Vater, den Bruch mit der Herkunft weniger plausibel. Auch die Logik, nach der er schon vor dem Bruch mit dem Vater sich der Renovierung von Kirchen zugewandt habe, diese jedoch in größerem Ausmaß eigentlich erst danach einsetzt, scheint nicht sehr schlüssig.
Klassische Fragen danach, wie es eigentlich gewesen ist, kämen hier rasch an ihr Ende. Man könnte die Episode von dem Kruzifix von San Damiano, das Franz aufforderte, das Kirchlein zu reparieren, als Konstrukt der Biographen beschreiben, mit welchem das, was bei Franz unklare Regungen waren, in den Bogen klarer Anweisungen durch seinen Herrn, Jesus Christus selbst, einsortiert werden sollte. Man kann hinter den hagiographischen Bemühungen sogar noch mehr wittern: In einer Zeit, in der stets der Abfall zu einer der zahlreichen Häresien zu befürchten war, machten der Auftrag Christi und seine Erfüllung durch Franz deutlich, dass dieser von Anfang an in Einklang mit der Kirche wirkte, nicht gegen sie – genau dies zu zeigen, war eines der wichtigsten Anliegen Celanos und anderer. So spricht viel dafür, dass die Erzählung vom Kruzifix so, wie sie überliefert ist, eine Erfindung darstellt.
Die Gratwanderung, auf die man sich begibt, wenn man ein entsprechendes äußeres Ereignis für unwahrscheinlich hält, ist freilich heikel, denn allzu schnell verbindet sich eine solche Destruktion mit dem Gestus der modernen Menschen, denen solche Wunder ohnehin suspekt erscheinen. Eben deswegen lohnt es sich, dabei zu verweilen, was dieses Wunder eigentlich für die Zeitgenossen besagte und wie es sich mit der Biographie des Franz verbindet. Belegt man heute, dass eine Episode erfunden wurde, bleibt doch zugleich bestehen, dass die entsprechende Erzählung für die Zeitgenossen selbstverständlich plausibel war. Schließlich hätte die Erfindung ja keinen Sinn, wenn die ersten Leser sie gleich als unglaubwürdig beiseitegelegt hätten. Das gilt nicht nur für diese Erzählung, sondern auch für Krankenheilungen und andere Wundertaten: Für die frühen Anhänger des Franz waren all diese Geschehnisse wirklich, und sie konnten wirklich sein, weil sie in das vormoderne Wirklichkeitsverständnis hineinpassten. Sie einfach weg- oder umzudefinieren hilft dem Verständnis einer historischen Persönlichkeit gerade nicht, sondern presst diese in das Raster des eigenen Wirklichkeitsverständnisses.
In einem direkten Sinne also wird man die Erzählung vom Kruzifix von San Damiano nicht einfach als Teil einer chronologisch greifbaren Erzählung äußerer Abläufe im Leben des Franziskus ansehen können – und doch ist sie gerade für die Chronologie von großer Bedeutung. Der Ruf Christi und die folgenden Ereignisse des Bruchs mit dem Vater gelten biographisch als Beginn der Lebenswende des Franz – und da Thomas von Celano seinen Tod recht genau datiert, nämlich auf den 3. Oktober 1226,167 und zugleich erklärt, dies sei zwanzig Jahre, nachdem er begonnen hatte, Christus anzuhangen und das Leben der Apostel zu führen, erfolgt,168 müssen die Geschehnisse, um die es hier geht, wohl 1206 stattgefunden haben.169 Mehr an Zahlen gewinnt man aus ihnen allerdings nicht – aber Jahreszahlen allein machen eine Biographie nicht aus, und vor allem ist eine Biographie mehr als eine Aneinanderreihung äußerer Geschehnisse. So fraglich der Dialog mit dem Kruzifix in historischer Perspektive ist – die Erzählung vom Kreuz von San Damiano ist nicht einfach eine Erfindung. Sie hilft vielmehr in ihrem spirituellen Kern dazu, mehr von Franz zu verstehen. Es ist nicht nur nicht gänzlich ausgeschlossen, sondern vielmehr geradezu wahrscheinlich, dass Franz im Angesicht des Kreuzes von San Damiano Erfahrungen der Gegenwart Christi machte: vielleicht nicht in dem Moment, an dem die drei Gefährten und andere Erzähler dies haben wollen, aber bei anderer Gelegenheit. Franz bewegte sich in einer Welt von Repräsentationen Gottes und der Heiligkeit, in welcher nicht allein die sakramentalen Vollzüge der Kirche Christus vergegenwärtigen konnten, sondern es vielfältige Berührungen mit Gott selbst gab. Ein Bild war nicht einfach das Gemälde eines Künstlers, sondern es war, so hat es Hans Belting umfassend geschildert, Teil der kultischen Vollzüge der Glaubenden,170 Medium zwischen Gott und den Menschen, Vergegenwärtigungsort, Subjekt frommer Vollzüge. In einer Gesellschaft, in der Heiligenbilder selbst Akteure des Kultes waren, konnte ein Kruzifix auch sprechen und dabei gar die Lippen bewegen.171 Das hatte weder mit überspannter Phantasie zu tun noch mit frommem Betrug, es war Teil einer vom Göttlichen angefüllten Welt – und zu Franz’ religiösem Lernprozess mag gehören, dass er genau dies in zunehmender Intensität erfuhr und wahrnahm. Das Bildnis eröffnete als Abbild des Dargestellten den Zugang zu diesem selbst. So hat denn die Erzählung vom redenden Kruzifix durchaus ihren Ort in der Lebenswelt des Franz von Assisi – auch wenn die nächste Ernüchterung folgt: Relativ späte Handschriften überliefern ein Gebet, das Franz vor dem Kruzifix von San Damiano gesprochen haben soll, als er den Auftrag Christi erhielt.172 Es ist in lateinischer wie italienischer Sprache überliefert und lautet:
„Höchster, herrlicher Gott, erleuchte die Finsternisse meines Herzens und gib mir rechten Glauben, gewisse Hoffnung und vollkommene Liebe, Sinn und Erkenntnis, Herr, dass ich deinen heiligen und wahren Willen tue“.173
Leider ist die Zuordnung dieses Gebetes hinsichtlich Ort und Zeit viel zu unsicher, um es als Zeugnis für Franz’ Verhältnis zum Kreuz von San Damiano auszuwerten – gelegentlich wird sogar daran gezweifelt, ob man es auf Franz selbst zurückführen kann.174 Auch dieses Gebet führt uns also nicht näher an Franz’ Verhältnis zu dem Kruzifix heran. Gleichwohl ist es nicht auszuschließen, dass Franziskus die Begegnung mit dem Abbild Christi auch als Begegnung mit diesem selbst erfahren und daraus Hinweise auf seine Lebensführung und die Notwendigkeit der Umkehr entnommen hat. Diese Plausibilität reicht indes nicht, um die nächsten Schritte des Franz in der Weise, wie es die frühen Biographen wollen, auf die klärende Anweisung Christi zurückzuführen. Sein Lebensweg erfuhr erst nach und nach und auf überraschend andere Weise Klärung. Historisch wird man rund um die Geschehnisse in San Damiano wohl auf nicht mehr stoßen als darauf, dass einer der Wege, die Franz als Alternative zu den vorgegebenen Lebensmustern ausprobierte, ihn auch in die Kirche von San Damiano führte und dass er hier eine hohe Spende hinterlegen wollte, dieses Vorhaben aber wohl am Misstrauen des Priesters scheiterte – weswegen er das Geld schlicht fortwarf. Aus den Berichten dringt durch, dass es sich hierbei möglicherweise um den gesamten Tagesverdienst aus einem beträchtlichen Geschäft handelte, ja dass Franz vielleicht sogar noch sein Pferd dafür drangegeben hat. Es bedarf keiner zu großen Phantasie, sich auszumalen, dass Franz recht bald gedämmert haben dürfte, dass seine spontane Geste, gerade weil sie über das übliche Maß religiösen Engagements hinausging, ihm bei seinem Vater keinen Beifall einbringen würde. Möglicherweise war das Geschehen in San Damiano deswegen tatsächlich ein Wendepunkt, weil mit ihm das bisherige Versteckspiel von Franz an sein unweigerliches Ende gekommen war: Anders als bei einer Kopfbedeckung, einem Gürtel oder einem Hemd ließ sich der Verlust dieses Betrages kaum mehr verheimlichen. So mag die beschriebene Furcht des Priesters auch ein Spiegel von Franz’ eigener Angst vor dem Vater gewesen sein – oder ihn vielleicht überhaupt erst an die Realität erinnert haben, die darin bestand, dass er eben im Begriff war, einen ansehnlichen Teil des Geschäftsgewinns, der seinem Vater zustand, zu verschenken, und das hieß in den Augen des Vaters wohl mehr als offenkundig: zu vergeuden. Stellt man diesen Hintergrund in Rechnung, so wird man auch Franziskus’ Gesuch, beim Priester wohnen zu dürfen, nicht als bewusst geplante Lebenswende hin zu einem asketischen Leben im Horizont der Kirche verstehen dürfen – manches spricht dafür, dass Franz schlicht ein Versteck suchte, weil er Schlimmes vonseiten des Vaters erahnte. Davon ist jedenfalls ab dem Moment die Rede, an dem Franz zu Ohren kam, dass sein Vater ihn verfolgte. Er hat sich nun offenbar in einer Höhle verborgen,175 die nach Celanos Bericht auf dem Gelände von San Damiano lag.176 Dazu passen freilich andere Berichte nicht, nach denen das Versteck so abgelegen war, dass nur eine Person davon wusste, und zwar nicht, wie man bei einem Versteck in San Damiano vermuten müsste, der Priester von San Damiano, sondern ein Angehöriger des Vaterhauses,177 wohl ein Bediensteter, dem Franz besonders ans Herz gewachsen war.
Am Rande der Gesellschaft
Vielleicht also war diese Höhle gleich nach der Begegnung mit dem Priester seine Behausung, mit großer Sicherheit wurde nun der Konflikt mit dem Vater bestimmend – und wohl zum letzten Auslöser für Franz, den eher spontan, ja fast versehentlich vollzogenen Bruch mit dem Vater öffentlich zu zelebrieren. Man kann die Auseinandersetzung mit dem Vater tatsächlich als eine erste Klärung verstehen, die die bisherige Diskrepanzerfahrung zum bürgerlichen Lebensstil, mit der Franz wohl seit dem Herbst 1203, also gut drei Jahre, gerungen hatte, durch eine klare Entscheidung gegen die Bürgerlichkeit auflöste. So steht am Anfang des Lebensweges des Heiligen aus Umbrien ein massiv zugespitzter Generationenkonflikt, ein Ausbruch aus den Schranken des bisherigen Lebens – und noch kein Aufbruch zu einem neuen Leben. Dass das nicht ganz unproblematisch ist, haben die Biographen wohl geahnt, und die Vorschaltung der Erzählung vom sprechenden Kruzifix stellt den intensivsten Ausdruck einer Korrektur dieses Lebensmusters dar, das eher nach einem Konflikt mit verspätet pubertären Zügen aussieht als nach einer Entscheidung für Christus oder gar einem Hören auf dessen Ruf.
In den Schilderungen der Biographen kommt naheliegenderweise der Vater nicht gut weg: Er erscheint als brutaler Verfolger seines Sohnes. Betrachtet man das Szenario, so wird man vielleicht etwas mehr Verständnis für ihn aufbringen können. Der Betrag, den sein Sohn achtlos in eine Fensternische geworfen hatte, war wie erwähnt wohl nicht gering, der Sohn musste in den Augen des Vaters als ein Tunichtgut erscheinen, dem der Vater nach seinen eigenen Maßstäben alles Gute hatte angedeihen lassen, der sich aber nicht in der Lage zeigte, den damit verbundenen Forderungen gerecht zu werden. Vielleicht war es sogar der Vater selbst, der durch einen Geldbetrag den Sohn 1203 aus der Gefangenschaft von Perugia gelöst hatte. Selbst wenn dem nicht so sein sollte, wird man in Pietro Bernardone zunächst einmal einen klassischen Vertreter des Kaufmannsstandes sehen dürfen, der offenbar begonnen hatte, seinen ältesten Sohn für das erfolgreich laufende Geschäft anzulernen. Die hinter den geschilderten Szenen stehenden Alltagsvollzüge lassen einen jungen Mann erkennen, der im Geschäft hinter dem Tresen stand und der auch kleine Handelsreisen tätigte, wenngleich wohl noch nicht die weiten Touren, die der Vater unternahm, der aber das Geld nicht zusammenhielt. Ob dem Vater die eigenartigen Geldverluste schon aufgefallen waren, die aus Franz’ überreicher Bereitschaft, Almosen zu spenden, resultierten, lassen die Berichte nicht erkennen. Nun war jedenfalls offenkundig der Punkt erreicht, an dem sich nichts mehr verbergen ließ – worauf Franz mit der alles andere als vernünftigen Maßnahme reagiert hatte, sich selbst zu verbergen. Wiederum drängt sich die Assoziation an pubertierende oder noch jüngere Kinder auf, die, konfrontiert mit den Folgen ihres Tuns, ein Fluchtverhalten wählen, das die Dinge im Allgemeinen schlimmer und nicht besser macht.
So auch im Falle der Familie Bernardone.178 Natürlich suchte der Vater nach seinem Sohn, der, so musste es ihm erscheinen, von einer Handelsreise nicht heimgekehrt war. Dass die Vermutung, er sei unter die Räuber gefallen, nahelag, wird nicht erzählt, ist jedoch, vollzieht man die Vorgänge mit ebenjener Empathie für den Vater nach, die den frühen Biographen ganz bewusst fehlt und fehlen muss, mehr als offenkundig. So ist auch sein Erstaunen und Entsetzen, als er hörte, dass Franz sich in San Damiano aufhielt,179 nicht, wie der Erzählduktus bei Celano und anderen suggerieren soll, auf eine Ablehnung der damit angedeuteten Wendung zu einem asketischen christlichen Leben zurückzuführen, wie sie sich später etwa in der Ablehnung der Konversion zur Ordensfrau bei Klaras Familie zeigen sollte.180 Wenn die vorgetragenen Überlegungen stimmen, war Franz ja nicht einmal in der Kirche untergeschlüpft, und wenn doch, so dürfte kaum dieser Umstand allein den Vater verärgert haben, sondern der unerklärliche Verlust des Geldes. Das zeigt sich schon allein daran, dass Geld und Besitz den weiteren Konflikt zwischen Vater und Sohn bestimmten. In der hagiographischen Zuspitzung bei Johannes von Perugia bedeutete dies, der Vater habe seinen Sohn bloß dem Fleische nach geliebt („carnaliter“)181 – was eine moralisch wertende Zuspitzung ebenjener in der Tat äußerlich-fleischlichen Konfliktlage darstellt. Die drei Gefährten halten die Erinnerung an die tiefe väterliche Liebe jedenfalls ohne einen solchen Zusatz fest182 – und es gibt auch für die heutige Rückschau keinen Grund, die Aufrichtigkeit und im besten Sinne Normalität der Liebe Pietro Bernardones für seinen Sohn in Zweifel zu ziehen: eine Liebe, die durch den Sohn einigen Prüfungen ausgesetzt war und, wie auch die Gefährten erkennen lassen, diesen Prüfungen nicht standhielt, sondern später in offenen Hass umschlug.183
Der Vater ist jedenfalls nun offenbar aufgebrochen, Franz aus San Damiano zu holen, aber die Biographen sind sich einig, dass dieser so gut versteckt war, dass sein Vater ihn nicht fand. Es fehlt also die dramatische Zuspitzung, dass Franz in seinem Versteck aufgestöbert wurde. Vielmehr ist Franz wohl irgendwann – anscheinend nach einem Monat184 – selbst aus dem Versteck herausgekommen. Sein Zustand nach diesen vier Wochen muss einigermaßen dramatisch, an der Grenze zum Ekelerregenden gewesen sein – Celano deutet dies an, wenn er erklärt, Franz habe es in der Zeit seines Verstecks „kaum gewagt, um menschlicher Notdurft willen hinauszugehen“.185 Gewissermaßen rund um die Uhr befand Franz sich demnach in einem engen Raum, ohne Kontakt mit anderen Menschen, ohne Luft zu schnappen, ohne sich zu reinigen. Einer der reichen Söhne der Stadt verwandelte sich so mehr und mehr in eine verdreckte und zerlumpte Gestalt: Was in Rom noch ein Testlauf gewesen war, wurde nun zu einer Realität. Franz wurde, noch ehe er die Armutsexistenz religiös deutete, zum Bettler, freilich zu einem Bettler, der rein rechtlich noch als Sohn und künftiger Erbe seines Vaters über Reichtümer verfügte und eben erst einen großen Geldbetrag von sich geworfen hatte.
Wie tief dieser Wandel reichte, zeigt die Reaktion der Bürger von Assisi: Als er sein freiwilliges Gefängnis verlassen hatte, wurde er rundum verspottet. Die Heiligenviten tauchen auch dies in ein Licht der Leitung durch Christus und der Abwehr durch die sündige Welt. Im Gebet fühlte er sich, so berichten es Celano und andere, plötzlich von Freude ergriffen und verließ sein Versteck.186 Das Wirken Christi erscheint hier weniger handfest und weniger explizit als bei der Erzählung vom sprechenden Kruzifix, und es ist nicht schwer, sich die Erfahrung vorzustellen, zu der Franz nach Wochen der Ungewissheit durchdrang. Er verlor offenbar, so beschreibt es Celano auch, die Furcht vor denen, die ihn verfolgten. Und diese Zuversicht überkam ihn in ebenjener Spontaneität, die ihn schon zuvor geprägt hatte. Er verließ also das Versteck: Der verlorene Sohn wurde wieder sichtbar, aber auf welche Weise! Tatsächlich glich seine Veränderung jenem Wandel, den in Lk 15 das Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt, der sich sein Erbe hatte auszahlen lassen, es verprasst hatte und nun armselig heimkehrte. Die Franz-Viten ziehen diese Parallele nicht, doch drängt sie sich auf, freilich mit der interessanten Pointe, dass Franz nicht wie jener verlorene Sohn demütig zu seinem Vater heimkehrte, sondern endgültig mit ihm brach. Das war bei seinen ersten tastenden Schritten unter freiem Himmel für die Bürger von Assisi noch nicht sichtbar. Sie sahen nur den Wandel, der sich an Franz vollzogen hatte: Fortgeritten war er als reicher Handelsmann in kostbaren Gewändern, aus dem Versteck kam eine verdreckte Gestalt, noch dazu, so berichtet es Celano, gänzlich abgemagert,187 was nach der Zeit in der erbärmlichen Behausung nicht weiter verwundern kann. Vier Wochen waren vergangen und hatten seine äußere Gestalt grundlegend geändert, zumal in einer Gesellschaft, die gewohnt war, sozialen Status auch in Kleidung auszudrücken. Ohne erkennbare Not hatte er aufgegeben, was seinen Stand und seinen Stolz ausmachte. So sahen ihn die Mitbewohner der Stadt, noch dazu mit der Geschichte im Ohr, dass er viel Geld verschleudert hatte, von dessen Verbleib man nichts wusste, das aber offenkundig nicht Räubern in die Hände gefallen war. Franz hatte nun erreicht, was er die ganze Zeit versucht hatte: Er hatte jeglichen bürgerlichen Habitus abgestreift. Der Wechsel war freilich nicht nach oben, in das Rittertum erfolgt, wie er es einmal angestrebt hatte, sondern nach unten, ja hinaus aus der Gesellschaft. Er war nun einer von denen, denen er sich ohnehin schon die ganze Zeit zugewandt hatte, ein Outcast jenseits aller Normen der städtischen Gesellschaft.
Und deren Angehörige bestätigten ihm noch einmal, wie ungewöhnlich seine Zuwendung zu den Menschen am Rande und jenseits der Ränder der Gesellschaft gewesen war. Denn der verlorene Sohn wurde nicht aufgenommen, sondern seine selbst gewählte Ausgrenzung wurde bestätigt:
„Wie man ihn so sah, begannen alle, die ihn kannten und seine Anfänge mit dem Ausgang verglichen, ihn mit Vorwürfen anzuklagen. Sie nannten ihn wahnsinnig und verrückt und warfen den Dreck aus den Gassen und Steine nach ihm“.188
Die Qualifikation als „wahnsinnig“, die schon einmal im Zusammenhang seiner Gefangenschaft in Perugia begegnete,189 lässt etwas von der Gratwanderung erahnen, die Franz vollzog. Wer freiwillig an allen Normen seiner Herkunft rüttelte, drohte seinen Halt zu verlieren,190 und dies umso mehr, als eine klare, positive Sendung zu diesem Zeitpunkt jedenfalls für seine Mitbürger noch nicht zu erkennen war – wenn die bisherigen Überlegungen stimmen, auch nicht für ihn selbst. Der Aussteiger und Outcast hatte in der Gesellschaft keinen Platz, hatte die Normalität so weit verlassen, dass man darin nur mehr Wahnsinn entdecken konnte. Dieses Urteil bot zwar nicht wirklich eine Erklärung, aber wenigstens etwas wie einen Ort, eine Einordnungsmöglichkeit: Als definiertes Gegenbild zur Normalität konnte der existenzielle Protest gegen die Normen, den Franz nun endgültig vollzog, zumindest eingeordnet werden. Wenn es denn eines Beleges dafür bedürfte, dass die Fragmente eines Lebens sehr unterschiedlich zusammengesetzt werden können, so bieten die Biographen ihn hier selbst: Nimmt man das geschilderte Verhalten von Franz zusammen, so kann es sich um Versatzstücke einer Heiligenbiographie handeln, als welche es geschildert wird, doch ebenso gut könnte man die pathologische Geschichte eines entwurzelten jungen Mannes erzählen, der, zu exaltiertem Verhalten neigend, verzweifelt, aber vergeblich versuchte, seine Herkunft abzuschütteln. Gärungsphasen wie der, die er durchmachte, ist es eigen, dass sie ergebnisoffen sind. Niemand wusste, wie dieser Lebensweg ausgehen würde, der in der schreckenerregenden Existenz auf der Rückkehr nach Assisi seinen vorläufigen Höhepunkt erlebte, welcher zugleich ein schmählicher Tiefpunkt war.
Natürlich erregte dieser eigenartige Einzug in Assisi Aufsehen. Und natürlich hörte der Vater davon und ergriff seinen Sohn.191 Wieder ist es für die Biographen offenkundig, dass sein Vorhaben nur schlimm sein kann: Wie ein Wolf auf ein Schaf, so hat er sich auf seinen Sohn gestürzt, hören wir – und dieses Bild ist so verdichtet, dass die drei Gefährten es gerne von Celano übernehmen.192 Er steckte den Sohn, der eben erst aus seinem dunklen Versteck gekommen war, wiederum an einen dunklen Ort und versuchte ihn durch Schläge und Fesseln gefügig zu machen.193 An moderner Pädagogik, gar modernem Umgang mit einem Kranken, für den Franz ja von vielen gehalten wurde, darf man dieses Verhalten nicht messen, von dem der Vater wohl meinte, es sei angemessen für den Sohn. Man kann sogar so weit gehen zu sagen, dass die Schläge, die er seinem Sohn angedeihen ließ, noch ein Ausdruck dessen sind, dass er ihn nicht ganz aufgegeben hatte: Franz war in seinen Augen nicht einfach an den Wahnsinn verloren, sondern es bestand, so dürfte der Vater gemeint haben, noch die Möglichkeit, ihn zurück in die bürgerliche Existenz zu holen, ihm durch Schläge das an Erziehung zu geben, was zuvor versäumt worden war. Dass Schläge kein Mittel der Erziehung sind, ist auch den Menschen der Moderne noch gar nicht so lange bewusst – einem Kaufmann im Florenz des 13. Jahrhunderts wird man unterstellen dürfen, dass er noch meinte, Schläge seien für den, dem sie galten, etwas Förderliches. Statt vor dem Wüten des unverständigen Vaters zu erschrecken – so sehr dies ein Teil der Wahrheit ist –, kann man auch versuchen, einen Vater dabei zu beobachten, wie er in Verzweiflung alles daransetzte, seinen Sohn für eine bürgerliche Existenz zu retten. Das gilt umso mehr, als die seit Celano feste Annahme, Franz habe mit dem Aufbegehren gegen den Vater schon zu diesem Zeitpunkt ein festes Vorhaben verfolgt, ja dies habe sich durch das Vorgehen des Vaters noch weiter verfestigt,194 nach allen bisherigen Überlegungen als der Versuch zu sehen ist, den Weg in die Heiligkeit möglichst früh und möglichst klar festzumachen. Fällt dies fort, so ging es dem Vater eben nicht darum, wie die Biographen suggerieren, Franz vom Weg in ein asketisches Ordensleben abzuhalten, sondern ihn auf dem vorgegebenen Weg in Richtung Wohlstand und Ansehen zu halten, zu dem selbst Franz wohl noch keine klare Alternative wusste. Auf die Rebellion des Sohnes antwortete der Vater mit Unterdrückung: ein Spiel von Macht und Gegenmacht zwischen Vater und Sohn – und in dem allen doch wohl auch, selbst wenn die Biographen dies immer wieder zu verstecken versuchen: ein Kampf um Liebe und ihren Verlust.
Freilich auch: ein Kampf um Geld.
Prozess vor dem Bischof
Und das Geld hilft tatsächlich, die Situation zu erhellen – weil sich an ihm besonders deutlich zeigen lässt, wie sich Celano mit seinem Bemühen, Franz schon früh ein religiöses Vorhaben zu unterstellen, in Widersprüche verwickelt. Bekanntlich hatte Franz das Geld verächtlich in eine Fensternische geschleudert. Nun aber berichtet Celano, schon in der ersten Vita, mit einem Mal, Franz habe vorgehabt, es für Arme und den Kirchenbau zu verwenden195 – die spontane Handlung des Franz gewinnt so von ihren Wirkungen her Sinn und Absicht. Ein Versuch, Franz aus heutiger Sicht erzählend zu verstehen, wird dem nicht einfach folgen können, sondern wohl dabei bleiben müssen, in Franz’ Verhalten in dieser Lebensphase gerade die Absichts- und Ziellosigkeit zu registrieren. Allerdings dürfte die Erwähnung einer Zielbestimmung des Geldes auch auf den Umstand hinweisen, dass Franz wieder an die fortgeworfenen Münzen gekommen ist – sonst hätte er ja gar nicht über ihre Verwendung nachdenken können.
Die Möglichkeit hierzu hat ihm, so scheint es, die Mutter verschafft196: Sie hat während einer Abwesenheit des Vaters noch einmal mit Franz gesprochen – wenn die Berichte stimmen, wohl im vergeblichen Versuch einer Vermittlung in dem Generationenkonflikt, der zwischen ihrem Mann und ihrem Sohn mit auf beiden Seiten unerbittlicher Härte ausgetragen wurde. Angesichts der Aussichtslosigkeit dieses Unterfangens ließ sie dann den Sohn frei. Ob dies nur daran lag, dass, wie es heißt, ihre „mütterlichen Eingeweide um seinetwillen bewegt wurden“,197 oder nicht die Freilassung genau das Ziel hatte, dass Franz das Geld für den Vater wiederbeschaffte, um es ihm zurückzuerstatten und ihn so zu versöhnen, wird man dahingestellt sein lassen. Jedenfalls würde dies recht gut dazu passen, dass Franz sofort nach San Damiano eilte, aber eben auch binnen Kurzem wieder zurückkam, laut Celano, weil der Vater zurückgekehrt war und durch Assisi tobte. Dass Pietro Bernardone dabei gedroht haben soll, dafür zu sorgen, dass der Sohn aus dem Herrschaftsgebiet von Assisi vertrieben werde,198 bildet wohl den Hintergrund für den sich nun anschließenden Prozess, den die drei Gefährten199 präziser beschreiben als Celano.
Der Vater verklagte seinen Sohn zunächst – passend zu dem Wunsch einer Vertreibung – vor den Konsuln der Stadt, also den Stadtregenten, die seit dem Jahre 1198 aufgrund jährlicher Wahl durch die Volksversammlung die Exekutive und Judikative der Stadt bestimmten.200 Die Einrichtung dieses Amtes war Teil jener Verlagerung hin zu bürgerlichen Normen, die die Stadt unabhängig von adeliger Vorherrschaft machen sollten. Franz war aber nicht bereit, der Vorladung durch die Konsuln zu folgen, weil er, so erklärte er, „durch Gottes Gnade schon frei gemacht worden“ sei.201 Das könnte, auch wenn es kein wörtliches Zitat sein dürfte, recht gut sein Lebensgefühl in dieser Lebensphase wiedergeben: Er hatte nun den Mut gefunden, den Konflikt mit seinem Vater auszutragen und, wie sich bald zeigen würde, ganz auf alle bürgerlichen Bindungen zu verzichten. In diesem Sinne war er tatsächlich frei geworden, frei von allem, das ihm bisher Beschwer gemacht und ihn durch jene Diskrepanzerfahrungen hindurch fast zerrissen hatte. Das Nein zur elterlichen Existenz jedenfalls war jetzt klar, und schon das stellt eine Befreiung dar. Die Konsuln mussten diese zutiefst spirituell-theologische Aussage in eine rechtliche Form gießen und interpretierten sie so, als sei Franz durch seinen Aufenthalt in San Damiano in den geistlichen Stand übergetreten.202 Sie vereindeutigten damit eine eigentlich noch unklare Situation juristisch und hatten auf diese Weise vielleicht zumindest Anteil daran, dass für Franz das Nein nicht allein stehen bleiben musste, sondern mit einer neuen positiven Formung einhergehen konnte: Die Kirche bot ja in ihren Orden durchaus Platz für Menschen, die in der bürgerlichen Welt nicht leben konnten oder wollten.
Dieser Vereindeutigungsprozess gewann dann sehr konkrete Gestalt in Guido I., dem Bischof von Assisi.203 Die Logik des Geschehens ist dabei rechtlich wie auch sozial klar: Rechtlich hatten die Konsuln, indem sie sich wegen seiner Zugehörigkeit zum geistlichen Stand für unzuständig für Franz erklärten, den Weg zur geistlichen Gerichtsbarkeit geöffnet. Dieser stand Guido vor. Indem Franz sich bereitwillig auf diesen geänderten rechtlichen Rahmen einließ, den offenkundig auch sein Vater akzeptierte und wohl akzeptieren musste, wurde zur obersten Instanz statt der bürgerlichen Konsuln ein adeliger Vertreter der alten Herrschaftseliten bestimmt,204 bei dem jedenfalls nicht mit Sympathien für Pietro Bernardone und dessen bürgerlich-kaufmännischen Habitus zu rechnen ist. Den Konflikt zwischen Vater und Sohn löste er gleichwohl, wenn dem Bericht der Gefährten zu trauen ist, auf eine geradezu salomonische Weise: Dem Vater gab er insoweit Recht, als er Franz aufforderte, ihm das Geld zurückzugeben, das er so verächtlich behandelt hatte. Dem Sohn aber gab er darin Recht, dass er ihm in genau dieser Verachtung zustimmte und die Rückgabe damit begründete, dass es vielleicht auf unrechte Weise erworben sei und daher gar nicht zu einem gottgemäßen Zweck verwendet werden dürfe und solle.205 Rechtlich also blieb er aufseiten des Besitzes, religiös-moralisch dagegen schlug er sich auf die Seite des jungen Rebellen – und vermittelte ihm den Eindruck, dass er mit seinem Protest gegen den Reichtum nicht alleinstand, sondern seinen Platz in der Gemeinschaft der Kirche hatte.
Dieser Eindruck ist aus heutiger Rückschau irritierend: Natürlich war die Kirche der Zeit keineswegs arm, schon lange gab es Proteste gegen ihren Reichtum (s.u. 208–210). Und Guido selbst hatte an den Macht- und Ränkespielen der Kirche seiner Zeit Anteil.206 Längst gab es einen Zwiespalt zwischen der ideellen Orientierung an Armut und dem faktischen Wohlstand der Kirche, und selbst die Orden, die eine Nische für tatsächlich armes Leben in der Kirche bieten sollten, hatten vielfach die Annehmlichkeiten von Geld und Besitz für sich entdeckt. Nun aber trat in den Augen von Franz Guido nicht nur als erfolgreicher Vermittler auf, sondern als Beschützer seines Kampfes gegen den Reichtum, ein Beschützer, der ihm das Gefühl gab, die empfundene Freiheit auch leben und den Konflikt mit dem Vater, der ihm den Berichten nach im wahrsten Sinn des Wortes Fesseln angelegt hatte, hinter sich lassen zu können. Diese Erfahrung der Fürsorge und des Schutzes durch den mächtigen Bischof einer reichen Kirche wurde für seine mentale Welt fundamental. Letztlich erklärt das so begründete Vertrauen in die Amtsträger der Kirche auch das Rätsel seiner Biographie, dass der arme kleine Franz ausgerechnet mit dem machthungrigen Weltenherrscher Innozenz III. eine Verbindung eingehen sollte (s.u. 199–207). Eben nicht ausgerechnet: Für ihn war dies die konsequente Fortsetzung der früh gemachten Erfahrung, dass die Kirche in ihren Amtsvertretern auf seiner Seite stand. Man kann es im Nachhinein mindestens als zwiespältig ansehen, dass Franz den Reichtum der bürgerlichen Gesellschaft mit scharfen Worten anzuklagen wusste, Reichtum und Macht der Kirche aber hinnahm. Genau solche Spannungen machen indes das Leben eines Menschen aus. Wer die Fragmente dieses Lebens nicht wie die ersten Biographen zu einer glatten Heiligenvita zusammensetzen will, sollte auch nicht umgekehrt ebenso glatt aus Franz einen Rebellen gegen kirchliche Strukturen machen. Das war er nicht. Und er wollte es nicht sein.
Frei wollte er sein. Frei von den Zwängen des Reichtums aus elterlichem Haus. So folgte auf die Vermittlung durch den Bischof, die vielleicht gar nicht einmal die Gestalt eines echten Prozesses angenommen hatte, eine, vielleicht die Schlüsselszene seines Lebens: Er gab dem Vater nicht allein das Geld zurück, sondern legte alle seine Kleider ab. Da war er wieder, der spontane Franz der vergangenen Jahre, und in dieses Muster passt die Erzählung Celanos über das Folgende nur zu gut. Franz entkleidete sich wohl tatsächlich öffentlich, sei es noch vor der Gerichtsversammlung oder auch nur vor Vater und Bischof.207 Er zog sich wohl nicht, wie es die Gefährten beschreiben, in eine Kammer des Bischofspalastes zurück, um dort ordentlich Kleider und Geld abzulegen und dann nicht ganz nackt, sondern immerhin mit einem Büßergewand bekleidet herauszukommen.208 Die Scham, die die Gefährten hier in ihrer Beschreibung an den Tag legen, hatte Franz, der erst vor wenigen Wochen verdreckt und zerlumpt durch die Stadt gelaufen war, längst hinter sich. Er konnte nackt vor die Welt und ihre Vertreter treten. So war er von allem gelöst – und übergab sich selbst dem Vater im Himmel:
„Bislang habe ich Pietro Bernardone meinen Vater genannt, aber weil ich mir vorgenommen habe, Gott zu dienen, gebe ich ihm das Geld zurück, dessentwegen er so aufgeregt war, und alle Kleider, die ich aus seinem Eigentum habe, und will von nun an sagen: ‚Vater unser, der du bist im Himmel‘ und nicht: Vater Pietro Bernardone“.209
Nur eines lässt an dieser Aussage spätere Überformung erkennen: der Hinweis auf das Vorhaben, Gott zu dienen, den die biographischen Erzählungen nicht müde werden in diese Lebensphase hineinzuprojizieren, obwohl ein solches Vorhaben wohl auch jetzt noch keineswegs klar konturiert war. Gerade der Hinweis auf das Vaterunser führt in einen anderen Kontext: Jesu Worte in der Bergpredigt, dass Vögel und Pflanzen sich nicht um ihren Unterhalt sorgen und der himmlische Vater sich doch um sie kümmert (Mt 6,25–34). Genau in diesem Sinne hatte der Bischof zuvor Franz ermuntert, das väterliche Geld sorglos zurückzugeben, da ihm Gott selbst alles Notwendige geben werde210: Noch war nur die Absage an den Vater eindeutig. Nicht einmal die geläufige, bei Celano angelegte211 Deutung, dass Franz mit diesem Akt begonnen habe, als Nackter dem Nackten zu folgen,212 will hierzu so recht passen, setzt sie doch schon eine Klärung im Sinne der Nachfolge Jesu voraus. Auf ganz andere Weise dürfte die Szene das Gefühl in Franz vertieft haben, in der Kirche und ihrem Bischof den Schutzraum für sein weiteres Leben gefunden zu haben: Der Bischof barg ihn in seinem Mantel213 und machte so symbolisch deutlich, dass das, was in der bürgerlichen Welt schambesetzt war, in der Kirche seinen Platz hatte.
Das Ganze ist ein typisches Beispiel der „symbolischen Kommunikation“ im Mittelalter, die Gerd Althoff eindringlich analysiert hat.214 Man musste, um sich zu verständigen, auch um Rechtsverhältnisse auszudrücken, nicht unbedingt nur sprechen und deuten, sondern bestimmte Akte konnten Wirklichkeit inszenieren und schaffen. Gelegentlich spricht man auch, um dies zu unterstreichen, von der „Performanz“ als Mittel der Verständigung im Mittelalter215: Etwas wird nicht erläutert, sondern gezeigt. Viele der bislang beschriebenen Schritte und der noch folgenden im Leben des Franz sind solche performativen Akte. Traditioneller würde man wohl von „Zeichenhandlungen“ sprechen, wie sie schon die alttestamentlichen Propheten ausgeübt haben. Ihrem Vorbild folgte Franz darin, seine Auffassungen bewusst oder unbewusst regelrecht zu inszenieren – es sei nur daran erinnert, wie er Assisi als reicher Kaufmannssohn verließ und ärmlich und ungepflegt Wochen später zurückkehrte. Da musste man über seinen Statuswechsel nicht mehr lange nachdenken, man sah ihn. Den Höhepunkt dieser performativen Akte bildete dann die Entkleidung vor dem Bischof und der demonstrativ von diesem gewährte Schutz.
Franz hatte so Gewissheit gewonnen, und doch war noch nicht alles geklärt. Gegen alle Versuche, schon in der Begegnung mit dem Kruzifix oder der Szene vor dem Bischof eine Klärung zu finden, spricht, dass Franz anscheinend noch nach dem Bruch mit dem Vater seine Aussteigerexistenz fortsetzte und ganz offenkundig weiter auf der Suche nach passenden Lebensformen war. So jedenfalls berichtet es noch Celano in der ersten Vita und auch Bonaventura in der Legenda maior216, während bei den drei Gefährten und in der zweiten Vita schon unmittelbar nach der Trennung vom Vater das Bemühen um die Wiedererrichtung von Kirchen folgt.217 Dagegen aber steht mit all seinem Gewicht der früheste Bericht Celanos218: Hier erleben wir einen Franz, der nach der öffentlichen Entkleidung219 tatsächlich keine neuen Gewänder erhalten hat, sondern „nur mit schmalen Gurten umschlungen“220 durch die Gegend streunte. Unter hagiographischen Gesichtspunkten ist dabei jene Geschichte besonders beachtlich, wie er unter die Räuber fiel und sich ihnen als „Herold des großen Königs“ vorstellte221 – dies ist eine der Verwechslungsgeschichten, von denen die frühen Biographien so voll sind und die immer wieder darauf hinauslaufen, dass eine religiöse Vorankündigung zu kurz, nämlich weltlich, verstanden wird: Natürlich erkannten die Räuber nicht, dass Franz mit dem großen König Gott selbst meinte, sondern hielten ihn für einen Abgesandten eines irdischen Königs – auch wenn es kaum glaubwürdig scheint, dass sie in einer so ärmlichen Gestalt tatsächlich einen Königsboten gefunden hätten.
Hält man es erst einmal für wahrscheinlich, dass Franz sich in dieser Zeit noch auf einer weitgehend ungeklärten Suche befand, ist allerdings viel interessanter, dass er im Zuge seines Umherstreifens am Rande der Gesellschaft in ein Kloster bei Gubbio kam, vermutlich das Benediktinerkloster San Verecondo.222 Die Erfahrung hier war, so Celanos Bericht, erschütternd: Franz stand in einem einfachen Hemd da und bekam weder ein besseres Gewand noch auch nur Nahrung, sodass ihn die Not bald wieder von dort vertrieb.223 Neben der Frustration über die Mönche eines etablierten Ordens ist das Entscheidende an dieser Episode, dass aus ihr sehr deutlich spricht, dass Franz selbst im Kloster gar nicht nach einer religiösen Heimat im definierten asketischen Leben der Mönche suchte. Sonst hätte er schwerlich bettelnd in der Küche gestanden, sondern Eingangspforte und Novizenmeister gesucht – und die Erzählung hätte vielleicht von der Schwierigkeit gehandelt, aus freien Stücken einem Kloster beizutreten, aber nicht von der gescheiterten Bettelei. So irrte Franz weiter – und landete wiederum bei einer Gruppe, die ihm vertraut war: Er lebte mit Leprosen, die er nun nicht mehr mit finanziellen Almosen versorgen konnte, wohl aber mit seiner liebenden Zuwendung, mit welcher er sie reinigte und ihre Wunden linderte.224 Noch also „blieb er in der Welt“,225 wie es Celano formuliert, noch war er mehr Aussteiger als Nachfolger Christi. Und doch, so viel war klar: Den Bruch mit seiner Herkunft hatte er vollzogen. Eindeutig und unwiederbringlich.