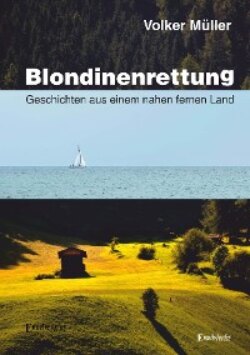Читать книгу Blondinenrettung - Volker Müller - Страница 7
DICHTERBÜSTEN
ОглавлениеDie Bildhauerin Anna Hahn amüsierte sich wieder einmal köstlich. Eine Schulfreundin hatte geschrieben, eine der wenigen aus ihrer Klasse, die in Grincana, der kleinen Stadt im Norden des Grünen Berglands, hängengeblieben waren. In dem Brief steckte, versehen mit der in Schönschrift prangenden Anmerkung „Das dürfte Dich sicher interessieren, nochmals herzliche Grüße Deine Rosalie“, ein Zeitungsausschnitt, der unter der Überschrift „Die Leiden des alten Broeder in G.“ eine mit Vogelkot bespritzte und auch sonst ziemlich unappetitlich ausschauende Büste aus Sandstein zeigte. Dem Bildtext war zu entnehmen, dass das leidige Problem mit den Denkmalen in der Anlage „Bürgererholung“ den Mitarbeitern des städtischen Grünamts bekannt sei und man in Kürze auch Abhilfe zu schaffen gedenke. Es müsse lediglich ein abschließender Bescheid der Unteren Denkmalbehörde abgewartet werden betreffs der Chemikalien, die bei der anstehenden Säuberung verwendet werden dürfen. Diesbezüglich gebe es seit kurzem neue Richtlinien.
Bei der Zeitung wussten sie wohl wieder mal nicht, worüber sie schreiben sollten, und haben die Geschichte mit den Büsten ausgegraben, die ewige Geschichte, dachte die Bildhauerin und strich den Ausschnitt glatt. So sah man sich alle Jubeljahre wieder …
Das Drama, anders kann man die Sache beim besten Willen kaum nennen, hat eine lange und ziemlich vertrackte Vorgeschichte. Gut sechzig Jahre, nicht zu glauben, ist das alles her. Damals war der letzte große Krieg zu Ende gegangen und das Städtchen Grincana wie so viele andere Orte auch unter sarkundische Besatzung gekommen. Vier Jahre zuvor waren die Machthaber in Talanta auf die Idee verfallen, nachdem sie schon eine Reihe kleinerer Nachbarländer erobert hatten, sich nun auch Sarkundien, das große Reich im Osten, vorzunehmen. Nach ersten spektakulären Erfolgen, der Gegner war von dem Angriff in einem ungünstigen Moment überrascht worden, geriet der irrwitzige Feldzug jedoch schnell ins Stocken und allmählich kehrten sich die Verhältnisse auf geradezu fatale Weise um. Zug um Zug mussten die talantesischen Truppen zurückweichen. Die Sarkundier erwiesen sich wider Erwarten als tüchtige Soldaten, das zu Zeiten raue Klima in dem Riesenland tat ein Übriges. Als sich die Front schließlich auch der ruhigen, idyllischen Gebirgsgegend um Grincana näherte, wurde dort die Furcht vor dem, was sich in Kürze ereignen würde, von Tag zu Tag größer. Wie würden die Sieger mit den Einheimischen verfahren? Nicht allein, dass Sarkundien allem Anschein nach aus heiterem Himmel überfallen worden war, es musste, war durchgesickert, dort auch unvorstellbare Verluste an Menschen und Material gegeben haben. Ganze Städte waren ausradiert, Hunderte von Dörfern niedergebrannt worden. War da anderes zu erwarten als Rache und Vergeltung?
Die meisten von den Oberen setzten sich deshalb auch – oft in letzter Minute noch – aus Grincana ab, flüchteten gen Westen, wo sie vielleicht auch nicht gänzlich ungeschoren davon kommen würden, jedoch wohl kaum das zu befürchten hatten, was ihnen von den Sarkundiern drohte. In dem Land hatte es zu allem Unglück vor einiger Zeit nämlich auch noch eine sämtliches Alte und Bewährte radikal hinwegfegende Revolution gegeben. Es war eine neue Ordnung aus dem Boden gestampft worden, in der man als Adelsspross, Fabrikant, Gutsbesitzer, Börsenspekulant etc. keine guten Karten hatte. Wer sich dort seinerzeit nicht rechtzeitig davonmachte, konnte ohne weiteres in die Lage kommen, sich fortan sein Brot als einfacher Arbeiter verdienen zu müssen. Nicht wenige zuvor vom Schicksal Begünstigte wurden gar eingesperrt oder landeten in einem Straflager. Dass mit dergleichen Existenzen in einem besiegten Land mindestens das Gleiche, womöglich noch Schlimmeres passieren würde, lag auf der Hand.
Als es soweit war, die Sarkundier einzogen, ihnen hatten sich nur zwei Panzer entgegengestellt, die binnen weniger Minuten in Flammen geschossen waren, sollten sich die schlimmsten Ängste und Vermutungen nicht bewahrheiten. Es war vielmehr so, dass der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung kaum etwas geschah. Auf den zwei großen Plätzen der Stadt, dem Prinzenanger und dem Alten Markt, standen Gulaschkanonen, wurden von den fremden Soldaten Suppe und andere Lebensmittel verteilt. Im Rathaus hielt ein sarkundischer Militärkommandant Einzug, der in den nächsten Tagen und Wochen allerlei Aushänge veranlasste. So wurde die vorübergehende Einführung eines Notgelds bekannt gegeben, Maßnahmen zur Abwendung von Seuchen angeordnet und die Bevölkerung aufgefordert, alle eventuell noch in Privatbesitz befindlichen Waffen unverzüglich abzugeben. Dem Kommandanten stand eine Gruppe Einheimischer zur Seite, meist Leute, die der Sozialistischen Arbeiterpartei angehört hatten, jener Organisation, die im verflossenen grausamen Radara-Regime verboten gewesen und deren Mitglieder unerbittlich verfolgt worden waren.
In den folgenden Wochen und Monaten geschahen dann Dinge, über die sich die meisten Grincaner nicht genug wundern konnten und an die man sich in späteren Jahren nicht selten mit einer gewissen Wehmut erinnerte. Binnen kurzem spielte auf Veranlassung des fremden Kommandanten nämlich das Theater wieder, was angesichts der beschränkten und in vielem noch ungeordneten Verhältnisse einem kleinen Wunder gleichkam. Das städtische Sinfonieorchester, dessen Arbeit in den letzten Kriegsmonaten gleichfalls geruht hatte, begann wieder zu proben, eine Musikschule wurde gegründet, es fanden in loser Folge Buchlesungen, Vorträge, Kammerkonzerte statt. Nie wieder, hieß es später, habe es so viele und so gut besuchte Kulturveranstaltungen in Grincana gegeben. Und je mehr Zeit ins Land ging, umso mehr fragte man sich, wie das möglich gewesen war, wo doch damals alles am Boden lag, und warum heutigentags das Leben so gemächlich, ohne rechte Höhepunkte, Freude und Bewegung verlief.
Mitten in dieser turbulenten Aufbauzeit, inzwischen hatte der sarkundische Major seinen Platz im Rathaus bereits wieder geräumt und dort jetzt die kürzlich landesweit gegründete Geeinte Sozialistische Arbeiterund Bauernpartei das Sagen, wurde wie es nachmals so schön hieß die Idee geboren, aus der „Bürgererholung“, einer kleinen Parkanlage am Bahnhof, einen Dichtergarten zu machen. Unter den mächtigen Kastanien, Linden und Ahornen, die einst fleißige Gärtnergesellen gesetzt hatten, war im Grincanaer Amtsanzeiger zu lesen, sollten bald schon in Reih und Glied Büsten großer Männer des Wortes stehen. Bedingung war: Sie mussten sich zu Lebzeiten auch als große Humanisten und beispielhafte Vorkämpfer einer sozial gerechten Ordnung ausgezeichnet haben. Allen voran war dabei an die beiden Klassiker der Weltliteratur Jost Henry von Broeder und Ferenc Karl von Schaller gedacht. Aber auch eine Reihe weiterer Dichter, Schriftsteller, Philosophen, Literaten, namentlich solche, die den revolutionären Strömungen ihrer Zeit nahestanden, kämen in Frage. Auf diese Weise, hieß es in dem Beschluss des Stadtrats weiter, solle der notwendige geistige Neuanfang in Grincana dokumentiert und zugleich weiter befördert werden, solle unmissverständlich deutlich gemacht werden, dass man fest gewillt sei, im täglichen Leben und Wirken den von tiefer Menschlichkeit geprägten Idealen dieser großartigen, beispielhaften, stets dem gesellschaftlichen Fortschritt verpflichteten Dichter und Denker gerecht zu werden. Der Erklärung war außerdem zu entnehmen, dass in jenem Dichtergarten regelmäßig literarisch-musikalische Veranstaltungen stattfinden sollten, vornehmlich zu den Geburts- oder Todestagen der dort geehrten Bannerträger der Gerechtigkeit und Völkerverständigung, aber auch anlässlich ausgewählter Höhepunkte im gesellschaftlichen Leben.
Die junge Bildhauerin Anna Hahn, die knapp ein Jahr vor Kriegsende ihr Studium abgeschlossen und danach in einer Munitionsfabrik gearbeitet hatte, wurde in jenen Tagen überraschend ins städtische Kulturamt bestellt. Was hat das zu bedeuten, fragte sie sich, und ging mit einem doch recht mulmigen Gefühl zur angegebenen Zeit ins Rathaus. Sie war in der Radara-Ära in keiner Weise hervorgetreten, hatte sich gleich gar nicht, wie sie meinte, in irgendeiner Form schuldig gemacht. Aber wenn man etwas finden wollte, wer weiß … Andererseits: Würde man sie in einem solchen Fall ins Kulturamt bestellen? Dafür waren vermutlich andere Stellen zuständig. Nach allerlei treppauf treppab stand sie schließlich immer noch tüchtig hin- und hergerissen vor der Tür mit der Aufschrift „Die Ämter Kultur, Volkserziehung, Gesundheit.“
Doch alles kam besser als gedacht.
„Sie können sich freuen, junge Frau. Genosse Döring hat, so viel darf ich Ihnen sagen, viel mit Ihnen vor“, sagte freundlich lächelnd die Mitarbeiterin im Vorzimmer, eine hochgewachsene ältere Dame, deren gepflegte Erscheinung zutiefst im Widerspruch zur spartanischen Einrichtung des Raums stand, den zwei wackligen Stühlen, dem abgewetzten Küchenbüfett, das als Aktenschrank diente, einem sich schon bedenklich zur Seite neigenden Tisch, dem verbeulten Kanonenofen, der fleckigen und verschiedentlich sich hässlich wellenden Tapete.
„Herr Döring sitzt hier, das hab ich ja gar nicht gewusst …“
„Ja, Genosse Döring, wäre gut, wenn Sie sich künftig so ausdrücken würden, ist seit einigen Wochen Stadtrat für Kultur, das sollte ihnen aber eigentlich bekannt sein“, bekam sie da von der Mitarbeiterin zu hören. Anna kannte Döring. Er war, bis ihn die Radara-Leute wegen seiner Ansichten, er war Mitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei gewesen, aus dem Schuldienst entließen, ihr Kunstlehrer in Grincana gewesen. Sie glaubte auch zu wissen, dass er mehrere Jahre in einem sogenannten Umerziehungslager schlimmen Repressalien ausgesetzt und erst nach Kriegsende wieder freigekommen war.
Da stand Döring auch schon in der Tür und bat sie in sein Büro, in dem es um keinen Deut besser aussah als im Kabuff seiner Mitarbeiterin, die im Übrigen auch noch für die Ämter Volkserziehung und Gesundheit zuständig war. Döring, der trotz seiner schlohweißen Haare und seines erschreckend bleichen Gesichts etwas erstaunlich Biegsames, Jugendliches ausstrahlte, sagte: „Schön dich zu sehen, Anna. Hoffe, dir geht’s gut. Kollegin Brandner hat dir sicher schon eine kleine Andeutung gemacht, weswegen du … aber ehe wir dazu kommen, wie ist’s euch ergangen, wie geht es euch?“
Anna schrak zusammen. Eine solche Frage hatte sie nicht erwartet. Sie entschloss sich, die Wahrheit zu sagen. Das war immer noch das Beste. Sie erzählte, dass die Eltern, als sie zu Besuch bei Verwandten in der großen Stadt Kitumen waren, bei einem Bombenangriff ums Leben kamen. Der Bruder sei gleich zu Beginn des Krieges gefallen. Sie habe noch eine Tante und zwei Cousinen, aber die wohnten alle weit weg. Sie sei in Grincana geblieben, weil sie den Eltern versprochen hatte, das Haus am Waldberg um keinen Preis in Stich zu lassen.
„Das hat sich ja nun anderweitig erledigt“, sagte Döring trocken. Die Villa war von der Besatzungsmacht zum Allgemeinbesitz erklärt und dort durch Krieg und Nachkrieg obdachlos gewordene Kinder untergebracht worden.
„Nun setz dich aber erst mal. Wo wohnst du jetzt?“
„Hab’s noch ganz gut getroffen. Kann mich nicht beklagen. Bin bei Otto Mörike untergekommen.“
Anna hatte sich vorsichtig gesetzt, während Döring stehen blieb.
„Der Steinmetz. Na, der hat sich sicher was gedacht dabei.“
„Nach der Arbeit in der Weberei helf ich bei ihm.“
„Du arbeitest in der Weberei? Ja? Na gut, es kommen auch wieder mal andre Zeiten. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema. Ich habe mich in der Sache Dichtergarten ja nicht ohne Grund für dich stark gemacht. Wäre schön, wenn du uns in Zukunft treu bleibst und nicht wie mancher andere kluge Kopf einfach so davonschwirrst. Wir wollen ja wieder eine Kunst- und Kulturstadt werden.“
„Dichtergarten, ich versteh nicht …“
„Nun, du hast doch sicher gelesen, was wir in der ‚Bürgererholung‘ vorhaben …“
„Ja, hab ich, dort sollen irgendwelche Büsten aufgestellt werden.“
„Ja meine liebe Anna, und da …“
„… soll ich mitmachen, ich, nein, das glaub ich nicht, das …“
Döring lächelte und nickte.
„Ich hab dich nach reiflicher Überlegung vorgeschlagen und man ist, ich will es einmal so sagen, bis dato auch nicht abgeneigt, es mit dir zu versuchen.“
„Was heißt mit mir zu versuchen, doch nicht etwa …
„Doch doch. Du sollst das in die Tat umsetzen, von Anfang bis Ende, hast ja schließlich Kunst studiert …“
„Ich … weiß doch gar nicht, ob ich das … also …“
„Machst du schon. Ich trau dir das zu. Hab meine Erkundigungen eingezogen und da hab ich viel Gutes gehört …“
Anna hielt es kaum auf dem schmalen, bei der geringsten Bewegung knackenden Stuhl. Immer wieder wippte sie mit dem Rücken gegen die gefährlich nachgebende Lehne.
„Also, ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, wo haben Sie sich denn erkundigt über mich, am liebsten würde ich gleich anfangen, es stimmt, bei den Büsten war ich nicht schlecht, die Zweitbeste im Kurs …“ Anna war aufgestanden. „Ich müsste in die Bibliothek, ich hab einiges an Vorlagen zu Hause, aber das reicht nicht, ich fang heut noch an, ja, ich will heut noch anfangen, wieviel Köpfe wären das eigentlich, können Sie mir eine Liste geben, müsste ja wissen, wer da alles …“
Döring bedeutete ihr mit flatternden Händen, sich wieder zu setzen. „Alles gut Anna. Dein Elan in allen Ehren. Hab das auch nicht anders erwartet. Aber so schnell geht das nicht, so schnell geht das nicht. Ich möchte, wenn du’s nicht weitersagst, beinahe sagen: Leider. Aber wir leben nun mal in einer aufregenden, alles andere als einfachen Zeit. Es gibt, um es klar zu sagen, zum Projekt Dichtergarten noch einigen Diskussionsbedarf. Da ist noch einiges zu bedenken, grundsätzlich zu bedenken. Es steht bei weitem noch nicht fest, um bei dem, was du zuletzt gefragt hast, anzufangen, wer eigentlich alles gewürdigt werden soll. Es ist aber schön, dass ich jetzt weiß, dass du dabei bist, mit dem Herzen dabei bist. Das kann ich an betreffender Stelle schon mal zu Protkoll geben. Du hörst von uns so in drei, vier Wochen, denk ich. Frühestens. Kann auch länger dauern. Mach dir aber keine Gedanken. So lang ich hier bin, brauchst du dir keine Gedanken zu machen, da bist du der Kandidat Nummer eins.“
Als Anna wieder aus dem Rathaus heraus war, prangten die Linden, die den Markt säumten, im schönsten Grün. Als die Blätter knallgelb waren, gab es noch immer keine Einigkeit darüber, wer alles in dem Dichtergarten kommen sollte. Döring hatte Anna ein ums andere Mal vertröstet. Sie erfuhr von ihm allerdings, dass man nicht mehr wie zunächst gedacht sechzehn Büsten haben wollte. Jetzt war von acht die Rede. Bis zum Frühjahr, ja, so viel Zeit verging noch, reduzierte sich die Zahl weiter. Schließlich kam man bei einem kaum noch zu unterbietenden Minimum an, wollte sich schlussendlich auf die beiden großen Klassiker von Broeder und von Schaller beschränken.
Jahre später erzählte Anna jemand, der damals mit am Tisch saß, was die Partei bewegte, nach und nach die anderen Großen der Literatur letzten Endes doch besser außen vor zu lassen. Als erste sonderte man jene Männer aus, die sich aus welchen Gründen auch immer das Leben genommen hatten. Ihre Ehrung, das leuchtete Anna ein, hätte kaum in Einklang mit dem von Optimismus und Tatkraft geprägten Aufbaugeist der Zeit gestanden. Als nächste blieben jene auf der Strecke, die waschechter adliger Abkunft waren, ihr „von“ also nicht wie Broeder und Schaller auf Grund ihrer Verdienste irgendwann einmal verliehen bekamen.
Den übrigen Unsterblichen, die keinen Platz in der „Bürgererholung“ haben sollten, wurden ihr bedenklicher Lebenswandel oder ihre allzu radikalen gesellschaftlichen Veränderungsideen, manchmal traf beides zusammen, zum Verhängnis.
Selbst gegen von Broeder und von Schaller, musste Anna hören, waren Bedenken laut geworden. Weil: Der Erste hing einer seltsamen, zentrale Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung gänzlich offen lassenden, somit auch jedermann, selbst Fürsten, Feldherrn und Fabrikanten, ein Lebensrecht zugestehenden Naturphilosophie an. Der Zweite hatte im letzten Drittel seines Lebens jeder Art von Volksaufständen eine schroffe Abfuhr erteilt und sich statt dessen dafür stark gemacht, Königen, Herzögen und anderen gekrönten Häuptern eine angemessene Erziehung und Bildung zuteil werden zu lassen. So wären die Sorgen und Probleme des Landes noch am ehesten in den Griff zu bekommen. Letztlich gab die unumstrittene Weltgeltung der beiden den Ausschlag. Gerade in Sarkundien galten der Schöpfer der „Geschichten des Dr. Faustus Agricolanus“ wie der Verfasser der „Göttlichen Ode auf die Erde“ als das Nonplusultra der Literatur, ja, jeglichen künstlerischen Schaffens überhaupt, wurde von einer exemplarischen Vorbildrolle beider für die Besten der eigenen sarkundischen klassischen Dichtkunst gesprochen.
Anna war heilfroh, als sie, es war inzwischen immerhin ein gutes Jahr vergangen, endlich wusste, was genau auf sie zukam. Sie hatte im Vorhinein schon eine Reihe Entwürfe für die zwei Büsten gezeichnet, zugunsten derer nun die Würfel gefallen waren. Sie ging deshalb noch am selben Tag, als sie von der Entscheidung in der Zeitung las, zu Döring und zeigte ihm die Skizzen. Er schaute kurz auf die Bleistifzeichnungen, nickte und sie dachte schon, alles würde seinen Gang gehen. Doch ihr Gegenüber schwieg, schien auf einmal weit weg zu sein und sie bekam es mit der Angst. War etwas passiert? Sollte jemand anders den Auftrag bekommen? Als wüsste er, was ihr durch den Kopf ging, legte Döring seine Hand auf ihre Schulter und sagte in einem seltsam entrückten Ton, der wiederum daran zweifeln ließ, ob er ganz und gar bei der Sache war: „Hast heute die Zeitung gelesen. Ja, es hat sich so und nicht anders ergeben. Nur die zwei sollen in die Anlage kommen. Na gut. Mal ganz davon abgesehen, keine Angst, ist vermutlich alles halb so schlimm, dass mir der Fall Dichtergarten gestern entzogen wurde, jetzt ist Genosse Mäder, Stadtrat für Volksbildung, dafür maßgebend; ich muss dir auch sagen: Das, was du da gezeichnet hast, Mädchen, wird schwerlich durchgehen. Ich rate dir, mach schnell was Neues oder noch besser: Wart erst mal ab. Glaubst mir nicht? Hm, kann ich vielleicht sogar verstehen. Aber ich sag dir: Broeder und Schaller als junge Kerle darzustellen, die Abenteuerlust, das Ungestüme, Brodelnde steht ihnen ja förmlich ins Gesicht geschrieben, das wird unter keinen Umständen durchgehen. Ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen. Wir brauchen jetzt, wie soll ich sagen, vor allem Disziplin, Verantwortung, Bewusstsein. Das steht jetzt oben an, muss es sicher auch. Verstehst du? Man redet sogar wieder von Gesinnung, fester, unbeirrbarer Gesinnung … Dazu passen deine Köpfe nicht, leider. Denn, ehrlich gesagt, je länger ich sie mir so anseh, desto besser gefallen sie mir. Aber darüber bitte zu niemandem ein Wort. Ich hab in der Sache nichts mehr zu sagen. Du wirst sicher demnächst Näheres von anderer Stelle hören.“
Anna war wie vor den Kopf geschlagen, dachte in einer ersten Aufwallung daran, alles hinzuwerfen. Die Skizzen hatten allerhand Mühe und Arbeit gekostet. Sie hatte sich die Aufgabe nicht leicht gemacht. Sie ließ sich jedoch nichts anmerken, dankte Döring für die Ratschläge. Sie werde sich bemühen. Warum er nicht mehr für die Büsten zuständig war, fragte sie nicht. Damals, auch später noch gab es überraschende Entwicklungen, die man am besten stillschweigend hinnahm. Wer da auch nur den leisen Anschein erweckte, etwas nicht zu verstehen oder von der richtigen Seite sehen zu können, musste damit rechnen, selbst bald zum Thema zu werden.
Sie ging nach Hause, stieg hinauf in ihre Dachkammer über der Bildhauerwerkstatt, blies zwei, drei Tage Trübsal, fasste dann aber doch, was sollte sie anders machen, wieder Mut und brachte neue Entwürfe aufs Papier. Broeder war nun ein versonnen blinzelnder, jugendlichen Geist, jugendliche Tatkraft ausstrahlender Alter und Schaller, der bekanntlich früh starb, ein gereifter, vor Energie sprühender, dabei dennoch auch irgendwo noch wohltuend gefasst wirkender Mann in den besten Jahren.
Der Stadtrat für Volksbildung, Fred Mäder, der sie gut zwei Wochen nach ihrem Treffen mit Döring zu sich bestellte, ein großgewachsener Fünfziger mit einem säuberlich gestutzten, kräftigen dunklen Schnurrbart, wollte die neuen Skizzen gar nicht erst sehen. „Nehmen Sie das mal wieder mit, so holterdiepolter geht das nicht. Jedenfalls nicht unter meiner Ägide. Das ist insgesamt eine viel zu ernste Angelegenheit. Hier gilt es von Anfang an, die richtigen sach- und fachgerechten Maßstäbe anzulegen, sonst können wir auf gefährliches Terrain geraten. Und das wollen wir doch nicht oder sehen Sie das anders?“ sagte er nicht unfreundlich, aber mit spürbarer Herablassung. „Also erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Spaß beiseite. Hören Sie zu Genossin Hahn: Das Vorhaben Dichtergarten Grincana, für das Sie der liebe Genosse Döring auserkoren hat, sicher in bester Absicht, zweifellos, nun wir werden sehen, soll und wird in Kürze nun endlich greifbar Form und Gestalt annehmen.“ Nachfolgend schnarrte er herunter, dass zu dem Zweck, was längst schon hätte passieren müssen, eine übergeordnete Kommission ihre Arbeit aufnehmen werde. Das Gremium werde nach gründlicher Erörterung des Gesamtvorhabens ein verbindliches Grundsatzpapier ausarbeiten, das sie, Anna Hahn, zu gegebener Zeit in die Hand bekomme und dann selbstverständlich gründlich zu studieren habe. Danach, und keinen Tag eher, könne man dann an etwaige erste Ideen und Skizzierungen denken.
Anna nahm allen Mut zusammen und sagte, dass sie keine Genossin sei, noch keine. Mäder überhörte das oder tat so als ob. „Haben wir uns verstanden? Ja? Hab ich mich deutlich genug ausgedrückt? Also: Es gibt demnächst klare Richtlinien. Gut, dann können Sie gehen.“
Acht Wochen später, inzwischen war es Juli geworden, bekam sie von einem Boten der Stadtverwaltung in der Tat eine Konzeption „Richtlinie Denkmalprojekt Büsten Dichtergarten“ in die Hand gedrückt. Damit wurde freilich alles noch komplizierter, denn in dem kapp fünfzig Seiten dicken Pamphlet fand Anna, obwohl sie sich zweimal von A bis Z durchkämpfte, kein Wort zu den Büsten selbst. Vielmehr waren darin ausgiebig Notwendigkeit und Zielrichtung des politisch-kulturellen Neuaufbaus in Grincana dargelegt, wobei das sarkundische, als in herausragender Weise sozial gerecht und fortschrittlich apostrophierte Gesellschaftssystem an allen Ecken und Enden als absolutes Vorbild deklariert wurde.
Anna ging in ihrer Not schließlich zu Döring. Sie wusste, dass er für ihr Projekt nicht mehr zuständig war, aber was sollte sie machen. Soviel war klar: Mäder gegenüber einzugestehen, mit der Konzeption nichts anfangen zu können, wäre das Ende der Geschichte, ja, konnte sogar noch weitergehende Folgen haben. Wer nicht verstand, was die Partei wollte, durfte mit besonderer Aufmerksamkeit und Fürsorge rechnen. Mit irgendwelchen künstlerischen Höhenflügen würde es für sie in Grincana dann vermutlich vorbei sein.
Döring wollte sie zunächst nicht zu sich lassen.
„Das habe ich Ihnen gleich gesagt. Ich weiß doch, warum Sie hier sind. Mir können Sie nichts vormachen. Aber Genosse Döring ist für Ihre Angelegenheit nicht mehr maßgebend. Nehmen Sie das bitte endlich zur Kenntnis. Außerdem hat er heute auch wenig Zeit“, erklärte die Sekretärin frostig das Nein. Es war nicht mehr die angenehm ins Auge stechende Dame von vor einem Jahr. Die Neue war kräftiger gebaut und trug ein furchterregend graues, eng anliegendes Kostüm. Anna ließ nicht locker. „Also gut. Sie haben recht. Ich bin deswegen hier. Also dann sagen Sie ihm bitte auch, er hat mich damals für die Büsten vorgeschlagen, deshalb … also ich setz mich jetzt hier hin und warte … bis er Zeit hat.“ Die Sekretärin schlug einen Ordner auf und blätterte, so kam es Anna jedenfalls vor, ziellos darin herum. Es verstrichen zehn, vielleicht auch fünfzehn Minuten. Da stand die Frau auf, ging zu Döring hinein, kam kurz darauf wieder zurück und sagte nicht unbedingt freundlich, aber auf jeden Fall eine Spur weniger frostig als vorhin. „Gehen Sie schon rein.“ Döring stand am Fenster und schaute hinaus. Es dauerte zwei, drei lange Minuten, ehe er sich umwandte. „Anna“, sagte er mit eigenartig rauer Stimme, „ich bin für den Fall nicht mehr zuständig, wie du weißt, und … ob ich darüber hinaus überhaupt in der Sache noch ein Ratgeber sein kann, ist auch fraglich, mehr als fraglich.“ Er setzte sich und forderte sie mit einer knappen Handbewegung auf, Gleiches zu tun.
Er ließ seinen Blick zerstreut über den Schreibtisch wandern, sah schließlich kurz zu Anna hin, verschränkte die Arme vor der Brust und sagte, jetzt wieder halb und halb an ihr vorbeischauend: „Weißt du, wir machen jetzt eine schwierige Phase durch. Es kann auch gar nicht anders sein. Das Neue, das wir aufbauen wollen, verstehst du, muss sich erst endgültig durchsetzen, festigen, die richtigen Konturen gewinnen. Da geht’s manchmal eigenartig zu, ja, eigenartig und vielleicht auch nicht immer gerecht …“ Döring verstummte und lächelte, was Anna von ihm nicht kannte, ungut, um nach einem kurzen, energischen Kopfschütteln fortzufahren: „Ja, aber du willst natürlich trotzdem wissen, wie du mit deinen Büsten dran bist. Hast Angst vor der Kommission. Nun, das ist auch wirklich … also mein siebter Sinn sagt mir, am Ende bist du am besten beraten, wenn du die Sache ausgesprochen pathetisch und heroisch anlegst. Und nicht zu knapp. Ja, pathetisch und heroisch. Es muss richtig donnern und krachen. Viel mehr als eigentlich gut ist. Zeig mal her. Du hast mir doch sicher was mitgebracht.“
Döring sah die Skizzen durch und sagte danach: „Schön, ganz schön, fast zu schön, aber leider zu wenig kämpferisch, zu wenig ernst und entschlossen. Geh ruhig noch ein ganzes Stück in die Richtung. Ich weiß,ich weiß, unsere Dichter hatten auch andere Seiten, waren an sich überhaupt nicht so. Vor allem der Broeder soll ja bekanntlich ein tüchtiger Freund von Wein, Weib und Gesang gewesen sein, aber …“ Döring lächelte auf einmal fast ein wenig verlegen, zuckte die Schultern und hob die Hände. „Wir, du und ich, müssen versuchen, das Beste draus zu machen, es hilft ja alles nichts, aber …“
Anna, die noch so viel hatte fragen wollen, hauchte ein „Ja“ und ein „Vielen Dank für alles“ und verabschiedete sich. Döring kann mir im Grunde auch nicht helfen, dachte sie. Was er gesagt hat, hätte ihr jeder andere ebenfalls sagen können. Sie ahnte nicht, dass ihr selbst in späterer Zeit so manches Mal die Worte fehlen würden und ihr dann oft auch nichts Besseres einfiel, als sich mit einem schlicht-vielsagenden und verdammt für sich allein stehenden „aber“ aus der Affäre zu ziehen.
Mäders Büsten-Kommission war tatsächlich nicht so leicht zufrieden zu stellen. Und Döring hatte Recht gehabt. Die Herren wollten möglichst kantige Köpfe sehen und es sollte dabei auch unbedingt etwas vom Elan der neuen Zeit zu spüren sein, zumindest eine Art freudestrahlende Vorahnung, und natürlich sollte die seit eh und je behauptete unverbrüchliche Volksverbundenheit der beiden klassischen Dichter dezidiert zum Ausdruck kommen. Ein Glück, dass man man wenigstens an einer weitgehenden äußeren Ähnlichkeit festzuhalten gedachte. Damit war dem Heroisch-Übermenschlichen irgendwo auch Grenzen gesetzt. Broeder wie Schaller hatten hohe Stirnen und ebenmäßige, schön geformte Köpfe. Anna war bemüht, den Wünschen der Kommission so gut es ging nachzukommen, auch weil sie Döring nicht enttäuschen wollte. Mit ihm hatte man wenigstens noch halbwegs vernünftig reden können.
Als endlich zwei ihr ziemlich schlimm vorkommende Entwürfe akzeptiert wurden, tröstete sie der Gedanke, dass sie bei der Ausführung, als Material war Troveller Sandstein vorgesehen, wohl noch dieses und jenes würde lindern können. Sandstein, würde sie im Falle des Falles sagen, habe von Natur aus etwas Weiches und Rundes, da fiele manche Partie unter Umständen naturnotwendig ein wenig anders aus als gedacht.
Der weitere Fortgang der Angelegenheit gestaltete sich bei weitem nicht so problematisch wie das bis dahin Geschehene. Anna bekam binnen weniger Tage – auf einmal drängte die Zeit, bis zu einem Staatsfeiertag Ende Oktober sollten die Büsten stehen – im städtischen Bauhof einen Schuppen zugewiesen. Dort wurden wenig später zwei stattliche Sandsteinblöcke abgeladen und die Arbeit konnte beginnen. Anna durfte, bei entsprechendem Verdienstausfall natürlich, mittags schon ihren Arbeitsplatz in der Spulensortieranlage der Weberei an der Äußeren Himmelreichstraße verlassen, um sich danach sogleich mit Hammer und Meißel an die Blöcke zu machen. Einige Male bekam sie unverhofften Besuch von der Kommission und ab und an schauten auch Mitarbeiter des Stadtrats für Volksbildung vorbei.
Nach knapp zwei Monaten war sie mit den Büsten fertig und die Kommission wie der Ausschuss für Kultur und Denkmalpflege der Stadtverordnetenversammlung nahmen sie ohne Beanstandung ab. Die mannshohen Sandsteinfundamente, auf denen die Dichterköpfe ruhen sollten, wurden angeliefert und schließlich war es soweit. An dem bewussten Festtag wurden die Denkmale im „Park des Friedens und der Völkerfreundschaft“, so hieß die Anlage am Bahnhof inzwischen, eingeweiht. Es gab es einen von wuchtiger Marschmusik begleiteten Fackelzug, an dem einige tausend Bürger teilnahmen. In dem Friedensund Freundschaftspark wurden Reden gehalten, Schüler rezitierten Verse der zwei Geehrten, ein Chor sang. Anna wurde am Ende nach vorn gebeten. Der Bürgermeister überreichte ihr einen Blumenstrauß, dankte für das Geleistete und nannte sie eine junge, hoffnungsvolle Künstlerin, die dabei sei, den Start in eine neue, bessere Zeit auf lobenswerte Weise zu meistern. Von ihr dürften Staat und Gesellschaft und nicht zuletzt auch Grincana noch eine Reihe weiterer guter Taten erwarten.
Kurz vor Weihnachten erhielt sie das noch unter Döring vereinbarte kleine Honorar. Er gab ihr selbst das Kuvert. „Hast du dir redlich verdient. War ja kein leichter Weg dorthin. Aber ich denke, es hat sich gelohnt. Du hast damit, vielleicht ist dir das noch gar nicht richtig klar, schon Anteil an unserem neuen Stadtbild. Und das ist doch was.“
Ein Vierteljahr später wurde Walter Döring in aller Stille als Kulturstadtrat abgelöst. Er hatte Grincana mit seiner Frau schon verlassen, als dazu einige knappe Sätze in der Zeitung standen. In der Notiz wurden Gesundheitsgründe für den Schritt geltend gemacht und weiter mitgeteilt, dass man den verdienstvollen Genossen Döring auf einen leichter zu bewältigenden Posten in einem anderen Bezirk der Freien Republik Talanta versetzt habe. Anna machte sich nun natürlich Vorwürfe. Nachdem die Sache mit den Büsten ein gutes Ende gefunden hatte und zudem in der Stadt ein für spezielle Kunst- und Künstlerfragen zuständiges Kulturkabinett eingerichtet worden war, hatte sie Döring aus den Augen verloren. Einmal ohne besonderen Grund bei ihm aufzukreuzen, worüber er sich vielleicht gefreut hätte, auf die Idee war sie nicht gekommen. Sie sollte ihn nicht wiedersehen. Als sie ihn schließlich in einer weit entfernten nördlichen Kreisstadt aufspürte, jemand aus der Stadtparteileitung hatte ihr nach vielem Hin und Her einen dahingehenden Tipp gegeben, teilte ihr der Amtsleiter für Allgemeines der dortigen Kreisverwaltung mit, dass Genosse Döring als stellvertretender Leiter eines Altenheims eine hervorragende Arbeit leiste. Gegenwärtig sei er aber auf unbestimmte Zeit zu einer Kur ins Ausland verreist. Anna ahnte, dass da etwas nicht stimmte. Eine Kur im Ausland, wenn es so etwas überhaupt mal gab, bekam doch nicht so eine kleine Nummer wie Döring. Eine Kur im Ausland und auch noch auf unbestimmte Zeit, das konnte sonst was bedeuten. Man mochte gar nicht darüber nachdenken. Um sie selbst war es in diesen Tagen auch nicht gerade zum Besten bestellt. Sie hatte es sich zunächst nicht eingestehen wollen, aber spätestens als ihr die zu Jahresanfang zur Verfügung gestellte kleine Werkstatt in der Ostvorstadt Knall auf Fall von der Stadtverwaltung wieder gekündigt wurde, musste sie davon ausgehen, dass ihr Stern in Grincana rasant im Sinken begriffen war. Aus welchen Gründen auch immer. Zuvor waren schon einige zunächst vollmundig an sie herangetragene künstlerische Vorhaben schlussendlich nicht zustande gekommen. Eine Geschichte nach der anderen platzte oder wurde von einem Tag zum anderen in neue Hände gegeben. Weder in dem kürzlich eröffneten Kulturkabinett noch bei Mäder, der vorübergehend das Kulturressort mit übernommen hatte, bekam sie Gelegenheit, ihre Situation zur Sprache zu bringen. Hier wie dort gab es fadenscheinige Ausflüchte, wurde sie von Woche zu Woche hingehalten und am Ende fiel auch dieses und jenes gröbere Wort.
„Sehen Sie denn nicht, dass die Stadt zurzeit andere Probleme hat, als sich von früh bis Abend um Künstler zu kümmern, die erst welche werden wollen?“ Als ihr das die Vorzimmerdame von Mäder an den Kopf warf, reichte es Anna. Sie wusste auf einmal, was sie zu tun hatte. Die Welt hörte ja in Grincana nicht auf. Sie fuhr am nächsten Tag nach Lapinta, ging in die Kunsthochschule und fragte dort nach ihrem einstigen Lehrer Professor Roberto Baumann. Sie hätte viel früher daran denken sollen, bei ihm Hilfe zu suchen. Baumann war wie Anna richtig vermutete – er hatte während der Radara-Zeit kein leichtes Leben gehabt, war einige Mal nur knapp an einem Rausschmiss vorbeigeschrammt – noch in Amt und Würden und sie konnte ihn am Nachmittag sprechen. Was er ihr zu sagen hatte, versetzte sie in eine solche Unruhe, ja, Verwirrung, dass sie beinahe ihren Zug abends zurück nach Grincana verpasst hätte. Ohnehin auf den letzten Drücker kommend, steuerte sie im Bahnhof zunächst den falschen Bahnsteig an.
In Lapinta sollte, hatte Baumann gesagt, ein Förderinstitut für junge Kunst gegründet werden. Man wollte aufstrebenden Begabungen optimale Möglichkeiten der Entwicklung bieten, wollte Ateliers und Wohnungen zur Verfügung stellen und für großzügige Förderverträge mit Betrieben oder staatlichen Einrichtungen sorgen. Auch war ausdrücklich eine moderne, experimentierfreudige Kunst erwünscht, geeignet, international Furore zu machen. Roberto Baumann saß zu allem Glück oder Unglück, je nachdem, von welcher Seite man die Sache letztendlich sah, der Kommission vor, die über die Teilnehmer an dem Projekt zu entscheiden hatte. Anna sollte sich, hatte er ihr empfohlen, schnellstmöglich bewerben, eine Mappe mit Zeugnissen, Lebenslauf und Arbeitsproben nach Lapinta schicken; seine Unterstützung, versicherte er, hätte sie in dem Fall.
Anna tat alles Nötige und erfuhr nach sechs Worten per Einschreiben, dass sie angenommen war. Als sie das, bis dahin hatte sie keinen Ton über ihre Pläne verlauten lassen, dem Leiter des Grincanaer Kulturkabinetts wissen ließ, drehte sich der Wind vor Ort schlagartig wieder. Ihr wurde quasi mietfrei eine Werkstatt angeboten sowie mehrere bis dato nicht zur Debatte stehende Verdienstmöglichkeiten in Aussicht gestellt. So sollte sie den Laienkunst-Zirkel im Vorzeigebetrieb der Stadt, einem Unternehmen, das Feuerlöscher fürs ganze Land produzierte, leiten und dafür monatlich in einer Weise entlohnt werden, dass sie von Stund an alle Existenzsorgen los gewesen wäre. Als Anna all das dankend ablehnte und erklärte, sie wolle bei ihrem Entschluss bleiben, nach Lapinta zu gehen, wurde sie in die Stadtverwaltung zu Mäder und Schilling, dem neuen Leiter der Abteilung Kultur, beordert. Sie redeten ihr zunächst im Guten ins Gewissen, drohten dann, als sie kein Einsehen zeigte, in der Lage zu sein, ihr ernsthaft Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Man habe keinesfalls vergessen, wurde Mäder deutlicher, dass sie aus einer Familie komme, die der bürgerlichen Ausbeuterklasse zuzurechnen sei. Er rate ihr, es lieber nicht darauf anzulegen, dass das mal richtig zum Thema gemacht werde. Außerdem sei ihnen und anderen verantwortlichen Genossen nicht verborgen geblieben, dass sie in engem Kontakt zu politisch-ideologisch unzuverlässigen Kräften gestanden habe, vielleicht sogar noch stehe.
„Mein Vater war kein Ausbeuter, sondern ein erfolgreicher Architekt. Davon kann man sich heute noch in unserer Stadt überzeugen“, konterte sie und fragte aufgebracht, was sie denn unter „politisch-ideologisch unzuverlässigen Elementen“ zu verstehen habe. Mäder lief rot an. Anna fürchtete schon, er würde die Fassung verlieren. Doch er war auf einmal wieder die Ruhe selbst und ließ vielsagend lächelnd fallen, sie wisse genau, um wen es da gehe. Gerade deshalb lege er ihr nahe, den Fall noch einmal gründlich zu überdenken. Es wäre schließlich in aller Interesse, wenn eine junge Künstlerin nicht in Turbulenzen gerate, die am Ende niemand mehr kontrollieren könne, sondern sich im Gegenteil ungestört fortentwickle, es weiter mit ihr. Dazu sei es allerdings dringend geboten, dass diejenige welche schleunigst alle Zweifel an ihrer Treue zu Staat und Gesellschaft aus der Welt schaffe, sonst, fügte er nach einer wohlberechneten Pause hinzu, könne er und wohl auch kein anderer in Grincana für nichts garantieren. „Wir haben gelernt, mit Feinden unserer Gesellschaft in geeigneter Weise umzugehen. Wir lassen nicht zu, dass jemand Schaden anrichtet. Ich sage das in aller Deutlichkeit.“ Die Sätze dröhnten ihr noch nach Tagen in den Ohren.
Was blieb ihr anderes übrig, als wieder nach Lapinta zu fahren und dem Professor ihr Leid zu klagen. Viel Hoffnung hatte sie freilich nicht, dass er ihr helfen könnte. Aber an wen hätte sie sich sonst wenden sollen? Sie staunte nicht schlecht, als Baumann nach ihrem verzweifelten Bericht nicht die Hände hob, sondern im Gegenteil sagte: Keine Angst, das kriegen wir hin. Da gebe es ganz andere Sachen, mit denen man sich heutzutage herumzuschlagen habe. Sagte es, lächelte, die Ruhe selbst zur Schau stellend, und wollte wissen, woran Anna gerade arbeite. Da musste sie ihm und sich auch eingestehen, dass sie seit Wochen keinen Handschlag mehr getan hatte.
Nach dem Treffen mit Baumann lösten sich in Grincana in der Tat alle Unannehmlichkeiten in Luft auf. Sie bekam vom Kulturkabinett, was den Umzug und die kurzfristige Ablösung bereits eingegangener Verpflichtungen anging, alle erdenkliche Unterstützung. Und, kaum zu glauben, sowohl Mäder als auch Schilling erkundigten sich bei ihr mehrmals, ob alles seinen Gang gehe oder gegebenenfalls noch etwas zu regeln sei. Von irgendwelchen Repressalien war keine Rede mehr. Das kürzlich stattgefundene, mehr als unangenehme Gespräch schien es nicht gegeben zu haben. Als sie Baumann fragte, wie er diese Wendung der Dinge habe bewerkstelligen können, sagte er kurz angebunden, aber nicht unfreundlich: „Kannst du dir das nicht denken? Mädchen, überleg doch mal. Ist doch nicht so schwer. Es gibt halt auch in der neuen Zeit ein Oben und Unten. Ein Amts- oder Abteilungsleiter in Grincana, selbst ein Mann der Partei, ist von Lapinta aus gesehen, wenn’s drauf ankommt, ein armer Tropf, ein Nichts. Mancher hat das notfalls noch zu lernen.“ Und er sagte dann auch noch: „Glaub mir: Ich mach so was nicht gern, aber wenn’s die Herrschaften in der Provinz nicht anders haben wollen, sind sie selber schuld. Punktum und silentio.“
Bald dachte Anna kaum noch an Grincana, vergaß Walter Döring, die Plackerei mit den Büsten und erst recht die Herren Mäder und Schilling. Die neuen Aufgaben nahmen sie voll und ganz in Anspruch. Und sie hatte, was sie anfangs selbst gar nicht glauben wollte, auf Anhieb Erfolg, erregte mit ihren Arbeiten bei regionalen wie landesweit bedeutsamen Ausstellungen Aufsehen, kam bei Wettbewerben öfter in die engere Wahl und holte auch diesen und jenen Preis. Das alles war wiederum nicht weiter verwunderlich, aber das begriff sie in vollem Umfang erst Jahre später. Ihr war es gegeben, ohne große Überlegung eine Art Quadratur des Kreises zustande zu bekommen. Ihre von weicher Linienführung geprägten, dabei stets etwas Zupackendes, klar Strukturiertes habenden und im Wesentlichen streng gegenständlich bleibenden Arbeiten verströmten einen kräftigen Hauch Moderne, ohne dass andererseits die geringste Gefahr bestand, das Ganze könnte in den Augen der höheren Orts für Kunst und Kultur Verantwortlichen allzusehr aus dem Rahmen fallen. Das brachte in der Tat nicht gleich ein jeder oder eine jede fertig. Anna kam im Gegensatz zu manchem Gefährten, mancher Gefährtin überhaupt gut mit den für Kunstfragen zuständigen Behörden und Gremien zurecht. Was dort gewollt oder verlangt wurde, war letztlich ein Klacks gegen das in Grincana Erlebte. Als nach Jahrzehnten über die Zeit der Parteidiktatur Gericht gehalten wurde, geriet auch Anna Hahn ins Blickfeld. Man bezeichnete sie als brave, dabei penetrant auf ihren Vorteil bedachte Staatskünstlerin und warf ihr wechselweise oder in Kombination Mangel an Talent und Charakter vor. Daraufhin gab es allerdings nicht wenige entschiedene Gegenstimmen, namentlich von ehemaligen Lapintaer Kunststudenten, darunter eine Reihe inzwischen namhafter Künstler, so dass die Vorwürfe bald verstummten.
Doch zurück zu den Anfängen. Nach Ablauf der vereinbarten zwei Förderjahre nahm Anna eine ihr von der Hochschule angetragene Aspirantur an und machte, Baumann war inzwischen Rektor geworden und hatte sie nicht aus den Augen verloren, ihren Weg. Mit siebenundzwanzig war sie Ordentliche Pädagogin im Hochschuldienst, mit dreißig wurde sie zur Professorin für Elementare Figürliche Gestaltung ernannt. Weiter wollte sie, was vermutlich gut möglich gewesen wäre, nicht aufsteigen. Sie fürchtete, dass sie, würde sie zum Fachbereichsleiter oder vielleicht gar Sektionsdirektor berufen, nicht mehr in ausreichendem Maße zu ihrer künstlerischen Arbeit käme. Das wollte sie um keinen Preis, obwohl oder vielleicht auch, weil sie spürte, dass es mit ihrer Kunst zu der Zeit nicht mehr recht vorwärtsging. Sie hatte das Gefühl, sich beständig nur noch zu wiederholen, spürte keine rechte Freude mehr, wenn sie ins Atelier kam, brauchte einen gehörigen Anlauf, um sich einer angefangenen Plastik zu widmen, die längst hätte fertig sein sollen. Etwas Neues zu beginnen, fiel ihr noch ungleich schwerer. Immer öfter passierte es auch, dass sie – bis dahin unfassbar- im Atelier nur ein, zwei Stunden, ohne etwas zu tun, herumsaß. Sie war sich darüber im Klaren, dass etwas geschehen, sich eine Tür oder ein Fenster öffnen musste, sonst könnte es aus und vorbei sein mit einer gewissen Anna Hahn. Dabei wusste sie: Weder die Rückkehr zur Darstellung klassischer Muskelprotze noch die rigorose Abkehr von aller Natur, allem Natürlichen als Vorlage – die zwei Wege schlug man damals hauptsächlich ein – kam für sie in Frage. Was aber war, wenn es kein Drittes gab? Oder sie nicht das Zeug dazu hatte, dahin zu kommen? Eine Weile dachte sie daran, die Bildhauerei ganz sein zu lassen, bis sie einem von Tag zu Tag stärker werdenden Impuls folgend, schließlich aufhörte, krampfhaft auf die große Erleuchtung zu warten. Im Ergebnis, nach Wochen und Monaten heftigen stillen Hin und Hers, von dem weder Kollegen, Studenten noch die Familie etwas ahnten, führte sie das Alte und Gewohnte in anderer, klug modifizierter Form, gestraffter, dabei dennoch hinreichend feingliedrig bleibend, ja, oft geradezu detailverliebt auftrumpfend weiter. Das hatte im Grunde nichts mit wirklich großer Kunst zu tun. Es war, daran gab es für sie nie einen Zweifel, nur wenig mehr als solides, honoriges Handwerk. Das erreichte nun freilich auch nicht ein jeder und dessen brauchte sie sich fürwahr nicht zu schämen. Damit konnte sie, musste sie leben.
Als sie nach langer Zeit Grincana besuchte, die schon erwähnte Schulkameradin hatte sie eingeladen, suchte sie im Park des Friedens und der Völkerfreundschaft ihre einstigen Schmerzenskinder zunächst vergeblich. Schließlich, so schnell gab sie ihr Vorhaben nicht auf, entdeckte sie die Büsten in einem abgelegenen Teil des Terrains, umgeben von einer Schar offenbar seit Jahren ungehindert wuchernder Berberitzensträucher und dazu auch noch reichlich bespritzt mit Vogelkot. Eine schöne Überraschung. Wie konnte es dazu kommen? In Grincana sei nun einmal Hopfen und Malz verloren, es werde nur noch das Allernötigste getan und oft reiche es nicht einmal dafür, meinte die Freundin. Traurig, aber wahr.
An der Situation sollte sich vorderhand nichts ändern. Das entnahm Anna der Korrespondenz, die sie seitdem mit der Kameradin führte, einer am Schicksal der Heimatstadt rege Anteil nehmenden, stets haarklein eine Fülle von Einzelheiten ausbreitenden Grundschullehrerin. Als nicht unbedingt förderlich für die Anlage am Bahnhof erwies sich, dass es in der Heimatstadt noch einen zweiten, größeren Park gab, mit lichten Eichen- und Buchenhainen, alten Lindenalleen, einem sorgsam komponierten Pinetum und einem See in der Mitte, dem der Parkschöpfer, ein namhafter Gartenarchitekt der ausgehenden Fürstenzeit, die buchtenreiche Form eines Ahornblatts verordnet hatte. Das Areal, zu dem auch ein kleines Lustschloss, ein von fernöstlicher Kultur inspirierter lauschiger Pavillon und eine eigene Blumenkultur gehörten, war weithin ein Begriff. Nach dem Krieg hatte die Anlage, die bis dahin den Namen eines vormals in Grincana regierenden Reichsgrafen trug, den Namen des sarkundischen Revolutionsführers Nikolai R. Lawrow erhalten. Am Eingang war ein Porträt-Relief des Umstürzlers angebracht und nicht weit davon auch noch eine überlebensgroße Bronzeplastik aufgestellt worden. Sie zeigte einen sarkundischen Soldaten, der mit bloßen Händen eine übermächtige Felsplatte sprengt. Vor dem Monument fand jedes Jahr im Mai am Tag des Kriegsendes ein Appell statt, an dem Schulklassen und Abordnungen aus Betrieben und Massenorganisationen teilnahmen. Wiewohl dem Lawrow-Park somit eine große Aufmerksamkeit und Bevorzugung zuteil wurde, war er andererseits aus denkmalschützerischen Gründen, er galt als überregional bedeutsames Gartenkunstwerk, nicht für unterhaltsame Freiluftveranstaltungen geeignet. Dergleichen Dinge, Volksfeste, Märkte, Ausscheide, bei denen Fanfarenzüge, Blasorchester, Rockbands, Tanzensembles oder Chöre ihre Kräfte maßen, mutete man bedenkenlos dem kleineren Bruder am Bahnhof zu, wo eine Freilichtbühne errichtet und ein Teil der Fläche betoniert wurde, damit bei Bedarf problemlos Bankreihen gestellt werden konnten. Die Büsten der Dichter rückten im Zuge dieser Entwicklung immer weiter an den Rand, gerieten am Ende nahezu völlig in Vergessenheit.
Die an der Stelle vorgesehenen literarisch-musikalischen Pogramme hatten zunächst in einem bescheidenen Rahmen stattgefunden. Später sah man von dergleichen Veranstaltungen ab. Es gab in der Stadt Orte, die für den Zweck besser taugten, mehr mit Gegenwart und Zukunft verbunden zu sein schienen als der beschauliche kleine Park mit den Denkmalen. Als ein junger, von Tatendrang erfüllter Literaturlehrer anderer Meinung war, sich dafür stark machte, dass Schüler zu den Dichter-Geburtstagen Blumen vor die Standbilder legten und zum Gedenken einige passende Verse rezitierten, untersagte ihm das sein Direktor unter Hinweis auf eine Weisung der Unteren Schulbehörde. Das Begehen von Gedenktagen im öffentlichen Raum, hieß es darin, sei zentral geregelt. Spontane Aktionen außer der Reihe seien rechtzeitig anzumelden und bedürfen unbedingt einer gesonderten Antragstellung und Genehmigung. Im vorliegenden Fall werde dafür nach eingehender Beratung und in Abstimmung mit den zuständigen übergeordneten Partei- und Staatsorganen keine dringliche Notwendigkeit gesehen.
So verging Jahr um Jahr. In Grincana machte sich, diesen Eindruck musste Anna gewinnen, kaum jemand mehr Gedanken über den kleinen und den großen Park. Die unterschiedlichen Rollen und Bedeutungen schienen auf Ewigkeit zugewiesen. Dann kam jener stürmische Herbst, in dessen Folge alles anders wurde. Die allmächtige Geeinte Sozialistische Arbeiter- und Bauernpartei verlor über Nacht ihre bis dahin unangefochtene Vormachtstellung. Eine Reihe anderer Parteien gründeten sich und konkurrierten von nun an – oft ohne die geringste Rücksicht auf die Interessen des Gemeinwesens – um die Sitze im Stadtrat. Und natürlich war es so, dass der bis dahin allgegenwärtige sarkundische Einfluss mit jedem Tag mehr der Vergangenheit angehörte. Es gab wieder jede Menge privater Unternehmen, die einander zum Teil erbittert Konkurrenz machten. Und auch eine Menge anderer Dinge, Gepflogenheiten, Feste, Jubiläen, Denkarten, Ansichten, die in den vergangenen Jahrzehnten kaum noch Beachtung fanden oder als unstatthaft galten, waren auf einmal in alter Herrlichkeit wieder da. Kaum jemand hätte für möglich gehalten, wie schnell die verflossenen vierzig Jahre, als das Gemeinschaftliche im Vordergrund stand, alle das Gleiche haben und möglichst auch denken sollten, in Vergessenheit gerieten.
Im Sog dieser Veränderungen, die die meisten Menschen in Grincana zunächst als Riesenfortschritt empfanden, bekamen Park und Palais den Namen des Grafen Eckhard von Nabellen zurück, der beides hatte anlegen lassen. Das Relief am Eingang, das den Revolutionär Lawrow zeigte, wurde entfernt und mit den Appellen am Tag des Kriegsendes war es gleichfalls vorbei. Der bronzene Soldat, an dem man zunächst nicht zu rühren wagte, wurde einige Jahre später auf Beschluss des Stadtrats in einen verborgenen Winkel des alten Friedhofs verbannt. Dahin waren zuvor bereits die sterblichen Überreste sarkundischer Soldaten überführt worden, die bis dahin in einem Ehrenhain unweit des Theaters ruhten.
Über Walter Döring, auch das gehört in diese denkwürdige Periode, war zu lesen, dass man ihm seinerzeit übel mitspielte. Auf Grund falscher Beschuldigungen, wonach er einer oppositionellen Gruppierung innerhalb der Partei nahe gestanden haben soll, war er zunächst auf einen untergeordneten Posten weit weg von Grincana versetzt, dann sogar ans Fließband in einer Herdfabrik verfrachtet worden. Dort war seine Lungenkrankheit, die er sich unter der Radara-Herrschaft zugezogen hatte, schlimmer geworden und er starb wenige Monate später. Nach ihm jetzt eine Straße in Grincana zu benennen, war eine Weile in der Diskussion. Doch letztlich vermochte sich der Stadtrat nicht dazu durchzuringen. Die zu erwartenden Kosten wie mögliche Widerstände in der Bevölkerung gegen einen solchen Schritt wurden dafür geltend gemacht. Anna hatte da ihre Zweifel. Sie wusste von ähnlichen Fällen anderorts. Einen Genossen der früheren Staatspartei zu ehren, selbst wenn er wie Döring ein tragisches Opfer der Verhältnisse geworden war, fiel zu Zeiten schwer, wurde entweder auf die lange Bank geschoben oder fand in den zuständigen Gremien nicht die nötige Mehrheit. Anna schien das schlussendlich eine Form der Abrechnung mit der alten Ordnung zu sein, eine alles in allem wenig ehrenhafte Ersatzhandlung, nachdem klar war, dass letztlich kaum etwas Überzeugendes in dieser Richtung zu machen war. Es waren zu viele einstige Amtswalter und Nutznießer, denen man hätte zu nahe treten müssen. Und die, selbst die größten Schufte und Kanaillen unter ihnen, hatten im Falle des Falles angesichts der nun geltenden nachsichtigen liberalen Rechtsprechung beste Aussichten, ungeschoren davonzukommen. Es sah ganz danach aus, als ob am Ende die unerbittlichen Aufarbeiter, die Verfechter einer angemessenen Bestrafung und Sühne die Dummen waren. Was im Fall Walter Döring den Ausschlag gab, vermochte Anna nicht sagen.
Woran kein Zweifel bestand: Die Grincaner hatten in diesen Tagen auch noch andere Sorgen. Binnen kurzem waren fast alle größeren Fabriken, meist Zweigbetriebe der einst das Land prägenden überdimensionierten Kombinate, dichtgemacht geworden und auch der Stolz der Stadt, die Fachschule für Maschinen- und Anlagenbau, hatte ihre Tore geschlossen. In dieser Situation setzten die Grincaner im Kampf um landesweite Aufmerksamkeit und Zuwendung große Hoffnungen in ihren fürstlichen Landschaftsgarten mit dem See in der Mitte. Die staatlichen Stellen entfalteten in der Folge eine fieberhafte Betriebsamkeit. Die Gehölze wurden fachmännisch beschnitten sowie nötige Nachpflanzungen veranlasst, die Wege mit blendend weißem Kies bestreut, das Palais neu verputzt und gestrichen, die das Gebäude umschließenden Blumenrabatten wenigstens ums Doppelte erweitert. An besonders sonnigen Stellen wurden Pflanzkübel mit Palmen aufgestellt, man stampfte einen nahegelegenen Parkplatz für Busse aus dem Boden, ließ formidable Broschüren und Prospekte drucken, mühte sich, allen tiefeingewurzelten Grincanaer Eigenstolz und Dünkel beiseite schiebend, geradezu devot um die Gunst von Touristikagenturen.
Die Parkanlage am Bahnhof, die nun wieder wie gehabt „Zur Bürgererholung“ hieß, kam indessen immer mehr herunter. Mit den üppigen Volkskunst-Estraden war es vorbei, die Bühne verfiel und wurde schließlich abgerissen. In jüngster Zeit haben die Schützenvereine, die es wieder in der Stadt gibt, den vor sich hin dämmernden Ort entdeckt. Sie stellen ab und an dort ein großes Zelt auf und lassen ihre Trefferkönige hochleben. Wer hat sich das vorstellen können, dachte Anna, dass sie einmal in die Verlegenheit kommen würde, jenen bunt kostümierten, mit seltsam verbissenen Gesichtern aufmarschierenden Frauen und Männern wohl zu wollen. Aber ohne ihre Feste wäre die „Bürgererholung“ vermutlich vollends in Vergessenheit geraten.
In den Sommermonaten, wenn die Parlamente nicht tagen, die Verwaltungen bis auf spärliche Notbesetzungen an fernen Gestaden für die nächste Session Kraft schöpfen und auch die meisten Grincanaer Kulturstätten und Sportvereine eine verdiente Ruhepause einlegen, passiert es immer mal wieder, dass sich ein von der Nachrichtenarmut geplagter Redakteur den Fotoapparat umhängt, in der Hoffnung, die Dichterbüsten im Bürgergarten bieten wie gehabt einen wenig komfortablen Anblick.
Wo ist denn die Sonne hin? Der Teppich mit dem üppigen Flammenmuster, eben noch ein greller Blickfang, ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Der Tag ist, wie’s aussieht, wieder mal unter Träumen und Erinnern dahin gegangen.
Nun soll also die Chemie alles retten. Die achtzigjährige Anna Hahn, die noch die gleiche kräftige, um nicht zu sagen leicht füllige Gestalt hat wie ehedem, auch noch nicht so schrecklich gealtert zu sein scheint wie mancher andere ihres Jahrgangs, das einst schwarze Haar ist mittlerweile freilich tüchtig grau geworden, glättet den Zeitungsausschnitt noch einmal vorsichtig und legt ihn auf den Packen in einem besonderen Fach ihres Schreibtischs.