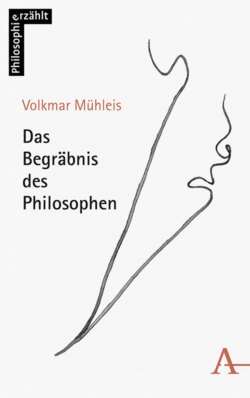Читать книгу Das Begräbnis des Philosophen - Volkmar Mühleis - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.
ОглавлениеErst seit wenigen Tagen standen die Möbel im neuen Haus, als am Telefon sich ein alter Mann nur mit seinem Vornamen vorstellte, als wären wir lange schon Freunde. Überrascht ließ ich mich auf einen freundlichen Plausch ein. Hatte er sich in der Nummer geirrt, auf seinem Telefon die falsche Taste der eingespeicherten Verbindungen gedrückt? Er schien nicht verwirrt, ganz im Gegenteil, hellwach und mitteilsam war er und ließ sich ebenfalls auf den Plausch ein. Nach einer Weile des redseligen Beschnupperns fragte er plötzlich, wie um das Spiel zu beenden, ob ich denn nicht wissen wolle, warum er überhaupt anrufe. Er war keiner der geistig verträumten Alten, denen man als Jüngerer mit Nachsicht und viel Geduld begegnen mag, lass sie mal reden, was auch immer an Geschichten, Verwirrungen, Anekdoten sich vor einem auftat, eine versunkene Welt. Nein, mein Gesprächspartner bat mich, die Partie zu eröffnen, jetzt bist du am Zug, also gut, worum geht’s? Mein neuer Freund erzählte mir, dass er seit längerer Zeit fast erblindet sei und weder schreiben noch lesen könne. Er hätte zwar jemanden, der ihm hilft, dem er seine Überlegungen diktieren könne. Doch der Assistent beherrschte das Deutsche nicht fehlerfrei, und auch wenn er fast sein ganzes Berufsleben auf Niederländisch gearbeitet habe, philosophieren mochte er nur in seiner Muttersprache. Ob ich die Notizen seines Mitarbeiters nicht verbessern könnte, er wollte die Texte der ein oder anderen Zeitschrift anbieten. »Sehr gern«, sagte ich. Wir verabredeten die weiteren Schritte, dass ich die beiden kurzen Manuskripte über Mail erhalten sollte, sie durchgehe, mich telefonisch bei ihm melde, und wir ein Treffen vereinbaren würden, um die nötigen Verbesserungen zu besprechen. Er schien hörbar erleichtert; seine Stimme beruhigte sich.
Ich blieb noch einen Augenblick im Sessel sitzen. Acht, neun Jahre wird es her gewesen sein, seit wir uns das letzte Mal sahen. Und auch davor waren wir uns nur einmal begegnet. Ein Student unserer Hochschule hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass an der Universität jemand wie Sie – sprich ein Deutscher, der in seinem besten Bemühen ums Niederländische Philosophie unterrichtete – Vorlesungen halte. Einen Kollegen mochte ich ihn nicht nennen, denn ein Blick in meinen Bücherschrank verriet mir, dass ich ihn bereits über 518 Seiten lang kennengelernt hatte, in seinen Worten einer Übersetzung aus dem Französischen, mit eigenen Bemerkungen vorab, geschrieben im Mai 1965 in Leuven. Der Mai steht als Blüte dem Tod entgegen, verbindet sich mit ihm, wenn er im letzten Satz dem Autor dankt, der kurz vor seinem Tode noch die Arbeit an dieser Übersetzung auf den Weg hat bringen können. Ein plötzlicher Tod damals, im Mai 1961. Der französische Philosoph war einer der ersten gewesen, die das Archiv in Leuven besucht hatten, um die vor den Nazis geretteten Manuskripte von Edmund Husserl, dem Begründer einer der einflussreichsten philosophischen Richtungen des 20. Jahrhunderts, einzusehen – Phänomenologie war denn auch das Stichwort seines Buches, das im Original bereits 1945 erschienen war und zwanzig Jahre später dann auf Deutsch. Mein vermeintlicher Kollege war längst selbst Teil dieser Geschichte geworden, jemand, der im Archiv die Manuskripte Husserls entziffert hatte, zu druckreifen Texten geformt, hauptverantwortlich oder mit anderen herausgegeben. Mein neuer Dutzfreund stand längst in meinem Bücherschrank und grüßte mich jetzt auch übers Telefon.
Wir saßen im Kreis. Ein Semester lang hatten wir über das Buch des Philosophen gesprochen, sein letztes. Nun war er da. Entspannt lehnte er in seinem Stuhl, kleiner als die meisten Studierenden, die in ihrer körperlichen Frische und offenkundigen Unsicherheit warteten, wer denn nun den Anfang machen würde, eine Frage zu stellen wagte. Die intime Runde erleichterte und erschwerte das Gespräch zugleich. Es sollte kein bühnenreifer Auftritt sein, bei dem der Gast souverän interviewt wird. Doch die Nähe der Person vermischte sich mit dem Abstand, den sein Buch geschaffen, vergrößert oder vermindert hatte, nach dem jeweiligen Eindruck seiner Leserinnen und Leser hier; junge Künstlerinnen und Künstler, die seit Herbstbeginn am Freitagmorgen die Woche mit der Lektüre dieses Buches ausklingen ließen, rückblickend, erwartungsvoll, auf sich selbst zurückgeworfen. Ein Student hatte stets seinen Tee aufgesetzt, so kunstvoll wie er es im Atelier tat, und wie es später Teil seiner szenischen Improvisationen werden sollte. Wie alle anderen blickte er gespannt in die Runde und sagte kein Wort. Ich würde wohl das Eis brechen müssen, auch wenn es in der entspannten Haltung des alten Mannes längst geschmolzen war und sein Lächeln verriet, wie sehr er es genoss, noch einmal in kleiner Zahl über sein Buch sprechen zu können, ein Buch, das überhaupt nur ein aufmerksames Publikum kennt, Kollegen, philosophisch Interessierte, Studierende wie an diesem Tag, wer sonst hätte es nicht weggelegt. Dabei war die Lektüre nicht nur aufgrund der Gedankengänge oder der Schreibweise den meisten in meiner Gruppe schwergefallen; auch die Welt der Kunst, um die es ging, hatte sich längst gewandelt. 1927 war unser Gast geboren worden, am Heiligmorgen, in Berlin. Ein inzwischen Achtzigjähriger, der über die Kunst im Allgemeinen zu denken versucht hatte, weit über die Entwicklungen der letzten fünfzig Jahre hinaus, so dass ihre Eigenheiten kaum noch erwähnt wurden, die ganze popkulturelle Lebenswelt meiner Studierenden. Nicht nur jetzt, im Gespräch, musste ich das Eis brechen, zumindest auf ihrer Seite – schon von den ersten Seiten unserer Lektüre an. Der Philosoph aber kam von weit her. Und der Augenblick war ihm zu kostbar, um ihn mit Eitelkeiten zu vertun. Er war schon lange emeritiert, aus dem Tagesgeschäft allen akademischen Betriebs, und hatte ebenso Zeit für sein Denken und Schreiben wie gleichermaßen weniger Kontakt. In den flämischen Medien tauchte er ab und an auf, in Deutschland schien er selbst bei Fachkollegen nahezu vergessen – wie, er ist noch aktiv, ich habe zuletzt in den siebziger Jahren von ihm gelesen. Wie das öffentliche Interesse sich wendet, es einen trifft, auf dem eigenen Weg, und wieder verlässt; auch das hatte der Philosoph hinter sich. Und so lauschte er meiner kurzen Einleitung, bevor er selbst die Studierenden mit einer Frage überraschte.
»Was denkt Ihr, müssen wir wissen?«
Die Anspannung in den Gesichtern wich dem Nachdenken, nicht angeschaut werden wollen, Verblüfftsein, Stirnrunzeln – was hätten wir wissen müssen, in jenem Dezember 2009? Die Frage war so allgemein gestellt, dass der Zeitpunkt wohl kaum von Belang war (belangrijk, wie es auf Niederländisch heißt). Was sollte man überhaupt wissen? Und ging es denn um ein Wissen, wenn die Philosophie schon mit der Infragestellung jeglicher Kenntnis ansetzte, wenn Philosophen meinten, die Orientierung beginne damit, sich nicht auszukennen, die Fliege im Glas zu beobachten, wie sie wohl den Ausweg findet (oder nicht), man selbst allegorisch in eine Höhle versetzt wurde, aus der man zum Quell allen Lichts aufsteigen müsse, den Bedingungen unseres und allen Daseins? Der Philosoph schaute amüsiert, freundlich, abwartend in die Runde. Er selbst hatte seine Antwort bereits gegeben, auf den ersten Seiten des Buches, das wir alle in Händen hielten – ein jedes Exemplar mit anderen Anmerkungen, Notizen, Unterstreichungen und Zeichnungen versehen (Portraits aus der Gruppe, dem Blick aus dem Fenster?). Seine Frage war aber nicht rhetorisch gestellt, als wolle er uns nur prüfen, ob wir sein Buch denn auch gründlich gelesen hätten. Sie war ehrlich gemeint, das verriet seine Geduld, auf unsere Antwort zu warten. In den Gesichtern zeichnete sich das Denken ab, und wenn es nur die Suche danach war, zu denken auf dass man dachte, was immer sich damit zeigte, auftat, und war es die eigene Leere, Unbeholfenheit. Im Hintergrund hörte man die Arbeiten im Atelier, Glas wurde geblasen, Skulpturen aus Ton geformt. Wir waren in einer Werkstatt, im offenen Zwischengeschoss, dem Mezzanin, wie man die Plattform aus Beton liebevoll nannte, als böte sie Aussicht auf eine italienische Piazza. Sie bot zumindest Ausblick auf Kunst im Entstehen, halbfertige Entwürfe und Modelle, Regale voller Materialien und Instrumente, Staub und Belag wie er von jahrelangem, alltäglichem Gebrauch zeugte. Unten schien man sich nicht für unsere Diskussion zu interessieren, die Produktion ging weiter, Gebranntes musste abkühlen, Gestaltetes trocknen, das Wissen war dort sehr konkret und jedes Müssen davon bestimmt. Wie oft hatte sich der Glasbläser bei den Studierenden beschwert, er brauche genaue Zeichnungen, wenn er ihre Vorhaben umsetzen solle! Experimente mochten bei glücklichen Zufällen enden, sie allein dem Zufall zu überlassen, dafür war der Aufwand zu teuer, die Stoffe, Zutaten, die Zeit, die man anderen stahl, wenn man sich nicht an den vereinbarten Plan für alle hielt. Die Kunst entstand hier mit dem Handwerk, in all seiner gedanklichen Durchdringung, Befreiung, es blieb stets ein Arbeiten damit, ein Abarbeiten daran. Ich kannte die Leiterin des Ateliers gut, und wir durften hier zu Gast sein. Ich wollte es dem alten Herrn nicht zumuten, über steile Treppen bis unters Dach steigen zu müssen, wo unser Seminarraum lag, einen Fahrstuhl gab es in dem Trakt des alten, verwinkelten Gebäudes nicht, die letzte Treppe war noch aus Holz, der Duft gestauter, warmer Luft drang einem mit jedem Schritt unters Dach entgegen, erst einmal lüften, so lief ich zu den schrägen Dachluken und öffnete sie mit einem Holzstab. Für unser Leseseminar war der Raum ein verstaubtes Paradies gewesen. Man konnte alle Tische und Stühle frei bewegen, einen Kreis bilden, schien abgeschieden von der Welt, keinerlei Geräusche hörte man, die Welt der Ateliers lag weit entfernt, zwei Treppenhäuser weit, hierhin verirrte sich niemand, der nicht genau wusste, wann und warum er in Raum 22 sein musste. Das Müssen schien immer konkret zu sein, das Wissen zugleich auch praktisch.
»Müssen wir müssen?«, wagte sich eine Studentin aufs Eis – so leicht bricht es nicht.
»Das liegt wohl kaum in unserer Hand.« Es war nicht nur die Lebenswelt, die sie beide trennte, es war vielmehr die Lebenserfahrung. Und so sehr die Phänomenologen auch von Erfahrung und Lebenswelt sprachen, die Frage der Lebenserfahrung war mir in ihren Schriften nicht begegnet. Wie aus den Nachwirkungen, Ablagerungen, Schatten und Spuren der Jahre und Jahrzehnte sich ein Leben verdichtet, auf die schwindende Kraft im Alter, mit ihr das noch Mögliche, Wesentliche in den Blick zu nehmen –. Die Studentin sprühte vor Leben und Spekulation, sie sah eine Zukunft als Künstlerin vor sich, brannte darauf sich zu beweisen, und dieser Elan hatte so manchen Freitagmorgen andere mitgerissen, die Diskussion angefacht. Der Philosoph wollte einer Diskussion nicht ausweichen, aber er suchte eher das Gespräch, nicht nur den Austausch von Argumenten, sondern auch von Erfahrungen. Die meisten der Studierenden waren so voller Leben, jedoch ihrer eigenen, bewusst vorangestellten; es kam ihnen kaum der Gedanke, wie sehr sie bereits von anderen durchdrungen waren, und wie es sich immer offener zeigen würde, im Miteinander, über die Jahre. Ich musste an ein Gespräch mit unserem Direktor denken, der mir einmal begeistert von der Lesung eines deutschen Schriftstellers in Brüssel erzählt hatte. Ich kannte den Schriftsteller, von seinen ersten öffentlichen Auftritten im Rheinland, die ich damals so schlecht fand, dass ich kein Buch mehr von ihm lesen mochte. Der Direktor sah mich nur gnädig an und meinte: »Die Arroganz der Jugend hat auch etwas Schönes.«
»Als Künstler suche ich nicht nach Wissen«, setzte ein Student an. Hörte er denn nicht den Lärm aus der Werkstatt, dem Atelier, von den Handgriffen, Schneidegeräten, das Klopfen und Hämmern? Er studierte nicht Bildhauerei, Keramik, Glaskunst, in seinem Atelier war es oft still, zeichneten die Studierenden Bilder und Bildergeschichten, überwand man die Schwerkraft, indem der Blick ins Papier tauchte und Gestalten im Zeichnen und Malen entstehen ließ. Bedeutungen entstehen zu lassen ist grundanders als sie wissbegierig zu suchen, auszustellen, zu besprechen. Gleich zu Beginn seines Buchs hatte der Philosoph sich von Immanuel Kant abgewendet; die Studierenden dagegen sahen ihn durch eine romantische Brille, verklärte Ästhetik. Sie würden nie auf die Art wissen wollen, wie der Philosoph danach gesucht, verlangt hatte, sich selbst und anderen gegenüber. Ihre Bilder, Darstellungen, Arbeiten schufen Räume, damit im Leben zu stehen. Das Wissen schien für sie immer Mittel zum Zweck. Und so tat sich ein eigenartiges Missverständnis auf: Auch dem Philosophen war das Wissen als Selbstzweck ein Gräuel. Nur sprachen die Studierenden und er aus ganz unterschiedlichen Beweggründen. Ihnen wäre es nie in den Sinn gekommen, das Wissen anders zu denken als vor allem naturwissenschaftlich verbrieft, empirisch geprüft, mathematisch bewiesen. Alle anderen Formen von ›Wissen‹ schienen nur schwache Abwandlungen davon zu sein, von ›Erfahrungswissen‹ gar nicht zu reden. Deshalb hatten sie doch die Kunst gewählt, um frei und intuitiv ihre Talente und Phantasie ausleben zu können. Es schienen Klischees und zu grobe Vereinfachungen, die Vereinseitigungen in der Gesellschaft hatten jedoch zu genau solchen geführt, der Nachdruck auf die Wirtschaft, das immer nur Machbare, nie zu Träumende, nie Auszubrechende. Wie sollten sie es besser wissen, und warum auch? So viele Fachleute hatten das Besserwissen in den Medien übernommen, in Regierungen selbst, die weltweite Finanzkrise zu bewältigen.
Auf seine Frage mit nur einem Satz zu antworten schien banal und traf zugleich den Punkt – wie zerbrechlich das Leben ist, nicht nur das eigene, vielmehr seine Welt im Ganzen. So zumindest hatte er es selbst in der Einleitung zu seinem Buch geschrieben, etwas ausführlicher zwar, doch sinngemäß in zwei Worten. Die Welt des Lebens ist beschränkt, eine Ausnahme im All, und auf der Erde noch bedroht, durch den Menschen wie durch die Unwirtlichkeit der Natur. Hier setzte seine Kunsttheorie ein, nicht als Ästhetik, den Blick auf den Einzelnen und seiner Erhebung als Blickfang aller weiteren Betrachtung; es war diese Zerbrechlichkeit des Subjekts, die zum Handeln zwang, zur Umbildung der Natur, wie er es nannte, und zur Einbildung einer lebensfreundlichen Welt, einer Lebenswelt. Das Handeln und Tun waren hier nicht getrennt, als wäre nicht auch das Bilden ein stets mit anderen geteiltes Unternehmen. Seine Kunsttheorie steckte voller Begriffe, die meinen Studierenden kaum mehr über die Lippen kamen – von Schönheit war da die Rede, vom Handwerk, ganz zu schweigen von der Vorliebe des Philosophen für Lehnworte aus dem Griechischen, das er wie das Lateinische, Französische, Niederländische, Englische flüssig beherrschte, anklingen ließ. Poietik stand auf dem Umschlag geschrieben, manche hatten ihr Exemplar des Buches in Händen. Mich beschäftigte vor allem seine Vorliebe für das Wort umbilden. Umbilden schien eine Umkehr bereit zu halten, die der Bildung auf ihrem stetigen Voranschreiten fremd war. Das Umbilden in seinem Sinn war jedoch eher ein Verwandeln, Verdrängen oder Verbergen. Man konnte die Natur handwerklich verwandeln, wie er schrieb, und ich dachte daran, wie ich ihn unbedingt fragen wollte, ob er eine besondere Liebe zum Handwerk habe, denn nicht nur beschrieb er das Verwandeln in Anlehnung an die Natur selbst, den Wandel der Jahre und Zeiten, evolutionär wie historisch, er wählte auch als Wort dafür einen Begriff, der an die Verwandlungen seit Ovids Metamorphosen denken ließ, denn gegen Ende seines Buches verweist er wiederum auf ein Gemälde, Pieter Bruegel dem Älteren zugeschrieben – Der Sturz des Ikarus (ein Bild nach den Metamorphosen des Ovid) –, in dem ein Bauer groß und voran gezeigt den Acker pflügt, in bedachtsam geschwungenen Linien, sie verwandelnd, formend, gestaltend. Das Handeln mit der Natur verkehrt sich zudem in eines gegen sie, im Verdrängen ihrer wuchernden Welt, in Abgrenzung, Unterbindung sich bildender, organischer Verläufe, im Errichten widerständiger Schutzbauten – Architektur (wie die hell schimmernde Stadt im Hintergrund des Gemäldes). Manchen Kollegen in der Hochschule für Architektur war dieser Gedanke peinlich bewusst, und es gab nicht wenige Ateliers, in denen die Nachhaltigkeit des Bauens untersucht wurde, von der Planung bis zur Wiederverwertung sämtlicher verwendeter Materialien. Es blieb dabei, noch gehörte die Baukunst zu den größten Umweltverschmutzern weltweit. Zerbrechlich wie der Mensch war, brauchte er eine Behausung (oder rechtfertigten sich die Behauser, die Sesshaften, hier nur selbst, über den Schatten der Vorgeschichte und Traditionen der Nomaden hinweg?), und zerbrechlich war die Natur, auf weiteste Fernen allein im All, Element unter Elementen, im Dunstkreis dünner Luftschichten, der Atmosphäre, im Abstand zur Sonne sich erholend, austreibend, verdorrend. Der Philosoph sprach nicht gern von Systemen, ihm waren Begründungszusammenhänge lieber, wie man sie inwendig aus Beziehungen, Verbindungen schließen konnte, ohne dabei aufs Große und Ganze zu gehen – sei es das Versprechen auf die Einsicht in ursprüngliche Ursachen (die Metaphysik), Gottes Wirken und Walten (die Theologie) oder gar die Systemtheorie, nach Bielefelder Art. Die Einbildung einer Lebenswelt – sie war tatsächlich eine; dank der Umbildung der Natur, in ihr sesshaft geworden zu sein, überleben und leben zu können, Kultur ausgebildet zu haben, sich bilden zu können mit der Einbildungskraft, die dem Menschen gegeben ist und nur begrenzt in seiner Hand liegt, Kraft der Entwicklung von Evolution und Geschichte.
Schon länger schien eine Studentin mit ihrer Frage gewartet zu haben, schaute sie unruhig in die Runde, suchte den passenden Moment, als wolle sie den Gesprächsfaden kreuzen, mit einem Stich ins Gewebe.
»Warum glauben Sie, abstrakte Kunst sei Dekoration?«
Der Philosoph hielt kurz inne und schaute sie freundlich an. Dann erzählte er von den Kunstwerken in seinem Haus, zumeist Gemälde. Er liebte die Malerei wie die Musik und Literatur. Film, Photographie, die Medien der Moderne und Digitalität schienen ihn kaum zu beschäftigen. Die Studierenden hatten anderes in seinem Buch gefunden, als was sie im Alltag suchten. Ein Student sprach von der unglaublichen Dichte der Sätze, Überlegungen, die Klarheit dabei. Ob ihn die Gedankengänge überzeugten, ließ er offen. Darum ging es ihm nicht. Er las in dem Buch wie in einer Kugel, die man dreht und wendet, in deren Spiegelungen man sich und die Welt um einen erkundet, ein abstrahlender Globus, der sein Geheimnis nicht preisgibt.
»Viele meiner Gemälde zuhause sind abstrakt. Sie zeigen nichts als sich selbst. Und sie verbergen, was immer hinter ihnen liegen mag – die Tapete, die Wand, die Straße draußen, Natur. Wie Dekoration. Bilder zeigen etwas. Dekorationen verbergen, auf schönste Weise! Durch Farbe, Form, befreit von jedem Inhalt. Sie bewegen sich auf dem schmalen Grad zwischen bloß dekorativer Übermalung sonst schmutziger Stellen und Form- und Farbspielen, die unsere Einbildung anregen, kurz gesagt: zwischen Kitsch und Kunst, zwischen Dekorationen die zu etwas dienen und solchen, die nur sich selbst genügen. Ich zähle sie deshalb zu den Künsten der Umbildung von Natur.«
Für einen Augenblick war sie sprachlos, auch wenn sie die Antwort nach unseren Diskussionen bereits hätte vorhersehen können. Aber sie hatte es wohl von ihm selbst hören wollen, dem alten Mann, leicht in den Stuhl gesunken, ein lebendiges Fossil vergangener Zeiten oder jemand, der ganz anders und viel weiter sah? Ihn kümmerte nicht, wie Kunsthistoriker abstrakte Kunst darstellten, welche Manifeste und Zeugnisse die Künstler und Künstlerinnen selbst vorgebracht hatten. Er folgte seinen Gedanken. Und er hatte anderes vor Augen. Nicht die Geschichte der Kunst oder die Selbstzuschreibungen ihrer Hauptfiguren – die Zerbrechlichkeit von Natur und Mensch. Wie gehen wir mit der Natur um? Wir beackern sie, verdrängen sie und verbergen noch die Spuren davon, im schönen Schein. Handwerk, Baukunst und Dekoration bildeten um, und alle ihre Mittel und Geräte dazu stellten nichts anderes dar als sich selbst. Ein Pflug ist ein Pflug ist ein Pflug. Abstrakte Kunstfertigkeit, wenn man so will, nützlich. Abstrakte Kunst unterschied sich nur darin, vom Nutzen befreit zu sein, den Künsten der Einbildung verwandt. Die ganze Schwierigkeit bestand darin, ob man selbst seinen Gedanken folgen wollte; und er musste diese Schwierigkeit selbst in den Gesichtern der jungen Künstlerinnen und Künstler gesehen haben. Entschied sich denn wirklich der Blick auf bestimmte, abstrakte Bilder zwischen zwei Seiten, verbergen und zeigen? Während Kunstkritiker die Abstraktion einst als die reinste Beschränkung auf eigene Mittel der Malerei gefeiert hatten, galt sie dem Philosophen als nur eine Seite der Medaille bildender Kunst, vom Nutzen der Dekoration zwar befreit, doch ohne die Kraft des für ihn immer figürlichen Zeigens.
»Wie denkt Ihr denn selbst über das Verhältnis von Verbergen und Zeigen?«
»Bei Ausstellungen ist es immer die Frage, was aus dem Atelier sollte man zeigen, was besser nicht.«
»Aber heißt Nicht-zeigen denn schon Verbergen?«
»Wer seine Scham nicht zeigen will und doch errötet, kann sie nicht verbergen.«
»Ich denke, das Verbergen macht anderes vergessen, indem es einen auf sich selbst zurückführt. Es weist nicht über sich hinaus. Und das will, wie alles, gestaltet sein. Ich sehe zwar die Tapete in meinem Haus, aber ihre dekorative Gestaltung macht sie als Bedeckung der Wand vergessen. Wenn ich will, kann ich mich daran erinnern. Im Alltag aber reicht die Form, um nicht daran zu denken. Abstrakte Kunst ist keine Tapete. Doch sie bewirkt das Vergessen alles anderen, ohne auf anderes zu verweisen. Es sei denn, eine Form verweist deutlich auf eine andere, wie ein Zitat. Fällt Ihnen dazu vielleicht ein Beispiel ein?«
»Nur innerhalb eines Stils. Bei Mondriaan etwa.«
»Das Kreuz, bei Malewitsch.«
»Das Kreuz?«
Ich musste selbst kurz überlegen, worauf der Student im Werk des russischen Malers hinwies. Ein Kreuz? Er meinte doch nicht das Schwarze Quadrat oder Bilder von anderen Avantgardisten, El Lissitzky, Moholy-Nagy? Wir ließen es dabei. Der Philosoph nahm einen Schluck Wasser und wandte sich an seine Frau. Es hatte geschneit, die Straße war vereist, sie waren gemeinsam mit dem Taxi gekommen. Sie sagte kein Wort, schaute wohlwollend in die Runde, unscheinbar fast, wäre sie nicht größer gewesen als ihr Mann, der in den Stuhl gesunken umso kleiner wirkte, aber mit durchdringender Stimme, klarem Ton sprach, den Raum sogleich füllte, den Halbraum hier oben auf der Empore des Ateliers. Der Philosoph hörte genau zu, schien die Fragen und Bemerkungen bedachtsam abzuwägen, bevor er so deutlich wie möglich antwortete; es war ihm anzusehen, wie er jedes spontane Drauflosreden vermied, jede Impulsivität, nie überrascht schien, auch wenn er es im Inneren vielleicht war. Ein sehr bestimmtes Auftreten, in aller Bescheidenheit, Blitzgescheitheit, nach Erfahrungen auch von Blitzgescheitertheit, in der Jugend vielleicht, im jungen Erwachsensein, wer weiß. Ein auch altbekannt männliches Auftreten. Wie mochten die Studierenden ihn und seine Frau erfahren haben? Werden die Studentinnen sie mehr im Blick gehabt haben als die Studenten? Sich gefragt haben, wie man einen Philosophen nur lieben kann (geschweige denn die Philosophie oder gar Weisheit), ob sie selbst einmal so ruhig an der Seite eines alten Mannes sitzen wollen würden, ihn begleiten, seine Hilfe zu sein? Und käme es umgekehrt den Studenten in den Sinn? Der arme Karl August Varnhagen wird bis heute als untalentierter Steigbügelhalter seiner Frau Rahel dargestellt, nur weil es offenbar als unmännlich gilt, die Rollen zwischen Vorder- und Hintergrund derart zu vertauschen (unmenschlich dagegen durfte die Männlichkeit durchaus sein, aber das ist eine andere Seite der Geschichte). Der strenge, konzentrierte Stil des Philosophen, er setzte sich bis in sein Reden und Antworten fort; doch nicht in seiner Gestalt. Die kannte eine nonchalante Sympathie, für die anderen, ihre Umgebung, sich selbst. Sie war der Körper seiner Freiheit, die Seele seiner Freude am Denken, am Spiel mit den Möglichkeiten, das Offene zu durchwandern, Wege einzuschätzen, wohin einen dieser Abzweig wohl führen wird, dieser, oder dieser? Die Zerbrechlichkeit jeden schmalen Pfads verlangte eine Umsicht, die dazu zwang, den Weg zu überprüfen, umzuschauen, worauf man sich verlassen kann, eine Einstellung, Position zu finden, um Abstände überhaupt einschätzen zu können, sich neu zu orientieren, vergewissern. Der Körper einer Freiheit, die geistige Verlässlichkeit – ein Wechselspiel auch der Anziehungskraft …
Im Atelier war es still geworden. Vielleicht hatten manche Studierende Unterricht, vielleicht legten sie auch nur eine Pause ein. Wir mussten weniger angestrengt sprechen, zuhören, einem Studenten fiel jetzt erst das leise Quietschen seines Stuhls auf, wie angewurzelt versuchte er plötzlich zu sitzen und lächelte verlegen. Der Philosoph saß mit dem Rücken zum Geländer des Mezzanin, ich hatte das Treiben unten mit im Blick. In den Werkstätten der Schönheit war von ihr selbst wenig zu sehen. Ging es denn überhaupt um sie? Wie konnte sie dem Philosophen so wichtig sein? Die Generation der Dadaisten, die jedes Sinnversprechen im Ersten Weltkrieg vernichtet sahen, hatten die Schönheit längst verabschiedet, die Schönheit idealistischer Philosophen genauso wie die Schönheit geschwungener Linien, floraler Motive, jugendstillhaltender Dekoration für die geldadeligen Ingenieure militaristischer Imperialisten. ›Um einen Feuerball rast eine Kotkugel, auf der Damenseidenstrümpfe verkauft und Gauguins besprochen werden.‹ So sah es aus. ›Man muß weder Kant gelesen haben noch Nietzsche: es genügt, sich an einem Satz das Kotzen geholt zu haben …‹ Sprach der einzige Dadaist, den alle respektvoll den ›Doktor‹ nannten: Herr Dr. Serner, auch wenn Sie Jurist sind, verschreiben Sie uns die Welt in den kleinen Dosierungen ihrer Sätze, Anweisungen, lockern Sie den Verstand, auf dass ihm der Sinn vor die Füße fällt, die Welt steht Kopf, drehen Sie uns den Spieß um, den Vorgesetzten, lassen wir uns alle auf der Anklagebank nieder und picknicken wir bis der Abend glüht, auf den Feldern von Verdun, haben Sie uns im Wahnsinn gesehen, im Albtraum daran gedacht? Die Schönheit der blauen Blume, die dem Schuldigen nur dazu dient, sich ein Trugbild der Unschuld zu bewahren, der Schuld dazu dient, mit sich nicht allein zu sein. Doch sie blieb allein. Und wie haben Künstler darum gekämpft, diesen Zwiespalt mit ins Bewusstsein der Kunst zu nehmen, kritisch zu werden, modern. Der Augenschein trügt. Vorbei die Ästhetik der Salons, der feinen Gesellschaft. Vorbei die Moral der angesehenen Leute. Die Halbwelt hielt der Welt den Spiegel vor. Wenn schon ein Trugbild, dann dieses.
Kritisch blieb die Kunst, und wurde Kapital. Die Schönheit aber kehrte nicht wieder, nicht als vorrangige Frage. Schien es deshalb an der Zeit, sie zu stellen? Oder blieb der Philosoph in Idealen seines Fachs befangen? Welche Bedeutung sollten sie haben, wenn die Künstler selbst ganz andere Wege gingen, die Historiker sie begleiteten, der Markt die Entwicklung trug, Soziologen sie bekräftigten? Das scherte den Philosophen wenig. Warum auch? Ihn kümmerte das Begründen von Kunst, sie als solche erkennbar werden zu lassen. Er arbeitete daran, sie zu denken. Und dieses Denken folgte nicht den Beispielen der Werke allein, es ging auch diesen Beispielen voran, im Denkbaren. Das Denken war nicht nur ein Beschreiben, es war auch kein Vorschreiben, es war vielmehr ein Herstellen sinnvoller Zusammenhänge, und im Fall der Schönheit schienen sie dem Philosophen keineswegs abgebrochen. Er idealisierte sie auch nicht, ihm schwebte nur etwas anderes vor. Welchen Schaden sollte die Kunst nehmen, wenn sie nützlich sei – und liegt im Brauchbaren nicht ebenso Schönes? Er wehrte sich gegen die ästhetische Trennung von Kunst und Handwerk, von Schönheit und Nutzen. Und die Dadaisten mochten dagegen revoltiert haben, bewiesen nicht aber Börsenmakler wie Kommunisten in der Zeit zwischen den Weltkriegen gleichermaßen, dass dieser Gegensatz selbst sinnlos ist, wenn man in der belgischen Hauptstadt etwa die wunderbare Villa Van Buuren besucht, ein Gesamtkunstwerk von Kunst, Gestaltung, Architektur und Handwerk, genauso wie wenn man Arbeiten der russischen Avantgardisten sieht, die in den ersten Jahren nach der Oktoberrevolution noch möglich waren, visionäre Verschmelzungen und Durchkreuzungen von allem, womit sich kreieren lässt, ob es sich dabei um Gemälde oder Produktentwürfe handelt, ganz gleich. Und so kam er auch wieder auf sein Verständnis von Abstraktion und Gestaltung zu sprechen. Dass alles, was nur sich selbst und nichts anderes darstelle, abstrakt sei – eine Türklinke genauso wie eine Melodie. Dass es deshalb aber nicht im Widerspruch stünde zur Schönheit. Und dass Nutzen und Sinn dabei Hand in Hand gingen.
»Ist dann ihre Vorstellung von Abstraktion nicht gleichbedeutend mit Form? Wenn Sie jedoch meinen, abstrakte Gegenstände verweisen auf nichts als sich selbst und verbergen dadurch anderes – lässt sich dieser Gedanke auf den der Form übertragen? Denn im ersten Fall ordnen Sie die Abstraktion einer Umbildung der Natur zu, abseits aller Künste der Einbildung. Form ist allerdings ein Grundbegriff der Einbildung selbst. Im zweiten Fall, etwa beim Beispiel der Melodie, wäre das Abstrakte somit Teil der Künste der Einbildung. Oder nicht?«
Meine Frage hatte die Studierenden verwirrt, ihn nicht. Dabei war es der Gruppe wie mir so im Laufe der Lektüre gegangen, dass wir uns immer wieder an Stellen seiner Darstellung schwertaten, die Folgerichtigkeit seiner Schritte Nebenwirkungen kannte, Ein- und Ausschlüsse, die sorgfältig überdacht werden mussten. Wie viele seiner Generation teilte er grundlegende Ansichten Martin Heideggers – so wenig er etwa die Schriften Hannah Arendts schätzte, so vergleichbar ging er allerdings von Heideggers Aufriss der Welt aus, dass sie gebildet werden müsse, dass der zerbrechliche Mensch eines Schutzraums bedarf. Seine Wortwahl der ›Umbildung‹, ›Aus- und Einbildung‹ knüpfte hier an. Zugleich widersprach er Heidegger in dessen Suche nach einer gemeinsamen Wurzel für die Bildung einer Welt, ob diese nun in der Zeit liege, in der Materie oder sonstwo. Nein, das habe Aristoteles schon treffend deutlich gemacht, dass nur in der Konstellation von Stofflichkeit, ihrer erscheinenden Gestalt und dem sie Verbindenden eine Lösung gesucht werden müsste, die bis heute niemand gefunden hat. Der ontologische Knoten bleibt unerkannt, er vollzieht sich in allem, was wir werden und sind, die Annahme ist nicht unsinnig, nur jedem Zugriff entzogen. Dass dieser Knoten besteht, wirkt sich offenkundig aus. Worin er besteht, lässt sich nicht hervorkehren. So wirkt er im Rücken jeder Gewahrwerdung …
Anders als Heidegger beschrieb der Philosoph das Bilden nicht derart als Teil des Seins. Es würde immer unerkannt bleiben; es ging vielmehr darum, sich mit dem, was im Rücken ist, einander zuzuwenden, einzurichten, in einer gemeinsamen Welt, nach einem Wort von Heideggers Lehrer, Edmund Husserl: Lebenswelt. Husserl hatte sich noch die Erkenntnis dieser zugewandten Welt versprochen, der Philosoph selbst kehrte sich auch davon ab. Nicht, was kann ich wissen?, wie es seit Kant für die Erkenntnisphilosophie heißt, wäre der erste Grundsatz des eigenen Denkens. Stattdessen sollte es lauten: Was müssen wir wissen? Das Wissen wurde eingeschränkt auf ein bestimmtes Interesse – zu leben, in einer Welt (im Dezember 2009). Was galt es dafür zu tun, war sein zweiter Grundsatz. Einsicht war mehr gefragt als bloße Erkenntnis. Und was mit dieser Einsicht bewerkstelligt werden könnte, darauf richtete sich sein dritter Grundsatz. Das Hoffen überließ er lieber anderen (den Autor von Das Prinzip Hoffnung hatte er als junger Mann in Leipzig erlebt – ein ›komischer Kauz‹, wie er sagte). Mit Kant und Husserl und Heidegger dachte er über sie hinaus, über die Ästhetik, Erkenntnisphilosophie und Ontologie, zugunsten einer praktischen Wendung ihrer Annahmen, in Anlehnung an künstlerische Traditionen, die Rückbezüge produktiv machten, statt sie in Gegensätzen zu blockieren. Es war ein Zusammenhang, den er aufzuzeigen versuchte, ein Zusammenhang der tätigen Weltgewinnung, ganz wie man Land gewinnt. Und so spann sich ein Faden vom rhythmischen Pulsieren zur Einbildung musikalischer Formen, zum Tanzen des Körpers, dem Bildlichen im Gedicht, das gleichfalls einer Zuspitzung gleicht, aus dem Geschehen, dramatisiert, verkürzt, wie es Erzählformen anbahnen, weiterführen, und sich mit der körperlichen Bewegung im Theater zeigen, dramaturgisch erweitert, eine Aufführung gestaltet wird, eine Geschichte dargeboten. Wie immer man über diese Verweise dachte, die Notwendigkeit oder Zufälligkeit ihrer Verknüpfung, sie dienten dem Philosophen als Begründung ihrer Rückbezogenheit, ob als Kontrast, Entgegnung, Verbindung. Die lebendige Einbildung ermöglichte im Umkehrschluss auch die tatsächliche Veränderung der Natur, der Widerständigkeit um einen, der Elemente, dank derer man lebte und Teil ihrer war, in einer fortwährenden Durchdringung mit und Abgrenzung von ihr.
Die Umbildung entsprang der Einbildung, der Einbildung des selbst nie Wahrgenommenen, dass es vielleicht auch ganz anders gehen müsse als man es je gekannt hatte. Waren Menschen so einmal auf die Idee gekommen, ein Bett zu bauen? Statt weiter auf dem Boden zu schlafen, wie bequem hergerichtet auch immer? Hatten sich Nester als Modelle nie angeboten, sich nicht als praktisch erwiesen, fremd der Höhlen und Schlupfwinkel, in denen Menschen einst Schutz suchten? Wie wirkte das Bett sich auf das Träumen aus? Bot es einen Anlass liegen zu bleiben, dem im Schlaf Geträumten nachzuhängen, das Bett selbst als Hort der Träume zu begreifen, in ihm auch wach am Tag zu träumen, still vor sich hin? Wie sollte man hier das Nützliche von dem Schönen trennen, das Handwerkliche von dem Künstlerischen, das Wahrgenommene von dem Vorgestellten? Im Bett gemütlich eine ebenso literarisch bezaubernde wie gedanklich anregende Geschichte zu lesen – beinhaltete dieses Motiv nicht beispielhaft sämtliche Aspekte einer lebenswerten Lebenswelt?
Verblieb eine solche Vorstellung aber nicht zu sehr darin, auch vom Einzelnen geschaffen werden zu können, für sich allein? Wie verhielt sie sich zu Walden von Henry David Thoreau, dass jemand allein als Handwerker, Künstler, Jäger und Dichter sich eine Welt schafft, inmitten der Natur? Der Philosoph selbst sprach nie vom Einzelnen, in seinen Grundsätzen waren immer wir gemeint, redete er ausdrücklich die Leserinnen und Leser in all ihrer Verschiedenheit an. Eine Studentin hatte eine weitere Frage, und ich wollte den Gesprächsfluss nicht unterbrechen, auch wenn wir von meiner Zwischenfrage längst abgekommen waren.
»Sie schreiben von der Schönheit mancher Sinnlosigkeit. Gibt es sie nur in der Kunst oder auch in der Philosophie?«
»Im Leben, würde ich sagen. Und damit auch in der Kunst, und auch in der Philosophie. In der Tragödie mag das Handeln eines Helden am entscheidenden Punkt sinnlos sein, weil er, was immer er tut, verlieren wird – seine Liebe, sein Leben, jeden Sinn. Was er jedoch tut, und wie er es macht, daran entscheidet sich, ob seiner letzten Tat eine Schönheit und Würde innewohnt oder nicht, ob er ungebrochen untergeht oder verzerrt im Wahn, ob er nur ein mitleiderregendes Bild abgibt oder ein Vorbild in der alles entscheidenden Stunde.«
Die Studierenden fragten nicht weiter. Ob er dabei an den Krieg gedacht hatte?
Wir bedankten uns herzlich bei dem Philosophen und seiner Frau, dass sie trotz Eis und Schnee gekommen waren. Einige räumten die Stühle weg, andere plauderten im Treppenhaus, während unten im Atelier der Betrieb weiter ging. Ich zeigte dem Philosophen das Formular für die Honorarabrechnung, doch er winkte nur ab. »Es war mir eine Ehre«, meinte er, sichtlich erfreut über den lebhaften Zuspruch, das Interesse an seinen Gedanken. Als wir vor die Tür kamen, hatten sich die Studierenden bereits zerstreut. Seine Frau entschuldigte sich, sie wollte kurz zur Toilette. Wir blieben allein in der Kälte stehen. »Wie in Berlin«, meinte er verschmitzt und drehte sich eine Zigarette. Fast einen Kopf kleiner stand er neben mir, die flache Schirmmütze auf, seine weißen Haare wellten sich im Nacken, an Schal und Jackenkragen. Er trug keinen Anzug, keinen langen Mantel, trat nicht auf wie ein konservativer Professor, er hätte so bei einer Demonstration gegen Kernkraft mitgehen können und ins Bild linken Engagements gepasst. Doch wie er die Zigarette rauchte und so neben mir stand, dachte er an Berlin, seine Kindheit vor dem Krieg, den Schnee dort, die Eiseskälte im Winter, wie sie hier in Belgien, nahe am Meer, am Atlantik, kaum einzog. Er rauchte sich in seine Kindheit zurück, rauchte in den Tag, diesen Augenblick, umwölkte den Schnee aus den Wolken, war ein glücklicher Mensch. So schien es. Vielleicht war ich nur froh, dass unser Gespräch gut verlaufen war, dass er sich als so umgänglich gezeigt hatte, die Gruppe endlich aufgeblüht war, nach den Wochen und Monaten unterm Dach. Befreit von alledem, bereichert, stand ich mit dem Autor unserer Lektüre nun im Innenhof der Akademie.
»Haben Sie lange in Berlin gelebt?«
»Nein, wir sind bald nach Leipzig, mein Vater bekam dort eine Stelle.«
»Und wo in Berlin sind Sie aufgewachsen?«
»Schöneberg.«
Seine Frau stellte sich wieder zu uns, sie hatte schon ein Taxi gerufen, gleich würde es am Haupteingang stehen. Wir verabschiedeten uns, er hakte sich bei ihr ein, und beide schlenderten gemächlich zur Straße.