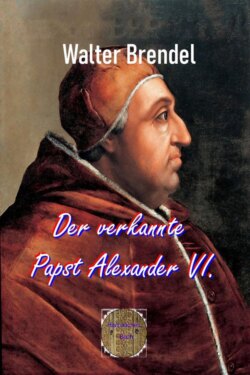Читать книгу Der verkannte Papst Alexander VI. - Walter Brendel - Страница 6
Herkunft und Aufstieg
ОглавлениеDie Borgia (italienisch) oder Borja (spanisch und valencianisch) waren eine aus Spanien (genauer: der heutigen Autonomen Region Valencia) stammende Adelsfamilie. Die Borgia stammen aus dem Königreich von Valencia, im Süden der Konföderation der Krone Aragón, vor allem aus València und Xàtiva. Die Familie kam zu Beginn des 15. Jahrhunderts in Italien zu Macht und Reichtum. Die Borgiafamilie stammte aus dem Dorf Borja in Aragón. Sie pflegten ihre Wurzeln und sprachen auch in Rom innerhalb der Familie die katalanische Sprache. Roderic Llançol i de Borja wurde als Sohn des aus Valencia stammenden Jofré de Borja y Escrivà (1390–1436), Sohn von Rodrigo Gil de Borja i de Fennolet und Sibilia d’Escrivà i de Pròixita, und der aus Aragonien stammenden Isabel de Borja y Llançol (1390–1468), Tochter von Juan Domingo de Borja und Francina Llançol, geboren.
Andere Quellen sprechen aber dafür, dass er als unehelicher Sohn seines „Onkels“, des späteren Papstes Calixt III., geboren wurde; seine Mutter war eine Schwester Calixts.
Der Familienname wird Llançol in Valencia geschrieben. Die allgemeine spanische Schreibweise ist Lanzol. Rodrigo nahm den Familiennamen Borgia an, als sein Onkel mütterlicherseits, Alonso de Borja, zum Papst gewählt wurde. Dieser regierte als Papst Kalixt III. von 1455 bis 1458 und ermöglichte Rodrigo de Borja den Aufstieg in der kirchlichen Hierarchie.
Wappen der Borgia
Rodrigo Borgia studierte zunächst – ab etwa 1453 – in Bologna kanonisches Recht, nachdem er von seinem Onkel bereits mit zahlreichen lukrativen Pfründen ausgestattet worden war, unter anderem als Kanonikus in Xàtiva. Er war zwar kein Priester – das wurde er, wie damals nicht unüblich, erst Jahre später – dennoch ernannte ihn sein päpstlicher Onkel am 20. Februar 1456 zum Kardinaldiakon von San Nicola in Carcere und bereits im darauffolgenden Jahr zum „Vizekanzler der Heiligen Römischen Kirche“. Dieses auf Lebenszeit verliehene Amt und seine zahlreichen Pfründen – Rodrigo stand etwa 30 Bistümern als Titularbischof vor – machten ihn zu einem der reichsten Männer Europas. Ab 1458 war er in commendam Kardinaldiakon von Santa Maria in Via Lata. 1471 wurde er Kardinalbischof von Albano und 1476 von Porto.
Schauen wir uns zunächst den ersten Papst aus dem Geschlecht der Borgia etwas genauer an.1
Er wurde als Sohn von Juan Domingo de Borja und Francina Llançol in Xàtiva, einem Ort in València, geboren. Alonso stammte aus dem spanischen Geschlecht der Borja, das dem niederen Landadel angehörte und im Laufe der Zeit verschiedene Führungspositionen in Valencia eingenommen hatte. Seine Schwester war Isabella de Borja y Llançol, die mit Jofré de Borja y Escrivà (Jofré de Borja) verheiratet wurde und Mutter des späteren Papsts Alexander VI. war. Er studierte zunächst kanonisches Recht in Lleida und begann 1408 seine kirchliche Laufbahn. 1411 wurde er zum Kanoniker an der Kathedrale von Lleida ernannt, ein Amt, für das der Familie Borja offensichtlich ein Vorschlagsrecht zustand. Um diese Zeit prophezeite der dominikanische Bußprediger Vicente Ferrer dem jungen Kleriker, dass er einmal Papst werden würde. Alonso, der einen hervorragenden Ruf als Kenner des kanonischen Rechts genoss, wurde zunächst vom Gegenpapst Benedikt XIII. als Berater an seinen Hof gerufen. Benedikt war einer von damals drei rivalisierenden Päpsten, die allerdings durch das Konzil von Konstanz enthoben und durch den 1417 neugewählten Martin V. ersetzt wurden. Alonso trat deshalb in die Dienste des Königs von Aragón, Alfons V. Dort fiel ihm vor allem die Aufgabe zu, in den Verhandlungen mit der Kurie die Interessen des Königs durchzusetzen. So verlangte Alfons für die Einstellung seiner Unterstützung der Gegenpäpste (Clemens VIII. und Benedikt XIII. hatten sich geweigert zurückzutreten) zahlreiche Zugeständnisse. Alfons konnte durch den Einsatz des versierten Juristen die Durchsetzung seiner Ansprüche beim Papst erreichen; Clemens, dem Alonso die Botschaft persönlich überbracht hatte, trat daraufhin zurück.
Auf Fürsprache des Königs wurde Alonso 1429 zum Bischof von Valencia erhoben; wie damals üblich, musste der neue Bischof dem König die Würde finanziell ablösen.
Für Alfons, der den Thron von Neapel zu usurpieren gedachte (das Königreich Neapel war ein päpstliches Lehen) und die französischen Anjou vertrieben hatte, verhandelte Alonso mit dem Papst, mittlerweile Eugen IV., und erreichte 1439 einen Waffenstillstand mit Rom. Alonso führte sowohl im Auftrag des Königs die Verhandlungen mit dem örtlichen Adel um die Anerkennung der neuen Herrschaft als auch 1443 mit dem Papst, der schließlich die Herrschaft Alfons’ über Neapel anerkannte; im Gegenzug entzog der König dem Konzil von Basel − Sammelpunkt der innerkirchlichen Opposition gegen den Papst − seine Unterstützung.
Als Anerkennung für seine Dienste erreichte Alfons die Verleihung der Kardinalswürde, die Alonso 1444 als Kardinal von Valencia erhielt. Entsprechend den Sitten der Zeit begann er nun, die Karriere zweier Neffen zu fördern: dabei handelte es sich um die Söhne seiner Schwester Isabel, Rodrigo de Borja und Pedro Luis de Borja. Ersteren holte er 449 zu sich nach Rom.Unter dem 1447 zum Papst gewählten Humanisten Tommaso Parentucelli, der den Namen Nikolaus V. annahm, kam es in Italien zu weitreichenden Veränderungen: die Sforza bestiegen den mailändischen Herzogsthron (Francesco Sforza war einer der Condottiere Alfons’ in Neapel gewesen) und mit dem Fall Konstantinopels am 29. Mai 1453 gewann die Kreuzzugsidee neue Bedeutung.
Nach dem Tod Nikolaus’ V. 1455 standen sich im Konklave, das am 4. April des Jahres begann (und an dem 15 Kardinäle teilnahmen − so wenige werden es nie mehr sein), die Fraktionen der Colonna und der Orsini gegenüber. Doch keine der beiden Seiten war imstande, ihren Favoriten durchzusetzen. Der zunächst als Kompromisskandidat eingeführte Kardinal Bessarion scheiterte, damit schlug die Stunde des mittlerweile 77-jährigen Katalanen. Alt und von untadeligem Ruf, dazu ein versierter Jurist, schien der Kardinal von Valencia keine ernsthafte Bedrohung der herrschenden Interessen zu sein. Am 8. April 1455 erfüllte sich die Prophezeiung Ferrers und Alonso wurde gewählt. Der Grund der Namenswahl war zweideutig: Es könnte ein Eigenlob sein (griech. Kallistos, der Schönste, Glänzende) oder auch eine Anspielung auf den Santo Cáliz, den in Valencia verehrten Abendmahlskelch Jesu („Heiliger Gral“).
Sein Pontifikat stand zwar unter den Zeichen des Kampfes gegen die Türken, die das Abendland bedrohten, doch war er der erste Papst, der einem geradezu schrankenlosen Nepotismus huldigte. Seine anfängliche Zurückhaltung in dieser Hinsicht gab er 1456 auf. Im Februar 1456 wurden Rodrigo de Borja und sein Neffe Luis Juan de Milà zu Kardinälen ernannt.
Kalixt III. ernennt Enea Silvio Piccolomini zum Kardinal – Fresko von Pinturicchio
Bald zeigte sich, dass Kalixt III. in übergroßem Maß Verwandte und katalanische Landsleute förderte, was den ohnehin wenig volksnahen Spanier in Rom geradezu verhasst machte. Bereits 1457 wurde Rodrigo zum Vizekanzler der Kurie ernannt − einem Amt auf Lebenszeit, das als das wichtigste Amt nach dem Papst gilt und jedenfalls als das einträglichste der Kurie. Dazu wurde er zum Hauptmann der päpstlichen Truppen bestellt, während Pedro Luis die Kommandantur der Engelsburg und zahlreiche kirchliche Lehen übertragen erhielt.
Bald geriet Kalixt in einen Konflikt mit seinem früheren Förderer, dem König von Aragón, der als Alfons I. auch den Thron von Neapel innehatte. Während die Auseinandersetzungen eskalierten, sah der Papst im neapolitanischen König das Haupthindernis für sein größtes Anliegen, nämlich die Rückeroberung Konstantinopels und ein neuer Kreuzzug. Der König drohte dem Papst mit einem Konzil zu seiner Absetzung und der Papst mit dem Entzug des kirchlichen Lehens Neapel. Als Alfons auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen am 27. Juni 1458 starb, verweigerte er dessen Sohn Ferrante (dem späteren König Ferdinand I.) die Krone und zog das Lehen ein. Sein Neffe Pedro Luis wurde mit den Vikariaten von Terracina und Benevent belehnt, die bislang der verstorbene König innehatte, dazu wurde er mit der Führung der Truppen im unausweichlichen Krieg gegen die Aragonesen betraut − das Königreich Neapel sollte, so Kalixt’ Absicht, seiner Familie zufallen. Rodrigo, als Alexander VI. später selbst Papst, sollte diese Idee für seinen Sohn Cesare Borgia neuerlich aufgreifen.
Als Ende Juli Kalixt schwer erkrankte, stürzte das Machtgeflecht der Borgia zusammen: Pedro Luis musste die Engelsburg übergeben, während die Orsini ihre verlorenen Kastelle zurückeroberten. Am 6. August 1458 starb Calixtus in Rom.
Er veranlasste eine Revision des Prozesses gegen Jeanne d’Arc, in deren Verlauf sie rehabilitiert wurde, und sprach den Dominikaner Vicente Ferrer heilig, der ihm einst die Papstkrone vorhergesagt hatte.
Kalixt III. war nicht nur ein hervorragender Jurist, sondern auch den Glaubensanliegen verpflichtet, wie sein Engagement in Sachen Konstantinopel beweist. Er führte ein einfaches Leben, war jeder Prunksucht abgeneigt, hielt eine einfache Tafel und hatte keine Affären, und auch keine Kinder, was ihn aus der Vielzahl geistlicher Würdenträger der damaligen Zeit heraushob. Dies alles war auch ausschlaggebend für seine Wahl, dazu war er bereits alt. Auch hatte er als Kardinal seine Verwandten nicht mehr als üblich gefördert.
Den gewählten Päpsten wurde zugestanden, zumindest einen Verwandten zum Kardinal zu erheben, und auch die Belehnung von Verwandten mit kirchlichen Lehen und die Vergabe von einträglichen Pfründen war durchaus üblich und wurde akzeptiert. Da er bis zu seiner Papstwahl keinerlei Anzeichen der damals üblichen Macht- und Geldgier zeigte, meinte man, Alonso werde seine Zurückhaltung auch als Papst beibehalten.
Tatsächlich enthielt sich Kalixt weiterhin aller Affären oder eines aufwendigen Lebenswandels, nicht jedoch des Nepotismus. Auch seine Vorgänger − etwa Bonifaz VIII., der seine zahlreiche Verwandtschaft mit einer Vielzahl von Lehen bedachte − huldigten diesem Prinzip, doch keiner tat es so aggressiv wie Kalixt. Kleinere, erbliche Güter den Verwandten zukommen zu lassen, war durchaus verbreiteter Brauch. Zum ersten Mal aber sind unter Calixt die Bestrebungen des Papsttums darauf ausgerichtet, einem Papstnepoten ein über eine Grafschaft hinausreichendes Herrschaftsgebiet (in diesem Falle das Königreich Neapel) zu verschaffen. Mit dem Jahr 1458 beginnt eine Phase des Nepotismus, die man als territorialen Nepotismus bezeichnen kann. Für alle nach ihm folgenden Päpste sind die Mauern des Anstandes und der Selbstbeschränkung eingerissen. Sie werden in Zukunft auch nicht vor Mord oder Kriegen für die Güter ihrer Nepoten zurückschrecken.
Und mit einem Gerücht musste er, wie auch später sein Neffe Rodrigo immer kämpfen, dass die Borgias ein Judengeschlecht waren. Der Verdacht, die Borgia könnten Anhänger einer von der christlichen Kirche bekämpften Religion sein, hat schon die Fantasie ihrer Zeitgenossen stark beschäftigt. Dies umso mehr, als die getauften Juden in Spanien eine sehr bedeutende Rolle spielten.
Doch es gibt für diese Annahme nicht den geringsten Beweis.
Welches Blut auch immer in den Adern der Borgia geflossen sein mag, eines steht mit Sicherheit fest: Die Borgia waren nach ihrer ganzen Mentalität und ihrem Selbstverständnis Spanier. Sie sprachen untereinander spanisch. Selbst in der Öffentlichkeit unterhielt sich Alexander, besonders wenn er freudig erregt war, mit seinen Kindern auf Spanisch. Spanisch war fast die gesamte engere Umgebung der Borgia, von den Leibgarden Alexanders und Cesares über Hauslehrer und Hofstaat bis hin zu Michelozzo, dem berüchtigten Meuchelmörder in Cesares Diensten.
Spanisch waren der ausgeprägte Sinn der Borgia für prunkvolle Hofetikette, Lucrezias Vorliebe für spanische Mode und Tänze, ebenso wie ihre Begeisterung für den Stierkampf. Rodrigo brachte den spanischen Nationalsport nach Rom, Cesare in die Romagna. Nach mehreren Todesfällen wurde er aber wieder abgeschafft.
***
Kehren wir zu Rodrigo zurück. Dem weiblichen Geschlecht war er trotz seiner Kirchenwürden sehr zugetan und verbarg dies – typisch für die Renaissance – kaum vor der Öffentlichkeit. Dass der freizügige Lebenswandel, bei vielen der zeitgenössischen Prälaten üblich, durchaus auch in der Kurie auf Widerspruch stieß, ist durch ein Schreiben Papst Pius’ II.2 – den Nachfolger seines Onkels als Papst - dokumentiert, in dem er den jungen Prälaten wegen seines Sexuallebens rügte.
Und das geschah folgendermaßen: Gleich nach seiner Wahl berief Pius daher einen Fürstenkongress ein, der ein einheitliches Vorgehen der Christenheit gegen die Türken zum Ziel hatte. Dieser fand in Mantuas statt. Der Vizekanzler der Kirche Rodrigo tauchte in den Berichten über den Kongress nur einmal auf. Borgia war offensichtlich der Auffassung, dass der Verzicht auf die Annehmlichkeiten Roms kein Grund sei, auf jede Art von Vergnügung zu verzichten. Er nahm sich den mantuanischen Hof zum Beispiel, zu dessen Hauptvergnügen im Sommer Ruderpartien auf den ausgedehnten Gewässern und Kanälen der Umgebung zählten. Im Verein mit den Kardinälen Colonna und dEstouteville besorgte er eine Barke, die mit ihren Sängern und Musikanten bald zu einer geschätzten Bereicherung der Bootspartien wurde. Pius II. schien diese Art von Freizeitgestaltung seiner Kardinäle dem Anlass dieses Kongresses alles andere als angemessen, und er brachte dies auch deutlich zum Ausdruck.
Die so gerügten geistlichen Weltmänner scheinen aber nicht nur mit ihrer Barke, sondern auch durch ihr Auftreten bei den im Sommer so zahlreich stattfindenden Gesellschaften in den Lustschlössern an den Ufern der Wasserwege Eindruck gemacht zu haben.
Papst Pius II. unter einem Baldachin, geschmückt mit seinem Wappen; Fresko von Pinturicchio
Und ein weiterer Rüffel ist in den Analen verzeichnet: Seine Vorliebe für das schöne Geschlecht war an der Kurie notorisch. Pius richtete dann auch ein zornentbranntes Schreiben 1460 an den damals neunundzwanzigjährigen Kardinal:
Es sei ihm zu Ohren gekommen, dass er auf einem Gartenfest zu Siena wie ein liebestoller Galan in Erscheinung getreten sei; Auftritte dieser Art solle er bitte im Interesse seiner eigenen Reputation und der Würde des Heiligen Stuhls künftig unterlassen.
Die in ihm enthaltenen Vorwürfe hat er dann zwar später in einem weiteren Schreiben abgemildert. Vermutlich nachdem sich sein erster Zorn gelegt hatte, dürfte ihm klar geworden sein, dass es im Interesse aller Beteiligten liegen würde, dem Ganzen eine möglichst harmlose Deutung zu geben.
Doch Pius hätte sich auch an seine eigene Nase fassen können, denn vor seiner kirchlichen Laufbahn führte Enea Silvio Piccolomini, wie er mit bürgerlichen Namen hieß, ein Leben als Dichter und Lebemann und war in seinem Wirken ebenso widersprüchlich wie später als Papst.
Am 19. August 1458 wurde Enea Silvio Piccolomini in einem dreitägigen Konklave in Rom zum Papst gewählt und am 3. September inthronisiert. In seinen Memoiren erinnerte sich Pius II. mit Abscheu an das abgekartete Spiel im Konklave. Die Wahl seines Papstnamens gilt als Anspielung auf den pio Enea, den ‚frommen Äneas“, von Vergil.
Als Papst war Piccolomini nun ein entschiedener Verfechter des Papalismus und kämpfte für die Entscheidungsgewalt des Papstes in allen kirchlichen und weltlichen Belangen. So erließ er am 18. Januar 1460 die Bulle Exsecrabilis, die eine Appellation an ein allgemeines Konzil gegen den Papst mit der Exkommunikation belegte. Damit war dem Konziliarismus ein wichtiges Instrument aus der Hand genommen.
Hatte man bisher nur die Macht des Christentums in Europa im Blick, so bahnte sich nun die Säkularisierung an, was Piccolomini lange vor seinem Papstamt bewusst war. Dies hat ihn sehr besorgt, denn er wollte die alte päpstliche Machtfülle wiederherstellen. Um Macht ging es auch in der Auseinandersetzung mit Georg von Podiebrad, dem König von Böhmen. Der vorgeschlagene Staatenbund-Plan und die Verweigerung des Obedienzeides bescherten ihm einen großen Streit.
In dem deutsch-kanadischen Historienfilm >Das Konklave< werden die Umstände, die zur Wahl von Pius II. führten, aus der Sicht des damals noch jungen Rodrigo Borgia erzählt.
Seine Stimme bei der Wahl von Papst Sixtus IV. hatte Kardinal Rodrigo Borgia eine Abtei mit vielen Burgen und einem stolzen Schloss als Gegenleistung eingebracht. Dieses „Geschenk“ zeigt, wie viel sein Votum schon dreizehn Jahre nach dem Tod Calixtus’ III. wert war. Als Vizekanzler hatte Rodrigo Borgia nach dem Papst die meisten Kontakte zu den europäischen Herrschern, die er durch Gewährung von Gnaden gewogen stimmen konnte. Das Geschick, das er bei solchen Geschäften an den Tag legte, wurde an der Kurie rasch legendär.
Er verfügte nach einhelligem Zeugnis der Zeitgenossen über eine ungewöhnliche Beredsamkeit, gepaart mit psychologischem Scharfblick und juristischer Sachkenntnis. Das alles machte ihn zu einem Meister in der Kunst des Verhandelns. Allerdings wurden seine dabei erzielten Erfolge nicht nur auf diese Qualitäten, sondern mindestens ebenso sehr auf die Fähigkeit zurückgeführt, sein Gegenüber über seine wahren Absichten zu täuschen und dabei auch den kleinsten Vorteil rücksichtslos auszunutzen. Strenger denkende Zeitgenossen mochten dieses Gebaren missbilligen, doch auch sie mussten einräumen, dass die Kurie solche Kardinäle brauchte. Die gegenwärtigen Zeiten verlangten nach Kirchenfürsten mit politischer Durchsetzungs-fähigkeit.
Die Päpstliche Kanzlei (Cancellaria Apostolica) war eines der ältesten Ämter der Römischen Kurie, ihre Gründung geht bis auf das 4. Jahrhundert zurück. Sie war anfänglich für die Ausfertigung, Beglaubigung, Versiegelung und Archivierung von Apostolischen Schreiben und päpstlichen Anordnungen zuständig. Sie wurde bis zum 12. Jahrhundert auch als „Scrinium Apostolica“ (Päpstliches Archiv) bezeichnet. Seit 1088 wurde sie vom „Kanzler der Heiligen Römischen Kirche“ geleitet. Der „Cancellarius“ darf nicht mit dem Camerlengo verwechselt werden.
Rodrigo diente als Vizekanzler unter folgenden Päpsten:
1455 – 1458 Kalixt III.
1458 – 1464 Pius II.
1464 – 1471 Paul II.3
1471 – 1484 Sixtus IV.4
1484 – 1492 Innozenz VIII.5
Über Kalixt und Pius wurde schon kurz berichtet. Was zeichnete deren Nachfolger nun aus?
Paul II.
Pietro Barbo war der Sohn eines wohlhabenden venezianischen Kaufmanns, seine Mutter Polixena Condulmer war eine Schwester von Papst Eugen IV. Schon früh profitierte Pietro Barbo vom Pontifikat seines Onkels, der ihm gute Privatlehrer sandte.
Im Jahr 1440 ernannte Papst Eugen IV. seinen Neffen Pietro Barbo zum Kardinal von Santa Maria Nuova in Rom. Außerdem war er Apostolischer Protonotar, Archidiakon von Bologna, ab 1440 Bischof von Cervia, ab 1451 Bischof von Vicenza und ab 1459 Bischof von Padua. Von seinen zahlreichen Pfründen ließ Pietro Barbo den römischen Palazzo Venezia erbauen.
Am 30. August 1464 wählte ihn das Konklave nach dreitägiger Wahldauer im Vatikan zum neuen Papst. Eigentlich wollte sich Pietro Barbo Papst Formosus II. nennen, aber die Kardinäle überredeten ihn, diesen Namen nicht zu verwenden. Seine zweite Wahl fiel auf den Namen Papst Marcus II., doch auch der Name des Evangelisten erschien den Kardinälen als nicht angemessen, da sie wie Apostelnamen generell als Papstnamen unüblich sind (bei Papst Marcus I. war es der bürgerliche Name). So überzeugten sie Pietro Barbo, den Namen Papst Paul II. anzunehmen, der als Name des Völkerapostels, der nicht zum Kreis der Zwölf und nicht zu den Evangelisten zählt, akzeptabel erschien. (Der Papstname Johannes bezieht sich auf Johannes den Täufer.)
Wie zu dieser Zeit üblich, verlangten die Kardinäle von ihm eine Wahlkapitulation, doch Papst Paul II. widerrief seine Wahlkapitulation, die ihn zur Berufung eines allgemeinen Konzils und zum Türkenkrieg verpflichtete, sofort nach seiner Krönung. Papst Paul II. wandte sich offen gegen die römische Akademie und hob schließlich auch das Abbreviatorenkollegium6 auf.
Aus heutiger Sicht wird Papst Paul II. als ein Antihumanist bezeichnet: Er war des Lateinischen nicht mächtig und auch kein Freund der Bildung. Er führte das Birett7 der Kardinäle ein und legte 1470 das Jubeljahr auf alle 25 Jahre fest.
Sixtus IV.
Der auf den Namen Francesco Getaufte entstammte einer angesehenen, jedoch armen Familie aus Ligurien. Den Namen della Rovere übernahm er später von einer Turiner Familie, mit der er nicht verwandt war. Rovere ist die Traubeneiche, und das Wappen des Papstes und auch seines Neffen Julius II. zeigt eine solche Eiche mit 12 goldenen Eicheln. Er wurde von seiner Mutter bereits im Alter von 7 Jahren in geistliche Obhut gegeben, und als er das notwendige Alter erreicht hatte, trat er dem Franziskanerorden bei. In der Folgezeit studierte er Philosophie und Theologie in Bologna, Chieri, Padua und Savona.
Am 14. April 1444 erreichte er den Doktorgrad in Theologie an der Universität Padua. Nun engagierte sich Francesco della Rovere in der Lehre, er hielt Vorlesungen in Bologna, Florenz, Padua, Pavia, Perugia und Siena. Hierdurch weckte er unter anderem die Aufmerksamkeit von Kardinal Basilius Bessarion. Bei seinen Zeitgenossen war Francesco della Rovere wegen seiner Lehrtätigkeit und als hervorragender Prediger geschätzt.
Francesco della Rovere wurde am 19. Mai 1464 auf Grund seiner Leistungen zum Generalminister des Franziskanerordens gewählt. Am 18. September 1467 erhob ihn Papst Paul II. in den Kardinalsrang (Titelkirche: San Pietro in Vincoli) und berief ihn an die Kurie nach Rom. Es wird von vielen Historikern vermutet, dass es Kardinal Bessarion war, der den Papst zu dieser Kardinalserhebung veranlasst hat.
Am 19. Mai 1469 trat er von seinen Leitungsfunktionen innerhalb des Franziskanerordens zurück, um sich seinen Tätigkeiten innerhalb der Kurie voll zuzuwenden. In dieser Zeit verfasste er viele theologische Abhandlungen, so auch die beiden Traktate De potentia Dei und De sanguine Christi.
Am 9. August 1471 wurde er nach dreitägigem Konklave überraschend zum neuen Papst gewählt. Das Kardinalskollegium hatte ihm vor seiner Ernennung jedoch verschiedene Wahlkapitulationen abgefordert. Die Namenswahl bezieht sich auf den altrömischen Märtyrer Sixtus II., an dessen Festtag das Konklave begann. Hatte man von dem Ordensgeneral zunächst eine Neubesinnung auf pastorale Leitwerte erwartet, so zeigte sich während seines Pontifikats sehr bald, dass Papst Sixtus IV. ein ausschweifender Nepotist war.
Bereits am 16. Dezember 1471 ernannte Papst Sixtus IV., entgegen den Vereinbarungen der Wahlkapitulationen, zwei seiner Neffen, Pietro Riario und Giuliano della Rovere, zu Kardinälen. Im Jahr 1474 folgte noch sein Neffe Girolamo Riario und im Dezember 1477 der Sohn einer Schwester Girolamos, Raffaele Sansoni-Riario. Außerdem besetzte Papst Sixtus IV. viele weitere geistliche und weltliche Positionen innerhalb der Kurie und des Kirchenstaats mit Angehörigen seiner Familie. In seinem dreizehnjährigen Pontifikat ernannte er 34 Kardinäle, 6 davon waren Mitglieder seiner Familie. Die übrigen Kardinalsernennungen betrafen Repräsentanten der Höfe von Frankreich, Kastilien, Portugal, Neapel und Mailand, ebenso wie Vertreter des römischen, genuesischen und venezianischen Adels. Das Heilige Kollegium hatte zum Zeitpunkt seiner Papstwahl insgesamt 25 Kardinäle umfasst.
1473 wollte der Papst aus Anlass der Vermählung Girolamo Riarios mit Caterina Sforza das kirchliche Lehen Imola einziehen und an Riario weitergeben; als Vorwand dienten ihm der Lehenszins, den Taddeo Manfredi angeblich schuldig geblieben war. Manfredi hatte die Stadt jedoch bereits 1471 heimlich an die in Mailand regierenden Sforza abgetreten. Der als Kardinallegat 1474 zu den Sforza gesandte Pietro Riario konnte jedoch erreichen, dass die Mailänder ihre Ansprüche gegen die Zahlung von 40.000 Dukaten an Girolamo zu verkaufen bereit waren; das Geld hierfür sollten die Pazzi und die Medici vorstrecken. Da Florenz ebenfalls Anspruch auf Imola erhoben hatte, verweigerte Lorenzo de’ Medici seine Beteiligung am Kredit und forderte die Pazzi auf, sich ebenfalls den päpstlichen Wünschen zu verweigern. Tatsächlich kam der Kredit mit anderen Geldgebern, aber unter Beteiligung der Pazzi zustande.
Im Sommer 1474 geriet Sixtus von neuem in einen Konflikt mit den Florentinern, als er die Stadt Città di Castello beanspruchte, die den Florentinern von Papst Eugen IV. zur Begleichung seiner Schulden überlassen worden war. Der Nepot Giuliano della Rovere, der nach dem Tode Pietro Riarios Anfang des Jahres dessen Platz eingenommen hatte, wollte die Stadt für seinen Bruder Giovanni. Der Streit konnte erst durch das Eingreifen Federico da Montefeltros (Heerführer des Papstes und von diesem während der Auseinandersetzungen zum Herzog von Urbino erhoben) geschlichtet werden, der Niccolò Vitelli, der die Stadt bis dahin für Florenz gehalten hatte, zur Aufgabe überreden konnte.
Zu neuen Auseinandersetzungen mit Florenz führten die anstehenden Besetzungen der Bistümer Florenz und Pisa. Dem vom Papst zum Erzbischof von Pisa eingesetzten Francesco Salviati wurde – da die Florentiner das Vorschlagsrecht besaßen und den Kandidaten des Papstes ablehnten – der Zugang nach Pisa verwehrt.
Salviati, ein enger Vertrauter des Nepoten Girolamo Riario, setzte gemeinsam mit diesem und Francesco de’ Pazzi eine Verschwörung ins Werk, die einen Machtwechsel in Florenz herbeiführen sollte. Dieser Umsturzversuch, der als Pazzi-Verschwörung in die Geschichte eingegangen ist, fand die ausdrückliche Billigung des Papstes, wie der in Diensten des Papstes stehende Condottiere Giovan Battisto Montesecco später in seinem Geständnis angab. Dabei sollten Lorenzo de’ Medici und sein Bruder Giuliano „entfernt“ werden und Pazzi sowie Riario die Macht in Florenz übernehmen. Montesecco, der zur Mitwirkung am Umsturz vorgesehen war, weigerte sich zunächst und bestand darauf, vom Papst persönlich die Anordnung dazu zu erhalten. Daraufhin kam es zu einer Unterredung Monteseccos mit Sixtus, an der neben Salviati auch Riario teilnahm. Riario verlangte dabei sogar vom Papst vorsorglich die Absolution für die geplanten Morde. Dies lehnte der Papst – unter Hinweis auf sein Amt – ab, eher ließ er den Verschwörern schließlich freie Hand bei der Wahl ihrer Mittel.
Zunächst sollte Lorenzo nach Rom vorgeladen werden, wo man ihn festnehmen wollte, während gleichzeitig sein Bruder in Florenz ermordet werden sollte. Als dies nicht gelang, reisten die Verschwörer nach Florenz und verübten am 26. April 1478 im Dom zu Florenz das Attentat. Giuliano wurde getötet, Lorenzo konnte verletzt entkommen. Salviati, der versucht hatte, den Palast der Signoria zu besetzen, wurde festgesetzt und noch am selben Tag an einem der Fenster des Regierungspalastes gehängt.
In der Folge verlangte Sixtus die Auslieferung Lorenzos, um den Umsturz doch noch herbeizuführen, konnte sie aber trotz Bann und Interdikt gegen Florenz nicht erzwingen. Es waren letztlich der Fall Otrantos, das 1480 von den Türken erobert wurde, und die daraus folgende Einsicht, dass die Einheit Italiens im Kampf gegen die Türken erforderlich wäre, die eine Aussöhnung zwischen Florenz und dem Papst herbeiführten.
Sixtus setzte alles daran, seinem Nepoten Girolamo Riario, der mittlerweile die Herrschaften Imola und Forlí erhalten hatte, zu weiteren Herrschaftserwerbungen zu verhelfen. Seine Begehrlichkeiten richteten sich zunächst auf Faenza, Ravenna und Rimini. 1481 hatte der Papst außerdem ein Abkommen mit Venedig geschlossen, das sich gegen Ercole I. d’Este, Herzog von Ferrara, richtete. Die Venezianer wollten den Herzog vertreiben und sich seinen Besitz einverleiben, der Papst aber beabsichtigte lediglich, sich der Venezianer zur Vertreibung des d’Este zu bedienen, um Ferrara anschließend Girolamo zuschanzen zu können. Wie schon Kalixt III. streckte er seine Hände nach dem Königreich Neapel aus, um es für seine Familie zu gewinnen; auch hier sollte ihm Venedig hilfreich zur Hand gehen. Doch zum Ärger des Papstes fand Ercole im sich 1482 entspannenden Ferraresischen Krieg, der bald ganz Italien in ein Schlachtfeld verwandeln sollte, auf allen Seiten Verbündete, die sich dem Expansionsdrang Sixtus’ widersetzten.
In Rom war es zuvor zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen zwischen den Faktionen der Savelli und Colonna mit den Orsini gekommen; die seit langem bestehende Feindschaft zwischen den beiden Gruppierungen war durch einen Fall von Blutrache erneut zum Ausbruch gelangt und wurde mit dem Ferraresischen Krieg neu angefacht. Die neapolitanischen Truppen, die Ercole gegen die Venezianer unterstützen sollten, waren am Durchzug durch Latium gehindert worden und wandten sich nun in Richtung Rom, während die Flotte Ferrantes Ostia blockierte. Marodierende Truppen der Colonna und Savelli (deren einige Ferrante als Condottiere dienten) verwüsteten nicht nur die Umgebung Roms, sondern drangen sogar in die Stadt selbst ein, um zu morden und zu plündern. Als Sixtus schließlich vom noch in seinen Diensten verbliebenen Prospero Colonna die Übergabe der Herrschaften, die die Colonna zum Dank für die Unterstützung gegen die Türken bei Otranto 1480 von Ferrante erhalten hatten, verlangte, wechselte auch dieser ins neapolitanische Lager. Sixtus hatte in der Zwischenzeit seine Truppen – auch aus Angst vor einem Aufstand der Römer – in der Stadt zusammengezogen; als Roberto Malatesta endlich Verstärkung aus Venedig heranführte, kam es im August bei Campo Morto in den Pontinischen Sümpfen zur Schlacht, die die Papsttruppen für sich entscheiden konnten.
spätes Porträt von Papst Sixtus IV. Tizian Uffizien Saal 28
Malatesta kehrte nach Rom zurück, starb dort jedoch schon zwei Wochen später – am 10. September 1482 – an Malaria, von der er auf dem Feldzug befallen worden war. Malatesta war zwar Verbündeter des Papstes gewesen, aber auch Herrscher von Rimini, und sein Erbe Pandolfo Malatesta war noch ein Kind; Sixtus beschloss, für seinen Nepoten zuzugreifen. Nur der raschen Intervention Florenz’ war es zu verdanken, dass der eilig in Marsch gesetzte Girolamo Riario hier erfolglos blieb.
Auch der Sieg bei Campo Morto zeitigte nicht den gewünschten Erfolg für Sixtus: Nicht nur, dass sich zahlreiche Städte in Latium nach wie vor in der Gewalt der Neapolitaner befanden, auch die Unterstützung Ferraras verstärkte sich – Kaiser Friedrich, der sich Ferraras angenommen hatte, drohte Sixtus mit der Absetzung durch ein Konzil. So musste Sixtus schließlich am 28. November 1482 einen Waffenstillstand unterzeichnen, der ausdrücklich die Beschränkung Venedigs und die Erhaltung Ferraras vorsah. Sixtus ließ seinen vorherigen Verbündeten Venedig fallen, das er der Schuld an dem Krieg bezichtigte, und schloss ein neues Bündnis mit Neapel gegen Venedig.
Die Auseinandersetzungen zwischen den Orsini und den Colonna gingen allerdings, vom Papst bestärkt, weiter. Die die Colonna betreffenden Vereinbarungen des Bündnisses hatte Sixtus außer Kraft gesetzt, um sich ihre Besitzungen aneignen zu können. Im Januar 1484 begann so neuerlich ein Krieg zwischen Orsini und Colonna. Girolamo Riario erpresste Kirchen und päpstliche Kollegien, um den Raubzug finanzieren zu können. Zunächst ergaben sich Gaetani und Capranica, doch bei der Belagerung von Palliano setzten dessen Verteidiger unter Prospero Colonna dem Nepoten so zu, dass dieser aus Rom Unterstützung erbitten musste.
Doch in der Zwischenzeit hatten die italienischen Mächte, des Krieges gegen Venedig überdrüssig, eigenmächtig einen für die Serenissima günstigen Frieden abgeschlossen. Sixtus, der sich von einem Sieg über Venedig einen finanziellen Gewinn erhofft hatte, wurde am 11. August 1484 von dem Waffenstillstand in Kenntnis gesetzt; am folgenden Tag verstarb er über einem Tobsuchtsanfall an einem Schlaganfall.
Er wurde im Petersdom beigesetzt. Sein Grabmal schuf der italienische Bildhauer Antonio Pollaiuolo.
Unter Papst Sixtus IV. wurde zwischen 1475 und 1483 die nach ihm benannte Sixtinische Kapelle im Vatikan erbaut. Sie wurde am 15. August 1483 eingeweiht.
Im Jahr 1478 erklärte Papst Sixtus IV. die Dekrete des Konzils von Konstanz für ungültig, die den Vorrang des Konzils vor dem Papst bestimmten (Konziliarismus). Am 1. November 1478 erlaubte er die Einführung der „neuen“ Inquisition durch eine spezielle Bulle und bestätigte die vom spanischen Herrscherpaar Ferdinand II. (Aragón) und Isabella I. (Kastilien) wiederbelebte spanische Inquisition.
Papst Sixtus IV. war zeit seines Lebens ein entschiedener Verfechter der Lehre von der Unbefleckten Empfängnis Mariens. Er setzte alles in seiner Macht stehende daran, dieser Lehre zur allgemeinen Anerkennung zu verhelfen. So publizierte er am 4. September 1483 die päpstliche Bulle Grave nimis. Die Bulle erklärte die Freiheit Mariens von der Erbsünde im Augenblick ihrer Empfängnis. Diese Bulle wurde im Übrigen nie von Rodrigo Borgia für voll genommen.
Der zeitgenössische Senatsschreiber Stefano Infessura schrieb in seinem Diario della città di Roma (Römisches Tagebuch) über Sixtus, dass „keine Liebe zu seinem Volk in ihm gewesen sei, nur Wollust, Geiz, Prunksucht, Eitelkeit; aus Geldgier habe er alle Ämter verkauft, mit Korn gewuchert, Abgaben auferlegt, das Recht feilgeboten; treulos und grausam hat er zahllose Menschen durch seine Kriege umgebracht.“ Den Tag von Sixtus’ Tod nannte er den „glückseligsten Tag, an welchem Gott die Christenheit aus den Händen eines solchen Mannes erlöste“. Nun gilt zwar Infessura als einer der entschiedensten antiklerikalen Kritiker des Papsttums in jener Zeit – es war auch Infessura, der dem Papst unverblümt Homosexualität vorwarf und ihm vorhielt, vor allem seine Lustknaben zu Kardinälen zu erheben. Der Vorwurf, seine Homosexualität habe die Kardinalskreierungen beeinflusst, ist allerdings zweifelhaft, da einige von Infessura in seinem Diaria darüber gemachte Angaben nicht belegbar sind. Sein Übriges Urteil deckt sich jedoch recht gut mit dem der Historiker auch nachfolgender Generationen.
Sixtus betrieb einen rücksichtslosen und ausufernden Nepotismus, mit dem Ziel, seinen engsten Verwandten ein erbliches Herzogtum zu sichern. Er schuf die Voraussetzung, dass dies nach dem Tode von Guidobaldo da Montefeltro mit Urbino tatsächlich gelang. Seine Verwandten wurden zudem so großzügig mit Lehen des Kirchenstaates, Benefizien und Pfründen bedacht, dass Vespasiano da Bisticci später schrieb: „Es hätte diese Wahl beinahe zum Niedergang der Kirche des Herrn geführt“.
Mit der Kardinalserhebung seines Neffen Giuliano della Rovere legte Sixtus IV. den Grundstein für dessen weitere Laufbahn: im Jahre 1503 bestieg dieser als Julius II. den Thron Petri, wurde einer der bedeutendsten italienischen Fürsten und Kunstmäzene seiner Zeit, vernachlässigte dabei aber die geistlichen Belange. Der zeitgenössische Historiker Francesco Guicciardini sagte sehr treffend über ihn, Julius II. habe vom Papst nur das Gewand und den Namen.
Innozenz VIII.
Cibo war 1467 Bischof von Savona und 1472 Bischof von Molfetta. Er wurde am 7. Mai 1473 von Papst Sixtus IV. zum Kardinal mit der Titelkirche Santa Cecilia in Trastevere erhoben.
Seine Wahl zum Papst am 29. August 1484 war weitgehend von Simonie bestimmt. Die päpstliche Politik bestimmte wesentlich Giuliano della Rovere mit. Dieser Neffe des Papstvorgängers Sixtus IV. wurde später selbst Papst und nannte sich Julius II.
Bekannt wurde Innozenz VIII. vor allem durch die Förderung von Inquisition und Hexenverfolgung mit der Bulle Summis desiderantes affectibus aus dem Jahr 1484. Sie bewirkte, vor allem in Deutschland, eine starke Zunahme von Hexenprozessen, noch verstärkt durch den 1487 von Heinrich Institoris unter Mitwirkung von Jakob Sprenger veröffentlichten Hexenhammer.
Innozenz war ein schwacher und unselbstständiger Papst, was nicht nur auf seine angeschlagene Gesundheit zurückgeführt wurde. Aufgrund anhaltender finanzieller Probleme war er teilweise sogar gezwungen, Mitra und Tiara sowie Teile des päpstlichen Kronschatzes zu verpfänden.
Er unterhielt auch gute Beziehungen zur Hohen Pforte, die jedoch hauptsächlich auf eine Verbesserung der Finanzlage hinzielten. In Gegenleistung für jährliche Tributzahlungen und Geschenke, darunter auch eine heilige Lanze, wurde für Sultan Bayezid II. dessen Bruder Cem gefangen gehalten.
Die Tatsache, dass sein Sterbedatum von Girolamo Savonarola korrekt vorhergesagt wurde, führte dazu, dass dieser charismatische Bußprediger, der die Missstände des Kirchenstaates heftig geißelte, einen noch größeren Zulauf erhielt.
Politisch war Innozenz’ Amtszeit auch durch den Streit mit König Ferrante von Neapel geprägt, der ihm den Lehnszins verweigert hatte, militärisch aber übermächtig war. Zudem kam der französische König Karl VIII. nicht wie vereinbart dem Papst zu Hilfe. So musste Innozenz im August 1486 mit Ferrante Frieden schließen, den dieser aber wieder brach. Erst durch die Doppelhochzeit seines 35-jährigen Sohnes Franceschetto Cibo (den er im Alter von 16 Jahren mit einem einfachen Mädchen gezeugt hatte) mit einer Medici, der 14-jährigen Maddalena, Tochter von Lorenzo I. de’ Medici (1449–1492), sowie gleichzeitig seiner Enkelin mit einem Onkel Ferrantes konnte der neuerlich ausgebrochene Krieg 1492 schließlich beigelegt werden.
Innozenz hinterließ viele Kinder (Octo nocens pueros genuit, totidemque puellas; hunc merito poterit dicere Roma patrem – „Acht Buben zeugte er unnütz, genauso viele Mädchen; ihn wird Rom mit Recht Vater nennen können“) und sein Nepotismus zu ihren Gunsten war so verschwenderisch wie schamlos. Seine Nachfahren wurden Herzöge von Massa und Carrara.
Es zeigt sich schon hier deutlich, dass die Vorgänger von Rodrigo Borgia all das an sich hatten und taten, was später nur ihm angelastet wurde.
Nun wurde es Zeit, dass er sich selbst als Papst ins Spiel brachte.