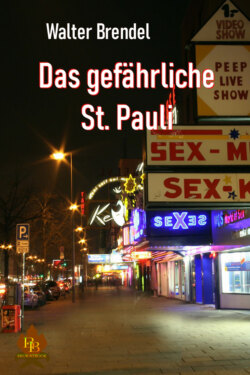Читать книгу Das gefährliche St. Pauli - Walter Brendel - Страница 4
Einführung
ОглавлениеIn St. Pauli soll man in Freiheit leben, wenn man sich an die Regeln hält. Dort zieht es alle hin, die, welche Geld haben und aber auch die, die Geld machen wollen. Und die die Geld haben, werden von denen, die Geld machen wollen, betrogen, erpresst und gar getötet. Es ist schon eine eigene kriminelle Welt hier auf dem Kiez.
St. Pauli. Ein kleiner Stadtteil in der Hafenstadt Hamburg. Nicht erst bekannt, seit den Hans-Albers-Filmen. Ein weltbekanntes Dorf mit der Reeperbahn und der Großen Freiheit. Seit dem 18. Jahrhundert zieht es Matrosen aus alle Welt an. Das Geschäft mit Glücksspiel, Prostitution und frivoler Unterhaltung blüht. Das Hafenviertel ist ein eigenes Universum.
Hier wird mit Theatern, Shows und Kneipen das große Geld verdient. Und natürlich auch mit Bordellen, die sich bereits hier im 19. Jahrhundert in größer Zahl etabliert haben. Jeder, gier irgendwie reich zu werden.
An der Grenze zu Altona gelegen, siedelten sich auf St. Pauli Menschen und Gewerbe an, die eigentlich gesellschaftlich eher unerwünscht waren. Dies führte dazu, dass in den dreißiger Jahren die Amüsierbetriebe in Hafennähe geradezu aus dem Boden schossen. Auch das Rotlichtgewerbe war bald in unmittelbarer Nähe zum Hamburger Hafen zuhause. Der Grund: potenzielle zahlungskräftige Kundschaft war durch die internationalen Seeleute, die mit ihren Schiffen im Hamburger Hafen festmachten, garantiert.
In den fünfziger Jahren wurde St. Pauli durch die Filme von Hans Albers und Freddy Quinn auch in den Kinos zu einem Synonym für das leichte Leben und erlangte weltweite Berühmtheit. Ganz nach dem Motto „auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ wollte sich schon bald jeder Hamburg Besucher amüsieren, im legendären Café Keese das Tanzbein schwingen oder im Hippodrom eine Runde auf echten Pferden reiten.
In den sechziger Jahren begannen für die Beatles in den legendären Clubs der Reeperbahn die ersten Erfolge. Der „Star Club“, der „Kaiserkeller“, das „Top Ten" und das „Indra“ wurden unter anderem regelmäßig von den Pilzköpfen aus Liverpool bespielt und erzeugten Aufmerksamkeit. Das war der Startschuss für eine unvergleichliche musikalische Weltkarriere.
In den siebziger und achtziger Jahren begann zusehends der Untergang von St. Pauli. Rivalisierende Zuhälterbanden wie „Die GmbH“ oder „Die Nutella Bande“ trugen ihre Zwistigkeiten offen auf den Straßen von St. Pauli aus und lockten allerhand zwielichtige Gestalten an. Prostitution, Drogen, Waffenhandel, Hehlerei und Gewalt waren an der Tagesordnung. Der Ruf von St. Pauli kehrte sich bedauerlicherweise ins Negative. Das Hamburger Partyleben verlagerte sich nach Pöseldorf und Harvestehude.
Der traurige Höhepunkt waren die Morde im Hamburger Polizeipräsidium durch den Auftragskiller „Mucki“ Pinzner im Jahre 1986. Pinzner erschoss einen Staatsanwalt, seine Frau und später sich selbst.
Durch den mutigen Schritt der Stage Entertainment GmbH, die im ehemaligen Operettenhaus an der östlichen Spitze der Reeperbahn das Musical „Cats“ in Hamburg etablierte, begann für den Kiez in Hamburg der Weg zurück zu neuem Ruhm und Glanz.
Das Schmidt Theater und Schmidts Tivoli wurden eröffnet. Das St. Pauli Theater und das Panoptikum - Wachsfigurenkabinett präsentierten sich neu und rund um die Reeperbahn eröffneten angesagte Clubs und Diskotheken.
Die speckigen Buden auf dem Spielbudenplatz wurden abgerissen. Die freie Fläche wird seitdem für Veranstaltungen wie das Reeperbahnfestival, die Food Trucks, den St. Pauli Nachtmarkt, den Schlagermove oder den Weihnachtsmarkt „Santa Pauli“ genutzt.
Rund um den Hans-Albers-Platz zogen Kneipen wie das Albers Eck, die Rutsche, das Mary Lou’s und der Silbersack ein, die am Wochenende tausende von Feierwütigen anlockten. All diese legendären Bars und Kneipen sind bis heute gut besucht und bei jüngeren sowie älteren Partygängern gleichermaßen angesagt.
Hier kann man sich unbeschwert in das Hamburger Nachtleben stürzen und wissen, welche Clubs und Theater man besuchen können und welche lieber gemieden werden sollten.
Über Generationen hinweg hat sich die „Meile“ den Ruf als lustvolles Amüsierviertel erarbeitet. Es gibt alles für jeden Geschmack und meistens findet man auch noch ein bisschen mehr.
Der Name stammt von den Reepschlägern, den Taumachern, die für die großen Schiffe die langen Haltetaue flochten und dafür lange gerade Straßen benötigten.
Die Reeperbahn ist übrigens die zweitbekannteste Straße der Welt – nach der Wall Street. Sie ist das Zuhause der Nachtschwärmer, Kneipengänger, Theater- und Musical-Besucher und einer ganzen Meute von Partypeople, die losziehen, um ihr Vergnügen zu finden. Dass sich diese unterschiedlichen Besucher mischen und gemeinsam oder wieder getrennt weiterziehen, liegt in der Natur der Sache und macht diesen wahnsinnigen Reiz aus.
Doch das heimliche Herzstück des Kiez ist sein Erotik-Angebot. Sex-Shops, Table-Dance Bars und Film-Entertainment bestimmen das Bild. Dazu gruppieren sich die berühmte Davidstraße und die Herbertstraße mit ihren hübschen Prostituierten, zu der Frauen keinen Einlass haben. Doch längst hat sich der Kiez emanzipiert, auch Frauenentertainment hat regen Zulauf.
Aber was den Kiez wirklich auszeichnet, ist die vorhandene Toleranz gegenüber Nationen, Glaubensrichtungen, Outfits und Weltanschauungen. Hier kann jeder sein, was und wie er will. Natürlich gibt’s auch mal Streit, das ist bei der täglichen Masse an Besuchern in ihren jeweiligen Zuständen nicht zu verhindern. Dennoch ist der Kiez ein sicheres Pflaster, denn die grünen Jungs (mittlerweile schwarz gewandet) sind meist in der Nähe oder es wird auf klassische Weise geschlichtet. Denn wer Ärger macht, bekommt auch welchen.
Für einen erfolgreichen Abend benötigt man eine Menge Geld. Von den Reeperbahnfilialen der Haspa werden durchschnittlich 120 Euro pro Person abgebucht. Freitags von 0 bis 24 Uhr verbuchen die Automaten 70.000-90.000 Euro. Da hilft es schon vorher zu sparen und sich eventuell Freikarten für Diskos im Internet zu erwerben. Wer beim Männerabend sein Glück im Casino oder am Spielautomaten herausfordern möchte, schont seinen Geldbeutel, indem er vorab online Strategien testet – ein Bonuscode hält die Einsätze in den virtuellen Spielewelten gering.
Wertsachen sollte man lieber nicht mitnehmen, da an einem normalen Wochenende auf der Davidwache 120-200 Strafanzeigen eingehen. Pro Woche kommen im Schnitt 80-120 Meldungen wegen Diebstahl zusammen.
Prostitution in Hamburg gehört seit Jahrhunderten zum gesellschaftlichen Leben der Hafenstadt. Die Hurentour präsentiert nun einen interessanten neuen Blick auf das Rotlichtviertel St. Pauli, bei dem dieser wichtige Aspekt der Hansestadt anschaulich näher gebracht wird.
Aufklärung über Prostitution funktioniert hier mal anders: nicht staubig und trocken, sondern lebendig und mit vielen Hintergründen, dabei sachlich-seriös und genau dort, wo die Prostitution allgegenwärtig ist: rund um die Reeperbahn des Hamburger Vergnügungs- und Rotlichtviertels St. Pauli. Die auffällige rot-gelbe Flügelmütze war einst Pflicht für die damaligen Huren.
Die Reeperbahn ist die zentrale Straße im Vergnügungs- und Rotlichtviertel des Hamburger Stadtteils St. Pauli. Sie ist etwa 930 Meter lang und verläuft vom Millerntor in Richtung Westen bis hin zum Nobistor (Hamburg-Altona), wo sie in die Königstraße übergeht. Die große Anzahl an Bars, Nachtclubs und Diskotheken, vor allem aber das auf und um die Reeperbahn konzentrierte Rotlichtmilieu, hat ihr den Spitznamen „die sündigste Meile der Welt“ eingebracht.
Parallel zur Reeperbahn verläuft etwas versteckt im Süden die bekannte Herbertstraße, eine Bordellstraße, die nur zu Fuß und durch zwei Sichtblenden hindurch betreten werden kann.
Die Reeperbahn erhielt ihren Namen von Taumachern und Seilern, den sogenannten Reepschlägern, die für die Herstellung von Schiffstauen eine lange, gerade Bahn benötigen. Dementsprechend gibt es auch in anderen Städten Straßen dieses oder ähnlichen Namens, beispielsweise in Kiel, Elmshorn, Schleswig, Stade, Buxtehude, Bremen (Reepschlägerbahn) oder im dänischen Aalborg. Auf einer Hamburg-Karte von 1791 ist dies nördlich des „Hamburger Bergs“ mit dem Namen „Reepschläger Bahn“ nebst den „Reepschläge-Hütten“ eingetragen.
Der Begriff Reiferbahn ist Hochdeutsch für Reeperbahn, bedeutet also dasselbe, während auf einer Seilerbahn geringwertigere Seile produziert wurden. Daher ist eine Seilerbahn auch nicht länger als etwa 50 m, während eine Reeperbahn mindestens über 300 m Länge verfügt. Die letzte echte auf Hamburger Gebiet verbliebene Reeperbahn ist heute in Hamburg-Hausbruch auf der südlichen Elbseite zu finden. Reifer und Reeper sind vermutlich auf protogermanisch *raipaz zurückzuführen, was auch denselben Vorläufer für englisch rope und niederländisch reep darstellt.
Die Reeperbahn lag bis zur Aufhebung der Hamburger Torsperre 1860/1861 und der sukzessiven Ausdehnung Hamburgs in der Vorstadt Hamburger Berg (alte Bezeichnung St. Paulis) genau zwischen den beiden Städten Hamburg mit der Stadtgrenze Millerntor und Altona mit der Stadtgrenze Nobistor auf Höhe der Einmündung der Großen Freiheit. Menschen und Gewerbe, die in beiden Städten unerwünscht waren, konnten sich so in unmittelbarer Nähe ansiedeln und waren dennoch in das Stadtleben eingebunden. Eine erste Wohnbebauung wurde 1826–1827 nach Entwürfen von Wimmel als kleinteilige Wohnhäuser im Stil einer Hausreihe auf der Nordseite der Reeperbahn zwischen Millerntor und dem Hamburger Berg vorgenommen. Für die in den 1880er Jahren angelegten Querstraßen (Hein Hoyer-Straße, Bremer Straße) wurden später einzelne Häuser abgerissen.
Ein kleiner historischer Fehler ist der, dass die Hamburger Reeperbahn angeblich nicht die eigentliche Bahn der Reeper war, sondern die im Vergleich zur Reeperbahn schnurgerade verlaufende parallele Simon-von-Utrecht-Straße. Zwischen diesen beiden liegt noch heute die Seilerstraße; deren Name ist Programm. Der Begriff „Reeperbahn“ steht also – neben Produktionsstätte für Tauwerk und Straße in Hamburg – heute als Synonym für: „Die sündige Meile“ bzw. ihr näheres Umfeld, meist aber einfach nur liebevoll „der Kiez“ genannt. Beim „Bummel über die Reeperbahn“ beschränkt man sich üblicherweise nicht auf die Straße Reeperbahn allein.
Nachdem die Anzahl der Gewaltdelikte auf St. Pauli kontinuierlich angestiegen war, wurde 2007 ein Waffenverbot für die Reeperbahn und die Seitenstraßen erlassen, Waffen, Messer und andere gefährliche Gegenstände mitzuführen. Die ansässigen Geschäfte wurden aufgefordert, keine Glasflaschen mehr zu verkaufen. Durch das Glasflaschenverbotsgesetz wurde 2009 auch das Mitführen von Glasflaschen und Gläsern in den Wochenendnächten und vor Feiertagen vollständig verboten und kann mit bis zu 5000 € Geldbuße bestraft werden. Gelbe Hinweisschilder grenzen das Gebiet ein. Ein Rückgang der Gewalt ist durch diese Maßnahme allerdings nicht festgestellt worden.
Dass dies die Straße der tollsten Gegensätze ist, dass hier das bürgerliche Restaurant neben der Kaschemme, das elegante Nachtlokal neben dem vulgären Hippodrom steht – das ist nichts Neues und doch immer wieder erregend im Wechsel der Atmosphäre, an dem Ausgleich aller sozialen Gegensätze. Der vollgefressene Gent erregt zwischen Chinesen, Dirnen und Arbeitern nicht ein Blinzeln – im Hippodrom bei dreißig Pfennig der Ritt, ‚Galopp eine Mark‘, fallen alle gleichmäßig vom Gaul, nicht nur die dazu eigens angestellten Mädchen mit endlosen Seidenbeinen; das Primat der Brieftasche ist aufgehoben.
Das soll erst mal als Einleitung genügen. Ich denke, dass die Leser nun wissen, in welcher Umgebung unser Buch nun handelt und was in St. Pauli beheimatet ist.
Kommen wir zu Kehrseite des Vergnügens und beschäftigen uns mit Aufstieg und Handeln der Kiezgrößen.