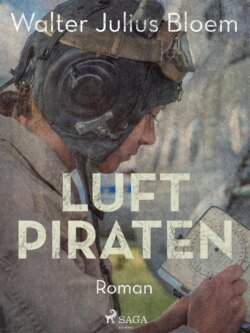Читать книгу Luftpiraten - Walter Julius Bloem - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Eisvogel
ОглавлениеGegen Ende eines regnerischen Septembers kam der Berichter der „New York Times“, Herr Giles, abends zum Oberst Pasquali herausgefahren, nach einer zehntägigen Abwesenheit. Giles schlug seine Jobbermütze an den Haken und ging höchst übelgelaunt zu Pasquali herein, der einer seiner Sekretärinnen ernsthaft diktierte. Eine grosse Tigerdogge erhob sich knurrend vom Teppich. — „Du hast mir auf die Redaktion eine Nachricht geschickt, ich möchte gleich nach der Heimkehr zu dir kommen. Was ist los, was für eine Pappsensation hast du wieder auf Vorrat?“
Pasquali schob in guter Laune einen Stoss von Briefen und Anordnungen beiseite und erkundigte sich teilnahmsvoll nach Giles’ Ergehen.
In den vergangenen Wochen hatte Giles mit vielen Pressevertretern am „Einfliegen“ einer neuen Linie teilgenommen, London—Sidney, neunzehntausend schnurgerade Meilen mit Zwischenlandung in Kalkutta. Ist das etwa nichts Besonderes? Der Australienschweber, mit Kabinen für dreihundert Fluggäste, besass die allermodernsten Einrichtungen für die Fernsteuerung, neue Erfindungen spielten Katze und Maus, und endlich gelang es dem tätigen Menschengeist, das gänzlich anonyme und mechanische Verkehrsmittel zu verwirklichen, die Sehnsucht eines Jahrhunderts. Dazu waren wochenlange Vorbereitungen nötig gewesen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit steuerten Feuereissen und Hutton Price den neuen A 3348 im Handbetrieb zwanzigmal über die Strecke, in riesigen, besonnten, sturmfreien Höhen, und selbstverständlich mit Rekordgeschwindigkeiten. Dann war es so weit, dann hatten die Fernsteuerungsmaschinen in Konstantinopel, Kalkutta, auf den Philippinen und in Sidney sich mathematisch eingestellt, die Öffentlichkeit wurde zugelassen und die Flieger verliessen ihre Zelle. Denn dieser neue Gigant raste ohne jede menschliche Führung durch die eisige Höhe, und zwanzig Minuten vor jeder Landung wurden die Flieger durch Klingelzeichen benachrichtigt, dass der A 3348 zwar nicht ihre Hilfe, aber doch ihre Aufmerksamkeit für das Niedergehen in Anspruch zu nehmen wünschte. Sie also, denen der Ruhm des Ikarus noch zwischen den Schultern brannte, ein vergilbter Ruhm, sie konnten schlafen, lesen, Karten spielen, mit den weiblichen Fluggästen äugeln, nach Belieben und wie es ihnen passte, der Australienschweber jedenfalls bedurfte ihrer Mitwirkung nicht. Drunten in der gähnenden Tiefe rollte die Erde vorbei oder die grellen Flächen unendlicher Wolken. Es war erreicht, es war restlos gelungen, dem fliegenden Businessc) jegliche Romantik auszutreiben.
So erzählte Giles. Der Oberst rieb die Handflächen aneinander und klopfte dem Freund auf die Schulter. „Du hast ganz recht. Es ist ein Grundsatz, Lieber. Werde Normalmensch! Die Zivilisation ist eine Hängematte, rings um die ganze verwendbare Erde. Wir knüpfen das Netz immer enger, immer feiner — warum und weshalb, das weiss ich auch nicht. Simson, das technische Jahrtausend ist über dir! Aber ist es nicht grossartig schön, dass ein Arbeiter genau so gut angezogen ist wie ein reicher Mann, du kannst eine Prinzessin von meiner Tippmamsell nur unterscheiden, wenn du sehr genaue Studien an derartigen liebenswürdigen Objekten betreibst, und die ganze Kruste quälender, schlecht riechender Armut wird von diesem rotierenden Kuchenteller langsam heruntergeputzt. Darum geht es, das ist vielleicht auch ein Sinn, so gut und vielleicht besser als die Tempel in Europa und Asien.“
Der Grog kam. „Wir werden philosophisch“, sagte Giles und baute sich bequem in den grünledernen Klubsessel ein, „da ich aber weder arm noch gequält bin, so hoffe ich, noch schlecht rieche, so vollzieht sich diese Entwicklung gegen mich. Ich möchte von meinem kurzen und vergnügten Dasein etwas haben, was ich leider nicht mit jedermann teilen kann, weil nicht jeder dafür Verständnis aufbringt. So geht es mir. So geht es Feuereissen. Hutton Price hat sich über die neuen Errungenschaften dermassen ausfallend geäussert, dass die gelehrige Kleopatra künftig nur einem Herrenpublikum vorgeführt werden kann.“
Pasquali lachte und liess die Hand über den Kopf seiner Dogge streichen. „Ich glaube, Giles, für drei Monate kann dir und deinesgleichen geholfen werden.“
Der Oberst zeigte über seinen Schreibtisch, der mit Papieren bedeckt war. In den Kreisen der OAW war ein Plan aufgetaucht, künftig zu günstiger Jahreszeit Erholungsflüge über die Polargebiete zu veranstalten. Zunächst handelte es sich darum, dass eine Flugexpedition im nächsten Südpolsommer die meteorologischen und erdmagnetischen Bedingungen der Antarktis erforschen sollte. Das Unternehmen stand vor unbekannten Bedingungen, einige Rekordflüge im vergangenen Jahrzehnt brachten nur spärliche Aufklärung. Man war auf Vermutungen angewiesen, wie sich die drahtlose Kraftübertragung dort bewährte. Auf jeden Fall griff Pasquali die Anregung auf, es bot sich eine seltene Gelegenheit, erprobten Verkehrsfliegern Abwechslung von ihrem immer gleichen, eintönigen Dienst zu bieten. „Machst du mit, Giles? Ich habe Feuereissen und Bob heute nachmittag über Persien drahtlos erwischt, sie heulten vor Begeisterung. Für drei Monate bist du ein Held!“
Denn so lange sollten die Forscher sich im ewigen Eise aufhalten, drei Monate des Polartages, an dem die Sonne schräg oben ein bisschen rund um den Himmel wanderte, neunzig Tage mit Pelz, Büchse und Filmapparat. Abends, was dort so Abend hiess, einen heissen Grog im geheizten Flugzeug, Tanzmusik aus London und jeden Mittag einen bangen Anruf aus der bewohnten Welt: Lebst du immer noch, Geliebter, ich habe solche Sorge, dass du dich erkältest ...
„Hm“, machte Giles, „wenn du einen andern Tintenbullen ausser mir zulässt, Pasquali, dann erwürge ich dich mit meinem Zeigefinger. Über die Stange Gold kannst du dich mit meinem Chef unterhalten. Das ist ein feines Vorhaben. Abenteurer auf Zeit, mit dem Rückzugsbillett in der Tasche, und wenn die Pioniere das Feld räumen, rückt das Kapital an.“
„Was übrigens von jeher so gewesen ist, Giles.“
Der Berichter schwärmte schon mit rollenden Augen. „Das gibt mal endlich wieder bildschöne Filmchen! Die Welt im Licht, naturweisse Woche, ich wette: wenn mein Polfilm in den Kinos läuft, muss der Normalmensch Schneebrillen aufsetzen. Herrlich. Das machen die natürlich später in fliegenden Sanatorien mit Glasdach, Aussichtsraum und therapeutischer Behandlung. Bordarzt, Bordgeistlicher, alles da. Was noch? An dieser Stelle da unten, jawohl meine Dame, gerade da, wo der Eisbär steht, nein, mein Herr, ich glaube nicht, dass der Bär eine Atrappe ist, erfror vor vielen Jahrzehnten der berühmte Südpolforscher Ix Ypsilon, Ober, stellen Sie die Heizung ein halbes Grad höher, die Herrschaften frösteln ...“
In einer windgeschützten Korallenbucht des Feuerlandes — sie führte den verheissenden Namen Buen Suceso — wo die Wellen des Atlantik eilig meerwärts liefen, erfolgte Mitte November der Start. An der Sache war weiter nichts Besonderes; heutzutage brauchten die Schweber sich nicht mehr mit Betriebsstoff zu belasten, da der drahtlose Starkstrom sogar bis zum Mond hinauf, wenn sie dorthin hätten fliegen können, unausgesetzt hinter ihnen dreinlief.
Der Zehntonnen-Schweber, der die Antarktis zugunsten der praktischen Vernunft aus ihrem bisher ewigen Schlummer reissen sollte, war mit jeglicher Bequemlichkeit ausgerüstet, die für anspruchsvolle Menschen der Zeit zur Ertragung einer monatelangen Trennung von der übrigen Menschheit genügte. Der „Eisvogel“ besass sechs starke Elektromotoren und konnte auf dem Wasser, auf dem Eis wie auf dem festen Land aufsteigen und niedergehen. Diese modernen Polarforscher konnten sich in ihr elektrisch geheiztes Haus zurückziehen, falls es draussen zu ungemütlich werden sollte. Für die Mussestunden standen hundert der spannendsten Kriminalromane zur Verfügung. Die Forscher konnten den durchfrorenen irdischen Leib in einer Badewanne erquicken, die je einen Hahn für warmes und kaltes Wasser besass. Unvermeidlich war, dass man sich alle paar Tage einige Eisblöcke auftauen musste, je nachdem der Reinlichkeitsfanatismus sich auf tägliches Bad ausdehnte oder auf einfaches Rasieren beschränkt blieb.
Um diesem üppigen Unternehmen einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben, wurde eine geologische Autorität mitgenommen, Monsigny mit Namen, ein kleiner, unfreundlicher, überaus pedantischer Herr aus Chikago, der sehr bald feststellen musste, dass er eigentlich nur zur Verzierung diente. Als einziger Reporter war Giles dabei mit seinem spitzen Vogelgesicht, er hatte schon zahllose Expeditionen in sämtliche noch leidlich unzivilisierten Gegenden der Erde mitgemacht und in Wort und Film verherrlicht. Er bekam einen Filmapparat und fünfzigtausend Meter Negativ mit und sollte derartige Lichtfluten in die Kamera bannen, dass ein Schrei über den Erdball hallen würde: Auf ins ewige Eis mit Vergnügungsschwebern der OAW! Den Pol sehen — und sterben.
Alles Reklame ...
Reklame war auch der Neger Jim, den man telegraphisch vom Urlaub geholt hatte, mit Kleopatra, versteht sich. Jim war ohne den geringsten Zweifel der erste Nigger, der je das weisse Land betrat. Da er sich für alle Dienste gleich gut eignete und mit seinem schwarzen Gaunergesicht eine unschätzbare Werbung für die filmische Ausbeute des Unternehmens bot — man bedenke ein Bild — Jim zerhackt einen Eisblock für die Warmwasserversorgung! — so konnte auf seine doppeltbepelzte Mitwirkung nicht verzichtet werden.
Es war alles da, alles eingefädelt, um das mit grossem Trara aufgezogene Unternehmen in den Blickpunkt zu rücken. Nur die Zeitungen, die von der OAW keine Inserate erhielten, fielen mit bissigem Spott über diesen Südpolflug her: man stelle sich an, als ob man noch in der Benzinzeit lebe, heutzutage, wo ein Polflug nicht gefährlicher war als der Aufenthalt in einem Sanatorium! — Diese Zeitungen machten, ohne es zu wollen, für die Verkehrspläne der OAW die allerbeste Reklame.
Und zu solchem Rummel mussten sich zwei brave Flieger hergeben!
Nur auf die Mitnahme eines weiblichen Wesens verzichtete man nach heftigen Meinungskämpfen, um die Friedensliebe der aus sechs Herren unter vierzig Jahren bestehenden Besatzung keiner allzu schweren Belastungsprobe zu unterziehen.
Nach einer sehr unruhigen Nacht erwachte Loie ziemlich spät am Morgen. Vor ihrem Fenster beschäftigte sich der graue Novembersturm mit den triefenden Lindenästen. Es war nasskalt, und Loie hatte die Grippe.
Während die junge Dame unfroh frühstückte, bemühte sich ihre Zofe um eine Verbindung mit der Buen-Suceso-Bucht. Endlich kam Hutton Price an den Apparat. „Lieber Bob, ich habe diese Nacht solche entsetzlichen Sachen geträumt, tu mir den einzigen Gefallen und fliege nicht mit.“
„Was hast du denn geträumt, Loie? Erzähle mal. Übrigens sitzt Kleopatra auf meiner Schulter, damit sie dir noch ein Küsschen geben kann.“
Loie erzählte eine unglaubwürdige Geschichte mit mehreren Eisbären und Walrossen, die eben nur darum glaubwürdig erschien, weil sie ausdrücklich als Traum bezeichnet wurde.
„Das ist ja hochinteressant. Aber warum soll ich deshalb nicht mitfliegen?“
„Bob“, bettelte sie, „liebster Bob, ich habe so eine schreckliche Angst um dich. Hier ist ein schauerliches Unwetter.“
„Ja ja, Loie, ihr habt ja auch Winter. Bei uns wachsen die Narzissen auf der freien Handfläche.“ Hutton stellte mit Genugtuung fest, dass der Verkehrston sich ganz erheblich zu seinen Gunsten verändert hatte. „Übrigens entschuldige: in fünf Minuten wird der Fernsprecher für den Rundfunk gesperrt.“
Sie schrie: „Bob! Wenn du nicht mitfliegst, heirate ich dich!“
Während einer ganzen Weile schnappte Hutton hörbar nach Luft.
„Furchtbar nett von dir“, sagte er endlich, „ich vermute aber, Loie, wenn ich auf dein bestechendes Angebot hin in der letzten Minute meine Kameraden im Stich lassen würde, dann würdest du mich erst recht nicht — —“
In den elektrischen Wellen entstand ein fürchterliches Geschimpfe, deutlich unterschied Loie eine Stimme: „Komm heraus, Bob! Schluss! Die andern klettern schon in die Kiste.“
Bobs Stimme schnalzte: „Kuss, Loie. Von jetzt ab bist du meine Braut. Rufe mich morgen mittag am Südpol an. Wie sagt man, Kleopatra?“
Kleopatra kreischte: „Loieloieloieloie! Kuss, Loie! Tjä hahi! Adioo!“
Im nächsten Augenblick ertönte in Loies Zimmer der Lautsprecher. „Hallo! Hallo! Hier Buen-Suceso-Bucht! Der Polarflug beginnt! Es ist ziemlich stürmisch und regnerisch, weit draussen schäumt der Atlantik über dem Golf. Der ‚Eisvogel‘ schwankt festgemacht am Strande —“ Loie vergrub sich fröstelnd in ihre Kissen und Decken, während die unerbittliche Stimme den fernen Hergang bis in alle Kleinigkeiten zu ihr herübertrug. Sie fürchtete um ihren Freund, den sie wirklich nicht liebte, und sie hoffte, irgendein leichter Unglücksfall werde noch in letzter Minute den Start durchkreuzen. Sie hörte die Wellen des Atlantik leise plätschern, dann ward die Stimme des Ansagers fast überschollen vom Heulen der sechs Elektromotoren — „als letzter kommt der zweite Flieger, Herr Hutton Price aus Fremon, Nebraska, mit seinem Papagei Kleopatra zum Strande hinab. Er hat sich ein wenig verspätet, weil er, wie man sich erzählt, noch in der letzten Minute mit einem jungen Mädchen in Europa ein wichtiges Gespräch führen musste. Achtung! Achtung! Die Pflöcke werden gelöst. Der Schweber gleitet vom Strand —“
Der Ansager schwieg. Das Heulen der Motoren entfernte sich, bis nur noch ein glasfeines Singen zu hören war, dann verlor sich auch dies. „Der ‚Eisvogel‘ wendet gegen den Wind. Schneller, immer schneller. Die Bugwelle überschäumt ihn — jetzt: er schwebt! Jetzt entrollen sich an den beiden Flügelspitzen die Starkstromantennen. Am Ufer winkt man. Hören Sie! Der ‚Eisvogel‘ fliegt über den Strand —“
Noch einmal lärmte in beängstigender Nähe das schrille Rauschen, deutlich unterschied Loie das Knattern der Luftschrauben. Dann, als wieder alles stille war, beendigte der Ansager seine Tätigkeit mit dem trockenen Spruch: „Wir wünschen den kühnen Fliegern eine gesunde Heimkehr. Die Hörer werden nötigenfalls daran erinnert, die Antenne zu erden.“
Loie blieb liegen mit den Empfindungen eines Menschen, der vom Kirchhof zurückgekommen ist. Sie sagte sich hundertmal, dass dort unten der Sommer sein Licht verstreute. Sie wiederholte sich, dass sie Hutton Price nicht liebte. Sie hätte aber auch seine Werbung ruhig annehmen sollen; unter den Gecken und Geschäftemachern, die sich um sie drängten, fand sie keinen, der ihr lieber war.
Der Tag schlich hin. Spät am Abend berichtete der Rundfunk, der „Eisvogel“ habe die Arktis erreicht und schwebe über dem ewigen Eise, an Bord sei alles wohl. Einige Abendzeitungen, die keine Inserate von der OAW erhalten hatten, benörgelten den Tamtam, der um diesen harmlosen Spazierflug gemacht wurde.
Loie fühlte sich am Morgen des folgenden Tages viel besser, sie stand auf und versuchte gegen Mittag eine Verbindung mit dem „Eisvogel“ zu erhalten. Die OAW hatte, um magnetische Störungen zu verhindern, in der Buen-Suceso-Bucht eine Funkanlage errichtet — doch obwohl Loie von dort aus bedient wurde, misslang die Verständigung. Es wurde ihr aber versichert, der Schweber funke allstündlich seinen Standort.
Durchs Gewölk bahnten sich zuweilen die müden Strahlen der Novembersonne einen Weg. Das junge Mädchen trank mit Fräulein Spring, der Gesellschafterin, im Wintergarten den Tee. Dann kam ihr Onkel Edward, schob seinen kahlen Eulenschädel herein und zerbröckelte ein wenig Gebäck in seine Tasse. Loie besass zwei Drittel der Anteile an der Lux-Mtschj., und da sie dem „alten Kolkraben“ nicht übermässig traute, so legte sie Wert auf gelegentliche Geschäftsberichte. Und da sie zu unruhig war, um den Abend müssig zu vertreiben, so fuhr sie im geschlossenen Wagen mit Fräulein Spring zur Oper nach Amsterdam.
Als sie das Theater verliessen, gellten Ausruferstimmen über den weiten Platz. „Extrablatt! Extrabladet!“ Die herausströmende Menge ballte sich zu Klumpen. „Wettersturz über der Antarktis!“ Loie riss das Fenster herab, durch das die nasse Herbstluft ins Innere des Wagens wirbelte, zerrte aus ihrem Täschchen ein Guldenstück hervor. Ein Junge sprang aufs Trittbrett, nahm das Geld, ein Zettel flatterte herein, der Junge brüllte schon wieder: „Wirbelsturm über der Antarktis. Der ‚Eisvogel‘ verloren.“
Loie wurde weiss bis an die Haarwurzeln. Das Papier in ihren Händen zitterte. „Bitte, lesen Sie, Fräulein Spring.“
„Unvermutet hat sich ein Zyklongebiet über den Südpol geschoben. Über Pazifik und Atlantik toben westliche Regenstürme. Die letzten Nachrichten des ‚Eisvogels‘ melden um fünf Uhr mitteleuropäischer Zeit schweren Schneesturm. Der Schweber bittet wiederholt, ihm seinen Standort zu peilen. Seit vielen Stunden fehlt jede Nachricht. Die amtlichen Stellen befürchten eine Katastrophe. Oberst Pasquali hat den Schweber angewiesen, nach Möglichkeit umzukehren. Der ‚Eisvogel‘ antwortet nicht mehr.“
„Nur nach Hause —“ flüsterte Loie. In Bloemendaal eilte sie, ohne den Mantel abzulegen, an den Fernsprecher und verlangte eine Verbindung mit der Buen-Suceso-Bucht. Aber in dieser Stunde umlagerten tausend Weltzeitungen und Agenturen nachrichtenhungrig die Funkanlage in der Bucht, deren fröhlicher Name nun auf einmal wie ein Hohn ins Herz stach. Ebensowenig glückte eine Verständigung mit Coney Island, von wo aus sämtliche Schweber der OAW zu erreichen waren. Loie klingelte den Postdirektor in Amsterdam aus dem Schlaf, sie bot tausend, dreitausend Gulden für eine einzige, noch so kurze Verbindung. Schliesslich liess sie sich erschöpft in einen Sessel fallen, und da sie durch keinen Zuspruch beruhigt werden konnte, so war es eine Wohltat für ihr aufgescheuchtes Seelchen, dass sie noch lange vor der Morgendämmerung in einen schweren Schlaf versank. Fräulein Spring rief einen Diener, Loie wurde auf ein Sofa gelegt, nachdem man ihr die Schuhe ausgezogen hatte.
Die letzte Nachricht, die vom „Eisvogel“ eintraf, war die Feststellung, dass er über dem Polargebiet nach Westen abtrieb. Als er am folgenden Tage auf keinen der zahllosen Anrufe Antwort gab und als er am übernächsten Tage weder einer Menschenseele zu Gesicht kam noch in der Bucht gelandet war, wurde das Polflugzeug für überfällig erklärt.
Am gleichen Abend bestieg Loie Lux den fahrplanmässigen Schweber nach New York. Dort angelangt, stellte sie eine riesige Summe für die Suche nach den Verschollenen zur Verfügung. Schon brausten Pasqualis Kriegsflieger zum Kap Horn, alle nur denkbaren Anstalten wurden getroffen. „Ich sichere Ihnen jede Unterstützung zu, Oberst“, bat Loie am Fernsprecher, „Geld spielt gar keine Rolle.“
„Wir starten morgen früh in der Buen-Suceso-Bucht, Fräulein Lux“, gab der Oberst sachlich zurück, „jedenfalls wird nichts versäumt.“
Eine Stunde später stieg Loie in die Kabine eines sogenannten Blitzschwebers, winzig klein und von der Form eines Torpedos. Dieser Blitzer flog mit der Geschwindigkeit des Schalles dahin, während er von zwei Flügelstummeln und grossen Schwanzrudern gesteuert wurde. Noch in der Nacht betrat Loie das Ufer der Bucht.
Sie setzte es durch, dass der Oberst ihr in seinem eigenen Flugzeug einen Platz abtrat. Das tat er nicht gern, diese überspannte und offenbar sensationshungrige Dame mit den freudlosen Augen gefiel ihm nicht. Aber die OAW finanzierte den Hilfsflug, und ihrem Verlangen musste er nachgeben.
Das Geschwader bestand aus ausgesucht schnellen Maschinen, die imstande waren, das gesamte Polargebiet im Zeitraum von fast zwei Tagen zu umkreisen. Alle diese Schweber konnten senkrecht landen und aufsteigen.
Am Morgen befand sich Loie schon hoch über dem sonnenbeleuchteten Atlantik. Das Unglückswetter, in das der „Eisvogel“ hineingeflogen, war so plötzlich gewichen, wie es gekommen. Vorn in der Führerzelle sass der Oberst mit einem seiner besten Flieger, in den dünnen Flügeln sorgten zwei schweigsame Funkleute für die Motoren; dicht über den Kufen und Rädern befand sich eine riesige, in grösster Hast eingebaute Glasplatte, durch die hindurch zwei Ausguckposten Land, See und Eis überschauen konnten. Zur Rechten hielt das ganze Geschwader sich in gleicher Höhe und Linie, weit auseinandergeschwärmt, und schon hier wurde der Ozean überwacht, der drunten so friedlich funkelte. Loie, das verwöhnteste Mädchen ihrer Zeit, hockte auf einem Strohsack in dem einzigen Schlafraum für die Ablösung und besorgte die Verpflegung ihrer Schützlinge. Es war so seltsam, sie hatte eine Aufgabe, sie war hier kein nutzloser Mittelpunkt, niemand kümmerte sich um sie.
Immer mehr Eisberge drunten, endlich im Süden ein weisser Saum, endlich drunten das weisse Land.
In einer genau vereinbarten Bewegung schwenkte das Geschwader nach Osten ein, der Vorgang dauerte über eine Stunde, denn von Flugzeug zu Flugzeug wurde ein Abstand von etwa drei Meilen eingehalten. Jetzt flogen sie immer der Sonne nach, die kalt und glanzlos durch die violetten Blendscheiben hindurchschien.
Ab und zu polterte ein Abgelöster in den Schlafraum, kroch in seine Hängematte oder warf sich auf seinen Strohsack.
Nichts geschah. Loie ging zuweilen an den Ausguck und starrte hinunter auf die unabsehbar weiten, in unausdenkbaren Formen besonnten und überschatteten Eisfelder. Dann zog das Geschwader über einen riesigen, blauen, von zahllosen Eisbergen bedeckten Golf, glitt tiefer, kreiste forschend und suchend um die erloschenen Vulkane des Viktorialandes und flog abermals hinaus ins weisse Nichts.
Loie schlief und wachte. Nach vierzig Stunden des ewigen Tages waren die Randgebiete der Antarktis, ihre Zipfel und Buchten ohne Ergebnis abgesucht. Der Oberst verständigte sich mit seinen Fliegern, die sich „wohl und munter“ meldeten, und zog in engerem Kreise dem Pole zu.
Am dritten Tage klagten einige Flieger über Ermüdung. Dann ging eines der Flugzeuge mit Steuerschaden nieder und stürzte schwerbeschädigt drunten auf das Eis. Der Oberst holte eilig sein Geschwader zusammen und landete als erster auf einem ungeheuren Schneefeld dicht bei den Abgestürzten; wie auf dem Übungsfeld glitt Flugzeug um Flugzeug senkrecht auf den Schnee hinab. In stundenlangen Bemühungen, in eisiger Kälte wurden die sieben mehr oder minder schwer Verletzten geborgen und herübergeschleppt, wo sie im geheizten Flugzeug von Loie verbunden wurden.
Der Kurbelkasten arbeitete fieberhaft.
„Tut es sehr weh — wie heissen Sie? — Herr Higgins?“
„Oh, gar nicht. Sie verbinden wunderschön, Fräulein Lux. Ich bedaure beinahe, dass ich mir nicht auch noch das andere Bein gebrochen habe. Sie müssen mich gesund pflegen. Es ist gut, Oberst, dass wir uns unsern Expeditionsengel mit aufs Eis genommen haben!“
Ein anderer hatte beim Sturz eine Gehirnerschütterung davongetragen und fluchte gotteslästerlich, sobald Loie ihre Hände von seinen Schläfen liess. Da dieser Sturz, abgesehen vom völligen Verlust des Flugzeuges, noch glimpflich verlaufen war, so hob sich die niedergedrückte Stimmung unter den handfesten Männern bedeutend; beinahe hätte man über dieser Hilfeleistung den ganzen Zweck des Fluges vergessen. Loie hatte endlich eine Daseinsaufgabe und wurde fast vergnügt. „Ich werde Sie alle pflegen, bis Sie gesund sind — ich werde — oh, ich habe eine wunderschöne Jacht — wir machen eine Weltreise damit —“
Tosender Jubel!
Abermals vergingen in den Lüften vier von keiner Dämmerung oder gar Dunkelheit unterbrochene Poltage. Der Oberst wurde nervös und nahm Abstand von den planmässigen Kreisflügen, die immer enger den Pol umzogen.
„Zwecklos, Fräulein Lux. Feuereissen und Price und alle andern sind tot.“ Das braune, breite Gesicht lag in Falten. Er griff zum Hörer und gab den Fliegern seines Geschwaders einen Befehl, sie schwebten fächerförmig zu einer letzten hoffnungslosen Suche auseinander, doch der Flug ging über den Pol nach Norden ...
Pasquali sass, an seiner Zigarre kauend, bei Loie in der Kabine und starrte zuweilen zum Fenster hinaus. Überall äffte ihn jetzt ein Spuk, in der Ferne glaubte er zwischen Schneespalten den zerschellten „Eisvogel“ zu sehen, einmal sogar stürzte er nach vorn und warf den Schweber in schräger Kurve herum, kreiste minutenlang um einen Eisberg, bis er sich überzeugte, dass getürmte Zacken ihn getäuscht hatten.
Abermals kehrte das Geschwader seinen Flug nordwärts. „Ich vermute“, sagte Pasquali, „dass die Antarktis nach diesen Geschehnissen wieder eine Weile Ruhe hat vor den Menschen ...“
Als sie das Gebiet des ewigen Eises hinter sich liessen, rückte das Geschwader eng zusammen, wie um es zu bestätigen, dass es nun nichts mehr zu suchen gab. Loie brach in Weinen aus.
Das Schicksal des „Eisvogels“ und der unglückliche Verlauf der Hilfsexpedition erregten in der ganzen Welt ein ungeheures Aufsehen. Den Vorteil davon steckten die Schiffahrtsgesellschaften in die Tasche, die seit der Einführung der Überseeflüge auf Riesenschwebern sehr schlechte Geschäfte im Gastverkehr machten. Seit dem grossen Morden in der Pazifikschlacht, also seit einem knappen Jahrzehnt, hatten sich keine Flugzeugkatastrophen mehr ereignet, nun bekam das Vertrauen in die Zuverlässigkeit dieses an Geschwindigkeit alles überragenden Verkehrsmittels plötzlich einen argen Stoss. Auf den wenigen noch vorhandenen Passagier „dampfern“ gab es in den nächsten Monaten kein Mauseloch, das nicht zu einer Kabine hergerichtet worden wäre, aber auf den Überseeschwebern herrschte eine beträchtliche Leere.
Die ganze Wut der Volksmeinung, genannt Presse, richtete sich gegen Riccardo Pasquali, den Oberst, der den ersten Non-stop-round ausgeführt hatte. Das Direktorium der OAW rief: „Haltet den Dieb!“ und bezichtigte ihn öffentlich, er habe dies verfehlte Unternehmen aus Ehrgeiz und Abenteuerdrang ausgedacht und mangelhaft vorbereitet. In Wirklichkeit hatten die Geldmacher ein Geschäft mit Südpolflügen gewittert — und, wie so etwas zustandekommt: ein behagliches Essen im Aero-Club, angeregte Unterhaltung bei guter Zigarre, „— das sollten Sie mal einfädeln, Oberst, ihr Flieger beschwert euch doch immer, es sei nichts mehr los auf der Welt, alles mechanisiert und so weiter, machen Sie das doch mal!“ Das Scherbengericht stürzte den Allzubeliebten.
Pasquali verteidigte sich nicht, er kündigte seinen Dienst, gab der Stadt New York die herrliche Villa mit Dank zurück, die ihm nach der Luftschlacht gestiftet worden war, und erwarb eine Insel vor dem Strand von Maryland. Dort erbaute er sich ein hübsches Haus, über dessen Eingang ein klassisches, aber nicht ganz stubenreines Zitat zu lesen stand. Der vergessene Mann beschäftigte sich hier mit der Aufzucht von Doggen und wartete im übrigen der Dinge, die da kommen sollten. Nur die kleinen Tänzerinnen von New York blieben ihm treu, immer waren drei oder vier bei dem Vielgeliebten zu Gast, sie brachten ihm neidlos und ohne Eifersucht ihre schönsten Freundinnen, sie kamen lachend zu ihm auf Urlaub und schieden unter tausend Tränen, meist musste Pasquali sie mit sanfter Gewalt hinauswerfen, damit sie nicht kontraktbrüchig wurden.
Die Erregung, die der so unglücklich verlaufene Südpolflug, der den Tod von acht ausgesucht tüchtigen Menschen und die Gefährdung vieler anderer hervorgerufen hatte, war aber nur ein schwaches Vorspiel zur Wirkung einiger rätselhafter Vorkommnisse, die das kommende Jahr beherrschten. Vom Weltmeer, genauer gesagt, vom Atlantik, verschwanden nämlich mehrere Frachtdampfer, sie wurden überfällig und kein Mensch sah oder hörte je wieder etwas von ihnen. Aber erst als das vierte Schiff, ein kanadischer Getreidefahrer, ebenfalls von der Bildfläche verschwand, begann die Öffentlichkeit, aufmerksam zu werden. Schiffe, spurlos verschwunden? Ja, wie, heute hat doch jede morsche Fähre eine Funkeinrichtung? Und herrschten denn so schreckliche Stürme? Gar nicht, durchaus nicht. In zwei oder drei Fällen fand man Trümmer im Ozean, hier eine Planke, dort einen Rettungsring, jedenfalls genug, um die schlimmste Befürchtung bestätigt zu sehen.
Die Lux-Seeversicherung in Amsterdam musste bedenkliche Schadensummen zahlen, sofort gingen sämtliche Prämien sprunghaft in die Höhe.
Da kam schon wieder so eine erstaunliche Nachricht, diesmal betraf sie einen dänischen Viehtransporter, der riesige Mengen lebendes Zuchtvieh nach Nordamerika brachte.
Diese merkwürdigen Vorgänge verdrängten den „Eisvogel“ und das Schicksal seiner unglücklichen Besatzung aus den Zeitungsspalten. Die Welt vergisst schnell.
Tief entmutigt kehrte Loie im Mai nach Haarlem zurück. Sie hatte die Abgestürzten der Hilfsexpedition gepflegt und bemuttert, wobei es nicht ohne geknickte Männerherzen abging. Mit ihren Pfleglingen war für den Sommer ein Stelldichein verabredet, alle sollten im Juli nach Holland kommen und auf der Segeljacht „Lux“ in Loies Begleitung eine halbjährige Seereise ausführen.
Loie betrat das grosse Haus am Leidscheplein, das der Lux-Versicherung gehörte. Der gute alte Onkel Edward sass verdrossen hinter seinem Schreibtisch und kläffte jeden, der da hereinkam, wie eine Bulldogge an. Mit einer Ausnahme waren die im Atlantik verschwundenen Schiffe mit Ladung und Besatzung bei ihm versichert, in den vergangenen Wochen hatte er dreissig Millionen Gulden auszahlen müssen, über Forderungen in fast der gleichen Höhe wurde teuer prozessiert. Solche Summen bar aus der Westentasche — wenn diese Ereignisse mit den rätselhaften Höllenmaschinen im gleichen Tempo weitergingen, so musste auch die bestgestellte Versicherungsgesellschaft in Schwierigkeiten geraten. „Hast du irgendeinen Verdacht, Onkel Edward, von welcher Seite diese fürchterlichen Anschläge ausgehen könnten? Meine Freunde glauben, die Russen seien die Urheber.“
„Alles Unsinn. Wenn es kein solch blödsinniger Gedanke wäre, so möchte ich eher glauben, die OAW zettelt die Schiffskatastrophen an. Jetzt wagt natürlich kein Mensch mehr eine Überfahrt mit den Dampfern, und die Schweber machen wieder gute Geschäfte, besser als je.“
„Aber tut man denn gar nichts gegen die Verbrecher?“ Loie erfuhr, dass seit Wochen jedes Schiff in den Atlantikhäfen vor jeder Überfahrt bis in den verschwiegensten Winkel hinein durchsucht und erst dann zur Ausreise freigegeben werde. „Mit dem Erfolg“, fuhr Edward Lux zornig fort, „dass seit vorgestern wieder so ein Kahn spurlos überfällig ist, den die Hafenpolizei in Tampico beinahe geröntgt hat, bevor sie ihn ausreisen liess. Natürlich ist ein kleiner Dynamitkoffer leicht durchzuschmuggeln —“
Edward Lux hatte also wirklich Ursache, sich Sorgen zu machen. Er war etwas über fünfzig, kannte keinerlei Lebensgenüsse als den einzigen, das Vermögen seiner Gesellschaft zu immer höheren Ziffern anschwellen zu lassen. Die Lux-Mschpj. war nicht beliebt bei den Versicherten, fast immer musste im Schadensfall prozessiert werden, ehe die Geschädigten auch nur einen Heller erhielten. Loies Vater und sein Bruder Edward hatten durch schonungsloses Unterbieten und Aufkaufen zahlreiche Wettbewerber totgedrückt, und die Lux-Gesellschaft nahm eine Monopolstellung ein, sie kutschierte jedenfalls den wohlorganisierten Trustwagen. Nach dem Tode seines Bruders hatte Edward alles mögliche versucht, die ganze Macht an sich zu reissen und Loie aus dem Geschäft herauszudrängen. Er musste befürchten, dass sie in irgendeinem ihrer müssigen Flirts hängenblieb, dann konnte der tatendurstige Jüngling, der dazugehörte, Einfluss auf die Geschäftsleitung verlangen, es war nicht auszudenken!
„Siehst du, Loie, nun geht es wirklich abwärts mit uns. Ich meine es gut mit dir, wir stehen unmittelbar vor dem Bankerott. Heute noch kann ich dir deine Anteile abkaufen, natürlich sind sie nicht mehr soviel wert, sagen wir: achtzig Millionen Gulden, was brauchst du mehr? Überlege dir das, morgen kann es zu spät sein.“
Loie verzog spöttisch den schmalen Mund. „Oh, ich werde dich in solcher bedrängten Lage natürlich nicht im Stich lassen. Wenn wir zugrunde gehen, dann gehöre ich an deine Seite.“
„Darf ich das dahin verstehen, Loie, dass du auf meinen wiederholt gemachten Antrag zurückkommen willst?“ Edward musterte sie vom kurzgeschnittenen Kopf bis zu den schlanken Beinen. Sie galt ihm gar nichts, er wusste mit diesen Puppen nichts anzufangen. Er schrieb sich selber eine Eunuchenseele zu, die aus Machtgier und aus Geiz bestand.
Seine Detektive suchten mit Schwebern den weiten Atlantik ab auf der Strecke, die von den zur Zeit überfälligen Dampfern gefahren war. Gerade in der Stunde, als Loie bei ihrem Onkel weilte, traf die neue Hiobspost ein, dass soeben im Ozean treibende Trümmer des seit vorgestern verschollenen Frachtdampfers aufgefunden waren. Onkel Edward schnappte nach Luft und setzte tiefgebeugt eine neue siebenstellige Ziffer auf die Verlustliste.
„Nochmals, Loie: ich rate dir gut, berücksichtige mein Angebot, du bekommst fünfzig Millionen Gulden bar sofort, morgen wird dir keine Katze noch etwas für deine Anteile geben.“
Aber sie lehnte ab, nachdem sie höhnisch Aufklärung über die bereits erfolgte hundertprozentige Erhöhung der Prämiensätze erhalten hatte. „Also, wie gesagt, lieber Onkel Edward: wir werden gemeinsam zugrunde gehen, Arm in Arm ins Elend! Was für Fracht fuhren die untergegangenen Dampfer?“
„Von den verlorenen Dampfern, ausnahmslos Mehrtausendtonner, hatte ein Engländer eine Ladung Landvermessungsgeräte, Waffen, Marinemunition, landwirtschaftliche Geräte und Stückgut für Mexiko; von dem dänischen Viehtransporter fand man nicht einmal Trümmer oder ertrunkenes Vieh; ein kanadischer Dampfer mit Saatgut und Konserven, ebenso ein Portugiese; einer der ersten Verluste betraf ein deutsches Schiff, das mit sechzig Flugzeugen von jeder Grösse und Art nach Brasilien unterwegs war.“
„Sonderbar —“ murmelte Loie, „diese ganze Zusammenstellung — das sieht doch nach System aus.“
Onkel Edward murmelte etwas von Quatsch, er war von der Minderwertigkeit des weiblichen Grosshirns so fest überzeugt, dass es ihm keinesfalls der Mühe wert erschien, über Loies Einwand besonders nachzudenken. „Wieso: Zusammenstellung? Diese Attentäter putzen sich heraus, welche Schiffe sie eben erreichen können.“ Dann verschnappte sich der gute Onkel: „Das werden wir bald abstellen, in allen Hafenstädten sind Belohnungen von vielen Hunderttausend Dollars ausgelobt worden, irgendeiner von den Verschwörern wird da schon drauf anbeissen —“
„Gottlob, dass du das hoffst! Ich wollte schon in die Stadt und mir einige Ellen Hungertuch besorgen ...“
Während der Heimfahrt nach Haarlem kam Loie an einem kleinen Vorstadtkino vorbei und erkannte ihr eigenes Bild auf den schreiend bunten Plakaten. Der Südpolfilm! Sie liess Wiebe halten, er wartete draussen zwei Stunden, fünf Stunden, bis Loie nach der letzten Vorstellung endlich wieder erschien, von Tränen geschüttelt. Man hatte die Bilder des verschollenen „Eisvogels“ zusammen mit den Aufnahmen von der Hilfsexpedition verwendet. Loie sah sie alle wieder: Die Palmen mit ihren schwankenden Fächern in der Buen-Suceso-Bucht, die Holzhütte — sie sah Feuereissen mit lässigem Schritt über den Strand gehen, zum „Eisvogel“ hinab, dessen Flügel in der Sonne gleissten. Giles, der mit seinen Kameraden verschollene filmende Berichter, hatte offenbar eine Eigenschaft aller grossen Photographen besessen, diese geheimnisvolle Fähigkeit, sich selbst unbemerkbar zu machen, so dass seine Bilder durchaus natürlich wirkten. Dies Verhalten war nicht schwer, wenn Hutton Price, mangelhaft bekleidet, im Sande schlief, gegen die Insekten ein Tuch vor dem Gesicht, und das Tuch hob sich mit den Atemzügen. Das Publikum kreischte vor Lachen bei diesem Bild. Und der soll weg sein, nicht mehr vorhanden, abgestürzt, erfroren?
Loie war wohl der einzige Mensch auf der weiten Erde, der in einer letzten Ecke des Herzens eine Gewissheit verteidigte: sie sind noch da, irgendwo —
Die Wissenschaftler hatten ihr haarklein bewiesen: Pasqualis verbrecherischer Leichtsinn habe den „Eisvogel“ nicht so ausgerüstet, dass seine Mannschaft im ungünstigen Fall auch nur eine einzige Woche des Polwinters hätte ertragen können, der jetzt dort unten wütete.
Loie war nicht imstande, und im Angesicht dieser Bilder weniger denn je, an den Tod ihrer Freunde zu glauben. Sie sah jetzt, wie der „Eisvogel“ fertiggemacht wurde. Und ihre Tränen strömten heftiger, als sie dort auf der Leinwand ihren guten Bob aus der Hütte laufen sah, den Käfig mit Kleopatra in der Hand. Das war ein paar Sekunden später gewesen, nachdem Hutton ihr über viele tausend Meilen den Abschied zugerufen hatte: Klingle mich morgen mittag am Südpol an, Loie ...
In der Erinnerung hörte sie seine kullernde Stimme: Ich, haha, jawohl, ich springe aus tausend Metern Höhe mit einem aufgespannten Regenschirm herunter, wenn ich gerade den Fallschirm vergessen habe, breche mir höchstens den kleinen Finger dabei, mir passiert nämlich nie etwas ... Nun also hatte es ihn wohl doch erwischt.
Loie litt in diesen kummervollen Wochen unter Todesahnungen. Sie bereitete die Weltreise vor, die sie ihren Freunden versprochen hatte, lud auch den vielgeschmähten Oberst dazu ein, und er kam begeistert aus seiner Verbannung hervor.
Mitte Juni verschwand wieder ein Schiff im Atlantik, Nummer sieben, ein Öldampfer, und alle Zeitungen gerieten in furchtbare Aufregung. Loie wurde nicht davon berührt, sie und Fräulein Spring waren den ganzen Tag unterwegs, um die nötigen Besorgungen für die Reise zu machen. Mit ihren Freunden hatte sie schon jetzt vereinbart, man wolle „andersrum“ reisen, ab Genua durch den Suezkanal nach Indien, von dort über Japan nach Panama, dann konnte man sich immer noch überlegen, ob man zu Schiff sich über den Atlantik wagen wolle.
Wieder einmal kam Onkel Edward zur Teestunde. „Du bist in etwas gerührter Stimmung, Loie?“
„Es passiert heutzutage soviel Unvermutetes, und ich gehe jetzt auf die lange Reise.“ Sie überlegte listig. „Ich trage mich nämlich mit der Absicht, ein Testament zu machen.“
Der alte Kolkrabe zog die Augenbrauen hoch. Er war Loies nächster Anverwandter und wusste, dass sie mit den übrigen sehr entfernten Familienmitgliedern in keiner Verbindung stand. „Sehr löblich, Loie, überaus vernünftig. Wohltätigkeiten, wenn ich fragen darf? Mein erfahrener Rat steht dir natürlich jederzeit zur Verfügung ...“
Loie sah träumerisch in die Luft und entwarf einen grosszügigen Plan, wie ihr Besitz — nach Edwards Meinung — verschleudert werden solle, Stiftungen hier und Stiftungen da, das „Häuschen“ sollte in ein Waisenheim verwandelt werden.
Onkel Edward nickte beifällig und machte zu Loies Erstaunen grosszügige Ergänzungsvorschläge. Als seine Nichte mit dieser Aufzählung fertig war, konnte er feststellen, dass sie ihren gesamten Besitz zerstreuen wollte, ohne dass für ihn, Edward, auch nur ein Cent übrig blieb.
Er räusperte sich: „Wenn man von solchen bedauerlichen Dingen überhaupt sprechen soll — du brauchst diese löblichen und warmherzigen Absichten nur schriftlich zu fixieren; Datum, Ort, Unterschrift — dies Testament legst du in dein Juwelensafe bei unserer Bank, den Schlüssel kannst du bei dir behalten —“
Ihr Misstrauen schwand.
„— oder du kannst ihn auch mir in Verwahrung geben, damit ich ihn dir bei deiner glücklichen Heimkehr wieder aushändige. Ein wohlgeordnetes Testament, Loie, ist das sicherste Mittel, um ein hohes Alter zu erreichen, höhö.“
„Onkel Edward ist ein viel besserer Mensch, als ich glaubte“, sagte Loie, als Fräulein Spring am Abend abgehetzt aus Amsterdam heimkam, „ich habe mit ihm über mein Testament gesprochen, und er wollte gar nichts für sich haben. Gut, dann soll er auch etwas bekommen.“
Also schrieb sie ihren „letzten Willen“ einige Tage später nieder, vermachte Onkel Edward ein Achtel ihres Vermögens und gab ihm das Testament in Verwahrung, damit er es auf der Bank einschliessen sollte ...