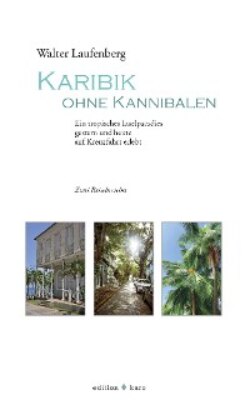Читать книгу Karibik ohne Kannibalen - Walter Laufenberg - Страница 7
JAMAIKA
ОглавлениеMerkwürdig, dass wir nichts an Meeresgetier zu sehen bekamen. Ringsum nur Wasser, manchmal über siebentausend Meter tief. Wasser, Wasser, soweit die Blicke reichen. Diese dummen Überblicke, zwangsläufig so oberflächlich, weil das Wasser, so durchsichtig es ist, uns eine unvorstellbar vielgestaltige Welt vorenthält. Nichts für uns. Als Landwesen sind wir an den äußersten Rand dieser Welt gedrängt. Nur einmal waren ein paar Delphine zu sehen, die eine Weile neben uns her schwammen und uns mit Luftsprüngen zu begrüßen schienen. Und vorgestern war der Tag der Fliegenden Fische. Ganze Schwärme dieser kleinen silbrigen Segler spritzten plötzlich schräg aus dem Wasser, segelten ein paar Sekunden lang dicht über den Wellen dahin und ließen sich von dem nächsten hohen Wellenkamm verschlucken.
Dann war da noch dieser winzige Goldfisch, mutterseelenallein in einem kleinen verdreckten Aquarium, das schief auf einem Brettchen hing. In der primitiven Kneipe in Kingston auf Jamaika. Wir waren am Morgen im Nordwesten der Insel gelandet, in Montego Bay, an der sogenannten Millionärsriviera der Insel. Das Schiff fuhr ohne uns um die Westküste herum zur Hauptstadt Kingston im Südosten. Mit unseren Koffern, mit all unserer Habe. Sollten wir alles erst am Abend wiedersehen, wenn wir quer über die Insel nach Kingston gekommen wären, egal wie. Aber wir konnten unbesorgt sein. Um das Wie kümmerten sich die Einheimischen. Und wie. Noch nicht ganz runter vom Fallreep, wurde man schon angeschrien: »Taxi!«, »Taxi!«, »Taxi!«
Das Gezerre und Gezeter wollte überhaupt kein Ende nehmen. Und mich begrüßten sie mit Fidel-Rufen, weil ich einen Vollbart wie Fidel Castro trug. Amerikanische Straßenkreuzer und VW-Busse zu Dutzenden. Dabei hatten die meisten Passagiere vorgeplante Autobustouren gebucht. Es ging nur noch um die paar Abenteurer, die es wagten, als Individualisten Jamaika zu durchqueren. Für fünfzehn US-Dollar pro Person. Nach einer halben Stunde Herumstehen und Fotografieren und Überlegen waren wir nur noch zehn Dollar pro Kopf wert.
Endlich auf meinem Sitz in einem der Kleinbusse, überkam mich ein Gefühl der Beruhigung und der Geborgenheit. Unser schwarzer Fahrer steckte in einem persilweißen, ordentlich gebügelten Oberhemd: Am Innenspiegel seines Wagens baumelte ein Rosenkranz mit silbernem Kruzifix. Zudem wurde der Spiegel halb verdeckt von einem fast schon geschmackvollen Spruchband, auf dem in Englisch zu lesen war: »Gott, ich werde heute sehr geschäftig sein; es kann sein, dass ich Dich darüber vergesse, aber vergiss Du mich bitte nicht.«
Unser Fahrer schien sich dieser Absprache mit seinem Gott sicher zu sein. Wir fuhren nicht über die Insel, wir überflogen sie. Mit 50 bis 60 Meilen pro Stunde auf holprigen Straßen, die fast nur aus Kurven bestanden. Kein Auto, das sich nicht einholen und überholen ließ, das war der Ehrgeiz unseres Fahrers. Dazu ließ er seine Autofanfare eifriger ertönen, als es ein Postkutscher mit seinem Posthorn selbst bei bester Gesundheit geschafft hätte. Die Melodie seiner Hupe, der Anfang vom River-Kwai-Marsch, wird mich bis an mein Lebensende an Jamaika erinnern. An Sitze und Griffe geklammert wie festgeschweißt, stoben wir über die Insel. Der Fahrer fuhr nach der Devise: Ich habe immer Vorfahrt. Dabei entwickelte er einen nicht nur rabiaten, sondern auch intelligenten Fahrstil. Jede noch so geringe Chance wahrnehmend, über durchgezogene Linien taktvoll hinwegsehend, sein Horn mal wie einen Kriegsruf, mal als Triumphgeheul ertönen lassend. Aber wir fuhren nicht nur. Man brauchte dem Mann überhaupt keine Anweisungen zu geben. Er wusste, was wir brauchten: eine kleine Badepause, ein gutes Essen, genügend Zeit zum Einkaufen. War alles schon fest eingeplant. Er raste zielstrebig hin zum Hilton-Hotel in Ocho Rios, lud uns aus in der Hotelzufahrt und parkte seinen VW-Bus zwischen den Stingrays und Chevys auf dem Hotelparkplatz.
Gehorsam eilten wir an den Hotelstrand. Ein paar schwarze Strandaufseher saßen im Schatten eines Kiosks. Offensichtlich amüsierten sie sich über meinen schwarzen Bart. Ich ging zu ihnen und erklärte ihnen den Zweck dieses fülligen Kopfputzes: In Deutschland, sagte ich, sei es immer sehr kalt, daher brauche man einen solchen Gesichtsschutz. Das mache den Unterschied zu Jamaika, wo es immer heiß ist, weswegen die Schwarzen immer nur ein paar einzelne Barthaare haben. Die Burschen staunten mich an und bogen sich vor Lachen. Ich hatte neue Freunde gewonnen. So konnten wir, ohne besorgt nach den Strandwachen schielen zu müssen, nach Herzenslust im Hilton-Wasser schwimmen und im Hilton-Sand herumtoben, uns vom Hilton-Sprungturm in den Hilton-Swimmingpool fallen lassen. Ein Vergnügen, das eigentlich für Millionäre und Spesenritter reserviert war.
Und anschließend durften wir sogar, ohne eine HiltonMark ausgegeben zu haben, ungerupft von dannen ziehen. Wir hatten unseren Fahrer dazu überredet, uns ein anderes Restaurant zu zeigen. Nicht so amerikanisch, lieber typisch jamaikanisch.
Das hatte dem Fahrer gefallen. Dafür brach er aus seiner Programmierung aus. Das heißt, er hatte wohl auch an anderen Stellen seine Leute, die ihm Provisionen zahlten. Jedenfalls hielt er noch zweimal an und lud uns aus. Beim ersten Mal gab es einen schönen Wasserfall, den wir betrachten durften oder sollten. Der 133 Meter hohe Dunns River Fall, den wir sogar ein Stückchen hinaufklettern konnten. Beim zweiten Halt war es eine alte, über und über efeubewachsene Kirche, die wir bestaunen durften, dazu Christoph Kolumbus, der als Denkmal vor der Kirche Wache hielt.
Kolumbus war auf seiner zweiten Reise, im Jahre 1594, auf Jamaika gelandet, wenn auch nicht da, wo jetzt sein Denkmal stand. Die Stelle, an der er zuerst jamaikanischen Boden betreten hatte, die Discovery Bay, hatten wir schon am frühen Vormittag kurz besichtigt. Sehr kurz, denn es war dort nichts zu sehen, als eine kleine Bucht. Die hatte der Entdecker Santa Gloria genannt. An Einfällen für schöne Namen hatte er ja keinen Mangel. Damit spätere Besucher etwas zu knipsen haben, hat man irgendwann ein paar Requisiten aufgestellt: Maschinen, deren Funktion uns rätselhaft blieb, Gedenksteine für Familien, die uns nichts bedeuteten, ein Kanönchen sowie ein Wasserrad, beide so putzig wie funktionslos. An die rund 60 000 Arawaks, die einst auf dieser Insel gelebt hatten, erinnerte nichts, obwohl es in diese Bucht gepasst hätte. Unter dem ersten spanischen Gouverneur, Juan de Esquivel, der im Jahre 1509 die Kolonisation der Insel begonnen hatte, wurden die Arawaks als von der gütigen Vorsehung geschenkte Sklaven betrachtet. Nach etwa fünfzig Jahren harter Arbeit für die spanischen Herren waren sie so gut wie ausgestorben.
Erst beim dritten Stopp nach dem Hilton-Strandhotel empfing uns ein gemütliches kleines Restaurant. Da wurde uns, draußen unter Palmstrohdächern, Landestypisches geboten: Krabben und Hummer. Und dazu Rumpunsch als eiskaltes Erfrischungsgetränk. Was für ein Unterschied zu dem heißen Tee mit Rum, der uns die heimischen Winter überleben half. Der Rum machte uns erst richtig klar, wie weit wir uns von zuhause wegbewegt hatten.
Dann ging sie auch schon wieder weiter, die rasende Fahrt. Es huschte alles nur so an uns vorbei. Es war so viel, was vor unseren eifrig bewegten Augen ablief, dass überhaupt nichts zu sehen war. Doch auf einmal rollten wir in eine fast städtisch wirkende Siedlung ein. Straßenzüge mit festen Steinhäusern um uns herum. Ein riesiges Plakat zeigte mir eine hochschwangere Schwarze: Werbung für Empfängnisverhütung per Pille. Kaum zu glauben, die Anti-Baby-Pille im Busch. Wir waren in der früheren Inselhauptstadt Spanish Town angekommen. Fotostopp auf dem Platz vor der ehemaligen Residenz der Vertreter des spanischen Königs. Säulengänge und ein schmuckes Portal, vergammelte Pracht aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, genau so deplaziert wirkend wie die Werbung für die Pille. Da musste man sich erst von dem Reiseführer in der Hand darauf hinweisen lassen, dass wir im Zentrum der einstigen Hauptstadt der Insel Jamaika standen. Zur Zeit der Spanier, und auch noch unter der anschließenden Herrschaft der britischen Gouverneure, war Spanish Town eine quirlige Metropole, jetzt präsentierte sich uns nur noch ein verschlafenes Landstädtchen, in dem die Arbeiter der umliegenden Bananenplantagen wohnten.
Nach anderthalb Jahrhunderten spanischer Herrschaft hatten die Engländer im Jahre 1655 in einem Handstreich die damalige Inselhauptstadt Spanish Town und damit die ganze Insel in ihre Gewalt gebracht. Sie organisierten in kurzer Zeit eine florierende Kolonie, die so wertvoll war, dass sie viele begehrliche Angreifer anlockte. Doch die Briten wussten sich gegen die französischen und spanischen Flotten zu wehren. Und sogar für die Bekämpfung des Piratenunwesens, wie in vielen anderen Meeren die permanente Gefahr für Inselbewohner, hatten sie ein Rezept, ein typisch britisches. Henry Morgan war der Anführer der Piraten, die in dem Städtchen Port Royal an der weiten Bucht, an der heute Kingston liegt, ihr Hauptquartier hatten. Die Britische Krone ernannte den Räuberhauptmann einfach zum Ritter und Leutnant-Gouverneur von Jamaika, also zum Oberaufseher. Das Spiel gefiel Henry Morgan. Er verbot die Piraterie und knüpfte eine Menge seiner ehemaligen Kumpane auf. Der Rest der unermesslich reichen und kraftstrotzenden Piratenherrlichkeit ging dann bei dem verhee- renden Erdbeben von 1692 zugrunde, das Port Royal auslöschte. Nach dieser Naturkatastrophe bauten die Engländer sich in der Nähe eine neue Inselhauptstadt, die sie Kingston nannten. Deren günstige Lage an einem weiten Naturhafen war ausschlaggebend für den Abschied von Spanish Town als Hauptstadt. Kingston, die neue Stadt am Fuße der Blauen Berge, eine Metropole mit einer halben Million Einwohnern, durfte sich inzwischen die größte englischsprachige Stadt in der Karibik nennen.
Jamaika war als der absolute Höhepunkt der Reise angekündigt worden. Eigentlich recht ungeschickt, den Höhepunkt am Anfang der Tour zu servieren. Mein Tischnachbar konnte der Jamaika-Durchquerung jedenfalls schon einen Superlativ verleihen:
»Die schrecklichste Autofahrt meines Lebens«, seufzte er. Auch er hatte die Fahrt in einem Taxi gemacht.
»Eine Raserei, eine Hetzjagd. Der Fahrer war ein Wilder, wie er im Buche steht. Der Kerl hat mit seinem Wagen an dem einen Tag mehr Delikte begangen, als er in zwanzig Jahren absitzen könnte. Er war nicht einmal zu halten, als er einen anderen Wagen kräftig gerammt hat. Ohne Aufenthalt weiter, rücksichtslos. Ich bin völlig bedient.«
Mein Tischnachbar auf dem Schiff war ein älterer Herr, Inhaber eines Unternehmens für Schuhimport/-export in Bremen, mit dem ich wenig gemeinsamen Gesprächsstoff hatte. Bücher zu schreiben hielt er für bloßen Zeitvertreib. Den Schuh zog ich mir nicht an. Wir beiden Ehepaare mussten aufgrund höherer Fügung immer zusammen an unserem Vierertisch sitzen. So kriegten meine Frau und ich beim späten Abendessen zu hören, wie es ihm und seiner Frau ergangen war:
»Rechts Wald und links Wald, und immer mal wieder Ausblicke über die hügelige Landschaft. Sehr schön. Aber eine Kurve nach der anderen, dass man schwindelig wurde. Dabei wollte ich mir das näher ansehen, die Hütte am Straßenrand, so schön strohgedeckt. Vorbei. Dann wieder so ein Anblick, Negerkinder drum herum, die aussahen, wie aus dem Märchenbuch geklaut. Wieder vorbei. Alles so herrlich ursprünglich, endlich der Blick durchs Schlüsselloch in die andere Welt, in eine echte Welt. Als wieder einige Hütten am Straßenrand auftauchten, haben wir dem Fahrer befohlen anzuhalten. Ein malerisches Bild war das: Offene Feuer, über denen Maiskolben geröstet wurden. Aber dann entpuppte sich die Idylle als Wirtshaus im Spessart. Der Mais-Mensch bestand darauf, seine Maiskolben zu verkaufen. Der Mann war nicht abzuschütteln. Dabei mag ich gar keinen Mais. Ich denke noch an das nasse Maisbrot nach dem Krieg. Und als ich von einem Negerknaben ein Foto machen wollte, stellte sich die dralle Negermami mit energischem Protest vor ihn und forderte Bezahlung. Die Frau hatte feste Preise: 20 Cents pro Foto. Als ich dem Kleinen 15 Cents in das Händchen gab, mehr Münzen hatte ich gerade nicht, lehnte die Mutter ab. Ich musste mir Geld leihen, um das naturverbundene einfache Leben fotografieren zu dürfen. Als wir dann wieder einstiegen, sah ich noch, wie die Frau dem Jungen das Geld mit Gewalt abringen musste. Der Kleine machte ein großes Geschrei und lief heulend in den Wald. Dabei hielt gerade ein weiterer Touristenbus an. Diese Verzweiflung der rabiaten Mutter, jetzt ohne ihren Lockvogel. Das habe ich ihr gegönnt.«
»Diese Blumenpracht«, schwärmte die Frau des Schuhmannes, »stellen Sie sich das vor: Unmengen von Weihnachtssternen. Unser Weihnachtsstern in dem Delfter Topf steht noch daheim auf dem Couchtisch. Ich hoffe, unsere Haushälterin gibt ihm regelmäßig Wasser. Aber hier waren ganze Hecken von Weihnachtssternen zu sehen. Im Vorbeifahren. Lange rote Hecken. Wie gern hätte ich mal die Nase hineingesteckt. Aber immer vorbei.«
Am frühen Nachmittag im Hafenviertel von Kingston angekommen und mit einem Aufatmen aus dem Wagen gekrochen, wurde jedem mit einem Blick klar, welchen Zweck die wilde Jagd hatte. Alle Busse und Taxis spuckten ihre Touristen vor einer riesigen Halle aus. Und diese Halle war vollgepackt mit Souvenirs. Ein Stand neben dem anderen, immer das Gleiche: Korbarbeiten, Holzgeschnitztes, Postkarten, Ketten, Hüte, Armreifen, Rumbakugeln und Trommeln. In jeder Koje saß eine dicke Mami und versuchte sich in Überredungskünsten. Weil das Schiff noch nicht im Hafen angekommen war, mussten die Durchgerüttelten fast vier Stunden lang den Kopf schütteln oder Dollars hinblättern. Kaum eine Möglichkeit, sich diesem Superangebot zu entziehen. Die Stadt Kingston lag weit weg, mit dem Taxi wäre das ein Aufwand von umgerechnet 25 Mark hin und 25 Mark zurück gewesen. Verzichtet. Aber außer dieser großen Halle, dem Crafts Market, gab es dort am Hafen nichts. Bloß noch die schäbige kleine Kneipe mit dem einsamen Goldfisch in seinem schiefhängenden Glaskasten, halb verdeckt hinter einem riesigen Ventilator in der Ecke.
Ich hätte vor Vergnügen trommeln können. Hatte ich doch eine kleine Bambustrommel an der Hand hängen. Der Tribut, den ich beim Warten auf unser Schiff gezahlt hatte. Ein langer Schwarzer war mir schon in der Halle mehrmals begegnet. Und jedes Mal hatte er mir etwas von seinen Waren verkaufen wollen. Dass ich keine der Halsketten aus Obstkernen brauchte, die er bündelweise um den Hals hängen hatte, sah er schnell ein. Aber die kleine Trommel, mit der er auf sich aufmerksam machte, schien ihm so recht für mich gemacht. Ich konnte noch so oft und wortreich gestehen, dass ich nicht trommeln könne und wolle, alles vergebens. Der Mann war auch überfordert mit meinen Hinweisen auf den modernen Wohnungsbau mit seinen dünnen Wänden und nervösen Nachbarn. Es gelang mir, den Mann immer wieder stehen zu lassen und mich in einen anderen Menschenklumpen hinein zu verdrücken. Aber dann, draußen auf dem Weg zu der Kaschemme, ging er wieder an meiner Seite. Und trommelte. Wie ein guter Kamerad, im Gleichschritt mit mir. Da habe ich ihm die Trommel abgekauft, um endlich meine Ruhe zu haben. Er strahlte und erklärte mich zu seinem Freund. Und mir schien, er hat ohne jede Erläuterung verstanden, wieso ich etwas kaufte, wofür ich keine Verwendung hatte. So selbstverständlich und stolz nahm er die Dollarscheine entgegen, offensichtlich als Anerkennung für ihn und für die rund 90 Prozent der Bevölkerung Jamaikas. Fast alle wie er Abkömmlinge der afrikanischen Negersklaven. Abkömmlinge auch der weißen Herrscher, denn die spanischen und britischen Herren haben mit ihrer Zuneigung zu den schwarzen Sklavinnen so nebenbei für eine vielfältige Blutsmischung gesorgt, ganz abgesehen von den Beimischungen, die auf das Konto eingewanderter Nordamerikaner und Chinesen und Inder gehen.
Auf dem Weg zu unserem Schiff, das endlich angekommen war und das Fallreep heruntergelassen hatte, konnte ich meine Trommel einem kleinen schwarzen Jungen schenken, der mitlief. Diese glücklichen Augen. Hoffentlich war das für ihn der Start zu einer blendenden Karriere als Jazzmusiker.
An dem Abend musste ich mich in einer der beiden Bordbibliotheken, die in getrennten Räumen waren, weiter mit den Schwarzen beschäftigen. Ich brauchte unbedingt die Information, dass im Jahre 1834 auf Jamaika die Sklaverei offiziell beendet wurde – und vier Jahre später tatsächlich. Den Hinweis fand ich in der Deutschen Bibliothek. Da konnte ich aufatmen. Ich las: Viele der befreiten Sklaven verließen die Plantagen und zogen sich in die Berge zurück. So mancher Zuckerrohr- und Kaffeepflanzer ging damals pleite, weil er keine Arbeitskräfte mehr hatte. Doch hat sich in der Folgezeit gezeigt, dass es auch ohne Sklaverei ging, nämlich mit Kontraktarbeitern. Jamaika wurde zum Großexporteur für Bananen, Zucker und Rum. Nicht zu vergessen Bauxit, das rote Gold Jamaikas, das bei der Herstellung von Aluminium unverzichtbar ist.
Jamaika war mehr als 300 Jahre britische Kolonie, ehe es im Jahre 1962 seine Selbständigkeit erhielt. Also erst vor neun Jahren, staunte ich. Ein Land, das die westafrikanische und spanische Kultur mit der britischen vermischte. Aus vielen Völkern erwuchs ein Volk, so wenig ursprünglich zu dieser Insel gehörend wie die meisten Pflanzen, die wir heute bestaunen können. Das Zuckerrohr brachten die Spanier auf die Insel. Der Kakao stammt aus Zentralamerika. Aus der Südsee holten die Engländer die Kokosnuss, die Banane und den Brotfruchtbaum. Aus Indien kamen Ingwer und Zitronen.
Und auch Kaffee und Tabak waren Fremdlinge auf dieser Insel. Nur der Jamaikapfeffer war schon vor den Eroberern hier. »Dahin, wo der Pfeffer wächst«, so heißt bei uns zuhause eine Verwünschung. Wenn die daheim wüssten, dass es hier traumhaft schöne Strände gibt, mehr als zweitausend Meter hohe Berge und über zweihundert verschiedene Orchideenarten …
Die vierte Reise des Kolumbus nach Westindien war die abenteuerlichste. Mit vier Karavellen und 150 Leuten war er vom 11. Mai 1502 bis zum 7. November 1504 unterwegs. Sein Brief an die Katholischen Könige, den er im Juli 1503 in Jamaika geschrieben hat, zeigt, dass dieses karibische Paradies auch die Hölle sein kann:
»Achtundachtzig Tage hindurch hatte der schreckliche Sturm nicht von mir gelassen, man sah keine Sonne und keine Sterne auf dem Meer. Die Schiffe leckten, die Segel zerrissen, die Anker und Winden gingen verloren, dazu Taue und viel Proviant; die Mannschaft krankte, alle waren zerknirscht, viele taten ein Gelübde, später ins Kloster zu gehen; keiner war, der nicht Opfer zu bringen und Wallfahrten zu machen gelobt hätte. Viele Male hatten sie gegenseitig ihre Sünden gebeichtet. Viele Stürme hat man gesehen, aber keinen, der so lange währte und solche Schrecknis brachte.«