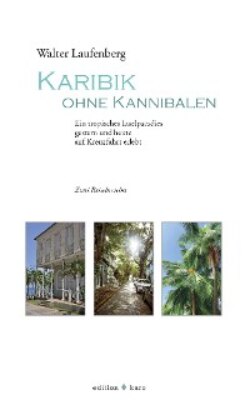Читать книгу Karibik ohne Kannibalen - Walter Laufenberg - Страница 8
CURAÇAO
ОглавлениеAm Mittag im Hafen von Willemstad auf Curaçao, der größten Insel der Niederländischen Antillen. Die Stadt umarmte uns mit einer lähmenden Hitze. Kein Wunder, dass die meisten Passagiere zunächst in ihren Kabinen blieben, vermutlich mit voll aufgedrehten Klimaanlagen.
Willemstad war für mich ein schönes Beispiel dafür, wie es dazu kommt, dass die Touristen bei einem Landausflug nichts Wesentliches zu sehen kriegen. Der Hafen war bloß eine halbe Stunde Fußweg vom Stadtzentrum entfernt. Doch wo die Passagiere von Bord gehen durften, mitten zwischen riesigen Öltanks, Lagerhäusern und Schuppen, da standen nur zwei Schritte von der Gangway entfernt die schwarzen Taxifahrer neben ihren amerikanischen Chromkutschen und schrien die verschreckten Ankömmlinge an. Die kamen gar nicht dazu, festen Boden unten den Füßen zu spüren nach der erlebten Seestärke 5 der Anreise. Schon saßen sie in den Taxis oder im großen Bus und sausten davon. Schnell durch die malerischen Vorstadtgassen hindurch zur Hauptgeschäftsstraße entführt. Drei US-Dollar das Taxi, recht preiswert. Doch fiel einem dann ein, dass man nach Kaufkraft den Dollar in etwa der Deutschen Mark gleichsetzen müsste. Dabei hatte man daheim beim Geldumtausch für einen Dollar 3,65 DM gezahlt. Vor allem musste man den Curaçao-Likör, aus bitteren Pomeranzenschalen hergestellt, kaufen. Dabei konnte man sich die lästige Umrechnerei in Niederländische Antillengulden sparen. Der US-Dollar galt im Amerikanischen Mittelmeer, wie man die Karibik gern nannte, einfach überall. Die offizielle Währung von Curaçao, der Antillengulden, war genau die Hälfte wert.
Beim Versuch, neben dem Likör etwas für Curaçao Typisches zu kaufen, verriet mir ein Verkäufer, dass alles, was in den wohlgefüllten Souvenirläden feilgeboten wurde, aus Hongkong oder Japan stamme, aus den USA oder den Niederlanden.
»Auf Curaçao«, sagte er voller Stolz, »hat kein Mensch Zeit für kunstgewerbliche Arbeiten. Hier ist man mit dem Ölgeschäft rund um die Uhr voll ausgelastet.«
Ich habe dann darauf verzichtet, nach Erdöl als Souvenir zu suchen, habe auch nicht nach Erinnerungen an den Sklavenmarkt gefahndet, einstmals der größte Umschlagplatz der Ware Mensch für die Karibik und Südamerika. Das ganze buntbeschilderte Einkaufsviertel mit all den vielen Engländern und Deutschen – die beiden Frachten waren gerade angekommen – konnte mir nichts bieten. Ich habe den schreienden Taxifahrern die kalte Schulter gezeigt und mich zu Fuß auf den Weg zurück zum Schiff gemacht, wobei die Schulter allerdings sehr heiß wurde.
So kriegte ich doch noch das Beste von Curaçao mit, nämlich die schönen Altstadtviertel mit ihren niedrigen Steinhäusern, dicht aneinandergeschmiegt und in leuchtenden Pastellfarben grüßend, eines rot, eines gelb, eines grün und das nächste blau. Jede Gasse ein herrlich buntes Bild. Und erst einmal die Menschen. Ein Gemenge aus vielen Völkerschaften. Braun in allen Schattierungen, in stattlichem Wuchs, schlank und stolz. Bezaubernd schöne Mädchen und Frauen, drahtige Männer. Und keine Touristen. Kaum jemand von unserem Schiff hat sich diesen Spaziergang zugemutet. Es gab ja keine Empfehlung für dieses nicht kommerzielle Vergnügen, durch eine wunderschöne Völkerschau hindurchzugehen, unangefochten, nicht zum Kaufen aufgefordert, nein, kaum beachtet. Mitten in einer Weltstadtbevölkerung, die mit sich selbst genug hatte, sogar in der Vorstadt. Dabei waren das sämtlich richtige Holländer. Sie freuten sich, wenn ich sie grüßte und antworteten mit einem tiefen und breiten »Daag«. Mit diesem Urlaut, den ich schnell aufgeschnappt und mir angeeignet hatte, bin ich durch Willemstad gewandelt wie auf einer Wolke, und glaubte in Alt-Amsterdam gelandet zu sein.
Mitten durch die Stadt war unser 20 000-Tonnen-Schiff am Vormittag in den Hafen eingefahren. Wir hatten gesehen: Weiter hinten war eine hohe Brücke über den Flaschenhals des Hafens erst im Bau. Der gesamte Verkehr der Halbe-Halbe-Stadt Willemstad ging immer noch über die Königin-Emma-Brücke. Eine Pontonbrücke, die jedes Mal ein besonderes Schauspiel bietet, wenn sich ein Schiff nähert. Die Brücke wird zur Seite geschwenkt, und der Stadtverkehr ruht. Das geht so bis zu zwanzig Mal am Tag, erfuhr ich.
Diese malerische Doppelinsel hat sich von dem Wohnsitz der Caiquetios-Indianer zu einem der wichtigsten Ölhäfen der Welt entwickelt. Die Indianer waren von demselben Stamm wie die an der Nordküste Venezuelas, die ja nur vierzig Meilen entfernt war. Der erste Weiße, der die Insel Curaçao betreten hatte, war ausnahmsweise nicht Kolumbus, sondern Amerigo Vespucci. Das war im Jahre 1499. Ein Kurzbesuch nur. Erst 28 Jahre später begannen die Spanier mit der Besiedlung der Insel und der Versklavung der Indianer. Als die spanischen Herren gut hundert Jahre später, nämlich im Jahre 1634, von den Holländern vertrieben wurden, hatten gerade noch 75 Indianer überlebt. Zehn Jahre später kam Peter Stuyvesant aus New Amsterdam als Gouverneur auf die Insel. Nach einer Kriegsverletzung soll ihm hier ein Bein amputiert worden sein, das irgendwo begraben wurde. Ich habe darauf verzichtet, das prominente Bein-Grab zu suchen. Ohnehin brachte Peter Stuyvesant nicht den Duft der großen weiten Welt mit. Den lernte er erst hier auf der Insel kennen, weil die noch lebenden letzten Indianer eifrige Tabakraucher waren. So richtig weltoffen wurde das Leben auf Curaçao erst, als die Juden kamen. Die waren vor den fanatischen christlichen Verfolgern in Spanien und Portugal geflohen und hatten bei den Holländern freundliche Aufnahme gefunden. Die Juden brachten der Insel dann einen ersten wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung.
Als ich durch die Straßen von Willemstad schlenderte und in die Gesichter der Passanten schaute, glaubte ich, die halbe Welt auf diesem Eiland versammelt zu finden. Nicht nur als Touristen, sondern als Einwohner. Dieses Völkchen Kunterbunt hat das Erdöl angeschwemmt. Dabei waren die Holländer ursprünglich nur am Salz interessiert. Das brauchten sie in Massen zur Kühlung ihrer Fischtransporte. Daneben nahmen sie aber auch gern die finanziellen Segnungen des bereits gut eingeführten Sklavenhandels wahr. Und sie beteiligten sich auch an den üblichen Überfällen auf spanische Schatzschiffe. Doch das ganz große Geschäft war das alles noch nicht. Das begann erst, als im Jahre 1914 in Venezuela am Maracaibo-See riesige Erdölvorräte entdeckt und angezapft wurden. Daraufhin baute die Firma Shell die der südamerikani- schen Küste vorgelagerte Insel Curaçao zu einem gewaltigen Ölstützpunkt aus, wo das Venezuela-Öl verarbeitet und gebunkert wurde. Von Arbeitern, die aus über fünfzig Ländern herbeigeströmt waren. Weil hier Farbige aus ganz Süd- und Mittelamerika die besten Einkommensmöglichkeiten fanden. Kein Wunder, dass sich auf dieser Insel auch eine neue Sprache entwickelt hat, das Papiamento. Eine Umgangssprache, die viele Bestandteile aus dem Holländischen und Spanischen, dem Portugiesischen, Englischen, Französischen und aus diversen westafrikanischen Sprachen enthält, angereichert mit »Okay« und ähnlichen Amerikanismen. Das heißt, wenn die Menschen auf Curaçao den Mund aufmachen, dann kriegt man die typische Weltoffenheit von Curaçao zu hören. Damit ist Curaçao im Kleinen das, was die gesamte Karibik im Großen ist, nämlich ein modernes Babylon: Von Insel zu Insel eine andere offizielle Sprache, dort Spanisch, dort Amerikanisch, da Englisch, da Französisch und hier Holländisch neben allerlei Mischmasch.
Kamen die Indianer vom Festland auf die Insel Curaçao, hinterher auch noch das Erdöl, dann war es nur konsequent, dass unser Schiff nun auf das Festland zusteuerte. Aber bis wir im Hafen von Caracas anlegten, blieb noch genügend Zeit, mir meine Mitreisenden genauer anzusehen.
Da waren wahre Wodkaheroen an Bord. Spät nachts, wenn die braven Reisebürger in ihren Kojen lagen, hockten sie noch in der Neptun-Bar zusammen. Oder auch in der Ukraine-Bar. Und sie tranken immer noch einen. Da wurde geschluckt wie in der ersten Stunde nach der Entlassung aus der Trinkerheilanstalt. Ganz der Verlockung der Minipreise hingegeben. Wer konnte da noch widerstehen? Zumal bei der einmaligen Chance, ohne Angst vor Polizeikontrollen und dem Verlust des Führerscheins sich volllaufen zu lassen. Der Heimweg war ja nicht lang und auf den breiten teppichbelegten Treppen vom obersten bis hinab zum untersten Deck notfalls auch auf allen Vieren zu schaffen. Im Krebsgang. Auf jedem Treppenabsatz stand ein Mädchen vom Personal in Habachtstellung, das bereit war, einem die Tür aufzuhalten.
Fünf Bars hatte unser Schiff. Mir schien fast, die 20 000 Tonnen, von denen voller Stolz die Rede war, seien mit Alkoholika gefüllt. Die Ukraine-Bar auf dem Obersten Deck war nachts so lange geöffnet, wie Gäste kamen. So eine fast zwanzig Meter lange Theke von Steuerbord bis Backbord auf dem obersten Deck war übrigens eine blendende Idee im Sinne der Verkaufsförderung. Dort oben waren natürlich die unvermeidlichen Schwankungen des Schiffs am stärksten. An der Theke standen die durstigen Touristen oft in drei Reihen hintereinander. Ein egalisierendes Gedränge, gegen drei Uhr morgens eine einzige Verbrüderungsorgie. Das lange breite Brett der Theke stand voller Gläser und Flaschen. Da gefiel es dem Genossen Taras Shevchenko, sich einmal etwas heftiger nach Backbord zu verneigen, und mit einem Rutsch waren sämtliche Flaschen und Gläser abgeräumt, begleitet von lautem Klirren und einem gemeinsamen Aufschrei, halb erschrocken, halb belustigt. Ein Serviermädchen nahm dann den Schrubber, der in der Ecke stand, und schob die Scherben unter dem Stuhl in der Ecke zusammen. Es wurde neu bestellt und neu bezahlt und fröhlich gezecht und weiter geredet. Bis unser Schiff es sich einfallen ließ, eine schnelle Verneigung nach Steuerbord vorzuführen, so dass wieder alles futsch war. Auch rechts stand ein Stuhl in der Ecke, unter dem der Scherbenhaufen wuchs. Bei den Preisen war das Wetttrinken mit den Wellen ein köstliches Spiel: 60 Pfennige die Flasche deutsches oder dänisches Bier, 90 Pfennige ein französischer oder armenischer Cognac.
Ich fand das Publikum recht gut gemischt. Von acht bis 82 Jahren reichte das Alter, von billiger Kirmesaufmachung bis zum Nerzjäckchen und der weißen Smokingjacke. Zum Abendessen waren für Herren Jackett und Krawatte vorgeschrieben. Das fand ich erstaunlich für eine Neckermann-Reise. Doch schon am dritten Abend verstieß einer der Herren gegen die Vorschrift. Bald fehlten immer mehr Jacken und Krawatten, und es herrschte eine angenehm lockere Atmosphäre. Was den Vorteil hatte, dass niemand großen Aufwand zeigen konnte. Jetzt hieß das ungeschriebene Gesetz: Bieder, bürgerlich, sportlich leger. Immerhin war die relative Armut der Reisenden abgestuft bis hin zum eigenen Haus auf Teneriffa und der Schuhimportfirma mit 150 Millionen Jahresumsatz, die mein 82-jähriger Tischnachbar besaß. Er und seine Frau lebten also auf entschieden größerem Fuß als ich und meine Frau, was uns aber nicht störte. Wir fanden die Zusammensetzung der Reisegesellschaft sehr angenehm.
Man wurde nicht erdrückt von schwerem Schmuck und steifer Würde. Der Vorteil der ungewöhnlichen Mischung bei dieser Neckermann-Reise lag auf der Hand: Freiere Bewegung.