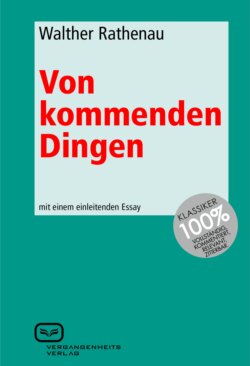Читать книгу Von kommenden Dingen - Walther Rathenau - Страница 5
Einleitendes Essay
ОглавлениеEinleitendes Essay
Walther Rathenau, Industrieller und Politiker (geb. in Berlin am 29.9.1867, ermordet am 24.6.1922), war der Sohn von Emil Rathenau, dem Gründer der AEG. Walther Rathenau bekleidete unterschiedliche Posten im Konzern seines Vaters: So war er 1892-99 Direktor der Elektrochemischen Werke Bitterfeld, nach 1899 Vorstandsmitglied der AEG, ab 1915 deren Aufsichtsratsvorsitzender sowie 1902-07 Geschäftsinhaber der Berliner Handelsgesellschaft. Schon früh agierte Rathenau auch als Politiker. 1914 regte er im Kriegsministerium die Einrichtung einer Kriegsrohstoffabteilung an, deren Aufbau er bis 1915 selbst leitete. Obwohl er die allgemeine Kriegsbegeisterung in Europa nicht teilte und noch 1917 ein Befürworter eines Verständigungsfriedens war, forderte er kurz vor der Novemberrevolution 1918 einen „Volkskrieg“ zur Abwendung der drohenden militärischen Niederlage.
Rathenau bemühte sich nach der Abdankung des Kaisers und der Gründung der Weimarer Republik vergeblich um die Schaffung einer bürgerlichen Sammlungspartei; seine politische Heimat fand er schließlich in der 1918 gegründeten DDP (Deutsche Demokratische Partei). Rathenau war einer der prominentesten Politiker der Weimarer Republik – und anders als viele seiner Zeitgenossen, ein überzeugter Republikaner. Als Industrieller war Rathenau aber auch Pragmatist, eine Haltung, die auch seine Politik prägte. Dass Rathenau sich nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg dafür stark machte, einen politischen Ausgleich mit den ehemals verfeindeten Staaten zu erreichen, wurde ihm jedoch mehr zum Vorwurf gemacht, als dass seine Zeitgenossen dahinter die einzig sinnvolle Handlungsalternative des besiegten Deutschland sehen konnten. Im Rahmen seines von nationalistischer und antisemitischer Propaganda (Rathenau war Jude) als „Erfüllungspolitik“ heftig bekämpften politischen Konzepts, Deutschland nach dem Gedanken den „einen Kontinent wiederherzustellen“ sowie dauerhaft und kooperativ im Kreis der europäischen Demokratien zu verankern, vertrat Rathenau Deutschland auf allen wichtigen politischen Konferenzen. Mit seinem Namen verbindet sich bis heute vor allem der Abschluss des Rapallovertrags, mit dem Rathenau den Osten Europas mit dem Westen zu verbinden suchte.
1922 fiel er dem Attentat von Mitgliedern der rechtsextremistischen „Organisation Consul“ zum Opfer. Er wurde von den Offizieren Ernst Werner Techow (Fahrer), Erwin Kern und Hermann Fischer aus einem fahrenden Auto heraus mit einer Maschinenpistole und einer Handgranate ermordet.
Rathenau war einer der interessantesten Köpfe der politischen und kulturellen Szene im Deutschland der 1910er und 20er Jahre. Er war nicht nur Lenker eines Firmenimperiums, nicht nur bloßer Politiker, sondern glühender Vertreter liberalen Gedankentums und der Republik, der ersten auf deutschem Boden. Als sozial- und kulturphilosophischer Schriftsteller war er ebenfalls einer der meistgelesenen Autoren seiner Zeit. Sein großes Thema als Autor waren die Gefahren der Mechanisierung und des materialistischen Denkens der Menschen in den modernen Gesellschaften. Bemüht, liberal-individuelle und sozialistische Elemente miteinander zu verbinden, entwarf er immer wieder die Utopie einer Gesellschaft jenseits von Kapitalismus und Sozialismus, um die Arbeiter aus ihrer unzeitgemäßen „Erbknechtschaft“ zu holen. Mit solchen Ansätzen setzte er sich weit ab von dem verbreiteten Lagerdenken seiner Zeit. Damals war man Sozialdemokrat, Kommunist oder vielleicht Monarchist – alles festgefahrene Kategorien, die Rathenau aufzusprengen versuchte. Mit diesem Versuch blieb er – wenn auch heiß diskutiert in der Öffentlichkeit – jedoch weitgehend unverstanden. Die Zeit des politischen Ausgleichs der Gruppeninteressen, die Zeit eines gesellschaftlichen Konsenses jenseits alter Grabenkämpfe war noch nicht gekommen. Rathenau galt den rechten, nationalistischen und monarchistischen Gruppierungen in der Weimarer Republik als Gefahr, seine visionären Gedanken überforderten die politische Debatte.
Das vorliegende Buch, „Von kommenden Dingen“, erschien 1917 – kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs, der die gesamte Ordnung der westlichen Welt auf den Kopf stellen sollte. Rathenau, ein genauer Beobachter seiner Zeit, nahm die Gemengelage zum Anlass, sein gesellschaftliches Konzept pointierter und ausführlicher als in den Schriften zuvor als wegweisende Alternative für die Zukunft darzustellen. Es ist ein visionäres Buch, gleichzeitig ein erhellendes Zeitdokument über das Ende des Kaiserreichs und den Beginn der ersten demokratischen Ordnung in Deutschland.