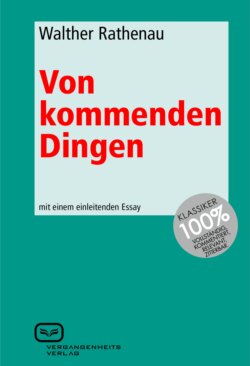Читать книгу Von kommenden Dingen - Walther Rathenau - Страница 7
Das Ziel
ОглавлениеDas Ziel
[31] Die Weltbewegung, welche die Epoche unsrer Zeit emporgetragen hat, stammt, von der Erscheinungsseite betrachtet, aus zwei Grundereignissen, die eng zusammenhängen.
Eine Volksverdichtung ohne Beispiel hat den zivilisationsfähigen Teil des Erdbodens ergriffen; sie hat in ihrem schwellenden Drang die dünne Haut der Oberschichten zerrissen, die vormals den europäischen Völkern ihre Farbe liehen und ihr Aufkommen bändigten.
Die zehnfach übervölkerte Menschheit verlangte eine neue Ordnung der Wirtschaft und des Lebens zu ihrer Erhaltung und Versorgung; die Umschichtung der Völker lieferte in den entbundenen Kräften der alten Unterschichten die intellektuale Verfassung, die dem Werke gewachsen war.
Der Weg, den der umschaffende Wille der Menschheit durchlaufen mußte, war lang; abstraktes Denken, exakte Wissenschaft, Technik, Massenbewältigung und Organisation mußten geschaffen werden, ein Umsteuern der menschlichen Wünsche, Gedanken und Ziele wurde gefordert, neue Lebensführung, neue Kunst, neue Weltauffassung und neuer Glaube mußten entstehen, um die veränderte Ordnung erst zu gestalten, dann zu rechtfertigen.
[32] Diese Ordnung habe ich in dem Buch „Zur Kritik der Zeit“ abgeleitet und beschrieben; ich habe sie Mechanisierung genannt, um ihre Universalität auszusprechen und um die mechanische Zwangläufigkeit anzudeuten, die sie von allen früheren Ordnungen unterscheidet. Denn ihr Wesen, alles in allem betrachtet, besteht darin, daß die Menschheit, halb bewußt, halb unbewußt zu einer einzigen Zwangsorganisation verflochten, bitter kämpfend und dennoch solidarisch für ihr Leben und ihre Zukunft sorgt.
Früh hat man den Zusammenhang der neuzeitlichen Erscheinung empfunden, doch wagte man nicht, mit einem Blick das Gesamtphänomen zu umspannen. Deshalb hört man noch immer vom Kapitalismus als einer die ganze Zeiterscheinung umschreibenden Tatsache reden, obgleich er nichts weiter ist als die Projektion der Gesamtordnung auf einen Teil der Wirtschaft. Deshalb bildet es noch immer ein unermüdliches Spiel der Wissenschaft, die Zweige der Mechanisierung aufeinander zu beziehen und voneinander abzuleiten: Kapitalismus, Entdeckungen, Krieg, Calvinismus, Judentum, Luxus, Frauendienst werden in wechselnden Bindungen verflochten und zur Evolvente des Gangs der Erscheinung gemacht, wobei es niemand auffällt, daß beständig ein Wunder durch das andre erklärt wird, und niemand einfällt, nach der Urvariablen zu fragen, die unabhängig und auf sich selbst gestellt das bunte Wallen der Erscheinungen beschließt und gerne gestattet, daß man die Töchter betrachtet, ohne der Mutter zu gedenken. Diese Grundfunktion aber ist im tiefsten Erleben des menschlichen Stammes beschlossen; von außen er- [33] blickt stellt sie sich dar als Wachstum der Zahl und Wandlung der Art, innerlich betrachtet ist sie ein Glied in der Geistesevolution des Lebendigen.
Denn auf der Schöpfungsgrenze, auf der wir stehen, durchschreitet der Geist das Gebiet des zweckhaften Intellekts, der mit seinen Trieben, Furcht und Begierde, vom Urgeschöpf bis zum Urmenschen alles Leben beherrscht, und strebt zur Seele, dem zweckfreien, wunschlosen Reich der Transzendenz. Damit die Menschheit dieses Reich gewinne, muß sie alle Lebenskräfte zusammenraffen, sie muß die Kraft des Intellekts, die einzige, über die sie in Freiheit verfügt, nach Menge und Stärke aufs höchste spannen, sie muß sich zugleich die Unvollendung, die Sinnlosigkeit dieses gewaltigsten Sinnes der materiellen Welt vor Augen führen. Denn der eine der Wege, die zur Seele führen, geht durch den Intellekt; es ist der Weg der Bewußtheit und des Verzichts, der wahrhaft königliche Weg, der Weg Buddhas. Diese Aufgabe und Schickung aber spricht sich aus als eine Not, wie alle Menschheitsschulung. Als Not ist diese selbstgeschaffene die schwerste trotz Eiszeiten und Wildnissen, als Aufschwung ist sie der gewaltigste seit Ursprung des Planeten.
Wer ist der Mensch, der von einer Torheit der Natur zu berichten wüßte? Die Mechanisierung aber ist Schicksal der Menschheit, somit Werk der Natur; sie ist nicht Eigensinn und Irrtum eines einzelnen noch einer Gruppe; niemand kann sich ihr entziehen, denn sie ist aus Urgesetzen verhängt. Deshalb ist es kleinliche Zagheit, das Vergangene zu suchen, die Epoche zu schmähen und zu verleugnen. Als Evolution und Naturwerk gebührt [34] ihr Ehrfurcht, als Not Feindschaft. Dem Feinde ziemt uns ins Auge zu blicken, seine Stärke zu ermessen, seine Schwäche zu erspähen, um ihn nach Schicksals Willen zu schlagen.
Mechanisierung als Not aber ist entwaffnet, sobald ihr heimlicher Sinn offenbart ist. Mechanisierung als Form des materiellen Lebens hingegen wird der Menschheit dienen müssen, solange nicht die Volkszahl auf die Norm der vorchristlichen Jahrtausende zurückgesunken ist. Drei ihrer Funktionen allein genügen, um ihr die Herrschaft über das materielle Erdentreiben zu sichern: die Arbeitsteilung, die Bewältigung der Massen und der Kräfte. Kein ernster Vorschlag wird verlangen, kein ernstes Urteil wird vermuten, daß die Menschheit freiwillig auf die Beherrschung der Natur verzichte, um in falscher Naivität ein kärglich beschränktes Dasein, ein völliges Vergessen alles Wissens, einen künstlichen Urzustand sich zu bereiten. Ganz töricht aber ist die Meinung jener großstadtmüden Einsiedler, die mit einem guten Buch, einfachem Hausrat und einer Laute sich in die Einsamkeit schöner Gebirge begeben und wähnen, der Mechanisierung entronnen zu sein, wo nicht gar sie gebrochen zu haben. Denn Mechanisierung als Praxis ist unteilbar; wer einen Teil will, der will das Ganze. Damit eine Axt käuflich sei, müssen Tausende in den Tiefen der Erde schürfen, damit ein Blatt Papier entstehe, müssen Waldungen im Rachen der Maschinen zerkaut werden, damit eine Postkarte bestellt werde, müssen die Schienenwege der Erde unter dem Donner der Lokomotiven erzittern. Betrug wider Willen und unbewußte Ausbeutung ist es, eine Mechanisierung mit Aus- [35] wahl gelten zu lassen; mögen jene Arkadienschäfer den letzten gesponnenen Faden, das letzte gezüchtete Saatkorn und die letzte Münze von sich abtun: sie werden auf der Erde kaum einen Fußbreit zum Schauplatz für erklügelte Robinsonaden finden.
Denn das Wesen der Mechanisierung schließt Universalität ein; sie ist die Zusammenfassung der Welt zu einer unbewußten Zwangsassoziation, zu einer lückenlosen Gemeinschaft der Produktion und Wirtschaft. Da sie aus sich selbst erwachsen, nicht durch bewußten Willen auferlegt ist, da keine Satzung Arbeit und Verteilung regelt, sondern ein allgemeiner Notwille, so erscheint die ungeheure Arbeitsgemeinschaft dem einzelnen nicht als Solidarität, sondern als Kampf. Solidarität ist sie, insofern das Geschlecht sich durch planvolles Wirken erhält und jeder sich auf den Arm des andern stützt, Kampf ist sie, insofern der einzelne nur so viel Anteil an Arbeit und Genuß erhält, als er erringt und erzwingt. In dieser brutalen Regellosigkeit des Triebartigen und Unbewußten der mechanistischen Organisation liegt, dies sei hier zum erstenmal betont und im künftigen ausgeführt, der eigentlich nothafte Kern ihres Folgewesens; die Welterscheinung selbst, soweit sie auf der Gemeinschaft des Kampfes um und gegen die Naturmächte beruht, ist weder gut noch böse, sondern schlechthin notwendig, weil Alle vereint mehr leisten als Einer, und weil Sammlung und Organisation die Bestimmung aller zum Leben geordneten Kräfte ist. Gleichviel in welcher planetarischen Heimat, wird jeder hinlänglich verdichteten und geistig zulänglichen Menschheitsform eine der Mechanisierung entsprechende Kollektiverscheinung er- [36] wachsen; von der seelischen Stärke dieser Menschheit aber hängt es ab, ob sie sich dem dunklen Willen unterwirft, oder ob sie den Zwang meistert.
Auf unserm Gestirn hat die Mechanisierung einen großen Teil ihrer Aufgabe erfüllt. Unter der Form der Zivilisation hat sie eine äußere Verständigung angebahnt, die Möglichkeit eines leidlich reibungslosen Zusammenlebens und organischen Aufbaues geschaffen. Unter der Form der Produktions- und Verkehrsgestaltung hat sie Ernährung, Kleidung und Behausung der vervielfältigten, ständig wachsenden Erdbevölkerung gesichert, indem sie die Fundstellen des Erdkreises öffnete, Zentralisierung der Verarbeitung, Dezentralisierung des Vertriebes lehrte. Unter der Form des Kapitalismus hat sie ermöglicht, die Arbeitsleistung der Menschheit nach Bedarf zu sammeln und auf geordnete, einheitliche Ziele zu lenken. Als staatliche und bürgerliche Organisation hat sie versucht, jeden Gruppenwillen zum Ausdruck zu bringen und dem Gesamtbewußtsein vernehmlich zu machen. Unter der Form der Publizistik leitet sie jeden Eindruck, den das Gesamtwesen empfängt, zum Wahrnehmungszentrum der Gemeinschaft. Unter der Form der Politik versucht sie die Umgrenzung der Nationalität und die Arbeitsteilung zwischen den Nationen zu erwirken. Unter der Form der Wissenschaft erstrebt sie ein Gemeinschaftsforschen des Erdgeistes, unter der Form der Technik setzt sie das Wissen um in Kampfbereitschaft gegen die Naturkraft.
Kein Gebiet der Erde ist unerschließbar, keine materielle Aufgabe undurchführbar, jedes Erdengut ist erschwinglich, kein Gedanke bleibt verheim- [37] licht, jedes Unternehmen kann Prüfung und Verwirklichung fordern; die Menschheit ist, soweit materielles Schaffen reicht, zu einem fast vollendeten Organismus erwachsen, der mit Sinnen, Nervensträngen, Denkorganen, Blutumlauf und Tastwerkzeugen den Ball umspannt, seine Kruste lockert und seine Kräfte aufsaugt.
Vom Organischen zum Ungegliederten führt kein Entwicklungsweg. Andre Organisierungsformen als die der Mechanisierung sind denkbar; dennoch werden auch sie stets ihrem materiellen Sinne gemäß einen materiellen Aufbau bilden, der Menschenkräfte sammelt, um Naturkräfte zu bezwingen, dennoch werden auch sie stets dem Leben die gleiche Gefahr und Bedrängung bieten, sofern die Kräfte der Seele sich ihrer nicht bemächtigen.
Noch ist es entschuldbar, daß die Welt an ihrem ersten Einheitswerke sich berauscht, ja daß sie das materiell Erbaute als für den Geist bewohnbar erachtet, daß sie ihr Denken und Erkennen, Fühlen und Wollen in den Dienst der selbstgeschaffenen Ordnung stellt. Und dennoch, obwohl das Gebäude den Gipfelpunkt noch längst nicht erreicht hat, regt sich das Gewissen. Zunächst freilich im grob mechanischen Sinne: die Enterbten bäumen sich auf; sie wollen diese sinnlich-mechanische Ordnung vernichten, um eine andre sinnlich-mechanische Ordnung an ihre Stelle zu setzen, die ihnen gerechter dünkt und mehr verspricht. Doch auch die Bevorzugten fühlen sich bedrückt. Sie fühlen den Verfall ästhetischer und sittlicher Werte, sie möchten die alten Zeiten herbeiholen und sind bereit, von der unteilbaren Mechanisierung so viel zu opfern, als ihnen zusammenhanglos erscheint, so [38] viel, als ihre Interessen und Bequemlichkeiten nicht betrifft. Vor allem aber dämmert ein Bewußtsein, daß Unrecht im Spiel ist. Daß keiner, auch der Glücklichste nicht, von innerem Abbruch verschont bleibt, daß ein Höheres als das Verlorene in Gefahr ist. Noch webt das Geplänkel um Außenwerke, weil das Gesamtwesen und die Gesamtmacht der Mechanisierung nicht erkannt und nicht verstanden ist; Fragen der Weltanschauung, des Kapitalismus, des Elends, der Technik werden außer Zusammenhang mit dem Zentralproblem erörtert. Eine Orientierung besteht nicht; Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Kultur, Gleichgewicht, Politik, Interesse, Tradition, Nationalität, Ästhetik werden abwechselnd zur Achse gewählt. Hier pocht das schlechte Gewissen der Zeit und ihre innere Sorge; wir haben die Mechanisierung nach ihren ordnenden Kräften befragt, nun soll sie über ihre geheim waltenden Zersetzungen Rede stehen.
I. Mechanisierung ist eine materielle Ordnung; aus materiellem Willen mit materiellen Mitteln geschaffen, verleiht sie dem irdischen Handeln eine Richtungskomponente ins Ungeistige. Niemand kann dieser Richtkraft gänzlich sich entziehen, im mechanistischen Sinne bleibt auch der höchst vergeistigte Mensch ein wirtschaftendes Subjekt, das, um zu leben, besitzen oder erwerben muß. Die Welt ist zur Händlerin und Schaffnerin geworden, und jeder trägt den Einschlag und die Färbung der Zeit. Wie müssen Jahrhunderte des Denkzwanges auf den gepreßten Menschengeist wirken! Die Ära der Arbeitsteilung verlangt Spezialisierung; bewegt sich der Geist in den ähnlich bleibenden Normen und Praktiken seines Sondergebietes, erscheint ihm [39] zugleich, durch tausendfältiges Botschaftswesen das Nebelpanorama des unbarmherzig wechselnden Weltgeschehens, so dünkt ihm leicht das Kleine groß, das Große klein; der Eindruck verflacht, leichtfertiges, verantwortungsloses Urteil wird begünstigt. Bewunderung und Wunder erstirbt vor dem Schrei der Neuheit und Sensation; von allem bleibt der schäbigste Vergleich: Zahl und Maß; das Denken wird dimensional. Gilt von den Dingen die Abmessung, so gilt vom Handeln der Erfolg; er betäubt das sittliche Gefühl, so wie Messen und Wägen das Qualitätsgefühl verblödet. Vom raschen Urteil nährt sich der Erfolg; Irrtum und Täuschung kostet; der Sinn wird skeptisch. Er will nicht in die Dinge, sondern hinter die Dinge, Menschen und Mächte dringen, er verliert Scheu und Scham. Wissen ist Macht, heißt es, Zeit ist Geld; so geht Wissen erkenntnislos, Zeit freudlos verloren. Die Dinge selbst, vernachlässigt und verachtet, bieten keine Freude mehr, denn sie sind Mittel geworden. Mittel ist alles, Ding, Mensch, Natur, Gott; hinter ihnen steht gespenstisch und irreal das Ding-an-sich des Strebens: der Zweck. Der nie erreichte, nie erreichbare, nie erkannte: ein trüber Vorstellungskomplex von Sicherheit, Leben, Besitz, Ehre und Macht, von dem je so viel erlischt, als erreicht ist, ein Nebelbild, das beim Tode so fernsteht wie beim ersten Anstieg. Ihm drohend gegenüber erhebt sich, realer und tausendfach überschätzt, das Furchtbild der Not. Von diesen Phantomen gezogen und getrieben, irrt der Mensch vom Irrealen hinweg zum Irrealen hin; das nennt er leben, wirken und schaffen, das vererbt er als Fluch und Segen denen, die er liebt.
[40] Dieser Zustand des mechanisierten Geistes aber ist nichts andres als der zum Großstadttaumel aufgepeitschte Urzustand der niedern Rassen, das Furcht- und Zweckwesen derer, die in ihrem Aufschwung das Zeitalter geschaffen haben. Mehr als ein Atavismus: ein Niedersinken aller, die den Trank genießen, in die Tiefe der Dunklen, die ihn brauten. So sind sie auf dem Zenit der Zivilisation verdammt, das Leben, die Stimmung, die Angst und die Freuden zu erleben, die ihre Vorderen den Sklaven gönnten.
Diese Stimmung aber ist Streben und Verblendung. Streben, dem kein Ziel genügt und das doch so irrational ist, daß es zuletzt die Arbeit zum Selbstzweck macht, und so erdgebannt, daß es alles, was gleißt, vom Wege aufliest und, mit der toten Fracht der Mittel belastet, sich zum Grabe schleppt; Verblendung, der keine Tatsache real genug, kein Wissen zu nebensächlich ist, und die doch jede Vertiefung scheut, die Welt entfleischt und entgeistert, den sterblichen Sinn ertötet und den unsterblichen verschmäht.
Die Freuden sind die der Kinder, Sklaven und niedern Frauen: Besitz, der glänzt und Neid schafft, Unterhaltung und Sinnenrausch. Die Besitzfreude steigert sich zum irrsinnigen Warenhunger, der sich selbst vertausendfacht, indem Übersättigung und Mode alljährlich die Schatzkammern entwerten und leeren müssen, um sie mit neuem Unrat und Tand zu füllen. Tief erniedrigend und entwürdigend sind die Freuden der Großstadt und der Gesellschaft, die in unbewußter Ironie sich die bessere nennt. Verläßt ein denkender Mensch und Menschenfreund die Stätten, an denen dieses Volk sich [41] vergnügt oder, wie es mit dem gemeinsten Wort vulgärer Sprache es bezeichnet, sich amüsiert; verläßt er diese Orte, ohne auch nur einen Augenblick an der Zukunft der Menschheit zu zweifeln, so hat er die stärkste Prüfung seiner Weltzuversicht überstanden. Rausch, Lust und Verbrechen strömt aus Giften und Reizmitteln, die an Aufwand das Dreifache fordern von dem, was die Welt für alle Aufgaben ihrer Kultur zusammenträgt.
2. Mechanisierung ist Zwangsorganisation, deshalb verkümmert sie die menschliche Freiheit.
Der einzelne findet das Maß seiner Arbeit und Muße nicht mehr im Bedürfnis seines Lebens, sondern in einer Norm, die außer ihm steht, der Konkurrenz. Es genügt nicht, daß er nach dem Ausmaß seiner Kräfte und Wünsche schafft, er wird geschätzt nach dem, was der andre, die andren schaffen; halbe oder langsame Arbeit ist wertlos, sie gilt nicht besser als Müßiggang. Die Weltarbeit vom Feldherrn bis zum Postboten, vom Tagelöhner bis zum Finanzmann steht unter dem Druck des Akkord- und Rekordsystems; von jedem wird so viel verlangt, als der andre leistet. Der alte Handwerker ergänzte sein Schaffen durch Liebe und Verschönerung; die Mechanisierung produziert unter dem Sinnbild der Submission: ein Minimum an Güte und Menge wird vorgeschrieben, der geringste Preis ist recht, und Liebe wird nicht bezahlt. Die Grenze der Anspannung bietet der Kampf der Gruppen, aufwärts bis dem der Nationen, und auch der entscheidet sich nach objektiven Kräftesummen, ohne Einfluß des einzelnen.
Selbst in der Richtung und Fassung seiner Werktätigkeit ist der Mensch nicht frei. Mag er zur [42] Einseitigkeit oder zur Vielfältigkeit bestimmt sein die mechanistische Ordnung benutzt ihn zur Spezialisierung. Willig fügt sich das Geschlecht dem Zwang, es erzeugt den geborenen Handelsreisende und Schullehrer, wie es den geborenen Betriebsingenieur und Insektenforscher erzeugt; noch mehr es liefert die Typen in der Zahl und Auswahl, wie Bedürfnis und Überfüllung sie vorschreibt. Rückfall wird bestraft; entsteht noch dann und wann ein Mensch vom alten Schlage der Krieger, Abenteurer, Handwerker, Propheten, so wird er aus der gemeinsamen Anstalt ausgeschlossen und verfemt oder zum niedersten undifferenzierten Dienst entwürdigt.
Der Zwang geht weiter. Auch die Selbstverantwortung wird dem Menschen genommen. Denn das organisatorische Wesen der Mechanisierung beruhigt sich nicht, bevor jeder ihrer Teile, jede ihrer Summen wiederum zum Organismus geworden ist; in gleicher Lückenlosigkeit, wie jedes noch so kleine und noch so große Element der lebenden Natur sich als Organon darstellt. Genossenschaften, Vereinigungen, Firmen, Gesellschaften, Verbände, Bureaukratie, berufliche, staatliche, kirchliche Organisationen binden und trennen die Menschheit in unübersehbarer Verflechtung; niemand ist für sich, jeder ist unterworfen, andern verantwortlich. Dieser Zustand, erhebend in der Großartigkeit der Konzeption und in der naturgewaltigen Tröstlichkeit eines nicht mehr menschengeschaffenen Schicksals, wird zum öden Dienst in jenen gewaltigen, unbewußt dämmernden Regionen, in denen nicht selbstbewußte Verantwortung, sondern unterworfenes Interesse waltete. Auch der zünftige [43] Handwerker war abhängig, doch nicht im gleichen Sinne wie der Angestellte des Warenhauses; seine Gebundenheit war sichtbar, eindeutig und dennoch von innerer Freiheit erfüllt. Ein Blendwerk äußerer Freiheit bedeckt die mechanistische Bindung: der Unzufriedene kann Rücksicht auf Form verlangen, auftrumpfen, die Arbeit niederlegen, wegziehen, auswandern: und doch befindet er sich nach Wochen bei veränderten Namen, Personen und Ortschaften im gleichen Verhältnis. Die Anonymität der Unfreiheit vollbringt durch ihren Zauber, was den alten Despotien und Oligarchien mit ihren Häschern und Spähern nicht gelang: die Abhängigkeit zu verewigen.
Der Einzelzwang aber ist ein geringes Übel, verglichen mit der Massenerscheinung, die ihn überdeckt. Die Mechanisierung als Massenorganisation bedarf der Menschenkraft nicht einzeln, sondern in Strömen. Die Pyramidenmannschaft der Pharaonen genügt nicht, um den Tagesbedarf eines Landes auch nur an Werkzeugen zu decken; die Heeresmacht Napoleons reicht nicht zu für die Besatzung eines Bergwerksbezirks. Völkerschaften müssen bereitstehen, um sich zu wechselnden Heeresströmen beständig neu zu ordnen, millionenfache Maschinenpferde verlangen millionenfaches Zentaurenvolk. Nicht innere Notwendigkeit des Mechanisierungsprinzips, sondern bequem gebilligte Begleitumstände der Entwicklung haben die an sich unvermeidliche Arbeitsteilung zwischen geistiger und körperlicher Leistung zur ewigen und erblichen gemacht und so in jedem zivilisierten Lande zwei Völker geschaffen, die blutsverwandt und dennoch ewig getrennt, im gleichen Verhältnis [44] wie ehedem die stammesfremden Ober- und Unterschichten, einander gegenüberstehen. Beide sondert und beherrscht der Zwang. Ohne Verlust bürgerlichen Ranges und Bewußtseins, ohne Verzicht auf gewohnten Umgang, Güter des Genusses und der Kultur steigt kein Oberer hinab, ohne den Zufall eines Anfangbesitzes an Kapital oder Ausbildung dringt kein Unterer hinauf. Dieser Zufall aber ist, abgesehen vom Falle der Auswanderung, so unverhältnismäßig selten, daß unter Tausenden von Angestellten, die durch den Gesichtskreis unsrer Unternehmer schreiten, sich kaum der Sohn eines echten Proletariers findet.
Von unerhörter Härte ist dieser Trennungszwang für das zweite Volk. Helotie, Leibeigenschaft, Hörigkeit waren auf Landwirtschaft gegründete Abhängigkeiten. Die Arbeit, härter und unlohnender als die der Freien, war doch von gleicher Art; es war der schön bewegte Kreis des Landlebens, wenn auch unter Aufsicht und elende Kürzung des Ertrages gezwängt. Die Arbeit des Proletariers genießt zwar jene lockende Anonymität der Abhängigkeit; er erhält nicht Befehle, sondern Anweisungen, er folgt nicht dem Herrn, sondern dem Vorgesetzten; er dient nicht, sondern übernimmt eine freie Verpflichtung; seine menschlichen Rechte sind die gleichen wie die des Gegenkontrahenten; er hat die Freiheit, Ort und Stellung zu wechseln; die Macht, die über ihm steht, ist nicht persönlich: erscheint sie in der Form eines einzelnen Arbeitgebers oder einer Firma, so ist es in Wahrheit die bürgerliche Gesellschaft. Dennoch verläuft sein Leben, wie er es auch innerhalb dieser Scheinfreiheit gestalte, in generationenlanger Öde und [45] Gleichförmigkeit, über und unter Tage. Wer ein paar Monate lang bei ungeistiger Verrichtung von 7 bis 12 und von I bis 6 das Zeichen einer Pfeife herangesehnt hat, ahnt, welche Selbstverleugnung ein Leben der entseelten Arbeit fordert; niemals wieder wird er versuchen, durch kirchliche oder profane Überredung dieses Leben an sich als ein zufriedenstellendes zu rechtfertigen, und jeden Versuch, es zu mildern, als Begehrlichkeit verschreien. Wer aber ermißt, daß dies Leben nicht endet, daß der Sterbende die Reihe seiner Kinder und Kindeskinder unrettbar dem gleichen Schicksal überliefert sieht, den ergreift die Schuld und Angst des Gewissens. Unsre Zeit ruft nach Staatshilfe, wenn ein Droschkenpferd mißhandelt wird, aber sie findet es selbstverständlich und angemessen, daß ein Volk durch Jahrhunderte seinem Brudervolk frönt, und entrüstet sich, wenn diese Menschen sich weigern, ihren Stimmzettel zur Erhaltung des bestehenden Zustandes abzugeben. Das flache Dogma des Sozialismus ist ein Produkt dieser bürgerlichen Gesinnung; tiefste Notwendigkeit und funkelndes Paradox ist es zugleich, daß dieses Dogma zur stärksten Stütze von Thron, Altar und Bürgertum werden mußte: indem es nämlich mit dem Gespenst der Expropriation den Liberalismus schreckte, so daß er alles freie und eigene Denken fahren ließ und hinter den erhaltenden Mächten Schutz suchte.
Der herrschenden Volksschicht ist der mechanistische Trennungszwang keine Not, doch eine Gefahr. Es scheint ein Naturgesetz, daß jeder Organismus, der vom natürlichen Lebenskampfe auch nur um ein weniges entlastet wird, zunächst zwar üppig gedeiht, dann erschlafft und eingeht. [46] Die Völkeropfer dieser Schicksalsfolge wurden ehedem von Eroberern abgelöst und in wiedererzeugende Berührung mit dem Boden gebracht. Eroberer birgt der Behälter der Erde nicht mehr eine bloße Umwälzung der Schichten würde das Spiel mit vertauschten Rollen, nicht mit erfrischten Kräften, erneuern und kläglich beenden. Zu der Entlastung von leiblicher Arbeit tritt die Geschlechterfolge intellektualer Anspannung, die unsre Großstädte geistig und physisch entfruchtet und der Dämpfung des westlichen Volks Wachstums vorarbeitet.
Überblickt man die Erscheinung der zwangsweisen Schichtung, die wir dem rastlosen Streben der Mechanisierung nach Organisation und Arbeitsteilung zuschreiben, so ergibt sich abermals, daß die Bewegung zum Empfindungs- und Bewegungskreise ihrer dunklen Urerzeuger zurückgekehrt ist. Sie hat den Urständ der Sklaverei nicht verschmerzt und trotz Abendland, Christentum und Zivilisation verstanden, ein Hörigkeitsverhältnis über die Völker zu breiten, das ohne gesetzlichen Zwang, ohne sichtbare Herrengewalt, durch den bloßen Ablauf scheinbar freier Wirtschaftsvorgänge gesichert, eine zwar anonyme und verschiebbare, doch unzerbrechliche und erbliche Abhängigkeit von Schicht zu Schicht verbürgt.
3. Mechanisierung ist nicht aus freier und bewußter Vereinbarung, aus dem ethisch geläuterten Willen der Menschen entstanden, sondern unabsichtlich, ja unbemerkt aus den Bevölkerungsgesetzen der Welt erwachsen; trotz ihres höchst rationalen und kasuistischen Aufbaues ist sie ein unwillkürlicher Prozeß, ein dumpfer Naturvorgang. Un- [47] ethisch auf dem Gleichgewicht der Kräfte, auf Kampf und Selbsthilfe beruhend, wie etwa der Urzustand im Lebensgleichgewicht eines Waldes, verbreitet sie eine Weltstimmung, die, rückwärts gewandt über die frühe Arbeit des Christentums, über die politische und theokratische Ethik der Mittelmeerkultur hinweggreifend, unter der Deckung und Maske der Zivilisation abermals auf primitive Menschheitszustände hinstrebt. Denn diese Stimmung ist Kampf und Feindschaft.
Das menschliche Herz schlägt zu warm, es ist zu bedürftig der Anlehnung und Liebe, als daß der Haß als offne, weltverzehrende Flamme ausschlagen dürfte; doch je härter und spröder das Geschlecht, das der Mechanisierung erliegt, desto tückischer nagt der innere Brand im knirschenden Getriebe.
Der frühere Mensch goß seine Kraft und Liebe in sein Werk; er war um des Dinges willen da; die Menschen standen abseits, er bedurfte ihrer zum seltnen Austausch, zum gemeinsamen Schutz oder zum Dienst. Im engen Kreise umgaben ihn die Seinen, die er hegte, im weitern die Genossen, denen er Treue hielt, in fernerem Abstand die Feinde, die er bekämpfte. Der neue Mensch lebt nicht um eines Dinges willen; er strebt nach dem neutralen Gut des Besitzes, nach dem unverkörperten Begriffe einer relativen, doch beliebig ausdehnbaren Machtsphäre; sein Lebensinhalt ist nicht die Sache, die zum Mittel herabsinkt, sondern die Laufbahn. Durch Menschenmauern hindurch muß sie gebrochen werden; wohin er blickt, wo immer er stehen möchte, steht ein andrer, der ist sein Feind. Um Bresche zu reißen, bedient er sich des [48] Genossen, der Gefolgschaft; nicht aus Liebe führt er sie, folgen sie ihm, sondern aus Interesse; jeder ist dem andern Mittel, das aufgegeben wird, wenn es nicht mehr dient. Dem Produzenten ist der Mitmensch Konkurrent, das ist Feind, Abnehmer, das ist Mittel; Lieferant, das ist Feind, Sozius, das ist Mittel. Wem er sich nähert, von dem will er etwas, wer sich ihm nähert, der will etwas von ihm, so sind beide auf der Hut, und ihre Stimmung ist feindliches Mißtrauen. Deshalb erscheint es jedem einerseits gefährlich, anderseits ungeziemend, im Fremden den Menschen zu wecken; es ist Herkommen, ihn wie Luft zu behandeln, bis die blöde Konvention der Namensnennung den landesüblichen Schutz eines kalten Respekts gesichert hat. Der menschenfreundliche Schwärmer, der sich über die Form hinwegsetzt, wird, wenn er nichts zu bieten hat, kühl abgetan; hat oder vermag er Begehrenswertes, so fühlt er bald zum Dank seines Vertrauens sich zum Mittel erniedrigt. Er teilt mit Recht das Schicksal derer, die einen Gesamtzustand statt durch Einwirkung auf Gesinnung und Gewissen durch Sonderexperimente beheben wollen. Deshalb klagen die Menschen so gern einander an und warnen sich wechselweise, rühmen sich ihrer schlechten Erfahrungen und erklären sich als Pessimisten der Menschenkunde. Sie wissen nicht, daß sie sich selbst verurteilen. Denn in der menschlichen Natur liegt diese Feindseligkeit und Niedrigkeit nicht, das Herz des Menschen ist zart wie seine nackte Haut, es ist der Rührung, dem Schmerz, der Neigung hingegeben. Was dies Herz verhärtet, ist die Angst; die Sklavenpeitsche der Mechanisierung, die niemals ruht, und deren Zischen. [49] Hunger, Verachtung, Entrechtung, Schmerz und Tod bedeutet. Freilich sind die Nöte an sich nicht furchtbar, sondern Wege des Heils; doch nur für den gläubigen Menschen; die Mechanisierung aber hat vorsorglich verstanden, um ein wenig Wissen und Zauberei ihm den Glauben abzukaufen.
Feindschaft von Mensch zu Mensch steigert sich zur Feindschaft von Gruppe zu Gruppe, Stamm zu Stamm, Volk zu Volk. Der Mensch ist zum Interessenten geworden; irgendeine kümmerliche Theorie hat ihm und seinesgleichen Abhilfe aller Bedrängnis versprochen, sie schließen sich zusammen, nennen's Partei oder Interessenvertretung, verallgemeinern ihre umgekehrten Beschwerden zu einem positiven Idealbegriff und entrüsten sich, daß der Widersacher, vom entgegengesetzten Interesse ausgehend, nicht zum gleichen Ideal gelangt. In dieser an Spielarten so ergiebigen Zeit ist nichts schwerer zu finden als ein Mensch, dessen Überzeugung und Ideal sich nicht mit seinen Interessen deckt; diese verzweifelte Erfahrung führt dazu, daß es ernste Denker gibt, die eine Weltanschauung, eine transzendente Überzeugung überhaupt nicht mehr als eine Form der Erkenntnis, als einen Abglanz des Ewigen dulden, sondern vielmehr darin nur eine Art von Charakter- und Interessenumsetzung, gewissermaßen eine Krankengeschichte, eine idiosynkratische Sonderlichkeit erblicken. Soweit geht das Vertrauen zur Positivität der Interessen, zur Alleinherrschaft des Intellekts, zur Erdgebundenheit des Gefühls.
Welches Interesse hat nun die Mechanisierung, durch Angst und Not, durch Feindschaft und Kampf ihre Opfer auf die Höhe der Leistung zu [50] treiben? Ahnt sie nicht, daß alles Größte der Welt Werk der Liebe und brüderlicher Gemeinschaft gewesen ist? Zweifelt sie daran, daß Not zwar Eisen bricht, Glaube aber Berge versetzt?
Mag sie es ahnen, doch gleicht sie darin dem armen Satan, daß sie in den Höhen machtlos ist. Sie hat sich verpflichtet, den Menschen mit tausendfach vermehrter Sippe zu nähren, zu unterhalten und zu bereichern, und hält diesen Pakt. Ihre Mittel sind kunstvoll und erfinderisch, aber gemein, denn aus gemeiner Not entstammt sie; den edleren Menschen drückt sie hinab, den niedern zieht sie empor; bis zu ihrer eigenen Höhe, nicht höher. Nun kennt sie ihr Knechtsgefolge; den Glauben hat sie vernichtet, zum guten Willen hat sie wenig Vertrauen, mit Angst und Plage kommt sie zurecht. Wo Wetteifer nicht ausreicht, erzwingt es die Konkurrenz, wo Bruderhilfe erlahmt, erzwingt es der Kampf, wo Volksgemeinschaft ermangelt, erzwingt es die Klassenschichtung. Und abermals in allen diesen Mitteln herrscht der uralte Trieb des Neides, des Hasses, der Angst und Begierde, unter dessen Aspekt die Mechanisierung erzeugt ward.
Auch daran erinnert sie sich ihres Ursprungs, daß sie die Menschen verfolgt, die nicht nach ihrem Bilde geschaffen sind. Der freie Mensch der Phantasie, der Träumer des Göttlichen, der hingegebene Freund der Dinge und Geschöpfe, der Liebende, der für den kommenden Tag nicht sorgt und das Fürchten nicht lernt, ist ihr ein träger und verträumter Knecht. Noch über ein kurzes duldet sie ihn hinterm Pflug, in der Front, auf fremden Meeren, dann denkt sie sein Werkzeug durch Maschinen, ihn selbst durch Schlauere zu [51] ersetzen. Des Menschenfreundes, der glaubt, daß die Seele nach dem Worte der alten Schrift ans Blut gebunden ist, bemächtigt sich Verzweiflung, denn das beste Blut entströmt unwiederbringlich. Wer aber glaubt, daß der Geist das Blut beherrscht, daß aus Steinen Abrahams und Deukalions Same erweckt werden kann, der wird dies verrinnende Blut als die Opfergabe preisen, die dem Geist Befreiung aus mechanistischen Banden verbürgt.
Wir wissen, daß alle Güter dieser Erde nichts sind als amorpher Rohstoff, weder gut noch böse, weder wert noch unwert, solange sie nicht zu zweiter Natur wiedergeboren sind. Die Güte, die aus Gewöhnung und freundlicher Anlage kommt, nicht wiedergeboren aus Stärke des Herzens, ist keine Güte; Natur, durch kein vergeistetes Auge neu erzeugt, ist nicht Natur; das Meisterwerk gewinnt seine Freiheit, indem es durch Kunst zur Natur wiedergeboren wird; der Mensch selbst, ungeläutert durch Fall, Bewußtheit und Aufstieg, bleibt im Seelenhaften ungeboren. Die Wiedergeburt durch Bewußtheit und freien Willen zur Pflicht und zum Liebeswerk war dem mechanistischen Wesen noch nicht beschieden; noch ist es ungebrochenes Natur- und Kriegswerk, in gleichem Stande wie Selbstverteidigung vor Anbruch des Gesetzes oder Ernährung ohne Erkenntnis des Eigentums. Und doch ist die Mechanisierung sittlicher Durchgeistigung fähig; ihr höchster und edelster Teil, der Staat, hat durch vorzeitliche Weihen sie erfahren und könnte ohne diese Verklärung seiner Sendung nicht bestehen. Freilich fließen die tausendfachen Attribute des Staates aus ehrwürdigeren Quellen; Heimatsliebe, Stam- [52] mesgenossenschaft, nationale Gemeinschaft, des Kulturbesitzes und Erlebens, religiös-theokratische Verschwisterung des Empfindens haben sein Reich ins Übernatürliche gesteigert. Doch es entscheidet nicht die Herkunft, sondern die immanente Notwendigkeit des Wesens; es entscheidet das Bewußt sein, daß die geheiligte Institution höher steht als die Notdurft des einzelnen, die Ahnung, daß der Mensch nicht um eines irdischen Glückes willen geschaffen ist, sondern in göttlicher Sendung, der Glaube, daß die menschliche Gemeinschaft nicht eine Zweckvereinigung bedeutet, sondern eine Heimat der Seele. Dieses unausgesprochene Bewußtsein, das auch der unvollkommensten Staatsform noch einen Schimmer von Göttlichkeit verleiht, muß dereinst erwachen für jede Form und Handlung materiellen Lebens und muß selbst die Mechanisierung ergreifen und durchdringen. Stets war das Wirken in Wissenschaft und Kunst, in Heer und Staat sich bewußt, daß kein Werk verantwortungslos für sich allein steht, daß jedes sich selbst und der Welt Rechenschaft schuldet, daß eine Kette der Pflicht und Notwendigkeit alles Schaffen verbindet, daß Losgelöstheit und Willkür die Schmach des Eigennutzes und der sinnlichen Knechtschaft an der Stirn trägt. Das Bewußtsein muß aber erwachen, daß in gleichem Maße alles materielle Handeln und alles, was ihm dient, ein Bauen am irdischen und überirdischen Leibe der Menschheit bedeutet, darin jeder Schritt und Handstreich, jeder Gedanke und Laut Kerne und Zellen formt, daß eine göttliche Verantwortung und Dankbarkeit eines jeden Sache zu jedermanns Sache und jedermanns Sache zur Sache eines jeden [53] macht, daß es kein Unglück und Verbrechen gibt, für das wir nicht alle Rechenschaft schulden, daß kein Recht, keine Pflicht, kein Glück und keine Macht abseits vom Schicksal aller erworben und vertreten werden kann. Ist einstmals auch die Mechanisierung von dieser Erkenntnis durchgeistet, so ist sie nicht länger ein empirischer Gleichgewichtszustand; dann wächst sie empor und hinein als wahrhafter Organismus in das Gesamtorganon des Schöpfungskreises, auf daß nun in seinen Adern ungehemmt vom Herzen zum Herzen der Gottheit die Kräfte strömen und das planetare Leben zum Bilde organischer Theokratie sich vollendet.
Überblicken wir getrost den Umfang der mechanistischen Erscheinung! Die technisch dienende Verrichtung: Das wuchernde Geschlecht zu nähren und zu erhalten, wird von der mechanisierten Ordnung zulänglich geleistet. Zu den Kräften der Natur, zum Bereiche sinnlicher Erkenntnis ist ein bedeutendes Verhältnis geschaffen. Im nützlichen Denken, im Sammeln und Verteilen der Kräfte, in der Beweglichkeit der Massen und der Geister ist Ungeahntes erreicht. Das Übel der Mechanisierung beginnt, wo die ungebrochene, undurch- geistete Kraft sich des innern Lebens bemächtigt, wo die gewaltig entfesselte Bewegung verantwortungslos aus der dienenden Bindung sich befreit, um den Menschen und sein Geschlecht, den Herrn des Getriebes, zum Knecht seines eigenen Werkes zu erniedern. Hier quillt Unfreiheit, sinnloses Mühen, Feindschaft, Not und geistiges Sterben.
Doch dem Menschen ist es gegeben, sich zu besinnen und mit dem Lichte seiner übersinnlichen Ahnung die Wirrnis zu durchleuchten. Die Me- [54] chanisierung als materielle Ordnung wird er nicht preisgeben, solange nicht neue Ereignisse und Einsichten ihn gelehrt haben, den Naturkräften anders als durch organisierte Arbeit und Forschung entgegenzutreten. Die Mechanisierung als geistige Herrscherin des Daseins wird er bekämpfen und kann er vernichten, sobald er die Praxis vom Zweck zum Mittel mäßigt, sobald er des Notzwangs und Blutlohns nicht mehr bedarf, sobald er vorzieht, aus freiem Willen zu leisten, was heute der Zwang ihm erpreßt, und den ärmlichsten Teil seines unedlen Sonderglücks um Menschheitssegen einzutauschen.
Daß es nur eines Umsteuerns des Geistes bedarf, nicht des Maschinellen, begreifen wir aus innerster Tiefe, sobald wir nochmals die Mechanisierung als Erscheinung verlassen und sie als Geistesevolution von innen ergreifen. Hier erscheint sie uns als die gewaltige Steigerung des Erdengeschöpfes zum Intellekt, der in der beispiellosen Zahl seiner Träger, in der Schärfe und Nachhaltigkeit, Zielrichtung, Verzweigung und Sammlung seiner Organe ein ungeheures Maß niedersten Geistes in Bewegung hält. Dieses Maß reicht aus, um dem blinden Willen der Natur ein Gleichgewicht zu bieten; und die erste dankbare Regung der beschenkten Welt ist das kindliche Vertrauen, sie dürfe den überschwenglichen Kräften des Intellekts ihr Glück und ihre Freiheit anheimstellen. Hier beginnt Irrtum und Not und mit ihr die Heilung. Endlich hat die Steigerung des Denkens die kritische Einsicht gereift, daß Intellekt zum Ordnen der Begriffe taugt, nicht zum Erkennen; indem nun diese Einsicht sich zum Begreifen erhebt, die höchste [55] Pflicht der unteren Geisteskräfte sei Selbstbeschränkung, Selbstaufhebung, Verzicht auf alles Richten und Lenken: so ist alsbald der Boden für die reine Saat bereitet, die lebend von Anbeginn im Dunkel des Menschenherzens schlummert. Es ist Zeit zum Anbruch der Seele! Daß wir heute ihr Bild zu ahnen, ihren Mächten uns hinzugeben vermögen, verdanken wir der Not der intellektualen Weltepoche. Sie welkt, nachdem sie diese Frucht getragen; nicht in dem Sinne zwar, als solle die Menschheit künftig auf ihr Recht zu denken und zu formen verzichten: sie wird es pflegen und stärken, doch stets in dem Bewußtsein, daß es niedere Kräfte, zum Dienst geborene sind, deren sie in höherer Verantwortung und Sendung waltet. Berühren aber die ersten Strahlen der Seele die intellektuale Welt und ihre Verwirklichungsform, die mechanistische Ordnung, so ist es nicht entscheidend, welche der Starrnisse zuerst dahinschmelzen; denn nicht der Zusammenhang sekundärer Ereignisse, sondern die Sonnennähe transzendenter Ahnung führt den Frühling über die Welt. In diesem bescheidenen Sinne ist der aufbauende Teil der Erörterung zu verstehen: Nicht ein vollkommenes Verzeichnis irdischer Handlungen in zeitlicher Reihenfolge ist ihr letztes Ziel, sondern die Aufweisung pragmatischer Verwirklichungsformen des Gedankens: Daß Seelenrichtung des Lebens und Durchgeistung der mechanistischen Ordnung das blinde Spiel der Kräfte zum vollbewußten, freien und menschenwürdigen Kosmos gestaltet.
[56] Noch schwebt unentschleiert und unbenannt die Aufgabe über unserm Haupt. Den Weltzustand, der uns umgibt, haben wir ermessen; die Richtung, die zur Freiheit führt, wurde erkennbar, das Gestirn, dem wir folgen, weist den Weg zur Seele. Nun liegt uns ob, die pragmatische Form zu gestalten, die den überstrebenden Gedanken irdisch umfaßt und unsrer Epoche greifbar vermittelt; die metaphysische Aufgabe soll uns ihr physisches Abbild enthüllen.
Noch einmal muß zuvor ein Wort über materielle Einrichtungen und Entwürfe schlechthin gesagt werden.
I. Welchen Gewinn des innern Lebens dürfen wir von Lebensbedingungen und Lebensformen und ihrer Änderung überhaupt verlangen? Die materialistische Auffassung antwortet: Jeden. Der Mensch verdanke alles seinen Zuständen und Umständen; Blut, Luft und Erde, Lage und Besitz umschreibe ihn so vollkommen, daß jedem Wechsel der äußern Bedingungen eine gleichwertige Änderung des innern Bestandes entsprechen müsse. Zum stärksten Rüstzeug des Materialismus gehört dieser verführerische Irrgedanke: denn die Geschichte scheint ihn allenthalben zu bestätigen. Haben nicht die Veränderungen der Erdkruste die Evolution der Geschöpfe erzwungen? Folgen die Strömungen und Wanderungen der Menschenvölker nicht physischen Gesetzen? Ist nicht Wesen und Schicksal der Nationen aus Stammesart, Land und Umwelt bestimmbar? Ist nicht der Einzelmensch selbst Geschöpf seiner Vorfahren und seines Lebenskreises? Unbestreitbar: die Zentren der höchsten Kulturen fielen stets zusammen mit den Zentren [57] der Macht, der Volksdichte, des Reichtums; Einsamkeit, Armut, Not, die heiligen Quellen geistlicher Erhebung haben niemals einem Volke Kunst und Gedanken beschert. Seevölker werden klug, so heißt es; Hellas, Rom, Venedig, Holland, England verdanken ihre Macht dem Meere; Deutschland wurde stark durch sein Blut, Frankreich durch seinen Boden, Amerika durch seine Lage. Alles dies scheint wahr.
Verfolgen wir die Lehre mit ihren eigenen Mitteln, so verliert sie bald genug ihre Zuversicht. Welche Kraft war es denn, die bei allen Erdumwälzungen die Geschöpfe emportrieb? Der Wille zum Leben? Er allein konnte nicht Flossen schaffen noch Flügel wachsen lassen, nicht reden und nicht denken lehren. War es das Blut? Das kam ja erst durch jenen geheimnisvollen Willen zu seiner Adelung; auch der Urahn des Ariers war ein düsteres Geschöpf, weit tiefer stehend als Mongole und Neger. War es der Boden? Nun, es stand jedem frei, diesen Boden zu besetzen; der Stärkste und Erleuchtetste hat ihn genommen. Also doch wieder Stärke und Blut? Dann mag ein Zufall diese Vorzüge gebildet haben.
Genug dieser Argumente. Sie setzen voraus, was sie zu beweisen haben, daß Leib das erste, Geist das zweite ist, daß Materie Geist formt. Glauben wir, daß wir Geschöpfe des Fleisches sind, so mag wer will das Leben versüßen und beschmeicheln; dann ist das Ringen um Gott und unsre Seele eitel, und es haben die das Wort, die um des Nützlichen und des Nutzens willen da sind. Glauben wir aber, daß der Geist sich seinen Körper formt, daß der Wille nach oben die Welt emporträgt, daß der [58] Funke der Gottheit in uns lebt: dann ist der Mensch sein eigenes Werk, dann ist sein Schicksal sein eigenes Werk, dann ist seine Welt sein eigenes Werk. Dann ist das Seevolk nicht das von der See beschenkte, sondern das Volk, das die See wollte; dann ist das Volk der Bodenschätze nicht ein glücklicher Finder, sondern ein Eroberer; dann ist das Volk, das zur kulturtragenden Dichte gelangt, nicht eine heckende Horde, sondern ein Stamm, der Nachkommen will und ihnen ein Land bereitet; dann ist das edle Blut nicht ein Spiel der Natur, sondern ein Werk der Selbstzucht strebenden Geistes.
Darum darf dennoch nicht die Gegenfrage gestellt werden: Warum sollen wir Formen und Güter des Lebens achten und pflegen, wenn nicht sie, sondern Stille und Betrachtung das Höchste schaffen? Das irdische Leben bedeutet die Formation und Waffe, die dem Geiste verliehen ist, darin er um sein Recht, Dasein und Künftiges kämpfen soll; ist er tauglich zum unsichtbaren Kampf, so soll er auch zum sichtbaren Kampf tauglich sein. Das edle Geschöpf schafft sich Schönheit, das gesunde schafft sich Glück, das starke Macht; nicht um dieser Güter selbst willen, sondern als irdisches Kleid seines geistigen Daseins; nicht strebend und gierend, sondern selbstlos und selbstverständlich. Und wie der Träger die Waffe beherrscht, so wirkt die Waffe zurück auf den Träger; das Volk, das die Kraft hatte, schön zu werden, findet in seiner Schönheit einen neuen Ansporn zum innern Adel. Freilich steht dem Armen und Verachteten die Pforte des Seelenreiches doppelt offen; aber sein Wille sie zu suchen wird beflügelt, wenn ein edles [59] Volk von seiner Kraft und Sehnsucht ihm mitteilt. Unter Reichen freiwillig arm zu sein ist schön und trägt evangelischen Sinn; im Bettlervolk ein Bettler bildet keinen Kontrast und kein spezifisch sittliches Verdienst. Der Einzelmensch ist Endzweck; in ihm endet die Reihe der sichtbaren Schöpfung und beginnt die Reihe der Seele; ist in ihm die Seelenkraft erwacht, so bedarf er nicht mehr der irdischen Vorzüge und Vorteile; Armut, Krankheit, Einsamkeit müssen ihm dienen und ihn segnen; das Volk aber ist seine Mutter, die ihn im Erdendasein überlebt, sie braucht Schönheit, Gesundheit und Kraft zum ewigen Werke des Gebärens. Hier löst sich der Widerspruch: Was heißt es, nichts für sich begehren und dennoch für den Nächsten sorgen, der doch auch seinerseits nichts begehren sollte? Der Nächste und der Fernste sind unser aller Mutter und Brüder zugleich; damit sie leben und zeugen, ist unser Einzelleben ein geringer Preis. Deshalb ist es nicht unwürdig noch materiell befangen, der Gemeinschaft die Güter und Kräfte zu ersehnen und zu schenken, die man für sich selbst nicht achten soll.
2. Die zweite Vorfrage lautet: Wie sind pragmatische, der Menschheitslage gewidmete Entwürfe zu rechtfertigen; welche Beweiskraft liegt ihnen bei, welche Beweislast liegt ihnen ob?
Es wurde erwähnt, auf das Recht, Ziele zu finden, hat die Wissenschaft verzichten müssen. Für alles schöpferische Denken aber ist das Ziel entscheidend, nicht der Weg, die Frage schwerer als die Antwort. Und wiederum ist es leichter, sie zu finden, als sie zu suchen. Denn hier versagt die intellektualeKraft; die vermag eine Reihe von Beschwerden und Unzuträglichkeiten des Bestehenden zu sammeln und [60] zu sagen: dies sollte nicht sein — (obwohl sie Prüfung und Übel, segensreiche und schädliche Not nicht zu unterscheiden vermag) —, doch niemals kann sie bestimmen: dies ist als höchstes Gut der Menschheit beschieden und erreichbar, dies sollen wir erstreben, müssen wir erringen. Denn all unser Willen, soweit er nicht animalisch ist, entspringt den Quellen der Seele. Jedem schrankenlosen Verehrer des intellektualen Denkens sei es von früh bis spät wiederholt: Der größere und edlere Teil des Lebens besteht aus Wollen. Alles Wollen aber ist unbeweisbares Lieben und Vorlieben; es ist seelisches Teil, und neben ihm steht der zählende, messende und wägende Intellekt abseitig und selbstbewußt als Theaterkassierer am Eingang zur Bühne der Welt.
Was wir schaffen, geschieht aus tiefstem, wissenlosen Drang, was wir lieben, ersehnen wir mit göttlicher Kraft, was wir sorgen, gehört der unbekannten künftigen Welt, was wir glauben, lebt im Reiche des Unendlichen. Nichts davon ist beweisbar, und dennoch ist nichts gewisser; nichts davon ist greifbar, und dennoch geschieht jeder wahre Schritt unsres Lebens im Namen dieses Unaussprechbaren. Was tun wir vom frühen Morgen bis zum späten Abend? Wir leben für das, was wir wollen; und was wollen wir? Das, was wir nicht kennen und nicht wissen und dennoch unverbrüchlich glauben.
Dieser Glauben aber hat eine stärkere Evidenz als die des intellektualen Beweises. Was Plato, Christus und Paulus beweislos sprachen, kann jeder Rabulist widerlegen, und dennoch stirbt es nicht; und jedes dieser Worte hat ein wahrhafteres Leben und mehr Glauben entzündet als irgendeine physi- [61] kalische, historische oder soziale Theorie. Fragen wir, was im strengsten Sinne beweisbar sei, so hält selbst die euklidische Geometrie nicht stand; wenn dennoch die Welt von tiefster Wahrheitsempfindung immer wieder durchdrungen wird: was ist das Merkmal der lebendigen Wahrheit?
Es ist die Kraft, mit der sie an die Herzen schlägt. Jedes echte Wort hat klingende Kraft, und jeder Gedanke, der nicht in den Labyrinthen des dialektischen Verstandes sondern im blutwarmen Schöße der Empfindung geboren ist, zeugt Leben und Glauben. Deshalb ist alles Beweisen nur ein Überreden, gutgläubige Täuschung. Glaubt ein Mensch sich berufen, Wahrheit zu zeugen, nicht weil er sie denkt, sondern weil er sie schaut und erlebt, weil die Welt, die er im Geiste fühlt, ihm wirklicher ist als die er mit Augen sieht, so mag er reden. Ist er ein Verblendeter, so wird er mit seinem Staube den Weg dessen ebnen, der nach ihm und aus der Wahrheit kommt. Ist ihm aber auch nur ein einziges Wort verliehen, das Leben trägt, so wird es, nackt und unbewehrt in die Welt gestreut, zur Saat der Herzen. Das gilt vom Ziele. Versucht einer aber, nicht bloß das Ziel zu sichten, sondern auch dem irdischen Schritt den Pfad zu weisen, so ist es abermals auf dieser tieferen Ebene der Pragmatik nicht Überredung und Beweis, was ihm den Gang, den andern die Folge erhellt. Nie hat ein Führer oder Vorläufer vermocht, die lückenlose Beweiskette seiner Pläne auszubreiten, und hätte er's, so wäre das simple Thersiteswort: „Es geht nicht“ unübersteiglich ihm entgegengeschleudert worden. Das einzige, was in der Welt nachwirkt, wenn der Sturm [62] der Gegenreden verrauscht, ist die Forderung an das Gewissen. Sie redet leise, und sie wiederholt in der Stille der Nacht, was der Lärm des Tages übertäubt; sie spricht nicht in eines Menschen Namen, sondern im Namen des Lebendigen. Und indem sie immer den gleichen einfachen Weg bezeichnet, läßt sie offenbar werden, daß nicht ein erkünsteltes Projekt, sondern ein erschautes Müssen und Mögen uns bevorsteht. Deshalb kann auch das pragmatisch Geplante uns überzeugen, ohne zu beschwatzen; darin gleicht sich der gesunde Vorschlag des Geschäftsmannes und der Schlachtruf des Propheten, daß ein zwingend Notwendiges fühlbar wird, das im Geist nachklingt und tönend anwächst. Auch hier gilt kein Beweis; sondern Intuition erzwingt Einfühlung, Geschautes wird greifbar. Fehlt einer Darlegung diese kindliche Kraft, so bleibt sie gelehrtes Gedankenspiel und Ästhetenfreude, gepanzert wie sie sei mit Anmerkungen, Nachweisen und Tabellen.
So bürgt für das Ziel das Herz, das Gewissen für den Weg; und diese strenge Mahnung mag den Schreiber aufrichten, wenn der die Schwäche des Wortes erkennt; ihn demütig machen, wenn er sich von Lieblingsgedanken fortreißen läßt. Der Leser aber sei auf der Hut vor dem Gedanken, der sich Beweiskraft anmaßt, er richte nach dem, was in seinem Innern anklingt, mit Strenge, aber in Wahrheit.
3. Und endlich: Wenn unser Leben im höchsten Sinne den äußern Bedingungen enthoben ist, wenn Einrichtungen niemals Gesinnungen schaffen können, wenn alles äußere Dasein nur die Muschelschale, den Maskenausdruck des seelischen Erlebens [63] bedeutet; bleibt es würdig und angemessen, dem künftigen Gang des Gleichnisses vorzuspüren, statt gläubig dem Wege des Geistes zu folgen, in der Gewißheit, daß er auch dem Körperschritt Bahn läßt?
Wir sind in dieses leibliche Dasein gestellt als in ein Gleichnis, um es zu begreifen; als in einen Preiskampf, um ihn zu bewältigen. Was wir dem Geiste abringen, wird Wirklichkeit des Lebens, versteinert zur Stufe für neuen Aufstieg. Solange nur, als er Handwerker bleibt und Meister des Werkzeuges, wird der Künstler das Erlebnis seines Herzens unverdorben und unverfälscht aus seinem Innern lösen; Stoff und Werkzeug des Denkenden aber ist die Welt, und der Gedanke gewinnt die volle Kraft seiner Wahrheit erst dann, wenn die Welt, an ihm gemessen, organisch und möglich bleibt. Wer es jemals versucht hat, Gedanken, die der freien Region der Überzeugung entstammen, im Boden der Wirklichkeit zu verankern, wer die harte, stets unbelohnte Mühe dieser der Menge unvorstellbaren Arbeit kennt, der verliert den Respekt vor symmetrisch gerundeten Theoremen und schönen Denkfehlern, die aus Unterschätzung sinnlicher Erscheinung sprießen. Das Evangelium wäre sterblich, wenn es als abstraktes Gesetz auf Pergament stände, und kehrte sein Verkünder wieder, so würde er nicht wie ein studierter Pastor in antiquarischer Sprache mit syrischen Gleichnissen reden, sondern von Politik und Sozialismus, von Industrie und Wirtschaft, von Forschung und Technik; freilich nicht als ein Reporter, dem diese Dinge an sich erfüllt und stupend sind, sondern den Blick auf das Gesetz der Sterne gerichtet, dem unsre Herzen gehorchen.
[64] Nochmals sei nach diesen Einwendungen aufs kürzeste die Frage ausgesprochen: Wie setzt sich die transzendente Aufgabe in die pragmatische um? Die transzendente Aufgabe lautet: Wachstum der Seele; wie lautet die pragmatische?
Sicherlich lautet sie nicht: Steigerung des Wohlstandes. Selbstverständliche und leicht erfüllbare Menschenpflicht ist die Beseitigung aller Not und drückenden Armut; die Kosten eines Rüstungsjahres würden ausreichen, um die Blutschuld der Gesellschaft zu tilgen, die heute noch den Hunger und seine Sünden in ihrem Schoße duldet. Doch diese Aufgabe ist so einfach, so mechanisch, trotz ihrer herzzerreißenden Dringlichkeit so trivial, daß sie eher der polizeilichen als der ethischen Vorsicht zugeschrieben werden sollte. Was darüber hinausgeht, bleibt im letzten Sinne gleichgültig. Noch immer zeugt und trägt die Erde so viel, daß der Gesamtheit Nahrung, Kleidung, Werkzeug und Muße zur Genüge erwächst, sofern sie nur im rechten Maße schaffen, verbrauchen und genießen will. Mag Reichtum als Voraussetzung gehobener Lebensform gelten und bleiben: eine Gemeinschaft von Millionen schaffender Menschen ist in sich unendlich reicher als die berühmten Kleinstädte des Altertums und der Mittelzeit; ein Bahnhof verschlingt hundertfach die Arbeitsleistung des Parthenon; und bleibt der Geist edleren Lebens wach, so findet er Stoff und Werkzeug zur Verkörperung.
So wenig wie Wohlstand ist Gleichheit die äußere Forderung unsrer Seelen. Welcher irregeleitete Gerechtigkeitssinn konnte je auf die Forderung der Gleichheit verfallen? Wie wenig wissen wir vom [65] tiefsten Innern unsres Nächsten: Worte sind vereinbarte Botschaften über unverglichene Dinge; wir beide nennen rot, was bekannte Reihen von Gegenständen als Farbe ausstrahlen, und wissen doch nicht, ob die Rotempfindung des einen nicht gar der Grünempfindung des andern entspricht. Mut: dem einen das angeborene ahnungslose Gefühl der Unbedachtsamkeit, dem andern die furchtbarste Entscheidung des Seelenkampfes zwischen zwei Gefahren; Tugendreinheit, dem einen versuchungsfreie Gewohnheit glückererbten Lebens, dem andern frühverlorenes, traumersehntes Kleinod; Glück, dem einen ein göttlicher Strom aus jeder Offenbarung der Natur, dem andern ein künstliches, nie vollendetes Gebäude aus tausendfacher, nie gestillter Wunscherfüllung: diese Kontraste hat Natur hinter Menschenstirnen verborgen; sie zu mildern hat sie einem jeden den Weg gewiesen zu unendlicher Mannigfaltigkeit des Daseins, des Schaffens und Leidens, damit jeder Drang sein Gleichgewicht, jede Einseitigkeit ihre ausgleichende Umwelt finde: Was kann ungerechter in die Gnade dieses Planes eingreifen als mechanische Gerechtigkeit? So, wie die Ungleichheit zweier Höhen sich dem Auge verschärft durch die Wahl gleicher Basis, so muß die Ungleichheit der Geschöpfe bis zur Karikatur hervortreten bei gewaltsamer Ausgleichung der Lebensbedingungen. Wir finden uns damit ab, daß Mechanismen des Lebens, die der radikalen Ordnung dienen: Strafrecht und Polizei, Verkehr und Handelsrechte zur Gleichheit streben, die den Schlechteren gegen den Besseren schützt; was darüber hinauslangt, ist unbedachter Drang eines verirrten Gerechtigkeitsgefühls, das [66] nicht der Verantwortung, sondern dem Neide entspringt.
Niemals kann Gleichheit die irdische Forderung unsres seelischen Lebens verwirklichen. Kann es die Freiheit?
Freiheit! Nächst der Liebe der göttlichste Ton unsrer Sprache — und dennoch, wehe dem, der in unserm Lande vertrauensvoll und begeistert ihn ohne Umschweif vernehmen läßt. Auf ihn stürzen sich Schulmeister und Polizisten, gewappnet mit allen Distinktionen der Philosophen und allen Vorurteilen des Sicherheitsstaates, und beweisen ihm, daß die höchste Freiheit nur in der höchsten Unfreiheit liege, so daß als Freiheitskampf allenfalls ein Landeskrieg bezeichnet werden dürfe.
Wer wird Freiheit mit Zügellosigkeit verwechseln? Wer jedoch mir zumutet, daß schließlich auch mein Wille unfrei sei, daß die Autorität und Partei, der ich mich anschließe, rückwirkend meine Freiheit begrenzt, daß der Gegner, den ich bekämpfe, mich einschränkt, daß der menschliche Gleichgewichtszustand Beengung verlangt, der treibt Spitzfindigkeit mit halben Wahrheiten und drischt leeres Stroh.
Ein Baum wächst in Freiheit. Das bedeutet nicht, daß er sich auf und davon machen oder in den Himmel wachsen kann; daran hindert ihn die Begrenzung seiner Natur. Es bedeutet auch nicht, daß eine Zelle seines Stammes in die Krone wandern, daß ein Blatt sich in eine Blüte verwandeln, ein Ast über alle übrigen hinauswachsen darf; das verbietet das innere organische Gesetz. Dies Gesetz herrscht in Freiheit und durch Beschränkung. Es gebietet, daß der Stamm trage und nähre, dass [67] die Blätter atmen und die Wurzeln saugen, daß das Sonnenjahr mit Keim und Blüte begrüßt, mit Frucht gesegnet und mit Einkehr beschlossen werde.
Nun wird der Baum ummauert. Wurzeln und Zweige sind an der Entfaltung gehemmt, Wind und Sinne abgewiesen; das verkümmerte einseitige Wachstum steht unter verändertem Gesetz; so alt es sein mag, es ist nicht das eigene, es ist nicht Ausdruck innerer organischer Notwendigkeit, nicht mehr gewollte Selbstbeschränkung, sondern äußeres, gewaltsames Schicksal; an die Stelle der Freiheit tritt der Zwang.
Mag es schwer sein, Freiheit zu umschreiben; ihr Gegensatz, der Zwang, ist leicht zu erkennen. Er ist für jeden Organismus, Mensch, Volk oder Staat dasjenige innere oder äußere Gesetz der Hemmung, das nicht von innerer Notwendigkeit des eigenen oder des umfassenden Wesens verhängt ist. Kriterium für Zwang und Freiheit ist somit die Notwendigkeit; gefordert wird von den Befürwortern gottgewollter Abhängigkeiten der Nachweis, daß diese Notwendigkeit in Wahrheit und in solchem Maße besteht, daß die Aufhebung der Hemmung zum Zusammenbruch oder zur Verkümmerung des Organismus führt. Verwegene Überhebung ist es, in der Abhängigkeit an sich den Selbstzweck zu erblicken; dieser Gedanke führt zur Sklaverei; nur die organische Notwendigkeit erträgt den Namen des Gotteswillens.
Liegt die Ursache der Beschränkung und Abhängigkeit nicht in der Lebensnotwendigkeit des eigenen oder umfassenden Organismus, sondern im Willen und der Gewalt eines fremden Organismus, so ergibt sich der Stand der Knechtschaft.
[68] Knechtschaft und Sklaverei laufen dem Sinne des Christentums nicht zuwider. Sie sind Schickungen, die das äußere Leben behindern, die Entfaltung der Seelenkräfte, das Nahen des Gottesreiches nicht ausschließen. Epiktets Herzensgewalt wuchs in der Knechtschaft, die Blüte des christlichen Mittelalters entsproß dem Kloster. Doch unsre Frage ist anders gestellt; wir wollen nicht wissen, wie der einzelne durch die Gnade innerer Freiheit ein unabänderliches Schicksal überwindet; wir wollen die gerechte Form des Lebens finden, die den Seelenweg der Menschheit öffnet. Dieser Weg aber verlangt organische Entfaltung, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung; er kann nicht der Weg des Zwanges sein noch der vorbestimmten Abhängigkeit. Wir wissen eins: Knechtschaft ist der Gegenpol der seelischen Forderung.
Keinen ihrer Ruhmestitel schlägt unsre Zeit höher an als die Überwindung der Sklaverei. Leibeigen ist niemand; Untertan heißt der Mensch nur noch in anmaßenden Erlassen; er selbst nennt sich Staatsbürger, genießt ungezählte persönliche und politische Rechte, gehorcht niemand als der Staatsgewalt, bündelt, wählt und verwaltet. Er verdingt sich nicht, sondern schließt Arbeitsverträge, er ist nicht Knecht und Geselle, sondern Personal, Arbeitnehmer und Angestellter; er hat keinen Brotherrn, sondern einen Arbeitgeber, und der darf ihn nicht schelten noch strafen. Er kann kündigen und seiner Wege gehen, er darf feiern und wandern, er ist, wie er sagt, ein freier Mann.
Und doch seltsam! Gehört er nicht zu den wenigen, die man gebildet und vermögend nennt, so sitzt er nach wenigen Tagen in den Räumen eines [69] andern Arbeitgebers, bei der gleichen achtstündigen Arbeit, unter der gleichen Aufsicht, mit gleichem Lohn und mit gleichen Genüssen, mit gleicher Freiheit und mit gleichen Rechten. Niemand zwingt ihn, niemand tritt ihm in den Weg, und dennoch verläuft sein frühalterndes Leben ohne Muße und ohne Sammlung. Die mechanische Welt tritt ihm entgegen als ein verworrenes Rätsel, das eine Parteizeitung einfarbig beleuchtet; die höhere Welt erscheint im Ausschnitt einer billigen Predigt und eines populären Abrisses; der Mensch erscheint als Feind, wenn er dem fremden, als wortkarger Genosse, wenn er dem eigenen Kreise angehört, der Arbeitgeber als Ausbeuter, der Arbeitsraum als Knochenmühle.
Die Bürgerrechte bestehen, vor allem das Wahlrecht in beiderlei Form. Doch wiederum seltsam! Im behördlichen Leben bleibt der Mensch stets Objekt; Subjekt sind die andern, gleichviel ob sie als militärische Vorgesetzte ihn duzen, als Richter aburteilen, als Polizei und Beamte ihn behandeln, ausfragen, verwalten. Er mag sich verbünden und organisieren, versammeln und demonstrieren, er bleibt der Regierte und Gehorchende, auf den goldnen Stühlen sitzen die gleichen, die in breiten Straßen unter Bäumen wohnen, in Wagen fahren und sich grüßen; sie tragen die Verantwortungen, die Würden und die Macht.
Doch das bürgerliche Leben ist frei. Hier herrscht der Wettbewerb, der Starke und Kluge mag wagen und gewinnen, hier beschränken ihn nur notdürftige Gesetze und Regeln; dieser Kampfplatz steht allen offen. Und abermals: der Eintritt gelingt nicht. Der Kreis ist heimlich geschlossen, sein Bundes- [67] merkmal ist Geld. Wer hat, dem wird gegeben; was einer besitzt, das vermehrt sich, doch zunächst muß er besitzen. Er besitzt, was seinen Vorfahren gehörte, was sie ihm als Erziehung und Kapital hinterließen. In reichen, unerschlossenen Ländern mag es gelingen, daß der ersparte Pfennig sich mehrt; je älter und unergiebiger das Land, desto teurer der Einkauf in den werbenden Stand.
So erheben sich gläserne Mauern von allen Seiten, durchsichtig und unübersteiglich, und jenseits liegt Freiheit, Selbstbestimmung, Wohlstand und Macht. Die Schlüssel des verbotenen Landes aber heißen Bildung und Vermögen, und beide sind erblich.
Deshalb schwindet die letzte Hoffnung des Ausgeschlossenen: seinen Kindern möchte beschieden sein, was ihm selbst versagt war; er scheidet aus der Welt mit der Erkenntnis, daß seine Arbeit nicht ihm, nicht seinen Nachkommen, sondern andern und ihren Nachkommen diente, daß auch ihr Schicksal erblich, vorbestimmt und unentrinnbar sei.
Was bedeutet das? Das bedeutet nicht die alte Knechtschaft, die persönlich war, und indem sie die Schicksale zweier Menschen oder zweier Familien, widernatürlich zwar, doch unter einem Dach verband, die letzte menschliche Gemeinschaft und Anteilnahme aufrechthielt. Dieses Verhältnis bedeutet unter dem Scheine der Freiheit und Selbstbestimmung eine anonyme Hörigkeit, nicht von Mensch zu Mensch, sondern von Volk zu Volk, unter beliebigem Austausch der Beziehung, jedoch unter dem unverbrüchlichen Gesetz der einseitigen Herrschaft. Dieses erbliche Diensttum besteht in allen Ländern des alten Zivilisationskreises, es besteht unter Bevölkerungsklassen gleichen Stammes, [71] gleicher Sprache, gleichen Glaubens und gleicher Sitte und nennt sich Proletariat.
Mit der Forderung der seelischen Freiheit und des seelischen Aufstiegs vertragt es sich nicht, daß die eine Hälfte der Menschheit die andre, von der Gottheit mit gleichem Antlitz und gleichen Gaben ausgestattete, zum ewigen Dienstgebrauch sich zähme. Man wende nicht ein, daß beide Hälften nicht sich, sondern der Gemeinschaft leben und schaffen; denn die obere Hälfte wirkt unter freier Selbstbestimmung und unmittelbar, die untere wirkt, indem sie ohne Blick auf ein sichtbares Ziel mittelbar und im Zwange der oberen dient. Niemals sieht man einen Zugehörigen der oberen Schicht freiwillig niedersteigen; der Aufstieg der unteren aber wird durch Vorenthalt der Bildung und des Vermögens so vollkommen verhindert, daß nur wenige Freie in ihrem Kreise einen Menschen erblicken, der selbst oder dessen Vater den untersten Ständen angehört hat.
Trägheit und Vorteil sind starke Kräfte, wenn sie dahin wirken, sich mit dem Gegebenen abzufinden. Die Abschaffung der Sklaverei in Amerika, der Leibeigenschaft in Rußland hat leidenschaftliche Teilnahme erfahren, vor allem bei den Nichtgeschädigten; die Besitzer menschlicher Haustiere verteidigten ihre Einrichtung mit gleichen Gründen, wie heute Geistliche, Staatsmänner und Kapitalisten sie für die Notwendigkeit der Unfreiheit anführen: gottgewollte Abhängigkeit, Dienst, gleich viel an welcher Stelle, Demut und Selbstbescheidung; und auch hier gelten die Argumente stets für die andern.
Daß die im Rechte und Besitz Beharrenden ihre [72] hartherzige Meinung im besten Glauben vertreten, weil ihnen das Bestehende so absolut gültig, so festgefügt, unabänderlich und unersetzlich scheint daß nur der allgemeine Zusammenbruch an seine Stelle treten könnte, diese urteilslose Einseitigkeit und unfreiwillige Verhärtung hat nichts so sehr verschuldet wie der Kampf und Kampfplan der sozialistischen Bewegung.
Diese Strebung trägt den Fluch ihres Vaters, der nicht ein Prophet war, sondern ein Gelehrter, der sein Vertrauen setzte nicht in das menschliche Herz, dem alles wahrhafte Weltgeschehen entspringt, sondern in die Wissenschaft. Dieser gewaltige und unglückliche Mensch irrte so weit, daß er der Wissenschaft die Fähigkeit zuschrieb, Werte zu bestimmen und Ziele zu setzen; er verachtete die Mächte der transzendenten Weltanschauung, der Begeisterung und der ewigen Gerechtigkeit.
Deshalb hat der Sozialismus niemals die Kraft gewonnen, zu bauen; selbst wenn er unbewußt und ungewollt in seinen Gegnern diese produktive Kraft entzündete, verstand er die Pläne nicht und wies sie zurück. Nie hat er auf ein leuchtendes Ziel zu weisen vermocht; seine leidenschaftlichsten Reden blieben Beschwerden und Anklagen, sein Wirken war Agitation und Polizei. An die Stelle der Weltanschauung setzte er eine Güterfrage, und selbst dies ganze traurige Mein und Dein des Kapitalproblems sollte mit geschäftlichen Mitteln der Wirtschafts- und Staatskunst gelöst werden. Mag hie und da ein unbefriedigter Denker Auswege ins Ethische, Reinmenschliche, Absolute gesucht und angedeutet haben: diese Gewalten wurden niemals als die Sonnenzentren der Bewegung verehrt, son- [73] dern allenfalls als matte Seitenlichter ästhetisch geduldet; im Mittelpunkt der Bühne saß der entgötterte Materialismus, und seine Macht war nicht Liebe, sondern Disziplin, seine Verkündung nicht Ideal, sondern Nützlichkeit.
Aus der Verneinung entsteht Partei, nicht Weltbewegung. Der Weltbewegung aber schreitet Prophetensinn und Prophetenwort voran, nicht Programmatik. Das Prophetenwort ist ein einiges, ideales Wort; mag es Gott, Glaube Vaterland, Freiheit, Menschentum, Seele heißen: Besitz und Besitzverteilung sind ihm schattenhafte Nebendinge; selbst Leben und Tod, Menschenglück, Elend, Not, Krankheit und Krieg sind ihm nicht letzte Ziele und Gefahren.
Niemals hat Sozialismus die Herzen der Menschheit entflammt, und keine große und glückliche Tat ist jemals in seinem Namen geschehen; er hat Interesse erweckt und Furcht geschaffen; aber Interessen und Furcht beherrschen den Tag, nicht die Epoche. Im Fanatismus einer düsteren Wissenschaftlichkeit, im furchtbaren Fanatismus des Verstandes, hat er sich abgeschlossen, zur Partei geballt, im unfaßbaren Irrtum, daß irgendeine einseitig losgelöste Kraft endgültig wirken könne. Doch der Dampfhammer vernichtet nicht den Eisenblock, sondern verdichtet ihn; wer die Welt umgestalten will, darf sie nicht von außen pressen, er muß sie von innen fassen. Erschließbar ist sie durch das Wort, das in jedem Herzen, wenn auch noch so schüchtern, widerklingt und es wandeln hilft; das blinde Pochen einer Partei von Interessenten täubt und verschließt die Ohren.
Nimmt man alles in allem, in größten Zügen, [74] die rein politische Wirkung der sozialistischen Bewegung im Laufe dreier Geschlechter: so besteht abgesehen von geschäftlich-organisatorischen Wirksamkeiten die Summe ihres Waltens in der mächtigsten Steigerung des reaktionären Geistes, in der Zertrümmerung des liberalen Gedankens und in der Entwertung des Freiheitsgefühls. Indem der Sozialismus die Aufgabe der Völkerbefreiung zu einer Frage um Geld und Gut machte und unter diesem Banner die Massen gewann, wurde die Idee gebrochen; aus Unabhängigkeitsdrang wurde Begehrlichkeit; mancher innerlich Gebildete wandte sich ab, das Bürgertum erzitterte, die besitzende Reaktion sah sich durch Zulauf und bequeme Maßregeln doppelt gestärkt und lächelte über den armen Teufel der Masse, der Böses wollte, Gutes schuf, der Thron und Altar festigte, indem er Republik und Kommunismus anpries. Innerlich Interessentenvereinigung, äußerlich Beamtenhierarchie, verfiel der Sozialismus, der Weltbewegung werden sollte, dem Abstieg zur Partei, dem Wahn der Zahl, der populären Einheitsformel; im Gegensatz zu jeder echten Epoche verlor er an Wirksamkeit, je stärker er wuchs.
Aus der Trägheit des Gewissens, die der Widerstand gegen traurige Nützlichkeitsparadiese, gegen Schalter- und Markenideale, gegen nüchterne Schausprüche und invektive Drohungen im Herzen Europas hinterlassen hat, aus dieser Trägheit müssen wir uns losreißen. Empfinden wir den Stachel der Würdelosigkeit, den die Knechtschaft verwandten, geliebten und göttlichen Blutes uns einprägt, so werden wir ohne Scheu eine Wegstrecke neben der Bahn des Sozialismus wandern und dennoch seine [75] Ziele ablehnen. Wollen wir in der innern Welt das Wachstum der Seele, so wollen wir in der sichtbaren Welt die Erlösung aus erblicher Knechtschaft. Wollen wir die Befreiung der Unfreien, so bedeutet dies nicht, daß wir irgendeine Güterverteilung an sich für wesentlich, irgendeine Abstufung der Genußrechte für wünschenswert, irgendeine Nützlichkeitsformel für entscheidend halten. Es handelt sich weder darum, die Ungleichheiten des menschlichen Schicksals und Anspruchs auszugleichen, noch alle Menschen unabhängig oder wohlhabend oder gleichberechtigt oder glücklich zu machen; es handelt sich darum, an die Stelle einer blinden und unüberwindlichen Institution die Selbstbestimmung und die Selbstverantwortung zu setzen, dem Menschen die Freiheit nicht aufzuzwingen, sondern ihm den Weg zur Freiheit zu öffnen. Welche menschlichen und sittlichen Opfer dies fordert, ist gleichgültig, denn es wird nicht Nützlichkeit und Vorteil erstrebt, sondern göttliches Gesetz. Würde durch dieses Gesetz die Summe des äußern Glücks auf Erden vermindert, so verschlüge es nichts. Würde der Weg der äußern Zivilisation und Kultur verlangsamt, so wäre das nebensächlich. Wir werden ohne Leidenschaft erwägen, ob diese Nachteile eintreten; wenn es nicht geschieht, so ist das keine Anpreisung oder Ermunterung für unsern Gang. Denn der bedarf keiner Überredung und keiner Versprechung; im Sichtbaren will ihn die Würde und Gerechtigkeit unsres Daseins und die Liebe zum Menschen, im Jenseitigen will ihn das Gesetz der Seele.
Wenn von nun an diese Schrift sich eine Zeitlang mit den Dingen des Tages befaßt und dennoch nicht den [76] tastenden, beweisenden und überredenden Schritt beibehält, den der Praktiker gewohnt ist und sachlich nennt, so sei diese Unterscheidung bemerkt: Wir haben tausendfach Schriften, die das letzte Zehntel einer verbreiteten Überzeugung sicherstellen und unwiderleglich machen, bis die nächste Überzeugung kommt und die alte vernichtet, und wir haben solche, die aus gegebenen Voraussetzungen die brauchbarsten Folgen ziehen. Leider fehlt beiden bei aller mathematischen Sicherheit der Methode die Sicherheit des Zieles, die niemals mathematisch sein kann, sondern stets intuitiv ist. Hier wird keine Sicherheit beansprucht, sondern Empfindung und Wertung denkend erörtert; denn diese Schrift ist nicht praktisch erwägend, sondern zielsetzend. Entspricht dies Ziel im kleinsten dem Empfindungswege des objektiven Geistes, so wird das Maßwerk der Wirklichkeiten ohne unser Zutun zu den Bögen des Gedankens emporwachsen.
Das Ziel aber, zu dem wir streben, heißt menschliche Freiheit.
[ 77]