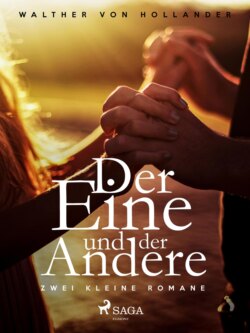Читать книгу Der Eine und der Andere - Walther von Hollander - Страница 9
5.
ОглавлениеWer war die Gawrilowa? Was war es mit der Gawrilowa? Eine Anfrage bei ihren Bekannten hätte merkwürdige Ergebnisse gehabt. War sie etwa keine Kokotte, weil sie über ein in der Bank von England lagerndes Vermögen von vielen Millionen verfügte? War sie etwa keine bedeutende Sängerin, weil sie höchstens alle halbe Jahre einmal öffentlich sang? War sie etwa keine Männerjägerin, weil es langsam – und sehr wider die öffentliche Meinung – durchsickerte, dass die Männer, mit denen sie vertraulich umging, mit denen sie reiste, wohnte, alle nicht an das heiss erstrebte „Ziel“ kamen? War sie, die Lieblingsschülerin der Pawlowa, etwa keine bedeutende Tänzerin, weil sich die Wigman abfällig über sie geäussert hatte?
Tatjana war eine ausgezeichnete Figur für alle Konventikel von Snobs und Übersnobs. Man konnte jemandem, der, sagen wir von der Kemp begeistert war, so herrlich entgegenhalten: „Und die Gawrilowa? Ha, Sie kennen nicht die Gawrilowa?“ Man konnte in Gespräche über Tanz einstreuen, dass die Gawrilowa die einzige sei, die Ballettechnik und Ausdrucksmöglichkeit des modernen Tanzes miteinander zu verbinden wusste; und man war nur selten in der Verlegenheit, auf einen Gegner zu treffen, weil nur wenige die Gawrilowa hatten tanzen sehen. „Schon weil sie prinzipiell nur nackt tanzt, ist der Zuschauerkreis begrenzt“, konnte man schmunzelnd schliessen.
An diesen Schwätzereien, Gerüchten und Verhimmelungen war natürlich einiges richtig. Tatjana Gawrilowa hatte eine herrliche Stimme und eine ungewöhnliche Begabung für Tanz. Aber soviel sie stimmlich und körperlich (sofern es überhaupt eine Trennung von Körper und Stimme geben kann) arbeitete, so wenig lag ihr an dem Resultat dieser Arbeit für andere. Sie lachte jeden aus, der sie eine „Künstlerin“ nannte. Sie meinte, dass heutzutage Künstler sein ein unnützes Ding und ein unverlangtes Opfer an die Menschheit darstelle, und sie wünschte nicht ein Quentchen ihres Lebens zu „opfern“. Sie arbeitete „nur für sich“, und zwar arbeitete sie zumeist streng und viel. Manchmal freilich liess sie auch monatelang alles liegen, um einer Marotte willen, einer Laune zuliebe, einer Kleinigkeit wegen – wie ihre Freunde sagten.
Man kann schon aus der Heftigkeit dieser Ausdrücke ersehen, dass diese Marotten zuweilen Mannsgestalt hatten. Dann war es auch nur die Jagd nach einem Stoff, der so leicht wie warm wie bunt sein sollte, nach einem Parfüm, das einmal eine mitreisende Dame in der Eisenbahn gehabt hatte, nach einer Blume, die einmal in Nizza ... oder auch nach einem Ort, an dem es keine Menschen und vor allem keine Männer gäbe.
Derlei Suchen unterbrach die systematische Arbeit natürlich fühlbar, und so kam es, dass die Technik der Gawrilowa sowohl im Tanz wie im Gesang nicht auf der Höhe ihres Talentes stand. Für uns ist es müssig, zu untersuchen, ob der Reiz ihres Gesanges und das Ergreifende ihres Tanzes vielleicht gerade in dem Mangel an Technik lag, oder ob eine schärfere Arbeit es ihr ermöglicht hätte, wirklich „die Bedeutendste in zwei Kunstgebieten“ zu werden.
Wir unterschreiben vielmehr den Ausspruch der Gawrilowa, die sich den glücklichsten aller ihr bekannten Menschen nannte, weil es ihr zuweilen geglückt sei, zur rechten Zeit das zu formen, was sie bedrängt, und das zu gestalten, was sie erfreut habe.
Dieser Ausspruch war übrigens nichts für die Kreise der Snobs, und er hielt sich auch bedeutend kürzer als die frechen Bonmots der Gawrilowa über Männer. Erwähnenswert ist er hauptsächlich des Nachsatzes wegen, der immer unterschlagen wird und dessen unverschwommene Melancholie mit dem Hochmut des Vordersatzes aussöhnt. Tatjana hatte nämlich geschlossen: „Wie freilich die anderen Menschen das Leben ertragen, war mir immer unklar, da es doch selbst für mich zuweilen unerträglich ist. Ach, ich bewundere manchmal grenzenlos das Leben eines Durchschnittsmenschen.“
Vielleicht liegt in diesem ein wenig überspitzten Satz der Schlüssel nicht zwar zu dem Geheimnis dieser Frau, das wir in so engem Rahmen nicht ergründen zu können meinen, wohl aber zu den Geschehnissen unserer Erzählung, zu der Notwendigkeit der Begegnung zweier Menschen, deren Wege doch scheinbar von Natur und Gottes wegen auf ewig getrennt bleiben müssten, wenn nicht ...
Ja, wenn nicht ebenso, wie eine Kraft im Schwachen mächtig ist, eine Schwäche im Kraftvollen wohnte, wenn wir uns nicht alle in einem höllischen Durcheinander befänden, in dem man verzweifelt nach der nächsten Hand greift, dass sie einen herausziehe, in dem man leicht ein erschrecktes Gesicht für ein unglückliches nimmt, ein verzweifeltes für eine Grimasse, in dem man hinter dem entsetzten Menschen schon den wahren hervorleuchten sieht, hinter dem wahren schon den vollkommenen, und in dem man gezwungenermassen immer ein Teil für ein Ganzes ansieht.
Wer unter uns lebt nicht mit der fixen Idee, man könne nicht genug Teile und Teilchen sammeln, weil sich das Ganze dann schon von selbst ergibt? Aber war nicht wenigstens das Leben der Tatjana Gawrilowa, dieses gefeierten, reichen, schönen, begabten und klugen Menschen, dieser Frau, auf die alle Gaben in beängstigender Fülle ausgeschüttet schienen, war dieses Leben nicht wenigstens ein Ganzes? Es ist natürlich merkwürdig, dass wir bei allem Glauben an die Möglichkeiten unserer Zeit auch hier ein „Nein“ setzen müssen; aber wir werden sehen, dass auch Tatjana nicht den Gesetzen ihrer und unserer Zeit zu entgehen vermochte, und vielleicht gelingt es uns, schon ein wenig von der Erkenntnis zu erlangen, nach der die Gesetze dieser Zeit erfüllt sein müssen, nach der Übergang zu Gegenwart sich wandeln muss, ehe aus vielen Teilen ein Ganzes werden kann.
Selbstverständlich war Tatjana ihren Zeitgenossen schon dadurch ein Stückchen voraus, dass sie den grössten Teil des europäischen Krieges ausserhalb der Kriegszonen, in Amerika, China, Indien, auf den Philippinen und auf Samoa, zugebracht hatte. Es fehlte dadurch ihrem Wesen ganz jenes Schleichende und Bedrückte, jenes Fresserische und Neidische, das im Durchschnittseuropäer als die Folge seiner unverstandenen und unverdauten Leiden zurückgeblieben ist und aus dem sich die neue Krankheit schon ankündigt ...
Und dafür, dass sie nicht allzu unbeschwert und gewichtlos, allzu ätherisch, ein Mensch ohne Schatten in dieser Welt, einherging, dafür sorgten ihre bunten und in der Mehrzahl trüben Schicksale: Aufstieg und Selbstmord ihres Vaters, des schon fast sagenhaften Kaufmanns und Hasardeurs Alexej Gawrilow, der zum Glück für seine Angehörigen in dem Augenblick zum Revolver griff, als gerade mal wieder sein Vermögen eine phantastische Höhe erreicht hatte, der bald darauf folgende Tod ihrer schwermütigen Mutter, die, eine kleine französische Provinzadlige, den Temperaturschwankungen ihres Schicksals und den Temperamentsschwankungen ihres Gatten nicht gewachsen war. Der Tod ihres ersten Mannes, des berühmten Tänzers Nowrotin, der, kaum mit der Sechzehnjährigen verheiratet, mit hunderttausend Kameraden bei den Masurischen Seen 1914 fiel. Auftauchen und Verschwinden des bekannten französischen Spions Dumesnil, der in ihrem Leben eine sehr bedeutsame Rolle spielte und ihrem Ruf jenes unheimliche Timbre verlieh, ohne das Männer sich nie ganz an eine Frau verlieren, und schliesslich ihre Ehe mit dem weltberühmten Sänger, die nicht lange dauerte, aber für die Ausbildung ihrer Stimme sehr wichtig war. Das alles, das sie nicht gesucht, von dem sie vielmehr gefunden und oft fast verschleppt war, hatte vielleicht nicht einmal so entscheidend ihr Leben beeinflusst, als es ihr Haltung und Zähigkeit und vor allem jenen Humor verlieh, den sie meist sogar ihren eigenen Angelegenheiten gegenüber aufbrachte.
*
Für Irma v. Kranebitter waren die Tage nach Egberts Rückkunft sehr festlich. Wie lustig, dass Egbert plötzlich Spass daran hatte, ihre alte, dunkle Kammer frisch zu streichen. Abends, wenn Egbert nach Hause gekommen war, schlossen sie sich beide in dem Zimmerchen ein. Kranebitter bekleidete sich mit einem alten Nachthemd und ein paar kurzen Unterhosen, die Füsse steckten in Malerschlapfen, und um den Kopf hatte er, wie verwundet, einige Taschentücher geschlungen. Irma hatte nichts rechtes Zerrissenes anzuziehen und sass meist auf einem Kistchen, das Kinn in beide Hände gestützt, und schaute zu, wie der Pinsel erst wuchtig und triefend, dann haarsträubend und sanft und schliesslich nach langem Fluchen glatt und flächefärbend über die Wand sauste.
Die Sache war recht mühsam und dauerte drei Abende. Peinlich für Irma war übrigens, dass sie in dieser Zeit mit ihrem Mann im Berliner Zimmer schlafen musste, das alle anderen nun mit bedeutsamem Schleichen und Dielenknacken durchquerten. Aber schliesslich war die Kammer leuchtend blau gestrichen, und zwischen dem Blau der Wand und dem Weiss der Decke lief ein bronzegoldener Trennungsstrich. Vor dem Einschlafen hatte man nun eine Farbe vor Augen!
Auch Egbert fand das sehr schön und war nur nicht zufrieden, dass diese Arbeit schon zu Ende war. Er zimmerte darum aus alten Kistenbrettern ein Nachtschränkchen für sich und eine Polsterbank für Irma, die diese ihr Wohnzimmer nannte und auf der sie in ihrer Lieblingsstellung, die Knie an die Brust gezogen, halbe Nachmittage verbrachte. Schliesslich legte er noch mit vielem Radau elektrisches Licht in die Wohnung und machte sogar neben seinem Bett eine Lampe in die Wand, so dass er genug Licht zum Lesen hatte, ohne Irma allzusehr zu blenden.
Dann aber hatte er weder Geld noch Material, weiter zu arbeiten, und so lag er wieder von zehn Uhr ab im Bett, sah zuweilen zu Irma hinüber, die zu schlafen schien (aber durchaus nicht immer schlief), rauchte seine Zigarette langsam und sachlich und blätterte in seinen Büchern oder starrte nur wieder vor sich hin.
Er wurde wieder von Unruhe und Unzufriedenheit geplagt, er versank allmählich wieder in jene Verbitterung, aus der ihn also weder Ehe noch Reise hatten reissen können. Das reine Rentnerdasein. Man verbessert sich. O ja, man verbessert sich. Man hat eine Polsterbank und eine blaue Wand. Das Summen und Singen des Gases war verstummt.
Man liebte sich auch nach jeder Trennung ein bisschen mehr. Man lebte nach einer Reise in einem kleinen, feinen Rausch, in einem ganz versteckten Singsang des Blutes, in einem für alle anderen unsichtbaren Zündfeuer der Blicke. Aber dann verdampfte das. Dann wurden die Hände wieder nüchtern. Dann musste man wieder warten, bis irgendein Ereignis, ein Stoss von aussen kam und das gleiche von vorn begann.
Man weiss, dass derlei Krisen um die Fünfundzwanzig am stärksten und vielleicht am gefährlichsten sind. Man hat da einiges erlebt, man ist von vielem enttäuscht, man ist gezwungen, neue Versuche anzustellen. Die Kräfte strömen nicht von selbst. Sie wollen heraufgeholt werden. Man hat vergessen, woher man kam, und weiss nicht, wohin man gehört.
Wie hätte Egbert v. Kranebitter auf den Gedanken kommen können, dass es für ihn nur gelte, seine Lebensform aus sich zu bilden? Dass die Lebensform seiner Vorfahren zertrümmert war, sah er immer noch als ein unverdientes Unglück und als eine Gemeinheit dritter an. Das Gesetz darin hatte er ebensowenig entdeckt, wie er vom Wendegesetz der Fünfundzwanzig etwas wusste.
Merkwürdig: es leben ja fast alle Menschen wie Kranebitter in einem verwischten, unklaren, nebligen Tappen von Tag zu Tag und spüren nicht, was mit ihnen vorgeht. Wenn v. Kranebitter durch die Strassen hetzte, morgens, die trockene Semmel noch halb in der Backentasche, wie eine Biene im Bienenschwarm in dem Knäuel am Schluss des Autobus hängend, wenn er mit Schutzärmeln über dem Anzug an seinem Zeichentisch stand, beherrscht vom Chefingenieur, der mit knarrender Wichtigkeitsstimme seine Befehle herunterjagte, bedienert bereits von einigen Anfängern, denen er in unverfälschtem Baltisch, aber auch schon mit gefurchter Würdestirn, seine Befehle gab, wenn er mittags nach Hause raste, um irgendeine unschmackhafte Billigkeit zu schlucken und einmal über Irmas beflochtenen Kopf zu streicheln – nun, so teilte er das Schicksal von Millionen und aber Millionen, die es meist ganz gleich oder nur um eine Spur besser oder schlechter hatten und von denen die einen für eine geringe Aufbesserung lebten, die anderen gegen eine Verschlechterung ankämpften.
Im November gab es noch einige Sorgen mehr. Gleichzeitig begannen die beiden Mütter des Ehepaares zu kränkeln. Aber während Irmas Mutter, die alte Baronin Schell, hustend und fluchend in ein paar Tagen dahinstarb, erholte sich Frau v. Kranebitter noch einmal und sass nach einigen Wochen mondscheinfarben und ein wenig erstaunt, aber klagelos wie immer in der Fensternische und begann einen neuen Strumpf für das Enkelkind, das sich zu ihrer Verwunderung auch nach zehn Monaten noch immer nicht einstellen wollte.
Irma hatte ein paar Wochen heftig und aufrichtig um ihre Mutter getrauert. Dann hörte das auf. Sie war so sehr mit sich beschäftigt und mit dem Staunen über ein Leben, das ihr zwar auch nicht herrlich erschien, dessen Mängel sie sehr brannten, das aber doch so sehr viel schöner geworden war, als man je hätte glauben sollen. Ihr genügte es, dass manchmal die Schläfrigkeit Egberts von der Wärme durchbrochen wurde, die sie nun in ihm wohnen wusste. Sie konnte warten, bis diese Wärme einmal ganz nach aussen schlug, und für ihr Leben war es fast noch wichtiger, dass das eines Tages kommen konnte, als dass es geschah.
Und so hätte man den Herbst, der dem Kalender nach schon nah am Winter stand, getrost beginnen können. Ja man war bei Kranebitters, was Winterschuhe und Kohlen anlangte, auf den Winter gut vorbereitet. Aber es war jener Herbst, der eher einem Frühling ähnelte, jene Novemberwärme, die an Montreux oder Nizza denken liess; es war der Dezemberanfang, an dem man unter dem eben gefallenen Laub kurzstengelige Veilchen blühen fand und Krokus mit hellgelben Spitzen aus dem dunklen Rasen keimen sah.
Man war aus der natürlichen Folge der Jahreszeiten ein wenig hinausgeworfen; man war auf den Winter gefasst, aber er kam nicht. Man konnte nichts Rechtes beginnen. Winterabende, an denen man die Fenster offenstehen lässt? Novembermittage zwischen sonnglänzenden Stämmen im Tiergarten? „Soll man die Pelze anziehen oder einmotten?“ murrte Tante Lisa. „Nie weiss man in diesem Deutschland, woran man ist. Im Sommer ist es kühl, und im Winter ist es warm. Bei uns in Schledden ...“
Egbert mochte nichts von Schledden hören. Je länger es warm blieb, um so gereizter wurde er. Es konnte niemand mit ihm fertig werden. Am wenigsten er selbst. Er tat allerhand komische Dinge. Eine ganze Nacht zum Beispiel verbrachte er in seinem Lehnstuhl am Fenster. Es war ein wenig Mondschein draussen. Der Schatten des Mondes, ein scharfbegrenztes Dreieck, verschob sich langsam, wurde gleichschenklig, rechtwinklig und ging schliesslich wieder im Grau der Hausmauer unter. Zuweilen kam ein Mensch nach Hause, tönten ein paar Stimmen herauf. Ein Hund bellte. Ein Kind begann zu weinen. Man hörte die Eltern beruhigend murmeln, dann schimpfen, poltern, sich anbrüllen. Das Kind blieb bis zum Morgen bei seinem Geschrei.
Es schien, dass Egbert nichts von diesen Dingen aufnahm, als ginge diese Nacht so spurlos an ihm vorüber wie die anderen auch oder wie jener Sonntagnachmittag, an dem er allein nach Grünau fuhr und den Gewaltmarsch an den Kanälen entlang machte, quer über die Felder lief und sprang und schliesslich, um den faulen Armen auch was zu tun zu geben, noch eine Bootsfahrt auf dem See machte.
Als er spät abends nach Hause kam, erschrak Irma zum erstenmal. In seinen Augen war ein Leuchten, das ihr krank zu sein schien. Sie begriff nicht, was das war, und fragte auch nicht danach. Nur wachte sie von da ab etwas häufiger in der Nacht auf und schielte vorsichtig zu ihrem Mann herüber, oder horchte auf den Takt seines Atems. Sehen konnte sie ihn nachts nicht mehr. Denn entweder schlief er, und dann war das Zimmer dunkel, oder er war wach. Dann lag sein Kopf wie ein grober, dunkler Klotz vor der Wandbeleuchtung.
Aber auch wenn sie ihn gesehen hätte, ja, wenn sie in ihn hineingesehen hätte, sie hätte nichts begreifen und erkennen können. Denn Egberts Warten musste ihrem Wesen fremd sein. Das war wohl ganz und gar ein zielloses Männerwarten, ein Warten, dunkel und geheimnisvoll, abgründig und gefährlich, fruchtbar und tödlich, aber auch stumpfsinnig, wahnsinnig, verblendet, fanatisch. Ja, Egbert wartete immer stärker, immer atemschnürender, war ganz nach vorn gelehnt. So wie er das eines Nachts träumte: er schlief in einem vergitterten Zimmer. Es gelang ihm aber, sich durch die Stäbe hindurchzuwinden. Da sah er, dass sein Zimmer im vierten Stock über einem kahlen Hof lag. Aber was war da unten? Eine Stimme? Ein Schatten? Ein Mensch? Er beugte sich weit vor. Das Gitter zersprang unter den Rucken seines Vorbeugens. Er stürzte, schrie und erwachte, die ängstlichen Augen Irmas zum ersten Male dicht über seinem erschreckten Gesicht.
Später konnte man natürlich sagen, dass er auf Tatjana gewartet habe. Ja, es bieten sich die Erklärungen immer reichlich an, wenn etwas abgeschlossen hinter uns liegt. Es ist uns aber wahrscheinlicher, dass durch das Warten dieses nicht in Egberts Leben Gehörige herbeigezogen wurde. Würden wir nicht auf die Dinge von aussen warten, dass sie uns vollenden sollen, es würde in jedes Leben nur die Hälfte seines Malheurs fallen.