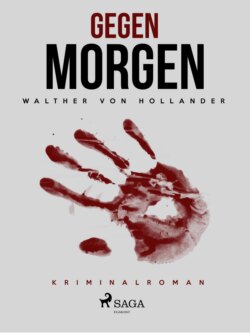Читать книгу Gegen Morgen - Walther von Hollander - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDie Mutter Karl Rastas, Frau Amtsgerichtsrat Rasta, geborene Gräfin Laschka, starb in diesem Frühling. Damit sank der letzte Mitspieler der totenreichen Tragödie, die Karls Namen trägt, ins Grab, der letzte Mensch, der Mitwisser und Handelnder zugleich, noch manches Dunkle hätte aufhellen können.
In den zwei Jahren seit Karls Ende, hat außer der Dienerschaft niemand die „Gräfin“ — wie man sie allgemein nannte — zu Gesicht bekommen. Man wußte nur, daß sie das Gut Willstetten, dieses bluttriefende Erbe, das ihr auf gräßlichen Umwegen zugefallen war, so umsichtig und tatkräftig verwaltete, als gelte es, für Generationen vorzusorgen und aufzubauen. Ob sie selbst ihre letzten Tage heiter oder traurig zugebracht hat oder (was wahrscheinlicher ist), mit dem undurchdringlichen Gleichmut, den sie vor den letzten Teil ihres Lebens gestellt hatte, das weiß niemand.
Die Rastas, die gewissermaßen die Eckbohms ausgetilgt haben, in einem Geschlechterkampf von mittelalterlicher Düsterkeit, sind nun selbst ausgestorben. Das Gut ist an den Staat gefallen. Es ist beinahe, als seien alle diese Menschen nie gewesen. Jegliche Spur ist ausgetilgt.
Der Tod der Gräfin hat mich nun endlich gezwungen, Vollstrecker des letzten Willens Karl Rastas zu sein. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, die Dokumente des Mörders, der sich mein Freund nannte, und dessen letzte Tat die Zerstörung meines Lebens war, herauszugeben, und man wird nach Kenntnisnahme dieser Vorgeschichte verstehen, daß es für mich mehr Hemmungen als Sporne gab, den letzten Willen zu ehren. Ich füge mich — auch das wird man am Ende besser verstehen — als nach allen Erklärungen, die ich geben könnte. Ich habe mich entschlossen, meine bitteren Gefühle auszuschalten und nur das hierherzusetzen, was zum Verständnis der folgenden Dokumente notwendig und wichtig ist.
Karl Rasta entstammte einer angesehenen Juristenfamilie. Sein Großvater war der berühmte Rechtslehrer und Forscher Eugen Rasta, sein Vater, Hermann Rasta, war Amtsrichter in meiner Heimatstadt. Er war ein Mann von ungeheurem Wissen, glänzender Dialektik, scharfsinniger Logik und beißender Ironie, zu der sich im Verlaufe der Jahre eine immer wachsende Verbitterung gesellte. Diese Verbitterung war berechtigt. Nach Urteilen von Fachleuten überragte Hermann Rasta nicht nur die Fakultätsgrößen seiner Generation, sondern auch seinen berühmten Vater Eugen um Haupteslänge, und es war sicher eine Ungerechtigkeit, daß diese Kraft als Amtsrichter unserer norddeutschen Mittelstadt verkümmerte. Woran diese offensichtliche Zurücksetzung lag, habe ich nie ganz begriffen. Vielleicht war es wirklich die Schuld seiner Frau, eben jener geborenen Gräfin Laschka, einer sehr kleinen, zierlichen, unendlich hochmütigen Polin, die man nur selten zu Gesicht bekam, und die hinter einer Wolke von geheimnisvollem Klatsch und Tratsch ein Dasein führte, dessen Äußerlichkeiten vielleicht nur ihrem Mann, deren innerstes Geheimnis — wie ich aus Karls Aufzeichnungen entnahm — nur ihrem Sohn bekannt war.
Jedenfalls soll sie es gewesen sein, die ihren Mann bestimmte, den Ruf an verschiedene kleinere Universitäten abzulehnen, weil sie seine Berufung nach Wien mit Energie und scheinbar sicherem Erfolg betrieb. Woran dann diese Berufung scheiterte — ob wirklich, wie die Klatschmäuler behaupteten, an dem Bekanntwerden schwerer sexueller Jugendirrungen der Gräfin oder, wie ich eher annehme, an der schließlich versagenden Energie Hermann Rastas —, das weiß ich nicht.
Aus der Ehe stammten zwei Söhne, Eugen und Karl. An den etwa fünf Jahre älteren Eugen erinnere ich mich nur dunkel. Er starb bereits mit vierzehn Jahren in einer Irrenanstalt, an unheilbarer Melancholie, sagen die Einen, an Auszehrung infolge Hypertrophie des Gehirns, die Anderen.
Karl war mein Freund, sozusagen von den Windeln her. Mein Vater war Präsident des Oberlandesgerichts, an dem Karls Vater Amtsrichter war. Er war also gewissermaßen der Vorgesetzte Hermann Rastas und mag es mit diesem bedeutenden Untergebenen nicht leicht gehabt haben. Jedenfalls gab es zwischen den Familien unter der weiten Decke des konventionellen Verkehrs Spannungen, die einige Male fast zum Zerreißen der Decke führten. Bei mir zu Hause kam es dann immer zu erregten Gesprächen meiner Eltern, die immer wieder in den Satz gipfelten, daß „bei aller anerkannten Tüchtigkeit doch wohl vieles mit dem Mantel der christlichen Nächstenliebe zuzudecken sei“.
Ich habe mich um die Eltern Karls im Grunde nie viel gekümmert und habe sie auch nicht oft zu Gesicht bekommen. Der Vater Rasta war mir gleichgültig, für die Gräfin hatte ich eine mit Gespensterfurcht untermischte leidenschaftliche Verehrung, die der Anlaß zum ersten Streit mit Karl war.
Hinter der palazzoimitierenden Villa der Rastas, die an dem ziemlich steilen Südhang der Stadt lag, kletterte ein sehr gepflegter, zierlicher Garten herauf, zwischen dessen wunderbaren Rosenbeeten, Rosenhecken, Rosenbüschen man an Sommerabenden die Gräfin leise und ruhelos stundenlang einhertrippeln sehen konnte. Das waren dann die Abende, an denen wir lautlos und bedrückt in einer Ecke saßen, gelangweilt Blätter zerpflückten, Stöcke zerschnitzten oder höchstens auf einem Grashalm zu fiepen wagten. Oder ganz leise über den Zaun kletterten und uns den Abhang hinabrutschen ließen, in den verwitterten, zerfallenden Sandsteinbruch, der mit Höhlen und Hecken, Teichen und Tümpeln der eigentliche Schauplatz unserer Jungenspiele war. Hier auch hat mir Karl Rasta anvertraut, wie sehr sein Leben unter dem unruhigen Schatten der Mutter stand und daß nach ihren Wanderabenden im Garten immer „irgendwas Furchtbares“ im Hause geschah.
Was dieses Furchtbare war, hat er mir nie gesagt. Es muß auch verschieden gewesen sein. Ein Zank zwischen den Eltern, ein klägliches Winseln der Mutter, das man — so sagte er — durch zwei Stockwerke hörte, ein unheimliches Geräusch von der im Zimmer fortgesetzten Wanderung. „Sie ist wie eine Fledermaus,“ sagte mir Karl, „tags siehst du sie kaum, nachts aber flattert sie umher und trinkt Blut, um ihr kaltes Blut warm zu machen. Ich hasse sie. Sie ist ekelhaft, dumm und unheimlich.“
Das Urteil des Zwölfjährigen mag richtig gewesen sein. Mich hat es damals maßlos entsetzt und führte zu der ersten Entfremdung zwischen uns, die indes nicht lange andauerte. Es blieb lediglich das Gefühl des Unheimlichen, ich spürte immer die Fledermaus um Karls breiten Kopf. Auf die Dauer aber konnte ich mich seinem Einfluß nie ganz entziehen. Er war in unserer Freundschaft immer der Führer, zuweilen der Verführer, stets der Überlegene. Ich mußte stets um seine Freundschaft werben, war seiner nie ganz sicher und weiß auch heute nicht, warum er eigentlich mit mir befreundet war.
Er war klüger und entschiedener als ich. Er hatte bei kältester Berechnung ein erstaunliches Temperament (eine mir ganz fremde Charaktermischung) und wußte seine Selsamkeiten immer so zu drapieren, daß der Wind der Anerkennung von allen Seiten segelfüllend ihn vorwärtstrieb. Er wußte alle Arten von Menschen zu nehmen und hatte bei einer an Biederkeit grenzenden Schwerfälligkeit eine erstaunliche innere Wandelbarkeit und Verwandlungsfähigkeit. Er war bei aller Faulheit ein glänzender Schüler — ich konnte nur mit eisernem Fleiße ihm nachkommen —, bei aller Frechheit äußerst beliebt bei den Lehrern. Er hatte ein phänomenales Gedächtnis, war trotz seines zur Fülle neigenden Körpers äußerst gewandt in allen Leibesübungen, war interessiert für alles zwischen Himmel und Erde. Mit einem stierartigen Willen ging er immer neue Gebiete des Wissens und Könnens an, verbiß sich nacheinander in Mathematik, Botanik, Astronomie, Militärwissenschaften, in Tennis, Skilauf, Schwimmen, Tischlern. Ließ binnen kurzem fast auf jedem Gebiet seine Lehrer weit hinter sich, ruhte nicht eher, bis er der Erste im Fach war, um es dann achtlos beiseite zu stellen. Kurz: er war in seinen Eigenschaften der bestechendste und bedeutendste Mensch, den ich gekannt habe. Ich hätte ihm auf jedem Gebiete die glänzendste Laufbahn prophezeit und auch jetzt noch, da ich weit über seinen Tod hinaus sein Feind bin, ist mir sein Ende unbegreiflich und schmerzvoll.
Ich glaube nicht, daß ich nachträglich ungerecht sein Bild verzerre, wenn ich sage, daß vielleicht in seinem Äußeren, genauer gesagt: in seinem Gesicht, Züge waren, die in jene verhängnisvolle Richtung wiesen. Ich sagte schon, daß sein Körper sehr groß und breit war und nur durch dauerndes Training davor bewahrt wurde, ungeschlacht zu sein. Auf diesem Körper, an dem die ganz überraschenden feinnervigen Frauenhände teils lächerlich, teils erschreckend wirkten, — saß auf einem breiten, kurzen Hals ein etwas zu kleiner, ganz runder Kopf, dessen breite, weiche Backen, dessen winziger, glutroter Mund, dessen dünnes, überaus gepflegtes blondes Kraushaar seltsam abstoßend wirken konnten, besonders in Augenblicken der garnicht seltenen Depressionen, die ihn die Augen halb schließen ließen, oder auch im Schlaf, der seinem Gesicht etwas durchaus Ochsenartiges verlieh.
Der Reiz des Gesichtes lag allein in den Augen, die gewissermaßen alle Schlaffheit des übrigen Gesichtes in sich einsogen, die in einem unbeugsamen Glanz schienen, die ein glühendes Gefühl ausstrahlen und übertragen konnten. Mächtige, tiefe blaue Augen, Augen, wirklich bald magisch und flimmernd wie Wintersterne, bald benachbart wie niedrige Südsterne, und die Unsterne meines Lebens, die unheimlich durch meine Nächte brennen.
Aber ich greife vor. Ich spreche von dem Karl Rasta, der mein Leben entschied. Vor dem Vierzehnjährigen steht der Dreißigjährige, und sie erscheinen mir oft ein und derselbe. Und doch kann das nicht sein. Nur etwas Entsetzliches kann diesen glänzenden, meteorischen Menschen aus seiner Bahn geworfen haben. Obgleich ...
Obgleich: ich sprach ausführlich von seiner Mutter. Ich weiß, wie sehr Karl seine Mutter haßte, weiß aber andererseits, daß während des Prozesses so ungewöhnlich innige Beziehungen zwischen Mutter und Sohn festgestellt wurden, daß die greise Gräfin um ein Geringes von der Zeugenbank auf die Anklagebank hätte übersiedeln müssen. Da steckt schon ein Rätsel. Haßte er sie, wie er mir damals versicherte, oder liebte er sie, wie später festgestellt wurde? Klar erscheint mir jedenfalls, daß die Mutter, wenn nicht durch Taten der böse Geist, so durch ihr Blut das verderbende Feuer dieses Lebens war.
Mir ist das alles erst später klar geworden. In meiner Vierzehnjährigkeit fühlte ich eigentlich nur, daß im Rastaschen Hause sich nicht das einfache, gesetzmäßige Familienleben abrollte, wie bei mir, im Allgemeinen aber waren unserer Freundschaft diese Dinge ganz gleichgültig, und wir wuchsen miteinander als echte Bengels über Äpfelstehlen, Molchefangen, Drachenkleben, Indianerhüttenbauen, Teschingschießen, erste Zigarette und ersten Rausch ziemlich reibungslos in die Zeit des ersten Romans, der ersten Liebe, der Tanzstunde hinein.
In der Tanzstundenzeit kam es zum ersten Bruch, und hätte ich damals meiner inneren Stimme gehorcht, wäre es zum endgültigen Bruch gekommen. Es handelte sich scheinbar um eine einfache Primanerliebe, und wäre diese Liebe zu Dorothea Gerbers nicht die Liebe meines Lebens geworden, so würde diese Episode in all dem leichten Sand und Flußtang versunken sein, in den vielerlei im Erleben Wichtiges und in der Wirkung Unwichtiges herabsinkt, und über die der Fluß des Lebens bis zur Unkenntlichkeit glättend hinwegfließt. So aber ...
Wir waren Rivalen. Ich kann mich nicht entschließen, ein Bild meiner nachmaligen Frau zu zeichnen. Teils weil sie zu lebendig und schmerzvoll in mir wohnt, teils, weil sie in all ihrer Lieblichkeit und Tiefe, in ihrer Sonnigkeit und Melancholie, in ihrer heiteren und doch verschleierten Schönheit nur mir bekannt ist. Für Karl Rasta — und hier schnürt mir der Zorn die Kehle — war sie eine unter Vielen, und darum ist ihr Wesen für den Verlauf der Sache unwesentlich.
Es begann sehr jungenshaft damit, daß wir auf einem Spaziergang in die herbstlichen Berge uns gegenseitig unsere Liebe zu Dorothea gestanden und im Überschwange unserer Freundschaft jeder sich anbot, vor dem anderen zurückzutreten. Wir kamen schließlich dahin überein, daß jeder getrennt um Dorothea werben solle und nur verpflichtet sei, den Anderen über den Erfolg auf dem Laufenden zu erhalten.
Dieses Versprechen hat Karl gebrochen. Ich will diese Kindergeschichten, so bedeutungsvoll sie mir erscheinen, nicht ausspinnen. Tatsache war, daß Dorothea an einem Abend mir ihre Liebe mit Hand und Mund versicherte, und daß ich am anderen Abend, als ich zu Karl gehen wollte, ihm dieses mitzuteilen, sie und ihn in einem Gebüsch in inniger Umarmung stehen sah. Noch heute erinnere ich mich des entsetzlichen Schmerzes, den ich damals empfand, und habe in meinem ganzen Leben, selbst in den glücklichsten Jahren meiner Ehe, nie über diesen Jugendschmerz lächeln können, gleich als ob ich immer geahnt hätte, daß aus diesem Augenblick die Vernichtung meines Lebens emporwachsen würde, wie der Tod aus einem winzigen Bazillus. Zum Streit kam es dann, als mir Karl nach achtundvierzigstündigem qualvollen Warten noch immer nichts mitgeteilt hatte und ich ihm mein Wissen ins Gesicht schrie. Damals zeigte Karl sein Geschick, die schwierigsten Situationen zu meistern. Er sagte nur ganz ruhig, daß noch nichts entschieden sei. Und hat es dann fertiggebracht, in einer Unterredung zwischen ihm, Dorothea und mir scheinbar chevaleresk zurückzutreten und Dorothea — wie ich jetzt glaube, in einer vorausgegangenen Rücksprache — dahin zu bringen, daß sie sich weinend an meinen Hals warf, mit der Versicherung, sie habe immer nur mich geliebt, für Karl nur Freundschaft empfunden und habe eine Verirrung begangen, als sie Karl küßte.
Mein Argwohn, der noch eine Zeitlang rege war, wurde durch eine merkwürdige Wandlung Karls beseitigt. Er war — frühreif in allem — ein Verhältnis mit einem Dienstmädchen des elterlichen Hauses eingegangen und fürchtete, daß sie ein Kind bekommen würde. Er machte mich zum Mitwisser und erklärte, daß er das Mädchen in diesem Falle heiraten würde, was ich damals durchaus billigte. Gleichzeitig geriet er unter dem Einfluß der Tolstoischen Sexualethik, und aus allerlei Angst, Reue, Einsicht und mit der ganzen Vehemenz seines Charakters grub er sich in eine Askese hinein, die sicherlich zunächst echt war, später mehr und mehr ausgehöhlt wurde und schließlich ganz verständlicherweise ins Gegenteil umschlug. Zunächst jedenfalls fiel er als Mitbewerber bei Dorothea aus, und obgleich noch vielerlei Wechselfälle eintraten, ist in jener Zeit der Grundstein meiner Ehe gelegt worden. Ob Dorotheas Zuneigung zu Karl echt und dauernd war, oder ob sie, wie ich glaube, lediglich unter dem Zwang seiner bestrickenden Gegenwart jeweils bestand, das halte ich fern von mir und will es nicht wissen.
Karl und ich bezogen etwa zwei Jahre nach diesen Erlebnissen getrennte Universitäten, und da er auch für die Ferienzeiten niemals ins Elternhaus zurückkehrte, habe ich ihn viele Jahre lang nicht zu Gesicht bekommen und bin für diese Zeiten fast ausschließlich auf Hörensagen, auf Klatsch und Gerücht über ihn angewiesen. Er galt in den Kreisen der alten Tanten beiderlei Geschlechts sehr bald als verbummelter Student, und das wohl nur deshalb, weil er launisch und exzentrisch und in seinen Entschlüssen abrupt uud fast brutal war. Zuerst hatte er Offizier werden wollen, hatte aber nach einem halben Jahre Dienst bereits seinen Abschied genommen, ging als Student nach Paris, Berlin, Cambridge und München in buntem Durcheinander durch fast alle Fakultäten, betätigte sich journalistisch, gab einen Band mäßiger Gedichte heraus, den er nach kurzer Zeit zurückzog und einstampfen ließ, war Reporter bei den Friedenskonferenz im Haag, Berichterstatter rechtsstehender Blätter während der mexikanischen Wirren, und Vertreter sozialistischer Zeitungen in den Balkankriegen. Er führte eine überaus scharfe Feder, seine Fähigkeit, Menschen zu behandeln, sein glänzendes Gedächtnis, seine an Frechheit grenzende Unerschrockenheit, machten ihn in kurzer Zeit bekannt. Aber nach dieser kurzen, erfolgreichen Laufbahn warf er alles Erreichte über den Haufen, wurde erst Bankbeamter und endlich Landwirt.
Im zweiten oder dritten Jahr seiner Abwesenheit war der alte Rasta gestorben. Karl erschien, wie ich hörte, überaus elegant gekleidet und scheinbar im Besitze größerer Geldmittel, in seiner Vaterstadt, verkaufte das Haus und beinahe sämtliches Mobiliar (wobei Dorotheas Eltern einige sehr schöne Stücke für unseren künftigen Haushalt erwarben), brachte seine Mutter in der Nähe der Stadt auf dem Gute seiner Verwandten unter und reiste ab, ohne irgendwie alte Beziehungen neu angeknüpft zu haben. Die Verwandten, bei denen nunmehr die Gräfin wohnte, habe ich nie gesehen Sie spielen aber im Leben Karl Rastas so sehr die entscheidende Rolle, daß ich ganz kurz wenigstens das hierher setze, was ich im Laufe der Zeit über sie in Erfahrung bringen konnte.
Ferdinand Eckbohm, ein Vetter zweiten Grades von Hermann Rasta, war Großfarmer in Argentinien gewesen und kam ein Jahr, nachdem ich die Universität bezogen hatte, in meine Heimatstadt. Er war verheiratet mit Clarissa Eckbohm, die gleichfalls eine Deutsch-Argentinierin war, und hatte mit ihr eine zur Zeit der Entscheidung vierzehnjährige Tochter mit Namen Sylvia. Clarissa soll eine Dame von ungewöhnlicher Schönheit gewesen sein. Ihr Temperament allerdings wird als so jäh und ungezügelt, so launenhaft und ziellos geschildert, daß ich sie kaum für eine reinrassige Deutsche halten kann, sondern eher für eine jener reizvollen, aber gefährlichen Mischlinge, wie sie häufiger aus jenen buntblütigen Kolonistengegenden herkommen. Karls Aufzeichnungen enthalten nähere Schilderungen über sie, die ich allerdings zum Teil für übertrieben halte und als charakteristischer für Karls bizarre Art zu sehen erachte als der Wahrheit entsprechend, obgleich es für Karl natürlich entscheidender ist, wie er sie sah, als wie sie in Wirklichkeit war.
So oder so: die Tatsachen waren jedenfalls, daß die Eckbohms, die sehr reich waren, sich das wunderschöne Gut Willstetten, kaum zwei Stunden von unserer Stadt, kauften und diese Besitzung zu einem weithin bekannten, scheinbar äußerst anziehenden Herrensitz gestalteten. Wirklich muß ja die Mischung von alter Feudalkultur — die Eckbohms hatten Willstetten mit allem lebenden und toten Inventar übernommen — und argentinischer Buntheit (es sollen ganze Wagenzüge exotischer und südlicher Merkwürdigkeiten nachgezogen sein) sehr überraschend und anregend gewirkt haben. Besonders da in Ferdinand Eckbohm, dem blonden, baßbegabten heiteren Germanen, und Clarissa, der zwitschernden, schillernden, bunten Argentinierin, da in diesem merkwürdig zusammengefügten Ehepaar das reizvolle Durcheinander der Einrichtung ein gleichsam lebendiges Widerbild hatte. In einem kleinem Seitenflügel des Herrenhauses residierte nun die Gräfin, und obgleich sie ganz auf Kosten der Eckbohms gelebt haben soll, scheint sie sich durchaus am Platze und wohl gefühlt zu haben. Der plötzliche Tod Ferdinand Eckbohms im November 1918, durch den Clarissa Eckbohm Besitzerin eines Riesenvermögens in inländischen und ausländischen Besitztiteln wurde, bildet den Auftakt zu den letzten Ereignissen auf Willstetten, und der Prozeß, der sich an diesen Tod knüpfte, setzte den Schlußpunkt hinter das Leben Karls. Ich habe zwar immer am Leben Karls den lebhaftesten inneren Anteil genommen; unsere Verbindung aber, die nie ganz abbrach, bestand meist in einigen kurzen Briefen und Postkarten, in denen ich Karl stets über die Stationen meines Lebens auf dem Laufenden hielt, während Karls wenige Zeilen in aphoristischer Kürze und oft schlagender Absurdität über sein inneres Wachsen und Werden berichteten. Unser Briefwechsel bestand, wie Karl es einmal sehr treffend ausdrückte, darin, daß ich meine Stellung im Leben, er seine Stellung zum Leben berichtete. Für mich waren Karls Briefe stets Ereignisse, Nötigungen immer wieder zu erneuter Prüfung, und ich bekenne offen, daß ich viele entscheidende Erkenntnisse nur ihm verdanke. Und wiederum stelle ich mir die Frage: was eigentlich veranlaßte ihn, die Verbindung mit mir aufrecht zu erhalten? Oder sollte die Verbindung eigentlich nur Dorothea gegolten haben? Nicht wahrscheinlich — aber möglich. Denn jetzt kenne ich Karls Fähigkeit, neben vielerlei großen Plänen eine Unzahl kleiner Nebenpläne zu fördern, in einer Art Doppel- ja Vielfachleben gleichzeitig auf einer Hauptstraße und vielen Nebenstraßen zu marschieren und neben Wichtigem auch das Unwichtigste nicht aus dem Auge zu lassen.
So mag er auch ein Jahrzehnt lang den Willen gehabt haben, sich Dorotheas auf dem Umweg über mich zu bemächtigen. Dieser Umweg war nötig, denn Dorothea und ich heirateten im Mai 1914 und lebten in denkbar glücklichster Ehe, bis der Krieg kam.
Karl und ich fanden uns im gleichen Regiment und der gleichen Kompanie wieder und erlebten unter dem Zwange des gemeinsamen Schicksals die tiefsten Stunden unserer Freundschaft, Stunden, an denen während der Garnisonzeit Dorothea oft schweigend und ergriffen teilnahm. Irgendeine weitergehende Verständigung zwischen den beiden entdeckte ich nicht. Wir zogen gemeinsam ins Feld — ich gefaßt und bedrückt, Karl begeistert und tatendurstig, allerdings mehr um des Abenteuers als um des Vaterlandes willen, das ihm nie etwas bedeutete.
Karl wurde sehr früh auf einem Patrouillengang schwer verwundet. Ein Auge wurde ihm herausgeschossen. (Es wurde übrigens sehr geschickt operiert, und es war später oft nur, als habe sich die Gespanntheit seines Blickes durch das Glasauge nur verschärft.) Er kam dann ins Kriegspressequartier und von dort zwei Jahre in geheimer Mission nach Zürich. Es hieß, er habe dem deutschen Gesandten große Dienste geleistet. Ich mußte den Krieg bis zum bitteren Ende durchmachen, kam aber unverletzt davon. Es hätte mich gewundert, wenn Karl nicht während der Revolution eine Rolle gespielt hätte, und in der Tat tauchte er als kommunistischer Minister eines thüringischen Staates auf, machte durch seine geistvollen Organisationspläne viel von sich reden, verschwand aber bald wieder, als er sah, daß er sich nicht durchsetzen konnte. Immerhin spielte diese Zeit im Prozeß keine unwesentliche Rolle, und ich muß zugeben, daß die Argumente in Karls Verteidigung aus einer Ethik stammten, die aus kommunistischen Doktrinen abgeleitet jenseits jeder staatenfügenden, ja jeder gemeinschaftsbildenden Ethik waren und insofern vielleicht wirklich Impulse seiner Taten bildeten, der Taten, mit denen er sich selbst ausgelöscht hat.
Kurz nach seiner Ministerzeit sah ich Karl zum letztenmal vor jenem verhängnisvollen Prozeß wieder. Er schien seltsam ernüchtert, unruhig, gealtert und gehetzt. Auch hatte sich eine Verbitterung in seine Worte, ja in sein Gesicht gegraben, die einen erschreckenden Gegensatz zu Karls sonst unbekümmerten Wesen bildete. Wir stritten uns damals heftig, d. h. eigentlich stritt nur ich, und Karl saß mit dem starren Blick, der durch die Leblosigkeit des Glasauges etwas Bedrückendes erhielt, nur immer zwischen Dorothea und mir hin und her. Es handelte sich um die Möglichkeit der Stabilisierung allgemeingültiger Gesetze, und ich erinnere mich genau der letzten Worte Karls, Worte, die mir rückwärtsleuchtend seine Tat zu erhellen scheinen: „Ich bin über die Grenze hinaus und kann darum Wort, Meinung und Tat beliebig wechseln, es kommt darauf nicht an.“ Worauf es ankäme, hat er mir nicht gesagt. Ich weiß aber noch, daß ich mich ärgerte, weil Dorothea, die unmöglich die Konsequenzen dieser Worte ergreifen konnte, zustimmend nickte. Äußerlich — berichtete er — ginge es ihm sehr schlecht. Er habe Pläne, wisse aber nicht, ob er sie ausführen könne. Im Augenblick habe er nichts, als was er auf dem Leibe trage, und werde zunächst Zuflucht in Willstetten suchen.
Das war unser letztes Zusammensein vor den entscheidenden Ereignissen. Eine Zeitlang hörte ich nichts. Dann brach alles Schlag auf Schlag herein.
Das erste Gerücht über Karl, das auch in unser abseitiges Heim drang, war, er bemühe sich in Willstetten sehr energisch und nicht aussichtslos um die Hand der Clarissa Eckbohm, er mache aber gleichzeitig und gewissermaßen in Reserve der fünfzehnjährigen Tochter Sylvia den Hof. Fest stünde, daß er Willstetten unbedingt in seinen Besitz bringen wolle, es sei nur ungewiß, ob er sein Ziel auf dem Umweg über die Mutter oder die Tochter erreichen wolle. Die materielle Seite dieser Gerüchte erschien mir kleinstädtischer Klatsch. Eher glaubte ich, daß auf Willstetten sich eines jener zahlreichen Liebesabenteuer Karls abspielte, und ich hielt es auch schon damals nicht für unmöglich, daß er — ein Casanova redivivus — sich gleichzeitig um die Gunst einer Mutter und Tochter erfolgreich bemühe. Ich hielt das um so eher für möglich, als er mir mit wirklichem Feuer diese beiden Frauen als in sich vollendete Vertreterinnen ihres Geschlechts geschildert hatte.
Ich hielt mir im allgemeinen die Gerüchte fern, trat aber äußerlich für ihn ein und wurde immer wieder gezwungen, für ihn einzutreten. Denn merkwürdigerweise bildete Karls Leben fast in jeder Gesellschaft das Gesprächsthema und ich gestehe offen, daß ich mit immer größerer Hartnäckigkeit ihn verteidigte, je heftiger man über ihn herfiel. Ja, ich geriet geradezu in eine schiefe Stellung, ich kam in eine schwere Krise hinein durch die Erkenntnis, daß wirkliche Begabung bei allen Mittelmäßigen immer Anstoß erregt, und daß der Durchschnittsmensch es auf keinen Fall erträgt, wenn der Begabte seine Gaben nicht in seinem Dienst verbraucht.
Meine sorgfältig aufgebaute Verteidigung wurde bald durch die Tatsachen weggeschwemmt. Etwa ein Vierteljahr nach Karls Ankunft in Willstetten starb Clarissa Eckbohm plötzlich und ohne vorherige Krankheit — wie es sich dann scheinbar klar herausstellte, Selbstmord durch Gift. Nach Testamentseröffnung ergab sich, daß Karl zum Vormund der Tochter bestellt und mit ihr zusammen als Universalerbe eingesetzt war.
Hier setzten bereits die Gerüchte ein, die von Mord sprachen. Die Staatsanwaltschaft wurde mit Briefen und Denunziationen bombardiert und leitete auch unter dem Drucke der öffentlichen Meinung ein Verfahren ein. Karl brach der Untersuchung die Spitze ab, indem er selbst auf das Energischste die Erhebung der Anklage gegen sich betrieb. Er ging bereits aus der Voruntersuchung glänzend gereinigt hervor. Ein Brief der Toten, in dem sie als Motiv ihres Freitodes die unerfüllbare Liebe zu Karl angab und damit gleichzeitig die Tatsache erklärte, warum sie ihn zum Miterben ihrer Tochter machte, wurde von Schreibsachverständigen als echt anerkannt. Besonderen Eindruck machte die Aussage der fünfzehnjährigen Sylvia, die den Brief vollinhaltlich bestätigte und gleichzeitig betonte, daß Karl ihre Mutter mehrfach vor früheren Selbstmordversuchen zurückgehalten habe.
Meine Freude war groß, und mein einziges Bedenken war, daß Karl weder von der Erbschaft zurücktrat, noch Willstetten verließ, daß er der Fama nach im innigsten Einvernehmen mit Sylvia lebte und sie zu heiraten gedachte.
Ich richtete damals einen Brief an ihn, in dem ich ihm in aufrichtiger Freundschaft nahelegte, den Schauplatz der durch ihn heraufbeschworenen Tragödie zu verlassen, das ihm durch so traurige Ereignisse zugefallene Erbe der einzig Erbberechtigten auszuhändigen und ein Leben endlich nach seinen Gaben aufzubauen. Karls Antwort war kurz und zynisch: „Wer einmal ins Gerede gerät, wird von den Bürgern gerädert, bis er seinen Geist aufgibt. Wer seinen Geist nicht aufgibt, sondern behält, wird unsterblich. Die Kleinen unter den Unsterblichen erhalten ein städtisches monumentum aere perennius in den Mäulern der Mitlebenden, um die Größeren spinnen sich Legenden aus der ängstlichen Hochachtung der Nachkommen. Ich gehöre zu den städtischen Unsterblichen. Gruß allen Mitlebenden.“
Wenige Tage nach diesem überheblichen Brief war die Katastrophe bereits da. Die fünfzehnjährige Sylvia Eckbohm starb ebenso plötzlich wie ihre Mutter, d. h. nicht ganz so plötzlich, nicht so plötzlich, wie Karl es vielleicht gewollt hatte. Der Hausarzt Dr. Teschendorf wurde zwar von Karl selbst telephonisch herbeigerufen (was Karl merkwürdigerweise im Prozeß sehr energisch in Abrede stellte). Da er aber zu Karls Unglück am Tag vorher sein Auto bekommen hatte, erschien er eine halbe Stunde eher in Willstetten, als Karl berechnen konnte. Karl versuchte zwar den Arzt in ein Gespräch zu verwickeln, dieser aber begab sich unverzüglich zur Kranken und fand sie mit dem Tode ringend. Nach der Aussage Dr. Teschendorfs habe nun die Sterbende gestammelt, daß sie denselben Weg geschickt sei wie ihre Mutter. Der Arzt beschwor im Prozeß, Sylvia habe ausgesagt, daß sie gleich ihrer Mutter von Karl gezwungen sei, Gift zu nehmen. Seine Frage, ob sie von Karl vergiftet sei, habe sie zwar mit Aufbietung letzter Kräfte mit „Nein“ beantwortet, vorher aber auf des Arztes bestürzte Frage nach dem bekannten Sterbebrief erklärt, daß dieser Brief gefälscht sei. Er, Dr. Teschendorf, habe sein möglichstes versucht, die rettungslos dem Tode Ausgelieferte noch zu kurzer Konzentration zurückzurufen, es sei ihm aber nicht gelungen. Als Dr. Teschendorf das Zimmer verließ, sei er mit Karl zusammengestoßen, der ihn sehr höflich gefragt habe, was er zu tun gedenke. Dr. Teschendorfs Worte: „Meine Pflicht“ habe er mit einem beinahe zustimmenden Kopfnicken beantwortet. Die Mordkommission, die zwei Stunden später in Willstetten eintraf, fand Karl bei seiner Mutter in einem scheinbar heiteren Gespräch. Er war im Reiseanzug, hatte eine Handtasche mit dem Nötigsten gepackt und empfing die Kommission durchaus nicht wie einer, dessen Flucht vereitelt ist, sondern, wie er sich ausdrückte, „bereit, die unvermeidlichen Konsequenzen der unangenehmen Affäre auf sich zu nehmen“.
Der Prozeß Karl Rasta gehört der Kriminalgeschichte an. Sein spannungsvoller Verlauf hat wochenlang die Spalten der Zeitungen gefüllt. Man weiß, daß Karl Rasta wegen Doppelmordes zweifach zum Tode verurteilt wurde, man weiß auch, daß heute noch, nach seinem freiwilligen Ende, die Kriminalisten verschiedener Meinung sind, ob er schuldig, mitschuldig oder unschuldig war, und ich bekenne offen, daß ich, trotzdem ich unter allen Lebenden Karl am besten kenne, nicht weiß, ob ich ihn als Mörder, als tödlichen Verführer oder nur als unerbittlichen Menschen bezeichnen soll. War er wirklich, wie er es darstellt, nichts als ein Mensch, dessen Wirkung den Tod verursachte, so hätte zwar dennoch oder gerade deshalb die Gesellschaft ein Recht, sich eines solchen Menschen zu entledigen, andererseits aber müßte dazu nicht der Weg des Fehlspruches, sondern der Weg über das Irrenhaus gewählt werden.
Wie dem auch sei — und ich bekenne offen, da im Dunkeln zu tappen und keineswegs eine Entscheidung treffen zu können — auf jeden Fall zwang Karls unbeugsame Haltung allen, selbst dem Staatsanwalt, Achtung ab und trieb die Richter zu immer neuer Prüfung der Sachlage.
Der dramatische Höhepunkt war sicherlich die Vernehmung Dr. Teschendorfs, der Karl, ohne eine Miene zu verziehen und ohne sich eine Notiz zu machen, folgte. Er machte auch gar nicht den Versuch, diese Aussagen zu widerlegen, da, wie er es ausdrückte, Dr. Teschendorf sie ja doch beschwören würde. Daß der Brief Clarissas gefälscht sei, gab er unumwunden zu, nachdem ein Gremium von Sachverständigen festgestellt hatte, daß der Sachverständige des ersten Prozesses sich durch die allerdings ganz ungewöhnlich geschickte Fälschung habe täuschen lassen. Er begründete die Fälschung an sich sehr geschickt damit, daß man ihm ohne diesen Brief ja doch sicherlich an den Kragen gegangen wäre und ihn im ersten Prozeß ebenso rettungslos verurteilt hätte, wie man ihn jetzt verurteilen würde. Die Beweise einer Schuld gegen einen außergewöhnlichen Menschen seien federleicht zu finden, seine Unschuld hingegen nicht zu erweisen, da ein genialer Mensch allein schon durch seine Existenz gegen die Gesetze verstoße und im innersten Sinne sie immer zu übertreten gezwungen sei. Sein Schlußwort habe ich wörtlich notiert: „Ich lebe in einer Welt, da Schuld und Unschuld sich so sehr vermengen, wie Tod und Leben ineinandergefügt sind. Ihr guter Wille, meine Herren Richter, gerecht zu urteilen, genügt nicht. Mein Verbrechen, das Nichtkönnen der mir verliehenen Macht, geschah in Bezirken, die Ihrem Spruch entzogen sind, jenseits von Grenzen, an die Sie mit Verstand und Herz zu reichen vermögen. Es geschah kein Mord in Ihrem Sinne. Wenn ich das Mörderische von Geschlecht, Wollust und Mutterschaft erkannte und im Erkennen auf mich nahm, so tat ich etwas, für das ich nur mir allein Rechenschaft schulde, so geschah etwas, durch das ich nach strengerem Gesetz als dem Ihren dem Untergang ausgeliefert bin oder als ein geweihter Mensch entkomme.
Untergang und Geweihtsein, das beides entspringt Quellen, aus denen die kommenden Jahrhunderte gespeist werden. Ich blicke aus der blendenden Helle zurück und sehe ihre Gesichter in Dunkel und Ungeduld getaucht. Ich spreche in Rätseln? Es ist mir nicht gegeben, mit Ihren Worten das Künftige zu künden, und so muß ich mich Ihrem gegenwärtigen Spruch beugen, der, wie er auch falle, ein Fehlspruch sein wird.“
Es ist durchaus möglich, daß diese letzte Rede, wie mir sein Verteidiger später sagte, ihm den Kopf gekostet hat. Jedenfalls waren die Meinungen der Geschworenen durchaus geteilt, so sehr auch die meisten durch Karls Auftreten provoziert waren. Ich glaube jedoch, daß weniger diese Rede als vielmehr die Tatsache der Brieffälschung, die belastende Aussage der toten Sylvia, den Ausschlag gab, sowie endlich die Feststellung, daß Karl Rasta tatsächlich mit beiden Frauen (und mit Wissen beider voneinander) ein Verhältnis hatte, das bei Sylvia nicht ohne Folgen geblieben war. Es mag lächerlich sein, aber ich leugne nicht, daß mich damals schon diese Tatsache gegen ihn einnahm, die mir jetzt als ein Glied in einem furchtbaren System des Frauenverbrauchs jenes Mannes erscheint und ihn bei mir verurteilt.
Die Verkündung des Todesurteils — und hier wiederum kann ich ihm meine Bewunderung nicht versagen — nahm Karl mit Lächeln entgegen, mit einem Lächeln, das gar nicht spöttisch, sondern seltsam ergreifend und fast königlich war, und dessen tiefe Wirkung er allerdings fast ganz auslöschte, als er bei dem Urteil, das ihn gleichzeitig wegen Verführung der minderjährigen Sylvia zu einem halben Jahr Gefängnis verdammte, in ein häßliches, hysterisches Lachen verfiel.
Der Prozeß gegen Karl Rasta war mit seiner Verurteilung keineswegs zu Ende. Man erinnert sich wohl, daß einerseits vom Verteidiger ein durchaus wohlbegründeter Revisionsantrag eingereicht wurde, andererseits der Staatsanwalt eine neue Untersuchung begann wegen Ermordung auch Ferdinand Eckbohms.
Die Revision wurde verworfen, ohne daß damit dem allgemeinen Rechtsempfinden Genüge geschehen wäre; denn es lag hier nach allgemeinem Ermessen wirklich einer jener durchaus seltenen Grenzfälle vor, in denen zwar nach meiner innersten Überzeugung der Gesellschaft letztlich das Recht zugesprochen werden muß, den unschädlich zu machen, der sie in ihrem Bestande bedroht, während es für Naturen wie Karl Rasta vielleicht wirklich ganz unmöglich ist, ohne Zusammenstoß mit dem Leben anderer ihr Leben zu vollenden. Ein „Schuldig“ im juristischen Sinn, ein Todesurteil, ist da fehl am Orte.
Wäre ich persönlich allerdings in der Lage gewesen, mein Leben gegen seines zu verteidigen, ich hätte es mir wahrhaftig nicht wehrlos aus der Hand schlagen lassen. Aber es ist mir von ihm über Nacht gestohlen worden, und ich konnte nur hinnehmen, was mir zugefügt war, zugefügt gleichzeitig durch den einzigen Menschen, den ich bewundert, und den einzigen Menschen, den ich geliebt habe. Und damit komme ich an jenen Punkt, der vielleicht für die Geschichte Karl Rastas unwesentlich ist, und der eigentlich nur wichtig ist, um zu erklären, wie die Dokumente seines Lebens in meine Hände kamen. Ich will aber die ganze Wahrheit sagen und nicht feige vor den letzten Zwingungen zurückweichen.
Die hundertmal in Bitternis wieder und wieder erlebten Ereignisse stehen mir in all ihren Anfängen und in all ihren Folgen so unheimlich lebendig vor Augen, daß es mir schwerfällt, das Unwichtige vom Wichtigen zu trennen, und ich in die Gefahr falle, meine Gefühle in den Vordergrund zu stellen, der ich in dieser Tragödie nichts bin als der zufällig Erduldende.
Der äußere Rahmen war, daß, während Karls Revision und die neue Anklage der Staatsanwaltschaft lief, die Sache Karl Rastas das Hauptthema aller Gespräche zwischen mir und Dorothea war, das heißt mein Hauptthema. Dorothea verfolgte zwar sehr genau alle Berichte in den Zeitungen und war ein geduldiger Zuhörer all meiner zweifelsvollen und schmerzlichen Auseinandersetzungen. Aber sie hörte in einer Art zu, daß ich immer glaubte, sie verstünde nicht eigentlich, welches Dunkel aus Karls Leben drohend sich erhob, welche Abgründe des Menschlichen sich auftaten, welche Fragen mich quälten. Es schien mir, daß die Frage nach Schuld oder Unschuld Karls sie kaum bekümmerte, jedenfalls weit weniger bekümmerte als die Frage, ob er dem Gericht entkommen würde oder nicht. Überhaupt hat Dorothea, wie es allerdings immer ihrer stillen und fast geheimnisvollen Art entsprach, nie eine besonders brennende Anteilnahme für Karl an den Tag gelegt, und so sehr ich mein Gedächtnis durchforscht habe: ich kann keine Äußerung finden, die eine Verbindung herstellt zwischen ihrem Leben und ihrer Tat, zwischen ihrem Wesen und ihrem Untergang. Es sei denn ihr einer Ausspruch, den ich zunächst kaum beachtete, und der mich erst sehr viel später stutzig gemacht hat. Als ich nämlich einmal das Schicksal der beiden Frauen bedauerte, wiegte sie den Kopf mit leisem Lächeln hin und her — ein Zeichen, immer, daß ein Gedanke sie beglückte — und auf meine Frage sagte sie leise: „Wie glücklich müssen sie aber auch gewesen sein, um so leicht unglücklich zu werden.“
Dieser Ausspruch ist, wie gesagt, die einzige Brücke, und sie ist für meinen Verstand zu schmal und für meine Füße zu schwankend. Ich kenne sie, aber ich betrete sie nicht. Das andere Ufer lockt mich auch zu wenig.
Die Entscheidung trat rasch und brutal in mein Leben. Es war am Tage des Prozesses wegen Ermordung Ferdinand Eckbohms. Wir hatten sehr erregt wieder die Möglichkeiten Karls, dem Tode zu entkommen, besprochen. „Unmöglich,“ sagte ich, „unmöglich, und käme ich in die Lage, ihm zu helfen, ich täte es nicht.“ Dorothea sagte lange nichts. Dann aber, als sie sich zum Schlafengehen anschickte, wandte sie sich an der Zimmertür zurück und sagte: „Ich täte es.“ Ich wußte zwar, was sie meinte, und es durchfuhr mich kalt, aber ich sagte: „Was tätest du?“ Sie antwortete nicht und ging. Ich hörte sie in ihrem anliegenden Schlafzimmer unruhig auf und ab gehen und später ein paarmal im Schlaf oder Halbschlaf leise stöhnen. Sie schien jedenfalls zu schlafen, als ich einmal nach ihr sah. Aber ihr Gesicht war von einem furchtbaren Schmerz überschwemmt, dem Schmerz, den ich damals zuerst sah, der sie nie mehr verließ, und der das Gesicht der Toten so entsetzlich verzerrte, als lägen die dunklen Grabschollen schon auf ihr.
Ich erschrak damals sehr über dieses Gesicht, über dieses ungeahnte Geheimnis, dieses Fallen eines Vorhangs, hinter dem ich süße Nebellandschaft geglaubt, hinter dem giftige und höllische Dämpfe der Vernichtung aufbrandeten.
Frage um Frage türmte sich so auf mein Herz, und ich ging in Qual über diese Wendung meines bisher klaren Lebens ins Fragerische, ging wie zerfetzt und verwundet in meinem Zimmer auf und ab. Immer wieder suchte ich meine Stirn an den Fensterscheiben zu kühlen, meine brennenden Augen zu baden im Märzmondgarten. Ich muß hinzufügen, daß unsere zur ebenen Erde belegenen Zimmer der Straße entgegengesetzt in den Garten mündeten. Ich weiß noch genau, daß ich im Mond erkennen konnte, daß die Kastanien vor dem Fenster schon schwollen und im Licht klebrig glänzten, jenem merkwürdigen Zwielicht aus Mond und dem fahlen Strahl meiner Lampe. Und ich dachte voll Bitterkeit, wie wenig ein Unglücklicher davon hat, daß es Frühling wird, und die Wiederkunft jeder Jahreszeit nur den freudig berührt, der im eigenen Rhythmus das Bleibende hat und es in Harmonie bringt mit dem Rhythmus des ewigen Wandels.
Und genau in diesem Augenblick stand zwischen Kastanie und Fenster, stand im Ungewissen der zwei Lichter, stand greifnah Karl Rasta vor mir. Man wird verstehen, daß ich eisig erschrak und mir die Worte im Munde erfroren. Ich, der ich wirklich an Gespenster und Halluzinationen nicht glaube, ich verfiel tatsächlich einen Augenblick in den Wahn (und man wird das den Umständen zugute halten), daß hier der Geist des toten Karl Rasta vor mir stehe oder ein Phantom, geboren aus der Zerrüttung meiner Nerven. Dennoch erkannte ich die Einzelheiten genau. Ich sah, daß Karl einen sehr schäbigen Sträflingsanzug trug, daß sein Haar geschoren war, daß seine Wangen, grauer noch als sonst, schlaff hingen, daß sein lebendes Auge stumpfer leuchtete als das Glasauge. Ich öffnete mechanisch das Fenster. Karl lächelte und begrüßte mich, als sei er vor kurzem dagewesen und käme höchstens zu ungewöhnlicher Stunde. Dann kletterte er, ohne meine Aufforderung abzuwarten, ins Zimmer hinein, steckte sich eine Zigarette an, ließ sich sichtlich erschöpft auf den Stuhl fallen, schloß apathisch die Augen und sagte nichts.
Schließlich raffte er sich auf, lächelte ein wenig, streichelte eine Kommode, die neben ihm stand, und ich dachte jetzt erst ein wenig verlegen, daß diese Möbel aus Karls Vaterhause stammten, und daß wohl jetzt sein ganzes Leben auf ihn einstürme. Aber wider Erwarten blieb das Streicheln fast die einzige Gefühlsregung, die ich an ihm wahrnehmen konnte. Er setzte mir vielmehr, indem er alle Fragen über Schuld und Unschuld und über seine Flucht kurz abschnitt, in seiner alten klaren Art auseinander, daß er zu mir gekommen sei, erstens, so sagte er wörtlich, um mir seine Lebensbeichte zu überreichen, die er bei mir in Sicherheit wüßte, während er „immerhin einigen Wechselfällen ausgesetzt sei“, zweitens bat er mich ihm Anzug und Geld zur Flucht zu verschaffen, die er beschlossen habe in der Erkenntnis, daß es ihm nicht möglich sei, seine Unschuld zu beweisen, und es ihm auch nicht angängig erscheine, für eine Schuld zu büßen, die er nicht auf sich lasten fühle. (In diesen spitzfindigen Worten steckt übrigens der ganze Karl Rasta. Ich weiß heute noch nicht, ob er damit sagen wollte, daß er keine Schuld habe, oder daß er seine Schuld nicht als Last fühle.)
Ich will nicht den Kampf schildern, der in mir brannte. Karl mochte spüren, wie schwer es mir fiel, ihm auf diesem ungesetzlichen Wege zu helfen. Er saß, wie um mich nicht zu beeinflussen, ganz unbeweglich da und sah vor sich hin, als ginge ihn meine Entscheidung nichts an. Und ich habe nicht die geringste Veränderung an ihm bemerkt, als ich ihm sagte, daß ich ihm zu helfen entschlossen sei.
Das andere hat sich in kaum fünf Minuten abgespielt und ist nur in seinen Untergründen nicht zu erklären. Äußerlich ist es in ein paar Worten erzählt. Ich ging hinaus, um den Anzug zu holen, und als ich zurückkam, bot sich mir ein Anblick, der mich weit über seine äußere Seltsamkeit hinaus erschreckte, erschreckte, als habe mich ein Blitz durch und durch geschlagen.
Kurz gesagt, als ich zurückkam, stand meine Frau, stand Dorothea, in ihrem Nachthemd an der Tür und lächelte den Mörder an, lächelte Karl Rasta an, als habe sie eine Lieblichkeit gefunden. Dieses Lächeln und Karls Blick, der mir schamlos erschien, erschreckten mich tief, und ich blieb starr mit meinem Anzug dastehen. Dorothea sah mich so flüchtig an, als sei ein Fremder eingetreten. Dann ging sie langsam Schritt um Schritt auf Karl Rasta zu. Über Karls Gesicht aber — und das beruhigte mich damals — ergoß sich mit jedem Schritt, um den sie sich ihm näherte, ein Entsetzen, ganz ähnlich dem, wie ich es vorhin auf dem Gesicht der schlafenden Dorothea entdeckt hatte. Und in dem Augenblick, als Dorothea sich über ihn neigte, ihn auf die Stirn zu küssen, wogte dieses Entsetzen ungehemmt über ihn hin. Ja, ein Meer von Entsetzen war sein Gesicht, ein Meer, über dem unbeweglich das Glasauge blinkte, ein toter Stern.
Dorothea ging zur Tür zurück, ich wollte sie wegbringen oder ihr wenigstens ein Kleid überwerfen, Karl aber lächelte: „Laß das doch und bring’ auch deinen Anzug wieder weg. Ich fliehe nicht. Ich gehe zurück, woher ich kam.“ Meine wirren Fragen beantwortete er nicht: „Ich werde dir den Schluß meiner Verteidigung zukommen lassen. Geh nun. Laß mich. Lassen auch Sie mich, gnädige Frau, zehn Minuten unter den alten Möbeln sitzen, ich gehe dann.“
Warum ich Narr ihm glaubte, warum ich meinen Anzug gehorsam wieder hinaustrug, warum ich so den beiden Zeit ließ zu ihrer verbrecherischen Verabredung, das weiß ich nicht mehr und habe es mit unbehörten Qualen bezahlt.
Jedenfalls war Dorothea fort, als ich wiederkam, Karl aber ging auf mich zu, umarmte mich und küßte mich. Es war der einzige Kuß, den er je mir gab (unsere Freundschaft war ganz unzärtlich), und war ein Judaskuß. Er schob mich in mein Zimmer, ich legte mich nieder und hörte keinen Laut von nebenan. Etwa nach einer halben Stunde erst — gerade wollte ich ihn mahnen, daß er nun gehen müsse — hörte ich ihn leise das Fenster öffnen, hinaussteigen und Weggehen. Unter seinen letzten Schritten schon fiel ich in totenähnlichen Schlaf.
Es ist bekannt, daß der Mörder Karl Rasta, nachdem er von seiner Flucht freiwillig zurückgekehrt war, am nächsten Tage unter Hinterlassung eines Briefes an mich seinem Leben im Gefängnis selbst ein Ende setzte.
Ich hatte die Nachricht erwartet und atmete auf, denn es schien mir der einzige Ausweg dieses Menschen aus den Netzen, in die er sich verfangen. Da reckte der Tote sich auf und zerschlug mein Leben. Dorothea fiel bei der Nachricht von seinem Tod in eine sanfte Ohnmacht. Als sie erwachte, erzählte sie mir ganz ruhig, und als sei es nichts Ungeheuerliches, daß Karl Rasta sie in der letzten Nacht verführt habe, oder, wie sie sich ausdrückte, und was ich nun und nimmer glaube, daß sie ihn unter dem mächtigen Zwang der Liebe verführt habe.
Wie ist es möglich, daß diese Frau erst bei meinem Aufschrei spürte, was da geschehen war, daß da erst die Schleusen in ihr brachen und Entsetzen, Hohn, Krampf und Gelächter sie überschwemmten? Wie ist es möglich? — das sind die Höllenworte, die mein Herz verbrannten, und die keine Antwort gefunden haben. Auch nicht, in jenen letzten Erklärungen Karls, die meinem Schmerz, meinem Verlust, diesem teuren Leben gegenüber mir erscheinen wie eine höhnische Farce.
Nein, bei aller Anerkennung Karls: hier in seinem Sexus lag der Keim zu seinem Verderben, und zu dem Verderben, das er um sich gesät hat. Er gehörte zu jener Klasse von unersättlichen Männern, die jede Frau besitzen zu müssen meinen. Und es gehört nicht viel dazu, Pessimist zu werden bei der Erkenntnis, daß es nur wenig Frauen gibt, die sich aus solchem Grund von solchen Männern abwenden.
Wie ist es möglich, daß Dorothee ... aber nein, es sind genug Fragen über meinen Kopf geschwirrt, und haben mir mit Sensen das Haar abgemäht. Ich bin alt geworden und wäre mein Kind nicht ...
Dennoch stehe hier das Bekenntnis: Dorothea, ich habe dich immer geliebt, und nicht weniger seit jener Nacht, und, so sehr ich vielleicht wollte, es hat mich nie geekelt vor dir, ich habe schließlich (o Rätsel!) nie zu richten vermocht über dich.
Sicher ist, daß ich sie nicht mit Vorwürfen in den Tod trieb. O nein, ich sah angstvoll ihr Welken, ich habe sie beschirmt und behütet. Der Name Karl Rasta ist zwischen uns nicht gefallen. Auch nicht, als sie schwanger wurde und wir beide wußten, daß sie ein Kind trug, das nicht mein Kind war. Dieses Kind — ich mag nicht länger schreiben — hat Dorothea getötet. Karl Rasta hat Dorothea getötet. Und wenn es wahr sein mag, daß er wirklich an dem Tode der anderen nicht schuldig war, so kann ich nicht anders, als seinem Schatten, der mich oft nächtens peinigt, zurufen: Mörder! Mörder!!
Dorothea starb im fünften Monate ihrer zweiten Schwangerschaft, ohne daß eine Krankheit an ihr festzustellen war. Ihr Herz hatte eines Nachts ausgesetzt. So fand ich sie morgens tot, mit dem Schrecken im Gesicht, von dem ich sagte.
Ich lebe, mein Kind lebt. Es wird Frühling. O wie wenig, wie wenig ist das! Die Erde bricht auf zu Blüte und Gras. Unten aber liegen die Toten, denen kein Licht scheint, und der Schrei der Nachtigall dringt nicht durch die Decke der Erde.
Ich aber trete in die Dunkelheit zurück und gebe das Wort an Karl Rasta. Es wird sich vielleicht doch jemand finden, der besser versteht als ich, was es um diesen Mann ist.