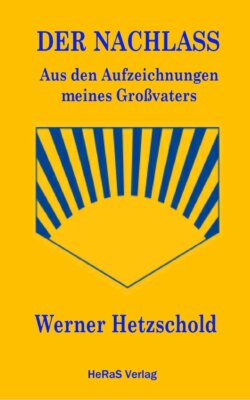Читать книгу Der Nachlass - Werner Hetzschold - Страница 5
2
ОглавлениеLängst ist die Zeit vorbei, dass die Schule erst um elf oder gar um zwölf beginnt. Wie die Großen muss Thomas jetzt auch früh aufstehen, damit er Punkt acht Uhr in der Schule ist.
Während Thomas mit den Großen und Kleinen aus dem Viertel auf dem gewohnten Schulweg am Stötteritzer Bahnhof vorbei die Schönbach Straße in Richtung 28. Grundschule hinaufsteigt, freut er sich auf seinen immer näher kommenden Geburtstag.
Als er den Klassenraum unmittelbar vor dem Stundenklingeln betritt, fliegt ihm ein nasser Schwamm an den Kopf. Ohne sich lange zu besinnen, schleudert Thomas den noch immer vor Nässe triefenden Schwamm seinem vermeintlichen Gegner entgegen, denn Thomas ist nicht entgangen, aus welcher Richtung der Schwamm kam. Kaum hat er den Schwamm abgefeuert, duckt er sich ab, gleich neben der Bank hinter der Tür.
„Hier ist schwer was los!“ Sein Freund Wolfgang kniet neben ihm in der Deckung.
„Das habe ich gleich bemerkt. Noch nie war früh so eine Stimmung! Vorsichtig prüft Thomas die Lage.
„Habt ihr zu Hause kein Radio?“
„Doch! So einen alten Volksempfänger.“
„Damit könnt ihr auch Nachrichten hören.“
„Und welche Nachricht hätte ich hören sollen?“
„Auf allen Sendern haben sie es gebracht: Stalin ist tot. Und jetzt wollen wir überall die Stalinbilder entfernen.“
„Wer ist wir?“
„Zum Beispiel du und ich und noch ein paar andere. Und jetzt tobt der Klassenkampf.“
„Mir hat der Stalin nichts getan“, sagt Thomas, „von mir aus kann er dort hängen.“
„Der wird nicht mehr hier hängen. Den nehmen wir ab und lassen ihn verschwinden, wo ihn niemand mehr findet.“ Die Augen von Wolfgang glühen wie die eines Revolutionärs.
Thomas ist beeindruckt von der Haltung seines Schulfreundes. Trotzdem zieht er es vor, sich nicht in den Klassenkampf einzumischen. Er hat Angst vor den großen Helden. In seinem Lesebuch sind viele Geschichten von solchen großen Helden abgedruckt. Auch wenn sie die Sieger waren, gab es viele Tote zu beklagen; viele tote Kampfgenossen und viele tote Verräter. Die Helden blieben am Leben, nur ihre namenlosen Mitstreiter hatten ihr Leben für die große Sache geopfert und hatten Glück, wenn ihr Tod beweint wurde, viele starben unbemerkt, namenlos, bereits vergessen. Die Namen der Toten wurden nicht genannt, dafür nur Zahlen. Thomas will kein Held sein.
„Ich werde das Stalinbild mit meinem Schlüsselbund zerstören.“ Wolfgang holt das Schlüsselbund aus der Tasche, setzt zum Sturmangriff an, wie er selbst sagt. Gerade in dem Augenblick wird die Tür aufgerissen, und ihr Klassenlehrer, der Herr Sanftmut, steht im Raum. Alle stürmen auf ihre Plätze, stehen still neben ihrer Bank. Die Stimme von Herrn Sanftmut klingt noch härter als sonst: „Ich setze voraus, dass ihr wisst, was sich ereignet hat. Wir werden den großen Stalin nie vergessen! Fünf Minuten werden wir jetzt schweigend an ihn denken. Fünf Minuten, habe ich gesagt. Und wer das nicht kann, der wird mich kennen lernen, mit dem fahre ich Schlitten.“
Mit Herrn Sanftmut will sich keiner aus der Klasse anlegen. Schweigend stehen alle neben ihrer Bank und starren ausdruckslos vor sich hin.
In der Pause sagt Wolfgang zu Thomas: „Der Sanftmut hat uns nur zwei Minuten stehen lassen. Ich habe auf meine Uhr geschaut.“
Nicht mehr lange und die Ferien beginnen. Thomas freut sich auf die Ferien. Nicht nur, weil er da länger im Bett bleiben kann, sondern weil der Tag ihm dann allein gehört. Er kann tun und lassen, was er will. Schon jetzt weiß er, was er will: Er wird die Ferien im Freibad verbringen, wenn die Sonne es gut mit ihm meint.
Als Thomas auf dem Balkon steht, um zu prüfen, ob er nur im Hemd gehen kann, fährt gerade ein Güterzug vorbei, beladen mit Panzern und Panzerfahrzeugen. In den offenen Güterwaggons stehen dicht bei dicht Soldaten, schauen sich die Landschaft an, winken ihm zu. An ihren kahl geschorenen Köpfen erkennt er sie sofort als Russen, wie die Leute im Viertel sie nennen, in der Schule werden sie Rotarmisten oder die Rote Armee genannt. Er zögert, ob er zurückwinken soll. Die Panzer und die anderen Fahrzeuge ängstigen ihn. Dabei kommen oft Truppentransporte an ihrem Balkon vorbei. Er ist ihren Anblick gewohnt, trotzdem beschleicht ihn jedes Mal eine seltsame Furcht, für die er keine Erklärung hat. Thomas zieht es vor, vom Balkon zu verschwinden. Ihm wird plötzlich kalt. Dabei scheint die Sonne, und es ist Juni, fast schon Sommer.
Auf dem Weg zur Schule bemerkt er ein emsiges Treiben am Bahnhof. Darüber wundert er sich, denn die Arbeiterzüge nach Borna, Espenhain, Böhlen fahren früh am Morgen, wenn er noch im Bett liegt. Onkel Erich arbeitet auch dort. Früh um vier Uhr verlässt er das Haus. Er hat schon längst seine Arbeit aufgenommen, wenn Thomas noch im Bett liegt und überlegt, ob er bereits aufstehen soll oder noch etwas liegen bleiben kann, bis die Mutter so ungeduldig wird, dass er es nicht mehr aushalten kann und sich aus den Federn schiebt.
Wie gewöhnlich erscheint Thomas unmittelbar vor dem Stundenklingeln in der Klasse. Erschreckt stellt er fest, dass Herr Sanftmut bereits im Raum ist. Seltsam ruhig klingt die Stimme seines Lehrers. Seine Mitschüler sitzen teilnahmslos in ihren Bänken. Später erfährt Thomas von Wolfgang, der immer über alles informiert ist, dass die Russen aufmarschiert sind.
„Warum sind die Russen aufmarschiert?“, will Thomas wissen.
„Es gibt einen Aufstand, vielleicht auch wieder einen Krieg“, berichtet Wolfgang.
Früher als laut Stundenplan vorgesehen, ist die Schule beendet. Auf dem Heimweg werden die Kinder am Bahnhof von Panzern und Panzerfahrzeugen erwartet. Russen stehen neben den Fahrzeugen oder sitzen in ihnen. Freundlich sind sie zu den Kindern, die sich um die Panzer versammelt haben und neugierig diese Ungetüme aus Stahl betrachten. Die Soldaten erlauben es sogar, dass die Kinder auf den Panzerspähwagen herum klettern, schimpfen nicht einmal, als Wagemutige sich hinter das Maschinengewehr setzen. Ganz Mutige klettern sogar durch die offene Luke eines Panzers.
Thomas bleibt nur kurz stehen. Unheimlich, irgendwie fremd wirkt der Bahnhofsvorplatz. Ein ungutes Gefühl beschleicht den Jungen. Er spürt, wie die Angst an seinem Körper empor kriecht, ihn dazu zwingt, sich in Bewegung zu setzen. Erst bewegt sich der Junge langsam, dann läuft er, wird immer schneller und schneller. Ihm ist zumute, als renne er um sein Leben.
Zu Hause angekommen, umarmt ihn seine Mutter. „Ein Glück, dass ihr beide da seid.“ Gisela ist schon vor ihm eingetroffen.
Am Abendbrottisch unterhalten sich die Eltern. Das ist ungewöhnlich, weil sie höchst selten Worte wechseln im Beisein der Kinder.
Thomas erfährt, dass einige Männer aus ihrem Viertel verhaftet worden sind.
Thomas ist erstaunt über das Verhalten seiner großen Schwester. Bei jedem ihrer Besuche hatte er Ärger mit ihr. Schon als kleiner Junge blieb ihm oft nur die Flucht übrig, wenn er nicht von ihr verprügelt werden wollte. Damals begann Helga ihre Karriere als Sängerin an einem Theater. Verirrte sie sich in großen Abständen einmal in die elterliche Wohnung, schulte sie in der Stube ihre Stimme.
„Glü, glü, glü“, zwitscherte sie in den höchsten Tönen.
Thomas fand das immer sehr lustig und krähte: „glü, glü, glü.“
Helga fand seinen Gesang gar nicht lustig. Da Worte bei ihm nichts auszurichten vermochten, griff sie zur Kelle und wollte ihn verprügeln. Er entzog sich der Berührung mit der Kelle, indem er fortlief und ihr aus sicherer Entfernung die Zunge herausstreckte oder ihr zurief: „Fang mich doch, du altes Loch ...“ Helga wurde dann noch wütender.
Diesmal begrüßt ihn Helga mit einem sanften Lächeln und sagt: „Junge, bist du gewachsen. Sicher hat auch dein Verstand zugenommen ...“
Thomas schluckt, will etwas sagen, zieht es aber vor zu schweigen. Er will seine Mutter nicht enttäuschen, die gerade die Stube betreten hat. Seine Mutter soll immer nur den besten Eindruck von ihm haben.
Seine Mutter sagt zu ihm: „Thomas, zeig einmal Helga, wie ausdrucksvoll du lesen kannst.“
„Er muss nicht ausdrucksvoll lesen“, unterbricht Helga die Mutter, „sondern richtig und vor allem flüssig, zügig.“
„Warum soll ich vorlesen und dann noch zügig, flüssig?“, fragt Thomas.
„Weil ich mitschreiben will, was du diktierst“, antwortet die Schwester.
„Warum willst du mitschreiben?“
„Frag nicht so viel, sondern lies. Als Belohnung winkt dir ein Stück Torte.“
„Ich darf aber die Torte auswählen.“
„Ja!“ Helga ist sichtlich genervt.
Thomas liest auf Helgas Wunsch ihr etwas aus einer Zeitung vor.
„Diktiere ruhig etwas schneller!“
„Ich denke, ich soll lesen. Und was ist das für eine Schrift. Die kann doch kein Mensch lesen.“
„Das ist Stenografie.“
Ehrfurchtsvoll schweigt Thomas. Jetzt versteht er, warum die Eltern so stolz auf ihre große Tochter sind. Dann fragt er die Schwester: „Erkläre mir einmal, warum eine Sängerin Stenografie schreiben muss.“
„Du sollst nicht so viel fragen“, bekommt er zur Antwort-
Jeden Tag diktiert er der Schwester Texte. Thomas gefällt seine neue Aufgabe als Diktator, weil sie etwas einbringt
Dann verabschiedet sich Helga. In den Augen seiner Mutter schimmern Tränen.
„Sie kommt doch wieder“, tröstet Thomas die Mutter.
„Aber wann wird das sein“, schluchzt die Mutter und lässt ihren Tränen freien Lauf.
Wochen später holt Thomas einen Brief aus dem Briefkasten. Neugierig betrachtet er ihn, denn so eine Briefmarke war bisher noch auf keinem der Briefumschläge. Bundesrepublik Deutschland steht auf der Briefmarke geschrieben. Wer kann ihnen aus der Bundesrepublik Deutschland wohl schreiben? Die Schriftzüge sind ihm nicht vertraut. Genau prüft er jetzt den Absender. Da steht Schwarz auf Weiß geschrieben: Helga Boronsky.
Thomas stürzt die wenigen Stufen zur Wohnung hinauf. Die Mutter steht in der Küche hinter dem Bügeleisen.
„Helga hat geschrieben!“
Seine Mutter unterbricht ihre Arbeit. Ihre Augen füllen sich mit Tränen. Dann schlägt sie ihre Hände über dem Kopf zusammen und schreit in die Stille: „Sie hat es geschafft!“
Tränen fließen über die eingefallenen Wangen der Frau Boronsky. Mit Tränen erstickter Stimme liest sie Thomas und Gisela den Brief laut vor. Immer wieder stellt Thomas fest, dass seine Mutter sehr gut vorlesen kann. Fließend ist ihr Vortrag und gefühlvoll.
Beide Kinder erfahren, dass ihre große Schwester Helga in den anderen Teil Deutschlands gegangen ist, den sie unter der Bezeichnung „Goldener Westen“ kennen. Hoffentlich ist dieser Westen so golden, so hoffen die beiden, dass die Familie auch große, dicke Pakete bekommt wie nicht wenige Familien im Viertel. Sie hören aus dem Munde der Mutter, dass ihre große Schwester in Köln ein neues Zuhause gefunden hat. Ihre Karriere als Sängerin hat sie aufgegeben, zumindest vorübergehend, schreibt sie. Jetzt arbeitet sie als Sekretärin bei einer großen Autofirma. Thomas wird nun klar, warum er ihr immer vorlesen musste. Nicht, um sich im Ausdruck zu schulen, wie Helga sagte, sondern um sie in Stenografie zu Höchstleistungen zu befähigen. Sie äußert, dass ihre Ausbildung in Stenografie und in Maschinenschreiben für ihre Einstellung von großem Vorteil war. Die Tränen verhangenen Augen der Mutter glänzen vor Glück. Entzückt ruft sie immer wieder: „Sie hat es geschafft! Sie hat es geschafft! Dieses kluge Mädchen!“
Weil die Mutter sich freut, freuen sich die Kinder. Sie wissen, ihre Mutter hat sonst wenig Gelegenheit zur Freude.
Als Thomas von der Schule nach Hause kommt, sitzt Frau Schlundt bei seiner Mutter in der Küche. Richtig verheult sieht das Gesicht der Frau Schlundt aus, verquollen und aufgedunsen. Beide müssen sich angeregt unterhalten haben, jetzt aber, da Thomas in der Küche ist, verstummt das Gespräch sofort. Das verunsichert Thomas, gleichzeitig macht es ihn neugierig. Nur kann er seine Neugierde nicht befriedigen. Seine Mutter schickt ihn ins Nebenzimmer, weil sie Wichtiges, wie sie sagt, mit Frau Schlundt zu besprechen hat. Wenn Frau Schlundt bei einer solchen Besprechung wie ein Schlosshund heult, muss es tatsächlich etwas sehr Wichtiges sein. Lange muss sich Thomas in der Stube gedulden und seinen Wissensdrang bezwingen. Er lenkt sich ab und vertieft sich in sein aus der Bibliothek ausgeliehenes Indianerbuch. Nur will ihm das nicht völlig gelingen. Die Neugierde meldet sich immer wieder und will wissen, was mit Frau Schlundt los ist. So viel ist Thomas klar: Es muss etwas ganz Außergewöhnliches sein, dass Frau Schlundt zu Tränen rührt, sonst würde nämlich die Frau keine Träne verlieren. Viel Zeit - Thomas kommt es wie eine Ewigkeit vor - ist verstrichen, bis ihn seine Mutter in die Küche ruft.
Seine Mutter sagt: „Hör gut zu, mein Junge. Der Untermieter von Frau Schlundt ist auf und davon. Niemand weiß, wo er abgeblieben ist. Nun hat sich Frau Schlundt schweren Herzens entschlossen, ihre Wohnung aufzugeben und ins Stift zu gehen. Wie sie sagt, bekommt sie ein schönes großes Zimmer mit Fenster zum Park Ihre Möbel will sie verkaufen bis auf die, die sie mitnehmen möchte. Für ihren Transport benötigt sie aber keinen Möbelwagen. Nun lässt sie dich durch mich fragen, ob du ihr beim Umzug behilflich sein könntest. Sie will sich auch erkenntlich zeigen. Ich habe schon zugesagt. Und du wirst doch deine Mutter nicht enttäuschen und ihr zur Hand gehen.“
Seiner Mutter zuliebe sagt Thomas ja. Er möchte ihr eine große Freude bereiten.
Abends nach dem Abendbrot sagt seine Mutter zum Vater, nachdem die Kinder sich in die Stube zurückgezogen haben: „Hast du schon gehört, Karl, der Schlundten ihr Untermieter ist abgehauen. Niemand hat eine Ahnung, wo er abgeblieben sein könnte. Alle wissen nur, er ist spurlos verschwunden, einfach abgetaucht.“
„Bei dem Drachen hält es doch keiner aus.“ Mehr hat Herr Boronsky nicht zu sagen.
Als an diesem Sonnabend Thomas von der Schule nach Hause kommt, wird er mit Ungeduld von Frau Schlundt erwartet. Hoch oben am Himmel steht die Sonne und heizt die Stadt auf. Wie seine Klassenkameraden würde Thomas lieber diesen Tag im Freibad verbringen, aber die Pflicht ruft, die ihm seine Mutter in ihrer Gutmütigkeit eingebrockt hat. Die Mutter will er nicht enttäuschen, deshalb fügt er sich in sein Schicksal, trinkt nur zwei Tassen gesunden Kamillentee, um seinen Durst zu löschen. Dann klopft er an die Tür der Frau Schlundt. Sie muss hinter der Tür gelauert haben, denn gleich nach dem ersten Klopfer wird die Tür aufgerissen, und Frau Schlundt steht vor ihm. Ihre Kleidung sieht gar nicht nach Arbeit aus. Sie trägt einen bunten Blumenrock, eine weiße Bluse. Ihre Füße stecken in Stöckelschuhen.
„Fein, dass du da bist“, empfängt sie Thomas, „wir gehen gleich nach dem Wagen.“
Nur ein paar Häuser weiter steht vor dem Hauseingang ein großer Leiterwagen für Frau Schlundts Umzug bereit. Thomas darf sich davor spannen und ihn ziehen, während Frau Schlundt neben ihm daher trippelt und lobt: „Du bist ja ein großer, kräftiger Junge. Für dich ist so ein Wagen eine Kleinigkeit.“
Thomas zieht es vor zu schweigen.
Frau Schlundt lässt nicht locker: „Sonst aber bist du gesprächiger. Hattest du Ärger in der Schule?“
„Ich fühle mich nicht wohl.“
„Wie kann sich ein so großer Junge wie du bei diesem Wetter nicht wohl fühlen?“
Wieder denkt Thomas daran, was er der Mutter versprochen hat.
Als Frau Schlundt ihre Wohnungstür aufschließt, sagt sie: „Ich nehme nur Kleinigkeiten mit.“ Beim Betreten der Wohnung stellt der Junge fest, dass sie bereits ziemlich ausgeräumt ist.
„Die Schränke habe ich schon ins Stift bringen lassen. Es sind nur noch einige Kleinigkeiten, die ich dorthin bringen möchte. Und du bist so nett, mir dabei behilflich zu sein. Zuerst nimm bitte die Kartons. Aber sei vorsichtig. In ihnen befindet sich mein Porzellan.“
Während Thomas vorsichtig den Handwagen mit dem Porzellan belädt, steht Frau Schlundt daneben und bewacht die teure Fracht.
„Wir wollen den Wagen nicht überladen, ruft sie besorgt aus. Schließlich sind es Kostbarkeiten, die ich dir anvertraue.“
Wieder spannt sich Thomas vor den Wagen, während Frau Schlundt neben ihm daher tänzelt und immer wieder besorgt ausruft: „Bitte vorsichtig! Nicht so schnell! Vorsicht! Bordsteinkante!“
Sie erreichen das Stift, das von einem kleinen Park umgeben ist.
„Die Bäume lassen wenig Licht in die Zimmer dringen“, sagt nachdenklich Frau Schlundt, „trotzdem sind Bäume schön. Sie machen ihre Umgebung lebendiger.“
Thomas hätte hier nicht wohnen mögen. Aus den geöffneten Fenstern schauen nur alte Leute. Ihre Gesichter sehen viel älter aus als das von Frau Schlundt.
„Ist der Kleine aber fleißig“, sagt eine alte Frau.
Thomas schleppt das Porzellan in den dritten Stock. Dort befindet sich das Appartement der Frau Schlundt, wie diese das Zimmer mit der kleinen Küche bezeichnet. Obwohl die Sonne ihre heißen Strahlen zur Erde schickt, hierher in Frau Schlundts Appartement verirrt sich kein einziger. Thomas friert. Er beeilt sich, dieser Kälte entfliehen zu können. Noch drei Fuhren warten auf den Jungen; erst dann befinden sich die wenigen Habseligkeiten, wie Frau Schlundt mitunter ihre Besitztümer nennt, im Stift.
Als roter Feuerball erscheint die Sonne am Himmel. Langsam weicht der Tag der Nacht. Thomas ist müde und hat Hunger. Auch Frau Schlundt ist froh, als der Umzug abgeschlossen ist. Als sich Thomas von ihr verabschiedet, sagt sie: „Der liebe Gott wird dich für deine gute Tat belohnen.“
Thomas tritt mit dem Leiterwagen den Heimweg an, bringt ihn zurück zu seinem Besitzer. Mit Ungeduld erwartet die Mutter ihren Jungen.
„Es ist schon sehr spät“, sagt Frau Boronsky, „Ich habe mir Sorgen gemacht, aber jetzt bist du da.“
„Und hat sie dich wenigstens ordentlich bezahlt“, lässt sich der Vater hören.
Thomas wird verlegen, bevor es über seine Lippen kommt, dann sagt er: „Eigentlich nicht. Sie hat beim Abschied gemeint, der liebe Gott wird mich für meine guten Taten belohnen.“
„Alter Geizhals!“ Mehr hat Vater Boronsky nicht zu sagen.
„Der Junge hat eine gute Tat vollbracht.“ Wenig überzeugend klingt die Stimme der Mutter.
Bestimmt hat Frau Schlundt auch im Stift die Sonne vermisst oder ist über den Verlust von Onkel Erich nicht hinweggekommen. Als Thomas von der Schule nach Hause kommt, sagt ihm die Mutter: „Erinnerst du dich noch an die Frau Schlundt? Sie ist gestorben. Gar nicht alt ist sie geworden. Und ich wusste gar nicht, dass sie eine Tochter hat. Die Anzeige in der Zeitung hat ihre Tochter aufgegeben. Nie habe ich eine Tochter gesehen. Eigenartig!“
Wolfgang hat Geburtstag. Thomas erhält eine Einladung. Wolfgang wohnt in einer der vornehmen Gegenden der Stadt. In Marienbrunn gibt es keine Mietshäuser, nur Einfamilienhäuser mit Garten. Diese Häuser haben viele Zimmer, sogar Besucherzimmer. Wolfgang führt Thomas in sein Zimmer, das größer ist als die Wohnstube der Familie Boronsky. Wolfgang hat einen eigenen Schreibtisch und Bücherregale mit vielen Büchern.
„Hast du die alle gelesen?“ Die Augen von Thomas wandern von Bücherreihe zu Bücherreihe.
„Fast alle.“ Thomas mag dieses Lächeln an Wolfgang nicht. Es drückt so viel Überlegenheit aus. Bei diesem Lächeln fühlt sich Thomas klein und unbedeutend. Trotzdem kämpft er gegen dieses dumme Gefühl an. Seine innere Stimme flüstert ihm dann zu: „Du bist auch wer, Thomas Boronsky. Zwar hast du keinen Privatunterricht in Englisch und Französisch, aber deshalb bist du kein schlechterer Mensch als Wolfgang.“
Wolfgang zeigt ihm den Garten.
„Ihr habt sogar Hühner!“ Thomas ist begeistert. Er mag Tiere.
„So haben wir wenigstens frische Eier.“ Wieder bemerkt Thomas dieses überhebliche Lächeln.
„Nur haben sie wenig Raum, sich zu bewegen“, setzt Thomas das Gespräch fort.
„Wir lassen sie in Abständen im Garten etwas herum scharren. Wir können sie ja jetzt etwas laufen lassen.“ Während er das sagt, öffnet Wolfgang die Tür der mit Draht eingezäunten Ecke zwischen Nebengebäude und Haus.
Thomas kann die Hühner nicht verstehen. Statt aus ihrem engen Auslauf auszubrechen, nehmen sie von der geöffneten Tür keine Notiz.
„Sie sind eben doof. Nur zum Eierlegen und Schlachten zu gebrauchen.“ Wolfgang begibt sich in den Hühnerauslauf und treibt die sechs Hühner aus ihrem Verlies in den Garten. Verlassen irren die Hühner in der ihnen für kurze Zeit gewährten Freiheit umher.
„Habe ich es nicht gesagt, sie sind doof. Kaum dürfen sie ihre paar Quadratmeter verlassen, verlieren sie den Überblick. Weißt du was“, dabei verwandelt sich das hochmütige Lächeln von Wolfgang in ein boshaftes Grinsen, „wir spielen Kommunisten und SS. Wir sind die SS, und die Hühner sind die Kommunisten.“
Bei dem Gedanken, die Rolle der SS zu übernehmen, fühlt sich Thomas nicht wohl. Auch Kommunist möchte er nicht sein.
„Können wir nicht etwas anderes spielen? Und die Hühner im Garten einfach in Ruhe herum picken lassen.“
„Die machen nur Schaden. Die müssen beaufsichtigt werden. Wie die Kommunisten! Du kannst mir glauben, dieses Spiel macht Spaß.“
„Ich will es aber nicht spielen.“ Am liebsten würde jetzt Thomas Wolfgang stehen lassen und nach Hause gehen, aber er möchte nicht unhöflich sein. Als er seiner Mutter von der Einladung erzählte, sagte sie: „Gehe mal hin, mein Junge. Das sind sehr feine Leute. Der Mann ist Lehrer, und die Frau ist Ärztin. Das ist ein sehr guter Umgang für dich. Vielleicht färben die guten Manieren auf dich ab.“
„Den Kommunisten werde ich es jetzt zeigen“, steigert sich Wolfgang in seine Rolle. „Eine kleine Jagd nach ihnen wird allen guttun.“ Mit diesen Worten scheucht Wolfgang die eingeschüchterten Hühner durch den Garten, wirft mit kleinen Holzstücken nach ihnen, um sie nicht ernsthaft zu verletzen. „Und lasst euch ja nicht einfallen, keine Eier nach diesem Vergnügen zu legen.“
Die Hühner wissen, wohin sie gehören. Kaum hatten sie ihr Verlies verlassen müssen, werden sie dorthin zurückgetrieben.
Kommunisten gehören eben hinter Schloss und Riegel. Zufrieden mit sich und der Welt schließt Wolfgang die Drahttür.
Die Jungen kehren zurück ins Haus, ziehen sich in Wolfgangs Zimmer zurück.
„Wenn du willst“, sagt Wolfgang, „kann ich dir Bücher ausleihen. Du brauchst mir dafür nichts zu geben.“
„Ich danke dir für das großzügige Angebot“, hört sich Thomas sagen, „aber ich bin Leser der Bibliothek. Da brauche ich auch nichts für die Bücher bezahlen.“
„Aber in der Bibliothek kannst du nicht jedes Buch ausleihen. Viele der Bücher, die ich besitze, wirst du in der Bibliothek umsonst suchen. Alle Bücher, die drüben veröffentlicht werden, findest du hier in keiner Bibliothek. Sie sind nämlich verboten. Und ich habe viele solcher verbotenen Bücher.“
Die Klingel unterbricht Wolfgangs Wortschwall.
„Das werden sie sein. Ich gehe nach unten um zu öffnen“. Kurz darauf taucht Wolfgang mit zwei Jungen auf, die etwas älter als er und Thomas sind, aber auch die 28. Grundschule besuchen.
„Ihr kennt euch ja alle“, stellt sie einander Wolfgang vor.
Die Jungen unterhalten sich über das Fernsehprogramm und über Filme, die Thomas nicht kennt. Seine Eltern besitzen keinen Fernsehapparat. Sie tauschen ihre Gedanken aus über ihre Englisch-, Französisch- und Lateinstunden, die sie bei Privatlehrern erhalten. Sie sind sich einig darüber, dass die Kenntnis von Fremdsprachen notwendig sei, um im späteren Berufsleben Karriere machen zu können. Thomas kommt aus dem Staunen nicht heraus. Die Jungen haben klare Vorstellungen von ihrer Zukunft, sie wissen genau, welchen Beruf sie einmal ergreifen wollen. Thomas weiß noch nicht, was er einmal werden soll, er weiß nur, dass er keinen Handwerksberuf erlernen wird, weil er zwei linke Hände hat, wie seine Eltern immer wieder betonen. Die Jungen wechseln das Thema. Sie sprechen über Musik, über ihren Klavierunterricht. Thomas kennt keine Noten, er weiß nicht, was ein Notenschlüssel ist. Der Begriff Partitur ist ihm fremd. In der Gemeinschaft dieser Jungen fühlt er sich nicht wohl. Die Gründe kann er nicht in Worte fassen, weil er nicht einmal die Ursachen für dieses unaussprechliche Unbehagen kennt. Ihn bedrängt die Vorstellung, diesen Jungen weit unterlegen zu sein.
Nach dem Abendbrot wird gespielt. Auch Wolfgangs Eltern beteiligen sich daran. Nach dem Allgemeinwissen wird gefragt. Wann welcher Dichter geboren oder gestorben ist oder beides, welche Werke er geschrieben hat, Zahlen und Ereignisse aus der Geschichte stehen im Mittelpunkt, aber auch die Kenntnisse in den Naturwissenschaften werden geprüft. Thomas bildet mit Abstand das Schlusslicht. Er spürt, wie eine große Traurigkeit in ihm aufsteigt, er muss die Tränen unterdrücken.
Es ist dunkel, als er sich von Wolfgang, dessen Eltern und Wolfgangs Freunden verabschiedet. Die Straßenlaternen weisen ihm den Weg. Er lässt die Märchenwiese hinter sich zurück, in der Wolfgang und dessen Freunde zu Hause. sind. Eine tiefe, fast unheimliche Stille umgibt Thomas. Die Grundstücke hinter den mit dichten Hecken bewachsenen Zäunen grenzen Thomas aus, gewähren ihm keinen Einblick. Hier ist er ein Fremder. Die Märchenwiese gehört Wolfgang und dessen Freunden.
Einsam sucht sich Thomas seinen Weg, seine Gedanken kreisen um sein Nichtwissen. Er überlegt, wie er sich auch dieses Wissen und noch anderes Wissen, das Wolfgang und dessen Freunde nicht haben, aneignen kann. Er sucht nach Möglichkeiten, wie er diese Zielstellung verwirklichen kann.
Am Ende der Sommerferien erhält Thomas einen Brief. Die Briefmarke auf dem Umschlag signalisiert ihm, woher der Brief kommt. Die Schrift auf dem Umschlag ist ihm vertraut. Wolfgang meldet sich. Thomas liest den Brief mehrmals, bis er versteht, dass er Wolfgang nie wieder sehen wird. Wolfgang hat mit seinen Eltern die Märchenwiese verlassen. Andere folgen ihnen. Auch Wolfgangs Freunde mit ihren Eltern nehmen Abschied von der Märchenwiese, lassen zurück den Garten, das Haus, die Möbel, vielleicht auch die vielen Erinnerungen. Thomas stellt sich die Frage, warum seine Eltern bleiben. Sie besitzen kein Haus mit einem großen Garten. Er fragt seine Eltern nach dem Grund, nur erhält er keine Antwort.
Nikolai hält inne, denkt nach. Oft hat der Großvater den Namen Wolfgang erwähnt. Nikolai erinnert sich. Einmal hat ihm der Großvater erzählt, dass er diesem Wolfgang im Leipziger Schauspielhaus begegnet sei, als er Student war. Höchst überrascht sei er gewesen, als er erkennen musste, dass Wolfgang von Statur kleiner war als er. Und dann hatte ihm der Großvater die Geschichte erzählt, als er noch gemeinsam mit seinen Eltern in der Hofer Straße im Meyerschen Viertel gewohnt hatte. Bis in alle Einzelheiten hatte sich ihm dieses Bild eingeprägt.
Es klingelt. Er öffnet die Wohnungstür und vor ihm steht ein schick gekleideter, junger Mann, fast zwei Köpfe größer als er. Thomas ist überrascht und verwirrt zugleich. Er erkennt sofort den vor ihm stehenden Riesen in dem modernen Anzug, dem weißen Hemd, der Krawatte, deren Farbe er nicht kennt. Den Mantel trägt er offen. Der Kragen ist hochgeschlagen. Der Besuch aus dem Westen überreicht ein Buch. „Schach von Wuthenow“ heißt es. Wolfgang lädt seinen ehemaligen Klassenkameraden Thomas ein, ihn in der Märchenwiese zu besuchen. Thomas folgt der Einladung. Er zieht sich schick an: die neuste Trainingshose mit Reißverschlüssen rechts und links außen an den Beinen, sein Sonntagshemd und den Wintermantel, der zwar viel zu warm für die Jahreszeit ist, aber er war fast wie neu, als er ihn von seinem älteren Cousin erhielt. Auf dem Weg zur Märchenwiese wird ihm unangenehm warm in diesem Mantel, aber Thomas weiß, wer schön sein will, muss leiden. Ganz deutlich kann er sich an diesen Satz seiner älteren Schwester Helga erinnern. Und nun leidet er auf dem langen Weg zu Wolfgang, wundert sich dabei, dass die Menschen, denen er begegnet, recht sonderbar lächeln.
Viele Jahre mussten vergehen, bis sie sich im Leipziger Schauspielhaus gegenüberstehen. Und nun überragt Thomas um einige Zentimeter den Schulfreund von einst. Wolfgang hatte den Kontakt abgebrochen. Thomas hatte noch zwei Briefe geschrieben, die der schreibgewandte Schulfreund von einst nicht beantwortete. Mutter Boronski sagte nur: Aus den Augen aus dem Sinn! So ist das Leben, mein Junge. Trauere ihm nicht nach. Noch oft wird es dir so im Leben ergehen, dass Freunde einfach so verschwinden. Ihnen musst du keine Träne nachweinen. Sie waren eben keine Freunde, nur Bekannte, die dich eine Wegstrecke in deinem Leben begleitet haben.“ Nur kurz und knapp unterhalten sie sich. Wolfgang ist diplomierter Philosoph, hat in Frankfurt und Hamburg studiert, schreibt an seiner Doktorarbeit. Was Thomas macht, will er gar nicht wissen. Persönlich sind sie sich nicht wieder begegnet.
Nikolai erinnert sich, dass der Großvater später im Zeitalter der Computer ihm erzählte, dass er dem Namen seines Freundes aus fernen Kindertagen im Internet begegnet sei. Philosophie gehörte zu den Hobbies des Großvaters. Lachend hatte er dem Enkel die Geschichte zum Besten gegeben: „In Hanau war es gewesen. An der Berufsfachschule. Wir lehrten beide in den Klassen der künftigen Erzieherinnen und Erzieher. Wir saßen im Lehrerzimmer, und ich gab meinem Affen Zucker, ließ mich über Gott und die Welt aus. Er lachte über meine Späßchen, fragte, ob ich Philosoph sei. Natürlich, sagte ich. Nur für einen Philosophen sei die Welt erträglich, vorausgesetzt er hat als Individuum die für ihn einzig und allein gültige Philosophie entdeckt. Viele Philosophen gibt es, demzufolge auch viele Philosophien. Dagegen sei nichts einzuwenden, solange diese Philosophen keinen Schaden anrichten und ihre Mitmenschen bekehren wollen. Der junge Kollege offenbarte sich dem Großvater. Er sei studierter Diplom-Philosoph, aber trotz seines bombastischen Abschlusses hätte er keine Anstellung gefunden. Da er nicht als Taxifahrer wie andere einstige Kommilitonen arbeiten wollte, manche von denen hätten gar promoviert, hätte er sich für das Fach Deutsch als Fremdsprache entschieden und eine weitere Zusatzausbildung absolviert und ein weiteres Stück Papier mit Auszeichnung erworben. Großvater nannte ihm den Namen seines einstigen Klassenkameraden aus den fernen Kindertagen. Für den Diplom-Philosophen war der Name kein Begriff. Großvater belehrte ihn, dass sein einstiger Freund nunmehr die Titel Professor und Doktor habe und eine private Lehranstalt in der Schweiz. Der zum Berufsschullehrer mutierte Diplom-Philosoph winkte ab und sagte: Vielleicht hat ihr einstiger Freund Glück und kann seine Philosophie gewinnbringend auf dem Bildungsmarkt verhökern. Jedenfalls für mich ist er kein Begriff. Noch nie habe ich von ihm gehört. Großvater nahm im Internet oft Kontakt mit seinem ehemaligen Klassenkameraden auf, der völlig vergessen hatte in seiner Vita die Wurzeln seiner Herkunft anzugeben. Er hatte das Land der aufgehenden Sonne in seiner Entwicklung völlig ausgeblendet, mit keinem Wort erwähnt, als hätte dieses Land nie existiert. Nun war der Großvater tot. Nikolai nimmt sich vor über das Internet zu prüfen, ob dieser Dekan, der für ihn kein Begriff ist, noch unter den Lebenden weilt. Jetzt will er erst einmal weiter lesen. Das Wetter ist geradezu ideal dafür. Draußen regnetes in Strömen.
Thomas kennt die Frau, die im Hausflur liegt. Er kennt nicht den Namen dieser Frau, er kennt sie nur vom Ansehen und weiß, dass sie oft betrunken ist und dann nicht den Weg zu ihrer Wohnung im dritten Stock findet. Mit ihrem Hund, einem Boxer, bewohnt sie eine Wohnung, die einen kleinen Korridor hat. Der Hund begleitet die Frau immer, auch wenn sie nüchtern ist. Wenn die Frau nüchtern ist, sitzt sie auf einer der Bänke in der Nähe des Spielplatzes und schaut den Kindern zu. Die Kinder haben sich an den Anblick der Frau gewöhnt. Sehr dünn ist sie, geradezu zerbrechlich und sehr klein. Der Hund wirkt riesig neben ihr. Die Haut ihres Gesichtes ist fahl. Ihre Haare sind schneeweiß. Manchmal, nicht immer zittern ihre Hände. Die Kinder mögen sie, weil sie nie schimpft. Sie sagt überhaupt nie etwas. Oft schenkt sie den Kindern Süßigkeiten. Wenn sie sie verteilt, streichelt sie zärtlich über den Kopf der Kinder. Selbst die Kleinsten der Kleinen wagen sich an ihren riesigen Boxer heran und kuscheln sich an sein weiches Fell. Ruhig bleibt der Hund, wenn die Kleinen ihn mit Zärtlichkeiten verwöhnen. Geduldig lässt er ihre vielen Streicheleinheiten über sich ergehen.
Inzwischen haben sich viele Schaulustige eingefunden, halten Abstand zu der Frau, die von ihrem Boxer beschützt wird. Friedlich, als wäre sie tot, liegt die Frau da, friedlich, aber die Neugierigen nicht aus den Augen lassend, liegt der Hund neben ihr.
Eine alte Frau, die im gleichen Haus wohnt wie die Frau mit ihrem Boxer, ruft ungeduldig: „Nun tut doch mal etwas, statt hier herumzustehen.“
Ein junger, kräftiger Mann fühlt sich angesprochen. „Man sollte sie hinauftragen“, sagt er, „sonst erkältet sie sich noch auf den Steinstufen.“ Er nähert sich der Frau.
Der Hund lässt ihn nicht aus den Augen. Der junge Mann zögert, wagt wieder einige Schritte nach vorn. Der bis dahin friedlich daliegende Hund erhebt sich, zeigt die Zähne. Der junge kräftige Mann tritt den Rückweg an, dabei verkündet er laut: „Ich bin doch nicht lebensmüde.“
„Der Dürre muss her!“, meldet sich eine Frau in mittleren Jahren zu Wort.
Der Dürre wird geholt. Sonst trägt er eine Polizeiuniform. Alle im Viertel wissen, er ist ein hohes Tier bei der Polizei, er muss keine Streife gehen.
Der Dürre erscheint. Ohne zu zögern geht er auf den Hund zu, der sich bei seinem Anblick erhebt, den Dürren schwanzwedelnd begrüßt, die Zähne dabei zeigt, aber so, als wolle er lächeln.
Der Dürre, der noch dazu klein ist, streichelt den Hund, flüstert ihm etwas Freundliches zu; dann hebt dieser schmächtige, unscheinbare Mann die kleine, schmächtige, unscheinbare Frau in die Höhe, nimmt sie in die Arme wie ein Baby und trägt sie die Stufen hinauf. Unauffällig unaufdringlich folgt ihnen der Hund.
Eines Tages ist die schmächtige unscheinbare, kleine, weißhaarige Frau aus ihrer großen Wohnung verschwunden. Alle wissen genau, sie ist nicht nach dem goldenen Westen gegangen; aber wohin sie gegangen ist, weiß auch niemand genau. Die Leute reden, ohne zu wissen. Nur alle wissen, nachdem sie fortgezogen ist, dass sie eine Jüdin war, die als einzige ihrer Familie das Konzentrationslager überlebt hat. Auch soll sie eigene Kinder gehabt haben. Im Viertel konnte sich das keiner vorstellen.
Am Sonntag zieht es die Familie Boronsky in die Natur. Außerhalb der Stadt gibt es Wäldchen, Felder, Wiesen, Teiche, kleine Seen. Familie Boronsky liebt besonders das Oberholz, das mit der Straßenbahnlinie 15 zu erreichen ist. Von Liebertwolkwitz aus führt der Weg zwischen Feldern entlang direkt bis in diese Oase der Maikäfer.
Thomas ist überzeugt; nirgends in der Welt gibt es so viele Maikäfer wie hier. Nur beginnt und endet die Welt für Thomas in Leipzig und Umgebung.
Die Zeit der Maikäfer ist vorbei. Jetzt ist die Zeit der Pilze gekommen. Weit auseinandergezogen durchkämmt die Familie den Wald. Thomas hört die Stimme seiner Schwester. Freudig erregt klingt sie. Thomas läuft auf die Stimme zu.
Und da stehen seine Eltern, seine Schwester Gisela und ein Mann und eine Frau.
Thomas nähert sich ihnen. Jetzt erkennt er den Mann, obwohl dieser Mann sich sehr verändert hat. Der Mann trägt einen Hut und keine Mütze wie Vater Boronsky. Zwischen dem geöffneten Mantel schiebt sich ein Bauch hervor. So ein Bauch fehlt auch Vater Boronsky.
Thomas sagt immer: Mein Vater kann ja gar keinen Bauch bekommen, weil er mit dem Körper arbeitet und hinter keinem Schreibtisch sitzt.
Mit den Worten - „das ist ja der Onkel Erich!“, - stürmt Thomas auf die Gruppe zu. Der Junge stellt fest: Onkel Erich hat sich wirklich verändert. Er ist ein Herr geworden. Nicht nur der Hut gibt darüber Auskunft, sondern sein Anzug, das Hemd, die Krawatte, seine Art, wie er spricht.
„Aus Kindern werden Leute“, sagt der Onkel Erich.
Bei diesen Worten verzieht seine Frau ihre schmalen Lippen zu einem schmalen Lächeln. In ihrem Kostüm mit der rosafarbenen Bluse und den Sauerstoff blonden Haaren sieht sie aus wie eine der Damen aus einer Modezeitschrift. Sie erinnert Thomas an Frau Schlundt. Nicht, dass sie wie Frau Schlundt aussieht, im Gegenteil, so attraktiv sah bestimmt Frau Schlundt in ihren attraktivsten Jahren nicht aus, sondern weil sie auch so dünn und lang ist.
Onkel Erich erzählt. Er arbeitet wieder in seinem alten Beruf. Er ist bei der Post tätig - in gehobener Position, fügt die Frau hinzu.
Thomas weiß jetzt, dass er nicht an irgendeinem Schalter sitzt, sondern einen eigenen Schreibtisch besitzt mit Sekretärin.
Immer wieder stellt Thomas fest, wie sich die Leute verändern mit den Jahren. Nur seine Eltern verändern sich nicht. Sein Vater arbeitet immer noch in einer Schlosserei und seine Mutter aushilfsweise als Verkäuferin in einem Bäckerladen.
„Wir haben uns auch verändert“, sagt der Vater, „wir sind umgezogen - in eine größere Wohnung. Die Wohnung war zu eng geworden.“
„Wir sind aber im Viertel geblieben“, fügt Mutter Boronsky hinzu.
„Wir wohnen hier ganz in der Nähe“, sagt Onkel Erich, der eigentlich gar nicht mehr der Onkel Erich ist, der er einmal war - der Kriegsheimkehrer und Untermieter von Frau Schlundt. „In Liebertwolkwitz haben wir ein kleines Häuschen erworben. Mitten im Grünen steht es zwischen Obstbäumen und Sträuchern.“
„Erich, jetzt müssen wir aber weiter“, drängelt seine Frau, „sonst wird es zu spät mit dem Mittagessen.“
„Ja, mein Hildchen.“ Die Stimme von Onkel Erich klingt sanft und weich. Dabei streichelt er ihre Hand.
So etwas tut Vater nie, stellt Thomas fest.
„Dann wollen wir uns verabschieden“, sagt der Onkel Erich und reicht den Borowskis zum Abschied die Hand.
„War mir ein Vergnügen, sie alle kennen zu lernen“, flötet Hildchen.
Thomas zweifelt an dem Vergnügen von Hildchen; er hat eher den Eindruck, dass sie nichts von der Familie Boronsky hält, dass sie, wenn es nach ihr gegangen wäre, jedes Gespräch mit dieser Familie vermieden hätte. Onkel Erich ist eben ein feiner Mann geworden.
Als Onkel Erich und Hildchen außer Sichtweite sind, sagt Frau Boronsky zu ihrem Mann: „Wie hat sich nur dieser Mann verändert. Hast du seinen Anzug gesehen, das Hemd, die Krawatte, die Schuhe. Und wie läufst du herum. Man muss sich richtig schämen.“
„Ich bin eben nicht so ein feiner Pinkel“, verteidigt sich Vater Boronsky, „ich mag nun eben mal keinen Schlips. Der drückt mir nur die Luft ab. Und ersticken will ich nicht. Außerdem gehen in so einem Aufzug nur Sesselpfurzer.“
„Wir gehen nie essen“, meldet sich Gisela zu Wort, „und dabei würde ich so gerne in einer Gaststätte essen.“
„Wir können uns solchen Luxus nicht leisten“, unterbricht sie der Vater.
Vorbei ist es mit der Pilzesucherei. Jeder hängt seinen eigenen Gedanken nach. Thomas denkt über die Ungerechtigkeit dieser Welt nach.
Ohne Schwierigkeiten erhält Thomas von der Schule und der Schulbehörde die Genehmigung für den Besuch der Erweiterten Oberschule. Einige seiner Klassenkameraden, deren Väter Ärzte oder selbständige Handwerker sind, werden abgelehnt.
„Wir können nur die Besten schicken“, sagt der Lehrer Herr Sanftmut.
Wer sind nun die Besten? Bei dem Ausleseverfahren merkt Thomas, dass die Besten nicht unbedingt die Klügsten, Intelligentesten, Fleißigsten, Strebsamsten sein müssen. Persönlich sucht der Klassenleiter die Eltern von Veronika auf, wobei Veronika längst nicht so leistungsstark ist wie Michael oder Bernd. Dafür ist aber Veronika ein Mädchen, und ihr Vater ist obendrein noch von Beruf Dreher.
Veronikas Vater gehört wie Vater Boronsky zur Arbeiterklasse. Michaels Vater dagegen und noch so manche andere Väter sind Angehörige der Intelligenz oder gar Unternehmer oder selbständige Handwerksmeister.
„Wir müssen die Arbeiterklasse fördern“, betonen immer wieder die Lehrer.
Umso überraschter ist Thomas, als er zu Schuljahresbeginn einige ehemalige Mitschüler wieder trifft, von denen er genau wusste, dass sie abgelehnt worden waren. Von ihnen erfährt er auch, dass einige der Abgelehnten den altsprachlichen Zweig wählten und nun die Thomas-Oberschule besuchen.
„Ich verstehe das nicht“, sagt Thomas zu Michael, „erst lehnen sie dich ab, weil dein Vater Angehöriger der Intelligenz ist und jetzt bekommst du die Erlaubnis.“
„Eben deshalb, weil mein Vater Angehöriger der Intelligenz ist.“ Ein vielsagendes Lächeln huscht über Michaels Gesicht. „Was wäre dieses Land für ein Land ohne seine über viele Generationen gewachsene Intelligenz? Die Intelligenz, die sie gerade dabei sind zu züchten, ist augenblicklich nicht einsatzbereit; inwieweit später, nun das wird sich zeigen. Augenblicklich sind sie noch von solchen Männern abhängig, wie mein Vater einer ist.“
„Und dieser Abhängigkeit hast du dein Hiersein zu verdanken?“ Thomas irritiert die Selbstsicherheit, die Michael ausstrahlt.
„So kannst du es nennen. Bestimmt wirst du auch noch im Leben nach Lösungen suchen müssen, um zu deinem Ziel zu gelangen.“
„Auch ich habe schon nach Lösungen suchen müssen“, verteidigt sich Thomas, „damals, als ich konfirmiert werden sollte, aber auch die Jugendweihe über mich ergehen lassen musste, sonst wäre ich nicht auf die Erweiterte Oberschule gekommen. Ich hatte Glück, unser Pfarrer war freundlich. Die Konfirmation folgte einige Wochen nach der Jugendweihe. Manche Pfarrer zeigten aber für die Probleme der Jugendlichen und deren Eltern kein Verständnis, entweder weigerten sie sich zu konfirmieren, wenn die Jugendweihe auch erfolgen sollte, oder aber zwischen Jugendweihe und Konfirmation musste ein Jahr dazwischen liegen. Während dieser Zeit musste der Jugendliche regelmäßig den Konfirmationsunterricht und die Kirche besuchen.“
Michael lächelt erhaben, während er sagt: „Oder der Jugendliche musste auf die Jugendweihe verzichten, die Konsequenzen tragen, damit rechnen, nicht den Besuch der Erweiterten Oberschule genehmigt zu bekommen. Wie ich zum Beispiel.“
„Aber da sie von deinem Vater abhängig sind, blieb dir der Weg zur Oberschule nicht verschlossen. Von meinem Vater ist niemand abhängig, deshalb musste ich das tun, was verlangt wurde, sonst wäre mir der Weg zur Oberschule versperrt geblieben. Wir als Familie sind von denen abhängig, die das Sagen haben.“ Thomas begreift mit einem Male, welche Wertigkeit die einzelnen Menschen haben, auch wenn in der Schule gelehrt wird, alle Menschen haben die gleichen Rechte und Pflichten im Arbeiter- und Bauernstaat.
Thomas ist stolz auf sich. Für die Leipziger Oper hat er zwei Karten für ‚Carmen‘ erstanden. Seine Mutter wird sich über den gemeinsamen Theaterabend freuen; gleichzeitig erinnert er sich an sein erstes Theatererlebnis mit ihr.
„Heute Abend gehen wir beide ins Theater“, sagt Frau Boronsky zu ihrem Sohn.
„Wir beide ganz allein?“ Ungläubig schaut Thomas seine Mutter an.
„Du hast richtig gehört, mein Sohn. Wir beide gehen ganz allein.“
„Und Vater! Und Gisela! Warum gehen sie nicht mit?“
„Deine Schwester interessiert sich nicht dafür. Und dein Vater erst recht nicht.“
„Bist du nie mit Vater im Theater gewesen? Ich meine, als ihr jung gewesen seid.“
„Dein Vater ist nie richtig jung gewesen. Einmal war ich mit ihm im Theater! Nie werde ich diesen Theaterabend vergessen! Nie! Ich habe mich so blamiert gefühlt. Und das alles nur wegen ihm. Stell dir vor, mein Junge! Wir waren in der Oper. ‚Carmen‘ wurde gegeben. Ich war so begeistert von dem Stück. Mir standen vor Rührung die Tränen in den Augen. Diese unsterbliche, diese schöne Musik! Mal temperamentvoll, mal traurig, mal schwermütig, mal heiter! Diese Oper ist ein Ohrenschmaus. Das kannst du mir glauben. Und was tut dein Vater? Er schläft. Seine Augen hält er fest geschlossen. Und sein Mund ist leicht geöffnet. Mich ergreift eine Panik. Wenn er jetzt anfängt zu schnarchen. Welche Blamage! Mit meinem linken Arm versetzte ich ihm einen heftigen Stoß. Erschreckt reißt er die Augen auf, wirft mir einen bösen Blick zu. Kannst du dir vorstellen, was er dann sagt? Er sagt: „Ich genieße die Musik.“ Er und die Musik genießen! Dass ich nicht lache ...! Geschlafen hat er. Neben uns macht es pst. Von da an hält er die Augen offen. In der Pause schimpft er, weil ihm der Schlips angeblich die Luft abwürgt. Und auf meine Frage, wie ihm das Stück gefällt, antwortet er: Die Kerle, damit meint er die Soldaten auf der Bühne, können nicht mal richtig Gleichschritt halten. Denen fehlt eine richtige Exerzier-Ausbildung, mosert er weiter. Kein Wort verliert er über die wunderbare Musik, über die unsterblichen Melodien! Kein Wort! Kannst du dir das vorstellen?“
Der erste gemeinsame Theaterabend mit ihrem Ehemann ist gleichzeitig der letzte gemeinsame Theaterabend mit ihrem Ehemann im Leben der Frau Boronsky.
„Wenn wir durchs Viertel gehen und jemanden Bekanntes treffen, sagst du ihnen nicht, wohin wir gehen. Du kannst mir glauben, sie werden uns fragen, weil wir uns so schick gemacht haben.“
Als Mutter Boronsky mit ihrem Sohn, aufgemotzt und angehübscht, das Viertel durchschreitet, bleiben die von ihr erwarteten Fragen nicht aus.
„Ei, ei, Mutter und Sohnemann! Wo soll es denn hingehen?“
„Fort! Wir gehen einfach fort!“ Thomas staunt über seine Mutter. Sie übertrifft jede seiner Erwartungen.
„Und Gisela? Und der Vater?“
„Sie hüten das Haus!“
„Was macht denn eigentlich ihre Große? Wir haben sie lange nicht mehr zu Gesicht bekommen.“
„Helga geht es sehr gut. Danke der Nachfrage.“
„Stimmt es, was die Leute tuscheln?“
„Ich weiß nicht, was die Leute tuscheln. Nur wir haben jetzt keine Zeit ...“ Und Mutter Boronsky lässt die Fragesteller einfach stehen. Gemeinsam streben Mutter und Sohn der Straßenbahnhaltestelle entgegen.
Bisher war Thomas nur in Schulveranstaltungen im Kinder- und Jugendtheater gewesen. Jetzt zum ersten Mal in seinem Leben betritt er das Theater für Erwachsene, das Schauspielhaus.
Feierlicher und viel gewaltiger wirkt auf ihn das Innere des Schauspielhauses in der Bosestraße als der Weiße Saal des Kinder- und Jugendtheaters am Zoo.
„Wie heißt eigentlich das Stück, das wir uns ansehen“, fragt Thomas seine Mutter.
„Der junge Gelehrte“! Und der Dichter, der dieses Stück geschrieben hat, heißt Lessing. Vor 200 Jahren hat er gelebt.“
„Und da wird es noch immer gespielt?“
„Richtige, echte Kunst, mein Junge, ist unsterblich. Sie ist unvergänglich. Sie ist nicht mehr wegzudenken.“
Thomas versteht, er muss Dichter werden, wenn er unsterblich werden will. Noch ist Thomas sich im Unklaren, ob er das eigentlich will, unsterblich zu sein. Er denkt an die Schule, an die armen Schüler. Wieder müssten sie sich mit einer weiteren Biografie und dem Werk eines Dichters beschäftigen.
Sie sitzen auf der letzten Reihe.
„Von hier aus sieht man sehr gut. Und wenn die Schauspieler deutlich und klar sprechen, ist hier auch jedes Wort zu verstehen“, Mutter Boronsky ist sehr zufrieden mit den Plätzen in der Mitte der letzten Reihe.“
Thomas schaut sich im Saal um. Von den Leuchtern mit den vielen hellen Glaskugeln ist er begeistert. Nicht nur er und Mutter sind festlich gekleidet, sondern alle hier im Saal. Manche Frauen tragen Kleider, die sicher ein Vermögen gekostet haben, denkt der Junge. Solche Kleider hat er bisher noch nie in seinem Leben gesehen.
Ein Gong ertönt, wird mehrmals wiederholt. Langsam verlischt das Licht im Saal. Thomas spürt in sich eine seltsame Feierlichkeit, eine ihm bisher unbekannte Freude und Neugierde. Langsam, geradezu bedächtig öffnet sich der Vorhang. Die bis dahin dunkle Bühne wird in ein mildes Licht getaucht. Thomas erblickt in diesem schummrigen Licht eine Wohnungseinrichtung, die sicher zu Lebzeiten des Dichters einmal modern war. Ein junger Mann erscheint auf der Bühne in einer Bekleidung, die vielleicht vor 200 Jahren der neuste Schrei war. Und dann beginnt der junge Mann zu sprechen.
„So spricht kein normaler Mensch, denkt Thomas. Vielleicht haben die Menschen vor 200 Jahren so gesprochen. Vielleicht ändert sich nicht nur die Mode, sondern auch die Sprache. Wenn ich mit meinen Freunden so spreche, denken sie, ich bin nicht richtig im Kopf.“
„Ein ausgezeichneter Sprecher, ein vorbildlicher Sprecher, flüstert ihm die Mutter zu. So musst du sprechen, mein Junge. Jedes Wort spricht er klar und deutlich aus. Keine Silbe verschluckt er. Nimm dir an ihm ein Beispiel und nuschle nicht länger.“
„Pst!“ machte eine Stimme in ihrer unmittelbaren Umgebung.
Je länger Thomas das Spiel auf der Bühne verfolgt, desto mehr findet er daran Gefallen. Schauspieler muss ein schöner Beruf sein, denkt er. Jeden Tag bist du ein anderer Mensch. Jeden Tag trägst du ein anderes Kostüm. Das Leben eines Schauspielers ist bestimmt nie langweilig.
Als Mutter und Sohn nach der Vorstellung zur Straßenbahnhaltestelle gehen, erzählt ihm die Mutter vom Theater. Damals war sie jung und noch nicht verheiratet. Sehr oft ist sie abends ins Theater gegangen.
„Damals im Alten Schauspielhaus - das stand dort, wo heute der freie Platz vor dem Kaufhaus Brühl sich befindet - gab es noch Stehplätze, erzählt ihm die Mutter. Diese Plätze waren sehr preisgünstig. Von dort oben hatte man eine vorzügliche Sicht. Das ganze Theater war zu überblicken. Die guten Schauspieler waren selbst noch auf dem Olymp, wie die Stehplätze scherzhaft genannt wurden, zu verstehen. Keine Silbe wurde verschluckt. Klar und deutlich wurde gesprochen, wiederholt die Mutter. Dem Martin Flörchinger, den hast du bestimmt schon in Kinofilmen gesehen, bin ich hier zum ersten Mal begegnet. Gut und vornehm sah er damals aus, als er noch jung war. Da war er noch nicht so verfettet wie jetzt. Damals hatte er Profil, schwärmt die Mutter weiter. Und ein Sprecher war er! Seine Worte waren selbst auf dem Olymp klar und deutlich zu hören. Keine Silbe verschluckte er. Es war ein Ohrenschmaus, ihm zuzuhören. Ja, ja, sagt die Mutter, die Zeiten haben sich geändert. Das Alte Schauspielhaus gibt es nicht mehr. Im Kriege wurde es zerstört. Sinnlos zerstört wie so vieles. Das schöne Schauspielhaus! Nun ist es von der Bildfläche verschwunden. Wie so vieles! Alles hat sich verändert. Damals bekamen die Schauspieler Blumen überreicht. Und heute? Nichts ist mehr so, wie es einst war. Alles ist anders geworden, aber nicht schöner.“