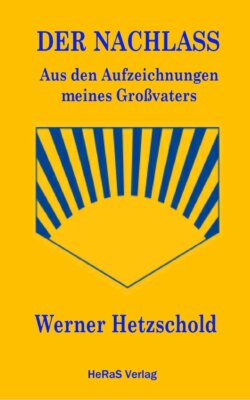Читать книгу Der Nachlass - Werner Hetzschold - Страница 6
3
Оглавление„Am Sonntag findet ein Friedensmeeting statt. Ich erwarte, dass mein Klasse als eine geschlossene Einheit auftritt.“ Dynamisch und forsch ist das Auftreten des jungen Klassenleiters, der in seiner neunten Klasse Deutsch und Russisch unterrichtet. Besonders die Mädchen mögen ihn.
„Das ist ein toller Mann“, sagen viele, und dabei denken sie sicherlich an seine blonden Locken und die blauen Augen.
Erst vor wenigen Tagen sagte Michael: „Blondi wird es noch weit bringen. Gerade erst von der Universität gekommen und gleich an eine Erweiterte Oberschule versetzt worden. Das kommt nicht oft vor. Die meisten Absolventen dürfen sich erst an einer Polytechnischen Oberschule bewähren, auch wenn sie das Bonbon tragen. Sag bloß, Thomas, du weißt nicht, was ein Bonbon ist. Dann will ich es dir sagen: Ein Bonbon ist ein spezielles Parteiabzeichen, nämlich das der SED.“
Am Sonntagvormittag findet sich eine unvollständige neunte Klasse auf dem Schulhof ein. Thomas vermisst Michael. Kurz vor dem Abmarsch schreibt Blondi für alle Anwesenden sichtbar die Namen der fehlenden Schüler seiner Klasse in sein Notizbuch.
„Mit denen werde ich ein ernsthaftes Wort reden“, teilt er lautstark den Anwesenden mit. „Sie werden begründen müssen - schriftlich -, warum sie nicht zu unserem Friedensmeeting erschienen sind. Ich denke, ihr seht das genauso wie ich. In unserer Gesellschaft kann doch nicht jeder gerade das tun, was ihm einfällt. Wo käme unser Arbeiter- und Bauernstaat wohl hin, wenn jeder nur an sich selbst denkt, nur auf sein persönliches, sein individuelles Wohlergehen bedacht ist. Ich freue mich, dass ihr die gleiche Einstellung habt wie ich und sie auch nach außen hin dokumentiert, indem ihr voller Stolz euer blaues FDJ-Hemd tragt. Auch ich bin stolz auf mein FDJ-Hemd und trage es zu solchen feierlichen Anlässen wie dem heutigen.“
Als geschlossene Formation marschiert die Schule klassenweise durch die Straßen. Thomas ist froh, dass er keine Fahne tragen muss. Fast wäre er dazu auserkoren worden, aber zum Glück finden sich noch einige Freiwillige, die Pluspunkte sammeln wollen. Thomas taucht in der Mitte der Marschkolonne unter, um möglichst nicht erkannt zu werden. Jeder Aufmarsch ist ihm zuwider. Blondi verteilt Zettel. Auch Thomas bekommt einen in die Hand gedrückt. Darauf steht mit der Schreibmaschine geschrieben: Wir wollen Frieden auf lange Dauer, nieder mit Strauß, nieder mit Adenauer, wir wollen keine Kriegsbarone, wir wollen die atomwaffenfreie Zone.
„Achtung!“, brüllt Blondi, „sprecht im Chor nach: Wir wollen Frieden auf lange Dauer ...!!!
Thomas kapselt sich ab, versucht an etwas Schönes zu denken, versucht die Gegenwart zu vergessen, die ihn so ängstigt.
Thomas steht vor dem großen Gebäude der Leibniz-Oberschule. Unschlüssig ist er, zögert, ob er das Haus betreten soll oder nicht. Noch ist Zeit. Einen flüchtigen Blick wirft er auf seine Uhr, einen weiteren hinüber zur Nordkirche. Noch hat er Zeit, ausreichend Zeit. Er zieht es vor, sich noch einen Augenblick von der Septembersonne wärmen zu lassen. Während er noch vor der Schule ausharrt und sich den Sonnenstrahlen überlässt, beobachtet er, wie immer mehr Menschen, junge und alte, in das Gebäude strömen. Heute ist Semesteranfang. Thomas hat auch einen Lehrgang an der Volkshochschule belegt.
Der Junge betritt das Gebäude. Gleich im Treppenhaus empfangen ihn riesige Tafeln, auf denen die Lehrgänge und die Zimmernummern angegeben sind. Wie viele andere auch sucht er nach seinem Lehrgang und dem Raum auf den Tafeln, ist glücklich, sie endlich gefunden zu haben. Er steigt Treppen hinauf, folgt langen Gängen. Wie die Humboldt-Oberschule so ist auch die Leibniz-Oberschule ein ehrwürdiger Bau mit Geschichte und Tradition. Wie die Geschichte ändert sich auch die Tradition: Zuerst wurden Gymnasiasten im humanistischen Zeitgeist ausgebildet, dann die geistige Elite des Deutschtums und jetzt erstmals die künftige Intelligenz des ersten Deutschen Arbeiter- und Bauernstaates in der deutschen Geschichte.
Nun steht Thomas vor dem angegebenen Raum. Weit geöffnet ist die Tür. Am Lehrertisch sitzt eine ältere Dame. Sofort bemerkt sie Thomas, fordert ihn freundlich auf, Platz zu nehmen. Beim Betreten des Klassenraumes fällt Thomas auf, dass er nicht der Einzige ist, der die deutsche Hochsprache, die deutsche Hochlautung erlernen möchte. Nicht leicht ist es für ihn, einen noch nicht besetzten Stuhl und Tisch zu finden.
Er findet seinen Platz am vorletzten Tisch in der Fensterreihe. Etwa zehn Minuten fehlen noch bis zum Unterrichtsbeginn. Thomas hat Zeit, sich im Raum etwas genauer umzusehen. Gleich fällt ihm auf, dass er einer der jüngsten Teilnehmer ist. Zwei Herren im Anzug mit Glatze erregen seine Aufmerksamkeit und Neugierde. Thomas schätzt ihr Alter zwischen 30 und 40 Jahren; vielleicht sind sie aber jünger und sehen nur so alt aus mit ihrer Glatze. Dann sind noch einige schicke Damen im Raum, die Thomas sehr anziehend findet, obwohl sich die Damen sehr voneinander unterscheiden, das beginnt schon bei der Frisur und der Haarfarbe. Ausgiebig betrachtet Thomas die Dozentin, wie sich die Lehrerinnen der Volkshochschule nennen. Sie erinnert ihn an eine Künstlerin, die sicher schon einmal bessere Tage gesehen hat. Ihre giftblond gefärbten Haare, die lang und glatt bis zu ihren Schultern herab wallen und die sie in der Mitte gescheitelt trägt, stehen im Kontrast zu ihrem faltigen, welken Gesicht mit den roten schlaffen Wangen und dem grellroten Lippen. Wenn sie lächelt, zeigt ihr Mund zwei tadellose weiße Zahnreihen. Ihre Zähne erinnern ihn an Frau Schlundt. Sie trägt ein langes schwarzes Kleid mit einem großen Ausschnitt. Solche Kleider hat Thomas bisher nur bei den Damen im Theater gesehen. Bestimmt kommt sie vom Theater, denkt Thomas, und jetzt arbeitet sie als Dozentin für Sprecherziehung.
Noch zwei Minuten fehlen bis zum Unterrichtsbeginn. Da betritt ein junger Mann den Raum, nicht viel älter als Thomas. Ohne zu zögern steuert er den Tisch von Thomas an.
„Der Platz neben dir ist doch noch frei?“ Die Stimme des jungen Mannes klingt sympathisch.
Thomas nickt ihm freundlich zu. Der junge Mann setzt sich, will gerade etwas zu Thomas sagen. In diesem Augenblick erhebt sich die Dozentin von ihrem Stuhl, strahlt ein breites Lächeln in die Runde, dann beginnt sie zu sprechen: Langsam, deutlich, wohl artikuliert, volltönend.
„Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Lehrgang zwecks Erlangung der deutschen Hochlautung ...“
„Die spricht ja wie die vom Theater“, denkt Thomas. Andächtig verfolgt er ihren Redeschwall.
Dann beginnen die Übungen. Die Dozentin spricht vor, die Teilnehmer müssen im Chor nachsprechen. Dann werden einzelne Teilnehmer aufgefordert, allein vor der Klasse die Übungen zu wiederholen.
Hoffentlich wählt sie mich nicht aus. Vor Aufregung bekomme ich kein Wort heraus.
Die Dozentin muss die Ängste von Thomas erraten haben, denn gerade in dem Augenblick fordert sie ihn auf, allein die Übung nachzusprechen. Thomas hat das Gefühl, seine Kehle wird ihm zugeschnürt, er bekommt keine Luft mehr.
„Nun, junger Mann, sprechen Sie unbesorgt nach. Wir alle sind Lernende. Keiner wird Ihnen etwas tun. Keiner wird Sie auslachen.“ Thomas kämpft mit einem Kloß in seinem Hals. Dann hört er sich sprechen, aber seine Stimme kommt ihm fremd vor, so als hätte er jegliche Kontrolle über sie verloren.
„Keine Angst, junger Mann, das wird noch werden“, beruhigt ihn die Dozentin, „Alle haben einmal irgendwo irgendwann irgendwie angefangen. Nur Mut, junger Mann.“
„Wir Sachsen haben es eben nicht leicht“, flüstert ihm der junge Mann neben ihm zu. „Pfiffig wie wir Sachsen sind, haben wir die Phonetik vereinfacht und auf wenige Laute reduziert, die wir mit dem uns eigenem Charme vortragen. Jeder in der Welt erkennt uns sofort als Deutsche mit dem liebenswerten, unverwechselbaren Akzent.“
Langsam überwindet Thomas seine Scheu vor den Sprechübungen. Bald wiederholt er inbrünstig, was die Dozentin vorspricht. Nun bedauert er nicht mehr, dass er diesen Kurs belegt hat. Er ist stolz auf sich, weil er ohne fremde Hilfe sich für etwas entschieden hat, was ihm Spaß und Freude bereitet und was gleichzeitig sehr nützlich ist, denn richtig zu sprechen kann auf keinen Fall falsch sein.
Nach Unterrichtsende verlässt Thomas gemeinsam mit dem jungen Mann den Raum.
„Ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Ich heiße Volker, besuche die Thomas Oberschule und will einmal Schauspieler werden.“
Wieder bewundert Thomas dieses Selbstbewusstsein, das aber in keiner Weise überheblich auf ihn wirkt, eher wie etwas Selbstverständliches, das erreicht wird. Volker hat ein Ziel vor den Augen, auf das er ohne Hemmungen oder Ängste einfach zugeht und das er verwirklichen wird, weil er von sich überzeugt ist. Er weiß, dass er es schaffen wird, dass er erfolgreich sein wird. Sonst würde er nie, so denkt Thomas, so offen und freimütig darüber reden. Thomas dagegen hütet seine geheimsten Wünsche, niemand soll sie kennen, seine Geheimnisse, Sehnsüchte, Träume.
An der Straßenbahnhaltestelle verabschieden sich die beiden jungen Männer voneinander. Thomas hat das Gefühl, einem Menschen begegnet zu sein, mit dem ihn mehr verbindet als nur Sympathie.
Seine Sprechübungen nimmt Thomas sehr ernst. Täglich übt er, wenn er allein in der Wohnung ist. Selbst auf den Spiegel verzichtet er nicht. Er vergleicht seine Mundstellung mit den Anweisungen, die die Dozentin gegeben hat. Immer wieder wiederholt er Übung für Übung. Gewissenhaft kontrolliert er die Mundstellung. Dabei ermüdet er nicht, im Gegenteil, je mehr er sich mit der Phonetik beschäftigt, desto interessanter wird sie für ihn.
Wieder ist er in seine Übungen vertieft und bemerkt nicht, dass die Mutter die Wohnung betreten hat. Für ihn völlig unerwartet steht sie vor ihm.
„Lass das nicht deinen Vater hören. Der denkt, bei dir hat es ausgesetzt oder du willst mehr sein als wir. Er wird dir sagen, kein Mensch spricht so, zumindest kein normaler Mensch. Erst gestern hat er zu mir gesagt: Ich kann mir nicht helfen, der Junge spricht jetzt anders als früher. Er betont so die Buchstaben, spricht langsamer als sonst, irgendwie völlig anders als früher. Ich habe ihm gesagt: Das bildest du dir nur ein, Karl. So habe ich ihn erst einmal beruhigen können. Aber wie schon gesagt, auch ihm ist es aufgefallen. Und das ist nicht gut. Er braucht nicht alles zu wissen und zu bemerken. Deshalb sei vorsichtig, mein Junge.“
Thomas steht vor dem Mietshaus, in dem Volker wohnt.
Vornehmer sieht das Haus aus und vornehmer ist auch die Wohnlage, stellt Thomas fest, als er dieses Gebäude mit dem Haus vergleicht, in dem er mit den Eltern und Gisela lebt. Vor dem Haus hinter einem schmiedeeisernen Zaun befindet sich ein kleiner Vorgarten mit Sträuchern und Blumen.
Zögernd öffnet Thomas die schwere Eingangstür, steigt die Stufen hinauf bis zur dritten Etage, dabei sieht er sich im Treppenhaus um. Die Farben an den Wänden sind nachgedunkelt, trotzdem sind die Muster noch deutlich zu erkennen. Sie zeigen bunte Vögel und bunte Blumen. Als das Haus noch jung war und die Farben noch frisch, muss das Treppenhaus wie ein kleines Paradies ausgesehen haben. Obwohl dieses Haus hier auch renoviert werden müsste, ist sich Thomas darüber im Klaren, dass Gohlis immer noch vornehmer ist als Stötteritz.
Thomas steht vor einer großen, breiten, reich verzierten Wohnungstür. Wieder zögert er einen Augenblick, ist sich unschlüssig, ob er sich bemerkbar machen soll, dann hat er sich entschieden. Kräftig drückt sein Zeigefinger den Klingelknopf. Wenige Sekunden später wird die Tür aufgerissen. Volker steht vor ihm.
„Junge, willst du die Klingel killen? Nur ganz leicht brauchst du den Klingelknopf zu berühren.“
„Entschuldige bitte“, stammelt Thomas und spürt, wie die Verwirrung ihm die Röte ins Gesicht treibt.
„Nun komm schon rein! Wir sind gerade dabei Kaffee zu trinken. Der Partner meiner Mutter ist auch da.“
Zum ersten Mal in seinem Leben lernt Thomas den Partner der Mutter von einem seiner Freunde kennen, sonst wurden die Männer der Mütter Ehemann, Gatte, Vater, Stiefvater, Freund genannt. Partner klingt gut, findet Thomas, irgendwie modern.
Als Thomas der Mutter seines Freundes gegenübersteht, wird er verlegen. Es ist die Verlegenheit, die über ihn kommt, wenn er mit einem Mädchen spricht, das ihm sehr gefällt und dem er es auch sagen möchte, dass sie ihm gefällt, es sich aber nicht getraut. In diesen Augenblicken ergreift eine Angst von ihm Besitz, die er sich selbst nicht erklären kann; er befürchtet, wenn er zu reden gezwungen ist, dann zu stottern, weil sein ganzer Körper vor Aufregung verkrampft und verspannt ist. Volker hat mit Abstand die jüngste und bestaussehende Mutter von allen Freunden und Schulkameraden. Dieses Urteil steht für Thomas unwiderruflich fest. Wie Volker hat auch die Mutter dunkle, nachdenklich blickende Augen. Ihre dunkelbraunen, leicht gewellten Haare, die bis zu den Schultern reichen und die offenbar nicht gefärbt sind, rahmen ein schmales, ausdrucksvolles Gesicht ein. Ihre Lippen wirken voll und kräftig, auch ohne Lippenstift. Sie reicht Thomas zur Begrüßung die Hand, sagt dabei etwas, was Thomas gar nicht wahrnimmt. So beeindruckt ist er von dieser Frau mit der sanften, angenehm klingenden Stimme, die in den Ohren des Jungen wie Musik sich anhört.
Ihr Partner ist wesentlich älter als sie. Zumindest ist das der Eindruck von Thomas. Vielleicht liegt das daran, denkt Thomas, weil er lange graue Haare hat und einen langen grauen Vollbart.
Die große randlose Brille unterstreicht noch seinen intelligenten Gesichtsausdruck. Auch dieser Mann verfügt über eine Stimme, die Thomas sehr gefällt, weil sie so volltönend und gleichzeitig weich ist.
Nun wird Kaffee getrunken aus Tassen, die Thomas unter der Bezeichnung Sammeltassen kennt. Irgendwie hat sich Thomas den Ausdruck für ihre Farbgebung gemerkt: Kobaltblau. Volkers Mutter fragt Thomas nicht aus, wie das andere Mütter oft tun, die wissen wollen, was seine Eltern beruflich tun, wo und wie sie wohnen, wie viele Geschwister er hat. Sie erkundigt sich nach seinen Interessen, nach seinen beruflichen Wünschen. Dabei blickt sie freundlich lächelnd in die Augen des Jungen. Das verwirrt Thomas, und er hat das Gefühl, sein Gesicht läuft rot an. Auch wird ihm heiß. Er hat Angst, Schweiß könnte sich bilden. Volkers Mutter bemerkt seine Verlegenheit und wendet sich dem Teller mit dem Kuchen zu.
„Thomas - ich darf dich doch bei deinem Vornamen nennen - möchtest du noch ein Stück Kuchen?“
„Gern“. Wie fremd doch meine Stimme klingt! Warum bin ich immer so gehemmt, so verkrampft? Die Frau ist doch einfach eine Wucht! Sie ist so nett, so sympathisch. Und ich! Thomas ist wieder mit sich nicht zufrieden.
„Edelgard, du bringst den jungen Mann noch in Verlegenheit! Während er das sagt, lächelt ihr Partner.“
„Warum sollte Thomas verlegen werden? Ich bin überzeugt, der Junge hat genug Selbstvertrauen. Auch hat er keinen Grund dazu, nicht wahr, Thomas?“
„Der Kuchen schmeckt ausgezeichnet.“ Thomas ist über sich selbst erstaunt, wie schnell ihm dieser Satz über die Lippen gekommen ist.
„Hast du gehört, Johannes? Schmeicheln kann Thomas auch.“
„Edelgard, wir gehen jetzt los. Ich weiß nicht, wann ich zurück sein werde.“
„Habe ich richtig gehört? Volker redet seine Mutter mit dem Vornamen an?“ Wieder ist Thomas überrascht.
Die Ärztin hatte darauf gedrungen: Vater Boronsky musste sich eine andere Arbeit suchen, eine körperlich leichtere.
Vater Boronsky wird Kassenbote. Der Betrieb nennt sich Institut, beschäftigt nur Diplomingenieure, Ingenieure, Sekretärinnen, kaum Arbeiter.
„Den ganzen Tag bin ich auf den Beinen, laufe hierhin, laufe dorthin, gebe etwas Versiegeltes ab, hole etwas Versiegeltes. Und jetzt bin ich noch zum Theaterobmann gewählt worden, habe nicht nur die Theaterkarten zu besorgen, sondern auch die Programme, Prospekte ... Heute habe ich die Anrechtskarten geholt für die Herren Diplomingenieure, Ingenieure, für die Sekretärinnen. Die Arbeiter haben kein Anrecht, obwohl es das Institut gerne sehen würde, wenn die Arbeiter von ihrem Recht auf ein Anrecht Gebrauch machen würden.“
„Wir brauchen auch kein Anrecht, unterbricht ihn Mutter Boronsky. Wenn Thomas mit mir ins Theater geht, bekommen wir unsere Karten an der Kasse oder wir warten, bis uns welche angeboten werden.“
„Und das wollte ich gerade tun.“ Ein Lächeln umspielt die Mundwinkel von Vater Boronsky. „Ich wollte euch gerade Karten anbieten, da werde ich auch schon unterbrochen. Ich wollte sagen, es gehört sicher zum guten Ton, dass die Studierten ein Anrecht auf ein Anrecht für das Theater haben, denn bei Weitem nicht alle gehen in die Vorstellung, vielmehr versuchen viele, ihre Karten zu verkaufen, zu verschenken. Zwei Karten habe ich für euch mitgebracht, für das Schauspielhaus.“
„Ich werde gleich einmal den Spielplan in der Zeitung mir vornehmen.“ Thomas ist von dem Angebot begeistert. Schnell hat er die Seite mit den Theaternachrichten gefunden. „Frau Flint“ bringen sie.
„Bestimmt so ein neuzeitliches Stück“, meldet sich Vater Boronsky wieder zu Wort, „das kein Mensch sehen will.“
„Mutter und ich werden es uns ansehen“, entscheidet Thomas.
Frau Boronsky widerspricht nicht.
„Da schickt dir Helga zum Geburtstag eine so schöne Hose, und du ziehst sie nicht einmal für die Schule an. Und ich habe gedacht, die ist gerade praktisch, ideal für die Schule. Auch kleidet sie dich. Richtig sportlich siehst du in ihr aus. Wie angegossen sitzt die Hose. Bei uns in den Geschäften habe ich noch nie so eine schöne und praktische Hose gesehen ...“
„Weil diese Hosen bei uns nicht hergestellt werden. Mutter! Das sind Jeans. Niethosen! Diese Hosen gibt es nur drüben. Und in der Schule ist es verboten, in diesen Dingern herumzulaufen.“
„Verstehe ich nicht.“ Frau Boronsky sieht ungläubig ihren Sohn an. „Wieso kann etwas verboten sein, was praktisch ist. Obendrein sehen diese Hosen manierlich und schick aus.“
„Mutter! Weil die von drüben sind! Deshalb!“
„Deshalb kannst du sie nicht in der Schule tragen? Und wenn einer nur solche Hosen hat? Manche bekommen doch alles von drüben.“
„Dann muss er sich ordentliche bei uns für die Schule kaufen. In den Dingern darf er sich nicht in der Schule sehen lassen. Das sind Hosen vom Klassengegner! Vom Klassenfeind! Und Dinge vom Klassengegner haben in der Schule nichts zu suchen. Deshalb trage ich sie auch erst nach der Schule. Erst vor drei Wochen wurde einer aus der zwölften Klasse gemaßregelt. Trotz wiederholter Ermahnungen kam er immer wieder in dieser Kluft. Einen Schnurbart hatte er sich auch wachsen lassen. Die Folge: strenger Verweis beim Fahnenappell. Im Wiederholungsfall Verweis von der Schule. Den Tag darauf erschien er ohne Schnurbart und ohne Jeans. Andere waren auch gleich beim Friseur gewesen. Wir dulden keine Gammler, hatte der Direktor lautstark während des Fahnenappells verkündet. Niethosen und lange Haare sind Auswüchse der Dekadenz, hatte er gebrüllt, sind unverkennbare Kennzeichen des Klassengegners, der unseren Arbeiter- und Bauernstaat unterminieren will; Niethosen und lange Haare sind äußerliche Merkmale des Klassenfeindes. Wer mit dem Klassenfeind sympathisiert, hat der Direktor gesagt, sich mit ihm identifiziert, indem er sich die Haare lang wachsen lässt und Nietenhosen trägt, hat an unserer sozialistischen Oberschule nichts zu suchen. Wir im Sozialismus dulden keine Nieten!“
„Das soll der Direktor gesagt haben? Das glaube ich nicht!“ Frau Boronsky schüttelt ungläubig den Kopf. „Solche schönen und praktischen Hosen sollen verboten sein? Ich kann das nicht glauben, mein Junge.“
Blondi tobt. So erregt und aufgebracht hat ihn Thomas noch nicht erlebt.
„Was bilden Sie sich eigentlich ein,“ schreit der Klassenleiter. Am liebsten hätte er Michael durchgeschüttelt. „Was bilden Sie sich eigentlich ein?“
Ihm fehlen die Worte. Er holt tief Luft, will wieder laut werden, besinnt sich, fährt in erzwungen ruhigem Ton fort: Immer wieder habe ich Ihnen gesagt, dass diese Niethosen nicht in der Schule getragen werden sollen. Das ist nicht die Kleidung für einen Oberschüler in unserer Gesellschaftsordnung. Wir an unserer Schule dulden keine Nieten. Und erst recht keine Niethosen! Verstanden! Und was tun Sie, Michael! Trotz wiederholter gut gemeinter Ermahnungen lassen Sie sich wieder in diesen Dingern in der Schule blicken. Sogar unser werter Direktor ist auf Sie aufmerksam geworden. Ist das nicht ein Schüler aus Ihrer Klasse, hat er gesagt. Reden Sie mit dem Mann, hat mein Direktor gesagt. Jawohl, habe ich gesagt, habe schon mehrmals mit dem Burschen geredet. Jetzt ist das Maß voll, zum Überlaufen voll. Wer provoziert, hat an einer sozialistischen Oberschule nichts zu suchen. Und nicht genug damit, dass Sie Niethosen tragen! Jetzt muss ich erfahren, dass Sie, wie nennt sich das doch gleich in Ihrem Jargon ..., ja richtig, dass Sie ein Elvis-Presley-Fan sind. So heißt doch dieser Kerl, diese Heulboje, dieser randalierende Asoziale ... Sie wollen mir doch nicht erzählen, dieser Presley gehört zu den Sängern, die wir schätzen auf Grund ihrer künstlerischen Qualitäten. Sie wollen mir doch nicht einreden, dieser Schreihals ist auf unseren Sendern zu hören! Sie wollen uns, unserer Partei doch nicht etwa unterschieben, dass wir solche Ganoven in unseren Sendungen bringen. Michael! Ich, wir, unsere Gesellschaft ... Wir können nicht dulden, dass Sie unserem Klassenfeind Gehör schenken. Wir haben nicht umsonst den Antifaschistischen Schutzwall errichtet! Wir wissen genau, warum wir das getan haben. Sichtbar für alle Welt haben wir uns abgegrenzt von unserem Klassengegner! Wir als Genossen wissen genau: warum! Michael, welchen Sender bevorzugen Sie denn?“
Ruhig steht Michael neben seinem Tisch. Ruhig antwortet er: „Luxemburg. Das wollen Sie doch hören. Sicher hat es Ihnen bereits einer meiner Freunde gesteckt. Hoffentlich hat der Betreffende nicht vergessen, Ihnen mitzuteilen, wie begeistert er von Elvis war...“
Jäh wird Michael unterbrochen.
„Was heißt hier gesteckt!“ Blondi läuft rot im Gesicht an. „Das ist die Pflicht jedes ordentlichen Schülers! Und Sie nennen das gesteckt! Was ist das nur für eine Terminologie! Sie hören also Luxemburg! Diesen Hetzsender! Wer Luxemburg hört, hört Rias, hört jeden westlichen Sender, jeden Sender des Feindes. Michael, ich versichere, ich werde alles in meinen Kräften Erdenkliche tun, um bei meinen Vorgesetzten durchzusetzen, dass Sie von der Schule verwiesen werden. Ein Exempel muss statuiert werden. Unglaublich das! Und das in meiner Klasse!“
Seine Faust donnert krachend auf die Tischplatte. Keiner schreckt hoch. Jeder ist bemüht, den vor sich sitzenden Rücken als Deckung zu nutzen.
Nur nicht auffallen, Thomas, befiehlt ihm sein Verstand: Verhalte dich ganz ruhig, Junge, sei still, tauche ab, falle nur nicht auf. Lenke nicht die Aufmerksamkeit dieses Minidespoten auf dich. Fieberhaft arbeitet das Hirn des Jungen. Wer hat Michael verpfiffen. Wird nun jeder jedem misstrauen? Jeder in der Klasse, in der Schule weiß, Michael hat Bänder mit der heißesten Musik.
In die Stille hinein peitscht die Stimme von Blondi: „Und wie beurteilen Sie als Klasse sein Verhalten? Als seine Mitschüler?“
Schweigen.
Blondi wird nervös: „Auch Sie sind wie ich zu erschüttert, zu aufgewühlt, um Worte zu finden.“
Vater Boronsky erhält eine Auszeichnung für seine ehrenamtliche Tätigkeit als Theaterfunktionär, obwohl er nie einen Schritt ins Theater setzten wird. Die Auszeichnung besteht aus zwei Opernkarten zu einer sonntäglichen Matinee für ehrenamtliche Theaterfunktionäre. Das ist zu viel für Vater Boronsky. Er soll sich Theater vormachen lassen. Niemals!
„Mit Vater gehe ich nicht“, sagt Mutter Boronsky entschieden. „Mit dem blamiere ich mich bloß.“
„Dann geht eben ihr zwei, du und der Junge.“
„Wer ist Theaterfunktionär, du oder ich? Also hast du zu gehen. Was sollen deine Kollegen von dir denken!“
„Die sind doch gar nicht da.“
„Es könnten aber welche da sein. Jedenfalls hast du dorthin zu gehen. Nimm den Jungen mit! Und indem sie sich an Thomas wendet, sagt sie: Pass auf Vater auf! Wenn er einschlafen sollte, versetzt du ihm einen kräftigen Stoß. Bei Kunsterlebnissen wird nicht gepennt.“
„Das kann ja was werden“, seufzt Vater Boronsky. „Mein Junge, wenn sich deine Mutter einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, ist sie nicht mehr davon abzubringen. Jetzt werde ich gezwungen, in die Oper zu gehen, werde gezwungen, mir etwas anzusehen, was ich gar nicht sehen will. Und ich gehe dorthin. Nur um des häuslichen Friedens willen!“
Seine Mutter wäre von den Plätzen begeistert gewesen. Bestimmt hätte sie gesagt: Das sind sehr teure Plätze, mein Junge. Die lassen sich das was kosten. Das wird ein besonderer Theatergenuss, mein Junge.
Vater Boronsky beeindruckt nichts.
Seine Mutter hätte von den Leuchtern geschwärmt, von der Weitläufigkeit des Foyers.
Frau und Tochter hatten lange auf Vater Boronsky einreden müssen, bis er bereit war, Hemd und Krawatte anzulegen, sich in einen Anzug zu pressen.
Nun klagt er, während er verzweifelt nach einer Toilette Ausschau hält, dass das Hemd ihm den Hals zudrückt, dass die Krawatte ihm die Luft abschnürt.
In unmittelbarer Nähe der Bühne hatte Thomas noch nie gesessen. Vater Boronsky, der sonst sehr schlecht sieht, stellt fest, dass der Vorhang fleckig ist.
„Den könnten die auch mal reinigen“, sagt er laut.
Thomas stößt ihn an, zeigt auf den gewaltigen Blumenschmuck vor dem Vorhang.
Vater Boronsky lächelt verschmitzt: „Mutter hat dir wohl Verhaltensregeln mit auf den Weg gegeben.“
Mutter hätte beim Anblick dieser Blumenfülle laut geschwärmt, hätte sich an den Farben und Formen der verschiedenen Gewächse berauscht, hätte darauf hingewiesen, wie viel Arbeit so ein Kunstgenuss kostet.
Ein Mann betritt die Bühne, stellt sich vor ...
„Seit wann gibt es beim Theater einen Doktor.“ Vater Boronsky schüttelt ungläubig mit dem Kopf.
Der Chefdramaturg spricht lange und viel: über den Spielplan, über Geplantes und Realisiertes, über die Möglichkeiten des Theaters.
„Wer soll sich denn das alles anhören“, zischt Vater Boronsky seinem Jungen ins Ohr. „Das interessiert doch keinen Menschen. Die spielen doch sowieso, was sie wollen.“
Die Versuche des Sohnes, den Vater zum Schweigen zu bringen, scheitern. Thomas ist die Situation peinlich. Er versteht die Mutter.
Verdiente ehrenamtliche Theaterfunktionäre werden ausgezeichnet. Blumen werden überreicht. Viel Beifall gibt es.
Der Vorhang öffnet sich. Ein Streifzug durch Oper, Operette, Ballett, Schauspiel nimmt seinen Anfang.
Vater Boronsky sagt nichts mehr. Er hält die Augen fest geschlossen. Gleichmäßig geht sein Atem. Ein Pfeifton entfährt laut seinem Mund. Sein Junge versetzt ihm einen Stoß. Erschreckt reißt der Vater die Augen auf, murmelt: „Mit geschlossenen Augen kann ich besser zuhören.“ Dabei lockert er seine Krawatte, löst den oberen Hemdknopf.
„Wegen der Luft! Die Luft ist hier ziemlich stickig“. Vater Boronsky bemüht sich, die Augen offen zu halten.
Marschmusik erklingt. Soldaten erscheinen auf der Bühne.
Vater Boronsky wird wach, brummelt kritisch vor sich hin: „Die Uniformen stimmen nicht. 1870 hatten die Franzosen andere Uniformen. Und Gleichschritt können die Kerle auch nicht halten. Denen fehlt eine richtige Exerzierausbildung.
Eine Hand berührt seine Schulter. Eine angenehm klingende Frauenstimme ist zu hören: „Können Sie nicht leise sein. Sie stören.“
Vater Boronsky begreift.
Als Vater und Sohn nach der Matinee auf dem Karl-Marx-Platz stehen und Thomas die Richtung zur Straßenbahnhaltestelle einschlagen will, hält ihn der Vater zurück.
„Wir müssen erst noch ein Bier trinken.“
„Aber Mutter wartet mit dem Mittagessen.“
„Lass sie warten. Ewig bleiben wir ja auch nicht weg.“
In Köhlers Bierstuben finden sie Platz.
„Weißt du,“ sagt Vater Boronsky, „die Musik war ja manchmal ganz hübsch, aber wenn die Kerle auf der Bühne nicht richtig Gleichschritt halten, die Uniformen nicht echt sind ... und dann nur Gesinge! Das A und O ist und bleibt eine gute Exerzierausbildung. Wenn der Gleichschritt nicht klappt, klappt nichts. Das sollten auch die vom Theater wissen. Sonst bleibt Theater eben nur Theater!“
Thomas gefällt der Unterricht bei der Künstlerin, wie er die Dozentin nennt. Regelmäßig besucht er ihren Unterricht, regelmäßig begegnet er auch dort Volker.
„Bedienen Sie sich stets einer gepflegten, kultivierten Aussprache. Lassen Sie keine Oberflächlichkeiten zu“, pflegt die Dozentin in jeder Stunde zu sagen.
Die Aussprache aller Laute wird durchgenommen. Thomas übt und übt, allein oder mit Volker gemeinsam. In den letzten Stunden vor Semester-Ende liest die Gruppe gemeinsam „Die Räuber“ von Schiller. Thomas ist begeistert. Wie Volker will er Schauspieler werden.
Eines Abends sagt Frau Boronsky zu ihrem Sohn: „Du hast dich sehr verändert, mein Junge.“
Sie stehen vor dem Schauspielhaus. Thomas spürt, wie die Unentschlossenheit sein mühsam erworbenes Selbstvertrauen beiseiteschieben will. Zögernd öffnet er die breite Glastür, durch die die Schauspieler immer gehen, lässt Volker den Vortritt, der wie immer Selbstsicherheit ausstrahlt. Hinter der Glastür erwartet sie eine weitere Tür, auf die Volker rasch zugeht, sie - ohne eine Sekunde zu zögern -- öffnet, den Raum betritt. Thomas muss sich beeilen, wenn er dem Freund folgen will. In der Pförtnerloge sitzt ein älterer Mann. In der rechten Hand hält er ein mit Wurst belegtes Brot, die linke umklammert eine Kaffeetasse. Überrascht schaut er Volker und Thomas an. Ihm ist die Verärgerung anzusehen. Thomas ist klar: Sie stören. Er hat Verständnis für die Verärgerung des alten Mannes, der gerade isst und trinkt und bei dieser Beschäftigung gestört wird. Schon will er eine Entschuldigung stammeln, da kommt ihm Volker zuvor.
„Einen wunderschönen guten Tag und guten Appetit. Lassen Sie sich bitte nicht stören, aber ...“
„Ihr wollt wohl Künstler werden?“
„Statisten.“ Dabei lächelt Volker wie ein Filmstar.
Der Pförtner wählt eine Nummer, wechselt ein paar Worte mit der Stimme am anderen Ende der Leitung, dann wendet er sich wieder Volker und Thomas zu: Durch diese Tür! Im dritten Stock den Gang geradeaus! Letzte Tür links! Da sitzt der Kollege Schlehmilch.
Volker und Thomas klettern die Stufen hinauf, laufen den Gang entlang, der in einer Tür mündet. Links neben dieser Tür befindet sich noch eine weitere Tür. Vor dieser Tür bleiben Volker und Thomas stehen.
„Das muss die Tür sein“, verkündet Volker. Kurz entschlossen klopft er kräftig an die Tür, drückt die Klinke nach unten, betritt vor Thomas den Raum. Thomas folgt ihm rasch nach. Hinter einem Schreibtisch mustert sie spöttisch ein graues Augenpaar. Der Mann mag Mitte Vierzig sein, obwohl die silbergrauen Haare, die er streng gescheitelt trägt, ihn älter erscheinen lassen. Äußerst gepflegt wirkt er. Die Krawatte passt zum Anzug. Er erweckt den Eindruck, als wäre er einer Modezeitschrift entsprungen.
Volker beginnt seine Rede. Leicht kommen die Worte ihm über die Lippen. Schweigend hört der Mann zu. Dann holt er ein großes, dickes Buch aus seinem Schreibtisch. Lässig blättert er in dem Buch, bis er die richtige Seite gefunden hat. Er lässt sich die Namen der Jungen geben, ihre Anschrift. Mit großer Geste trägt er alle Angaben in das große, dicke Buch ein. Jede seiner Bewegungen wirkt würdevoll, so als habe er sie vorher bis ins kleinste Detail vor dem Spiegel einstudiert. Nichts scheint dieser Mann unbewusst zu tun.
„Morgen Abend um 19:00 Uhr seid ihr hier. Wir geben „Die Räuber“. Noch irgendwelche Fragen?“
Als Volker und Thomas an der Pförtnerloge vorbeigehen, nickt ihnen der Alte freundlich zu.
Um wie vieles wirkt er sympathischer als der Komparserie-Chef. Um wie vieles natürlicher, denkt Thomas. Er ist ein Mensch wie ich. Der Komparserie-Chef spielt sein Leben.
„Wann geht es denn los“, erkundigt sich teilnahmsvoll der Pförtner.
„Morgen!“ Das ganze Gesicht von Thomas ist ein Strahlen. Auch er hat es geschafft. Nun gehört er der Statisterie an, ist Künstler, darstellender Künstler. Eine Wortschöpfung von Volker.
„Na, dann viel Erfolg bei den ‚Räubern‘.“
Es ist 19:00 Uhr. Obwohl Volker und Thomas zehn Minuten vor der vereinbarten Zeit bereits vor der Tür stehen, ist und bleibt sie verschlossen.
„Wir werden uns ein wenig umsehen“, schlägt Volker vor. Während er das sagt, klopft er kurz, aber energisch an die Tür neben der von Herrn Schlehmilch, anschließend drückt er die Klinke nach unten.
Die Tür öffnet sich, und die beiden stehen am Beginn eines neuen Ganges mit neuen Türen. eine der Türen ist angelehnt. Sofort geht Volker auf diese Tür zu. Hinter ihr sind viele Stimmen zu hören. Ohne zu zögern, betreten beide den Raum. Sie befinden sich in der Garderobe der Statisterie.
Thomas ist erstaunt. Nie hätte er es für möglich gehalten, dass sich so viele junge Männer zum Theater hingezogen fühlen.
Wie alte Bekannte werden sie begrüßt. Sie schauen sich um. Nirgends ist Herr Schlehmilch zu entdecken. Ein junger Mann tänzelt auf sie zu.
„Ihr seid sicher die beiden Neuen. Ich bin der Garderobier. Wir werden uns gleich einmal nach einem geeigneten Kostüm umsehen. Ihr gestattet, ich gehe voran. Schließlich bin ich hier zu Hause.“
Überall hängen Kostüme. Reihe folgt auf Reihe.
„Hier habe ich etwas Geeignetes für euch.“ Begeistert klatscht er in die Hände, ergreift eine Stange mit Harken, holt die Kostüme herab, prüft sie kurz. Die müssten passen. Streift sie einmal über.
Volker und Thomas verkleiden sich als Räuber. Sie betrachten sich im Spiegel, müssen lachen. Die Kostüme sind viel zu knapp. Sie stellen sich dem Garderobier vor.
Begeistert klatscht er in die Hände, ruft entzückt aus: „Kinder, süß seht ihr aus. Richtiggehend süß. Zwei richtige kleine süße Räuber seid ihr. Abwechselnd wendet und dreht er Volker und Thomas vor dem Spiegel hin und her, klatscht dabei jedes Mal in seine Hände, wobei er ausruft: Zwei richtige kleine süße Räuber seid ihr. Zum Anbeißen süß. Ihr könnt so bleiben, meine Süßen. Jetzt geht ihr zu unserem Maskenbildner und lasst euch anhübschen.“
Während Thomas geschminkt wird, erzählt der Maskenbilder, der wie der Garderobier ein sehr junger Mann ist, dass er von Beruf eigentlich Friseur ist, aber schon immer zum Theater wollte. Und jetzt ist er am Theater. Und er ist glücklich. Für ihn gäbe es nichts Schöneres als das Theater.
Volker und Thomas müssen lachen, als sie sich im Spiegel betrachten. Braun verschmiert ist ihr Gesicht. Ein gemalter riesiger Schnurrbart ziert den Raum zwischen Nase und Mund.
Herr Schlehmilch ist inzwischen eingetroffen. Er nähert sich Volker und Thomas.
„Na, ihr beiden, wie fühlt ihr euch?“
„Prächtig“, meldet sich Thomas zu Wort.
„Wenn wir jetzt auf die Bühne gehen, bleibt ihr in der Nähe von Matthias. Er wird euch zeigen, wie ihr euch zu verhalten habt. Matthias, du bist so freundlich und kümmerst dich um die beiden. Ich bin überzeugt, schon in der nächsten Vorstellung werden sie wissen, wie sie sich zu verhalten haben, wo es langgeht.“
Die jungen Männer verlassen die Garderobe, steigen treppauf, treppab. Nun haben sie die Hinterbühne erreicht. Deutlich ist Karl Moor auf der Bühne zu hören. Das Stichwort ist gefallen. Die gesamte Statisterie brüllt: „Hauptmann, Hauptmann, wir kommen!“ Enge, dunkle Stiegen klettern sie hinauf und wiederholen lautstark: „Hauptmann, Hauptmann, wir kommen!“ Jetzt stehen sie im Scheinwerferlicht. Thomas ist geblendet vor Glückseligkeit. Vor sich sieht er den Hauptmann, dargestellt von Günter Grabbert, seinem Lieblingsschauspieler. Schaumfetzen fliegen aus dessen Munde. Und noch immer steigert sich der Schauspieler in seine wilde Entschlossenheit hinein, brüllt, schreit, rast, ergreift einen Statisten bei den Schultern, schüttelt ihn und schleudert ihm die Worte ins Gesicht: Ich könnte dir noch mehr erzählen ..., lässt von ihm ab. Der junge Mann wankt, scheint das Gleichgewicht zu verlieren, fängt sich aber, wischt sich mit der Hand über das Gesicht.
Thomas blickt in den dunklen Zuschauerraum. Nur das Publikum in den ersten Reihen ist deutlich zu erkennen. Sichtlich ergriffen sitzt es auf seinen Plätzen. In Gedanken ist Thomas nicht mehr der anonyme Räuber, der anonyme Statist, er verwandelt sich in Karl Moor, reißt das Publikum von den Plätzen ...
Das Stück ist zu Ende. Erst Stille, dann tosender Applaus. Die Lichter im Saal nehmen an Stärke zu, immer mehr Gesichter sind zu erkennen. Thomas hält Ausschau nach Freunden, Bekannten. Kein ihm vertrautes Gesicht ist zu sehen. Der Vorhang wird geschlossen, um gleich wieder geöffnet zu werden. Der Komparseriechef gibt seine Anweisung durch: Beim nächsten Vorhang Abgang!
Auf dem Weg zum Hauptbahnhof sagt Volker zu Thomas: „Hast du auch wie ich den Eindruck gewonnen, dass der Schlehmilch, der Garderobier und der Maskenbildner Schwule sind?“
„An so etwas habe ich gar nicht gedacht“, gesteht Thomas freimütig, ich finde sie nur sehr freundlich und zuvorkommend.
Es ist Juli. Thomas ist froh, die elfte Klasse hinter sich zu wissen. Die Naturwissenschaften quälen ihn, verweigern ihm jeden Erfolg. Immer wieder stellen sie Hindernisse in den Weg, über die er stolpert. Immer wieder gefährden sie seine Existenz als Oberschüler.
Thomas steht vor dem Haus seines Freundes Volker. Im Vorgarten hinter dem schmiedeeisernen Zaun blühen Blumen. Die ergraute Fassade des Hauses sieht freundlicher aus, wenn die Sonne scheint. Rasch steigt Thomas in den dritten Stock, drückt mit Gefühl den Klingelknopf. Statt seines Freundes öffnet dessen Mutter. Freundlich lächelnd bittet sie ihn einzutreten. Im Wohnzimmer stellt Thomas fest, dass er mit dieser Frau allein ist.
„Volker hatte keine Möglichkeit, dir abzusagen. Ihr habt doch zu Hause kein Telefon, nicht wahr?“
Thomas nickt.
„Nun setz dich doch erst einmal, mein Junge. Ich beiße doch nicht.“
Thomas lässt sich in den Sessel gegenüber der Couch gleiten. In seiner Haut fühlt er sich nicht wohl. Die Gegenwart dieser attraktiven und selbstbewussten Frau beunruhigt ihn, irritiert ihn, bringt ihn in Verlegenheit.
„Die Schule liegt nun erst einmal hinter euch,“ setzt Volkers Mutter das Gespräch fort. „Ich nehme an, du hast alles gut überstanden. Und nun habt ihr erst einmal Ferien.“
Thomas nickt wieder.
„Bist du immer so gesprächig“, lacht sie und zeigt dabei ihre gepflegten Zähne.
„Es ist auch dieses Mal wieder alles gut gegangen“, Thomas hat das Gefühl zu stottern. Wieder verspürt er diesen Kloß im Hals.
„Wusste ich es doch!“
Ihre Augen begegnen sich. Sie lächelt. Er wird verlegen, senkt den Blick, dann blickt er auf, schaut ihr in die Augen, fest entschlossen, ihrem Blick standzuhalten, ihm zu widerstehen.
„Wusste ich es doch, dass du es kannst. Ich hole uns etwas zu trinken. Sicher magst du einen Cognac.“
Aus dem Schrank holt sie die Flasche, zwei Gläser. Jetzt bemerkt Thomas, dass sie unter der Schürze nur einen Büstenhalter und einen Slip trägt.
Lange, schöne, schlanke Beine hat sie, stellt er fest.
Sie stellt zwei Gläser auf den Tisch, die Flasche, kuschelt sich in die Couch, zeigt dabei ihre Beine. lächelt wieder, sagt dann: „Wusste ich es doch, du traust dich nicht.“
Nervös streicht Thomas seine blonden Locken aus der Stirn, versucht gegen den Schweiß anzukämpfen, der sich auf seiner Haut zu bilden droht. Er weiß nicht, wie er sich verhalten soll. Ihm fehlt die Erfahrung. Hilflos lächelt er die Frau an, wartet auf ein Zeichen von ihr.
Ermutigend lächelt sie zurück, wartet ab.
Thomas spürt, wie die Hitze in ihm aufsteigt. Er bildet sich ein, seine Ängste müssen ihm in das Gesicht geschrieben sein. Noch immer zögert er, wartet ab, ist gerade entschlossen ...
Die Frau erhebt sich von der Couch, geht um den Tisch herum, nimmt die Flasche in die Hand. Dabei berührt sie Thomas scheinbar unbeabsichtigt mit ihren langen, schlanken Beinen. Thomas spürt ihre Haut auf seiner Haut. Ihre Haut fühlt sich gut an, so weich und geschmeidig. Ohne ein Wort füllt sie die Gläser, neigt sich zu Thomas herab, flüstert kaum hörbar: „Prost“. Ihr Atem streift Thomas. Angenehm nach Pfefferminze duftet er.
„Prost“, antwortet Thomas, befürchtet, nicht gehört zu werden, zu versagen.
Ihre Gläser berühren sich.
Thomas spürt den Cognac auf der Zunge, schmeckt ihn, leert das Glas.
Die Frau lächelt. Ihre schmale Hand mit den langen Fingern umfasst die Flasche. Wieder stehen zwei gefüllte Gläser auf dem Tisch. Rotbraun schimmert ihr Inhalt in der Sonne. Thomas hat das Gefühl, seine Ängste und Hemmungen schleichen davon, seine Unbeholfenheit weicht, Mut und Entschlossenheit greifen nach ihm, geben ihm Selbstvertrauen und Sicherheit. Thomas ist zufrieden mit sich. Seine Hand sucht das Glas. Seine Fingerspitzen berühren die der Frau. Er spürt ihre Wärme. Ein Verlangen nach Zärtlichkeit durchflutet seinen Körper. Ihre Finger verschlingen sich ineinander. Ihre Blicke begegnen sich. Sie fordert ihn auf. Wieder hat er Hemmungen. Sie ist die Mutter seines Freundes. Sie ist älter als er. Sie hat einen Partner, feste Bindungen, die will er nicht zerstören. Sein Gewissen peinigt ihn. Er soll Grenzen überschreiten, die er überschreiten möchte, aber gleichzeitig auch nicht überschreiten will, weil er Angst hat. Sie ist die Mutter seines besten Freundes. Wie soll er ihm in die Augen sehen? Wie soll er in Gegenwart seines Freundes dieser Frau begegnen, die die Mutter dieses, seines besten Freundes ist? Bilder stürmen auf ihn ein, Gedanken, Befürchtungen. Was wird seine Mutter sagen, wenn sie erfährt, dass ihr Junge die Mutter seines Freundes liebt, mit ihr ... Weich und sanft ist der Druck ihrer Hand. Willenlos überlässt er sich dieser Hand, die seinen Körper streichelt, liebkost, ihn vergessen lässt. Er ist nur noch Gefühl. Er weiß nicht mehr, was mit ihm geschieht. Wie ein führerloses Schiff lässt er sich treiben. Noch nie in seinem Leben hat er so schön die Passivität empfunden. Er tut nichts und fühlt sich wie im Rausch. Ihr Mund tastet seinen Körper ab, erkundet seinen Körper. Er lässt es einfach geschehen.
Als Statisten wirken Volker und Thomas in einigen Stücken mit, so dass ihre Abende ausgefüllt sind. Wieder stehen „Die Räuber“ auf dem Spielplan. Hinter der Bühne wartet geschlossen die Statisterie. Das Stichwort ist gefallen. Wie die anderen auch stürzt Thomas die schwankende Holzstiege hinauf. Dicht hinter sich weiß er Volker. Scheinwerferlicht empfängt ihn. Er steht auf der Bühne. Die Gruppen formieren sich. Von Gruppe zu Gruppe geht Herr Schlehmilch. Jetzt nähert er sich Volker, Thomas und Matthias, sagt: „Deutlich singen, Kinder. Heute haben wir wieder ein volles Haus.“
Nun steht der Statistenchor im Mittelpunkt, trägt sein Lied vor: „Ein freies Leben führen wir, ein Leben voller Wonne. Der Wald ist unser Nachtquartier. Bei Sturm und Wind hantieren wir. Merkur ist unsere Sonne.“ Nach der Vorstellung gehen Thomas und Volker mit den anderen in die Kantine. Mitunter begegnen sie dort den Schauspielern. Inzwischen kennt Thomas die Mitglieder der Statisterie, weiß, was sie beruflich tun. Aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen sie. Viele sind Oberschüler und Studenten, aber auch Arbeiter sind unter ihnen, Lehrlinge, Angestellte.
In wenigen Stunden löst das neue Jahr das alte ab. Thomas befindet sich auf dem Weg zur Schauspielschule. Er ist aufgeregt. Ein komisches Gefühl, das er nicht deuten, nicht beschreiben kann, hat er in der Magengegend. Die Straßen, die ihm vertraut sind, erscheinen ihm fremd, so als würde er sie zum ersten Mal in seinem Leben durchqueren. Wie ein Fremder fühlt er sich in der Stadt, in der er aufgewachsen ist. Eine ehemalige Villa ist zur Schauspielschule geworden. Eine breite Treppe führt zu einer großen, schweren Tür. Hinter der Tür erwartet Thomas ein breiter Treppenaufgang mit reichverziertem Treppengeländer. Geräumig ist das Treppenhaus und vornehm. Sein Weg führt ihn nach oben. Dort empfängt ihn das nicht zu übersehende Sekretariat. Hinter einem gewaltigen Schreibtisch sitzt eine zierliche, fast zerbrechlich wirkende junge Frau mit schwarzen, kurz geschnittenen Haaren. Verlegenheit erfasst Thomas. Wieder befällt ihn die Angst, er könne stottern, wenn er zu sprechen beginnt. Ermutigend lächelt sie ihn an, erkundigt sich nach seinem Namen. Thomas reicht ihr die Einladung zur Prüfung. Sie fordert ihn auf, ihr zu folgen. Sie geleitet ihn in einen großen Raum, an dessen Wänden Stühle stehen. Die meisten sind schon besetzt. Auf ihnen hocken junge Menschen. Die jüngsten sind so alt wie Thomas. Der weitaus größte Teil unter ihnen ist aber über zwanzig Jahre alt. Thomas nimmt neben einem jungen Mann Platz, den er etwa Mitte zwanzig schätzt. Kaum sitzt Thomas auf dem Stuhl, verspürt er wieder dieses eigenartige Gefühl in der Magengegend. Er erhebt sich, verlässt den Raum, begibt sich auf die Suche nach der Toilette, findet sie schneller als er zu hoffen gewagt hatte, schließt sich ein. Hier ist er allein, ungestört; niemand kann ihn beobachten. Er schließt die Augen, geht noch einmal die Texte durch, suggeriert sich, ruhig zu bleiben. Bevor er die Toilette verlässt, wirft er einen kritischen Blick in den Spiegel, betrachtet sich lange und ausgiebig, kämmt sich die blonden Locken durch, schneidet Grimassen, muss lachen. Wieder im Raum angekommen, findet er den jungen Mann nicht vor. Bestimmt spricht er jetzt vor! Thomas spürt, wie bei diesem Gedanken wieder das Lampenfieber von ihm Besitz ergreift. Er versucht sich abzulenken, mustert seine Umgebung erneut. Neben ihm sitzt jetzt ein lang aufgeschossener junger Mann mit einem großen Koffer.
„Hast wohl gleich die Kostüme mitgebracht“, versucht Thomas ein Gespräch in Gang zu bringen.
„Genauso ist es! Ich fühle mich dann besser“, erklärt der Hagere. „Wenn ich in dem Kostüm stecke, dessen Rolle ich gerade spiele, bilde ich mir ein, wirke ich überzeugender. Ich bin sicher, ich habe die Rolle dann besser im Griff. Für mich ist das Kostüm von ausschlaggebender Bedeutung.“
Träge schleichen die Minuten dahin. Nicht nur Thomas ist die Ungeduld ins Gesicht geschrieben. Die Tür öffnet sich. Ein glücklich leuchtendes Gesicht stürmt aus dem Raum, schreit: „Kinder, ich habe es geschafft. Die Eignungsprüfung habe ich bestanden.“
„Das ist schon der Sechste!“, verkündet feierlich ein schwarzer Vollbart. „Die Chancen nehmen zusehends ab. Erfahrungsgemäß bestehen maximal zehn die Eignungsprüfung pro Prüfungstag. Und der Saal ist immer noch brechend voll besetzt.“
„Ach Kinder, bin ich glücklich. Ich kann es noch gar nicht fassen. Ich drücke euch allen die Daumen. Während er das sagt, nimmt seine rechte Hand die Reisetasche auf. Ich wünsche euch allen ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr. Tschüss bis zur Aufnahmeprüfung!“
„Der Beneidenswerte“, hört Thomas neben sich eine sanfte Frauenstimme.
Thomas hat gar nicht bemerkt, dass neben ihm eine tolle Blondine Platz genommen hat. Ein schmales, langes Gesicht hat sie mit großen, dunklen, schwermütig blickenden Augen. Auf Mitte zwanzig schätzt sie Thomas.
„Die erste Hürde hat er erfolgreich genommen, der Glückliche. Die meisten von uns werden hier schon stolpern und aufgeben müssen. Nicht wenige von den Ausgemusterten werden es dann im nächsten Jahr wieder versuchen. Manche kommen Jahr für Jahr, unterziehen sich erneut der Prüfung. Manche schaffen es letztlich auch, werden tatsächlich genommen. Drücke mir die Daumen!“
„Ich drücke sie ganz, ganz fest. Ich drücke sie für uns beide. Zu schön wäre es, wenn wir beide genommen werden.“
„Was wirst du denn vorspielen?“
„Den Kosinsky, den Jago und den Ferdinand.“
„Und keine Rolle aus einem zeitgenössischen Stück?“ Fragend blickt sie Thomas an.
„Muss das sein?“
„Soviel ich weiß, sieht das die Prüfungskommission gern.“
„Da habe ich wohl gleich schlechte Karten?“ Thomas kommt nicht dazu, über die von ihm getroffene Auswahl an Rollen sich den Kopf zu zerbrechen. Gerade in dem Augenblick wird sein Name aufgerufen.
Hinter ihm schließt sich die Tür. Er ist im Prüfungsraum, wird von zwölf Augenpaaren begutachtet. Manche der Gesichter kennt er von der Bühne, manche gehören auch Regisseuren. Ihre Freundlichkeit irritiert ihn. Zu viel mütterliche und väterliche Güte beunruhigt ihn. Der Gedanke, dass diese zwölf mild lächelnden Richter über seine Zukunft zu entscheiden haben, versetzt ihn in Angst, weil er sich nicht vorstellen kann, dass sie noch immer väterlich oder mütterlich milde lächeln, wenn sie ihm sein Todesurteil verkünden. In ein Gespräch wird er verstrickt. Fragen hat er zu beantworten: „Wer ist Ihr Lieblingsschauspieler? Warum? In welchen Rollen haben Sie ihn erlebt? Wer ist Ihr Vorbild? Sind Sie Mitglied einer Laienspielgruppe? Warum nicht? Warum wollen Sie ausgerechnet Schauspieler werden? Es gibt doch so viele andere interessante Berufe. Warum ausgerechnet dieser Beruf?“
Thomas beantwortet alle Fragen, erst dann darf er auf die Bretter, die für ihn die Welt bedeuten.
„Nun, junger Mann“, sagt der Leiter der Schauspielschule, „zeigen Sie uns bitte, was Sie können.“
Thomas spielt. Er rennt auf der Bühne hin und her, steigert sich in seinen Kosinsky hinein, er vergisst, wo er sich befindet. Er rast, brüllt, schreit, stellt seine zweite und dritte Rolle vor. Er ist am Ende. Den Schweiß spürt er auf der Haut. Schwer geht sein Atem.
Die Prüfungskommission berät; dann verkündet der Direktor der Schauspielschule das Urteil. Thomas hat bestanden.
Vor Freude möchte der Junge tanzen. Vor Freude möchte er schreien. Er wagt es nicht. Eine seltsame Scheu hält ihn davor zurück. Die blonde junge Frau mit dem schmalen Gesicht und den traurigen dunklen Augen gratuliert ihm.
„Ich warte auf Sie“, sagt Thomas, und er ist erstaunt, woher er den Mut so schnell genommen hat.
Als sie den Prüfungsraum verlässt, hat sie Tränen in den Augen. Thomas versucht sie zu trösten. Er nimmt ihre Reisetasche.
Gemeinsam schlendern sie durch die Stadt. Die Geschäfte haben bereits geschlossen. Stunden später steht er auf dem Bahnsteig, sie in der geöffneten Tür.
„Findest du, dass ich zu alt bin?“, fragt sie, „zu alt, um Schauspielerin zu werden?“
„Wieso das?“ Wieder ist Thomas hilflos, weiß nicht, was er erwidern soll.
Sie wartet seine Antwort nicht ab, sagt: Das war die Begründung für die Ablehnung.
Langsam setzt sich der Zug in Bewegung. Thomas winkt. Sie winkt.
„Nie werden wir uns wiedersehen.“ Thomas fühlt, wie eine große Traurigkeit über ihn kommt. Ich kenne ja nicht einmal ihren Namen ...
Immer wieder gefällt ihm dieses Zimmer. Immer wieder beneidet Thomas seinen Freund Volker darum. Gern hätte er auch so ein Zimmer, ein eigenes Zimmer mit eigenen Möbeln. Thomas muss sich sein Zimmer mit Gisela teilen. Für beide bringt das Probleme mit sich, weil sie aufeinander Rücksicht nehmen müssen, auf Persönliches weitestgehend verzichten müssen, denn es bleibt kaum Raum für eigene Regale, von einem eigenen Schreibtisch ganz zu schweigen. Volker besitzt das alles, wovon Thomas träumt: eigenen Schreibtisch, Bücherregale, Tonbandgerät, einen Sessel, gemütliche Couch, die gleichzeitig als Bett genutzt werden kann.
Volker und Thomas sitzen sich gegenüber, Volker auf der Couch, Thomas im Sessel. Thomas muss seinem Freund unbedingt die Neuigkeit mitteilen, dass er die Eignungsprüfung bestanden hat.
„Es wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein, wenn wir beide gemeinsam die Prüfung hätten ablegen können.“ Thomas gerät ins Schwärmen.
„Es sollte nicht sein.“ Volker blickt nachdenklich vor sich hin. „Es sollte eben nicht sein. So ist eben das Schicksal. Wir haben die kühnsten Träume, unsere Fantasie gaukelt uns die tollsten Bilder vor, aber die Realität bietet wenig Raum für Träumer und Fantasten.“
„Aber du bist doch weder das eine noch das andere; du bist Realist. Oder sollte ich mich täuschen?“ Thomas erkennt seinen Freund nicht wieder.
„Eben deshalb, weil ich Realist bin, habe ich mich nicht für das Schauspiel entschieden. Als Schauspieler habe ich meine Grenzen erkannt. Über Mittelmaß würde ich nie hinauskommen. Und Durchschnitt möchte ich nicht sein. Deshalb habe ich von der Schauspielerei Abstand genommen. Ich habe mich für die Theaterwissenschaften entschieden und für diese Disziplin mich an der Schauspielschule beworben. Nächste Woche finden die Prüfungen statt ...“
„Du willst nicht Schauspieler werden!“ Thomas kann es nicht fassen, nicht begreifen, dass sein bester Freund, für den es offensichtlich nur diesen Beruf gab, unvermittelt aufgibt und sich für die Theaterwissenschaften entschließt. Wie kannst du auf diesen Beruf verzichten, ohne dich ihm zu stellen?“
Ich habe eben erkannt, dass mein Talent nicht ausreicht. Einfach Selbsterkenntnis geübt - und meine Konsequenzen gezogen.“
„Immer habe ich uns beide gemeinsam auf der Schule gesehen. In meinen Träumen werden wir beide berühmte Schauspieler. Wir spielen an den größten Häusern...“ Thomas will seinen Faden weiterspinnen, wird jedoch von seinem Freund jäh unterbrochen.
„Der Realität halten die Träume oft nicht Stand, zerfließen wie Schaum, lösen sich in nichts auf. Es ist schon besser, Realist statt Träumer zu sein. So bleiben viele Enttäuschungen dem Realisten erspart“
Schweigend blickten sich die beiden Freunde lange an, dann sagte Volker in die Stille: Meine Mutter hat sich von ihrem Freund getrennt. Sie fühlte sich von ihm eingeengt, vereinnahmt, konnte nicht mehr sie selbst sein. Zumindest war das ihre Ansicht.
„Aber ich fand, die beiden passten gut zusammen, nur dass er um vieles älter war als sie.“
„So groß war der Altersunterschied gar nicht. Und ich mochte Johannes. Wir verstanden uns sehr gut. Immer sah ich in ihm einen älteren Freund, blickte zu ihm auf.“
„Und warum ist es auseinander gegangen?“
„Meine Mutter hat Schluss gemacht. Sie hat einen anderen Typ kennengelernt. Nur mit dem Neuen habe ich nichts gemeinsam. Er kommt auch kaum her.“
„Aber deine Mutter und du - ihr seid euch doch ähnlich, auch was die Interessen betrifft. Und wenn du nicht mit ihm auf einer Wellenlänge liegst, wie kommt sie dann mit ihm zurecht?“
„Vielleicht verbindet sie nur das Bett. Ich weiß es nicht, was sie an ihm findet. Und sie kann es mir auch nicht sagen. Immer weicht sie aus, wenn ich sie danach frage. Ich kann mir nur vorstellen, bei Johannes stimmte nicht mehr die Chemie mit der ihren überein; und mit dem Neuen spielt sie Synthese. Ich bin wirklich gespannt, wie lange dieses Verhältnis dauern wird. Und jetzt sprechen wir über etwas anderes.“
Wieder schiebt sich das große Schweigen zwischen die beiden Freunde.
Die Villa ist Thomas vertraut. Er wartet auf seinen großen Auftritt. Wie er so wollen außer ihm zwanzig junge Menschen die Prüfung bestehen. Dass sie Talent haben, wurde ihnen nach der Eignungsprüfung bescheinigt; ob sie erfolgreich sein werden, wird sich nach dieser Prüfung erweisen. Alle Prüflinge wissen, maximal werden fünf von ihnen die Aufnahmeprüfung bestehen, die anderen können sich im nächsten Jahr erneut zur Aufnahmeprüfung melden.
Wieder verlassen traurige, enttäuschte Gesichter den Prüfungsraum. Wie die anderen auch zählt Thomas die Glücklichen, die Gewinner. Bisher waren es zwei, und mehr als die Hälfte der Teilnehmer ist bisher geprüft worden. So hoffen die noch zu Prüfenden, dass sie zu den Auserkorenen, zu den Ausgewählten, zu den Auserwählten zählen.
Er hört seinen Namen. Thomas erhebt sich von seinem Stuhl, geht auf die Tür zu, hinter der die Prüfungskommission thront.
„Toi, toi, toi“, wird ihm zugeflüstert.
„Ich drücke die Daumen.“
Was soll das?“, denkt Thomas. „Sie wünschen mir Erfolg! Ist das ehrlich gemeint? Denn wenn ich Erfolg habe und genommen werde, nimmt ihre Chance ab, zu den Siegern zu zählen.“
Die Prüfungskommission tritt in der alten Besetzung an. Diesmal werden auch keine Fragen gestellt. Thomas nennt die Rollen, die er gestalten möchte. Er sagt gestalten und nicht spielen, weil gestalten für ihn mehr mit Kreativität zu tun als spielen. Irgendwie empfindet er gestalten seriöser, ernsthafter als spielen. Diesmal hat er sich sogar für eine Arbeiterrolle entschieden - für den Arbeiter in Friedrich Wolfs Stück „Professor Mamlock“.
Thomas steht auf der Bühne. Vor sich sieht er die Prüfungskommission. Die Blicke jedes einzelnen Prüfers fühlt er auf sich gerichtet. Er spürt seine Aufregung, er spürt, wie sie zunimmt an Intensität, wie sie dabei ist ihn aus seinem seelischen Gleichgewicht zu bringen. Er versucht in den Augen der Prüfer zu lesen, wie sie ihm gesonnen sind, ob er ihnen gleichgültig ist, ob sie schon prüfungsmüde sind.
„Nun beginnen Sie schon“, sagt der Leiter der Schauspielschule.
Thomas spürt, wie die Aufregung, die Angst von ihm weichen. Seine Texte beherrscht er. Nicht einen Versprecher handelt er sich ein. Alles klappt wie am Schnürchen. Seine Umgebung nimmt er nicht mehr wahr. Er lebt in seiner Rolle. Er schlüpft in die Gestalt des Arbeiters ...
Er beendet den letzten Satz, hat das Empfinden, aus einem Traum zu erwachen. Langsam findet er in die Wirklichkeit zurück. Unschlüssig bleibt er auf der Bühne stehen, wartet. Die Stimme des Leiters der Schauspielschule ruft ihn in die Realität zurück.
„Kommen Sie bitte nach vorn, junger Mann und nehmen Sie Platz.“
Der Leiter zeigt auf den Stuhl, der mitten vor der Prüfungskommission in Richtung Prüfungskommission steht.
Sitzend vernimmt Thomas das Urteil. Er glaubt seinen Ohren nicht zu trauen: Nach der Eignungsprüfung wurde ihm eine tragfähige, sonore Stimme bescheinigt; diesmal ist von einer belegten Stimme die Rede. Ein ungutes Gefühl beschleicht ihn.
„Junger Mann, wir empfehlen Ihnen, sich in Berlin zu bewerben. Dort sind solche Typen wie Sie gefragt. Bestimmt haben Sie dort Erfolg.“
Thomas versteht die Welt nicht mehr. Er wird abgelehnt, gleichzeitig aber wird ihm geraten, sich in Berlin zu bewerben. Wenn ihn Leipzig nicht nimmt, wieso sollte ihn Berlin dann nehmen? Entweder ich bin begabt oder unbegabt! Thomas gerät ins Grübeln.