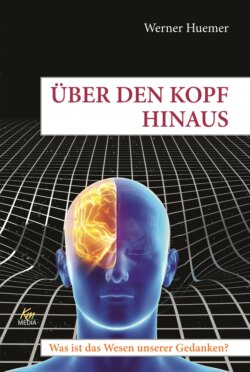Читать книгу Über den Kopf hinaus - Werner Huemer - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKAPITEL 2: Ich denke – bin ich also?
Existieren „reine Gedanken“ überhaupt?
Wer über René Descartes berühmte Daseins-Formel „Ich denke, also bin ich“ tiefer nachdenkt, steht vielleicht irgendwann vor der Frage: Um welches Denken geht es eigentlich? Was meinen wir ganz konkret, wenn wir von Gedanken sprechen? Die Bilder und Töne unserer Innenwelt? Die leisen Selbstgespräche, die man führt, um über irgendetwas zu grübeln oder mathematische Gleichungen zu lösen? Die persönlichen Erinnerungen? Die Lust- und Schmerzgefühle, die zum Ausdruck drängen? Oder etwa aufkeimende Vorstellungen, die wir in die Tat umsetzen wollen?
Solche Fragen zeigen, dass der Begriff „Gedanke“ im Grunde nichts fest Definiertes beschreibt, sondern eine ziemlich bunte Vielfalt. Er umfasst Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges, nüchterne Informationsverarbeitung ebenso wie empfindungsvolle Momente des Erlebens. Wobei unser Bewusstsein zweifellos vor allem jenen Regungen der Innenwelt verbunden ist, die uns bewegt, beeindruckt und begeistert haben. Erinnerungen an die erste Liebe bleiben gedanklich lebendig, ohne dass man viel dazutun müsste. Hingegen kostet es die meisten Menschen große Mühe, Ereignisse oder Fakten im Gedächtnis zu behalten, mit denen sie keine Erlebnisse verbinden.
Vielleicht sollte es „reine Gedanken“ ohne Verbindung zu Gefühlen und Empfindungen gar nicht geben. Vielleicht ist das Eintrichtern von Informationen nur ein zweifelhaftes Ergebnis des maschinenähnlichen Menschenbildes, das heute im Ausbildungsbereich gepflegt wird.
Kritische Gedanken in dieser Art äußert der bekannte Göttinger Gehirnforscher Prof. Dr. Gerald Hüther. Mit ihm habe ich das folgende Gespräch über grundlegende Begriffe geführt, die mit dem Denken in Zusammenhang stehen.
Einer allgemeinen Vorstellung zufolge sind zunächst die Gedanken da, erst dann folgen Handlungen. Aber inwiefern kann man Gedanken als etwas Eigenständiges betrachten? Wie entstehen die Vorstellungen, die uns prägen, aus der Sicht des Gehirnforschers?
Hüther:
„Damit man überhaupt irgendeine Handlung ausführen kann, muss man sie in seinem Inneren vorbereiten. Wir müssen Netzwerke aktivieren, die für diese Handlungen gebraucht werden. Wenn man handeln will, muss man ein Muster im Hirn aufbauen. Ich kann also nicht einfach den Daumen bewegen, ohne dass ich vorher in meinem Hirn das Areal, die Netzwerke aktiviere, die dafür nötig sind, dass er sich bewegt. Insofern können wir gar nichts nur denken, sondern es muss auch immer verbunden sein mit einer Handlung. Häufig ist das Denken auch noch mit einem Gefühl verbunden. Sobald wir in den Bereich der wirklichen Vorstellungen kommen, bemerken wir, dass an den Vorstellungen, die man von sich selbst oder von irgendetwas hat, oder davon, wie andere sein sollten, auch unglaublich viel Emotionalität hängt. Diese Emotionen bestimmen, wie man mit dem anderen umgeht.“
Meinen Sie also, dass es eine reine Gedankentätigkeit ohne Emotionen gar nicht gibt?
Hüther:
„Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es das in Wirklichkeit gar nicht gibt. Man kann es aber lernen. Wir haben in unserem Kulturkreis so eine Vorstellung, dass man denken kann ohne zu fühlen oder dass man irgendetwas wahrnehmen kann in der Welt, ohne dass das eine Empfindung auslöst. Das ist hirntechnisch gar nicht richtig gut möglich, es sei denn, man trainiert es. Wir können alles trainieren. Wir können uns allen möglichen Unsinn aneignen. Eine dieser besonderen Kulturleistungen, die wir uns offenbar immer wieder gegenseitig beibringen und auch unseren Kindern, ist die Abtrennung des Denkens vom Fühlen. Praktisch geht das gar nicht. Wir würden in dem Strom der Sinneswahrnehmungen ertrinken, allein schon durch das, was wir hier alles in diesem Raum wahrnehmen können, wenn wir nicht in der Lage wären, einzelnen Wahrnehmungen eine Bedeutung zu geben. Bedeutsam wird für uns immer dann etwas, wenn es affektiv aufgeladen wird, das heißt, wenn sich irgendetwas mit einem Gefühl verbindet. Dann wird auf einmal das, was ich dort sehe, wichtiger als jenes – weil ich damit etwas verbinde, was auch an Gefühle gekoppelt ist.“
Gemeinhin hat man lange unterschieden zwischen dem physischen Körper und einer nichtphysischen Seele. Heute verorten viele Wissenschaftler die Seele im Gehirn und sagen, Seele ist gleich Gehirntätigkeit. Was für ein Menschenbild haben Sie als Gehirnforscher?
Hüther:
„Es ist schwer, diese alten, gewachsenen, ewig diskutierten Vorstellungen „Was ist der Geist? Was ist die Seele? Und was ist das Gehirn?“ so auseinander zu teilen, wie man das eigentlich machen müsste.
Etwas, das mir sehr, sehr wichtig ist: Ich verstehe den Menschen als ein Wesen, das auf der Suche ist. Und seine Suche ist, wie bei allen Lebewesen, von den bisherigen Erfahrungen geprägt. Im Laufe seines Lebens macht jedes Lebewesen Erfahrungen. Diese Erfahrungen werden dann in innere Strukturen verwandelt. Das ist, nebenbei gesagt, genau so, wie wenn man in einem Staat eine Verwaltungseinheit aufbaut. Erst einmal wird das Verwaltungssystem aufgebaut, es gewinnt eine eigene Struktur, und die bestimmt dann, wie es im Staat weitergeht. Und so werden im menschlichen Gehirn Erfahrungen in Netzwerkstrukturen verwandelt, und die bestimmen dann, wie man handelt. Das heißt, das menschliche Hirn verwandelt gewissermaßen Immaterielles, nämlich Erfahrungen, in Strukturen, Netzwerkstrukturen. Und dann werden diese Netzwerkstrukturen wieder benutzt und aktiviert, um etwas Immaterielles, nämlich Gedanken, Worte, Ideen hervorzubringen, so dass wir wahrscheinlich mit der alten Trennung – dies ist körperlich und das ist geistig – sowieso nicht weiterkommen. Die Physiker haben uns das schon längst gelehrt. Wahrscheinlich kommen wir auch mit dem alten, aus dem vorigen Jahrhundert stammenden Ursache-Wirkungs-Denken nicht mehr weiter. Wir sind keine Maschinen. Wir sind Wesen, die sich selbst organisieren.
Der wunderbare neue Begriff der Selbstorganisation ist zwar schon sehr alt, aber man versteht ihn erst jetzt zunehmend. Steckt in diesem Selbstorganisationsprozess doch etwas, das mit der Seele zu tun haben könnte, wie wir sie in der Vergangenheit beschrieben haben, nämlich die Intentionalität. Es kann sich ja nur etwas selbst organisieren, wenn es irgendwas will. Selbst ein Hefekloß, den ich mit ein bisschen Butter, Wasser, Milch und Mehl anrühre, damit er aufgeht, würde, wenn ich ihn fragen könnte „Was willst du?“, antworten: „Ich will wachsen, ich will es weiter warm haben.“ Alles, was lebt, ist intentional unterwegs. Das ist es, was ich meine, wenn ich sage, der Mensch ist ein Suchender. Seine Intention ist, nach Formen des Zusammenlebens zu suchen, die sich mit den Erfahrungen decken, die er vorher schon gemacht hat.
Am Anfang seines Lebens sind das zwei ganz einfache Erfahrungen. Die eine heißt Verbundenheit – schon vor der Geburt waren wir mit der Mutter so eng verbunden, wie man sich das gar nicht mehr vorstellen kann – und die zweite Grunderfahrung aller Menschen heißt Wachstum, eigene Weiterentwicklung und auch Kompetenzerwerb, heißt: immer autonomer werden und auch immer freier. Deshalb suchen Menschen nach etwas, was sehr schwer zu finden ist, nämlich nach einem Zustand, nach einer Art von Beziehung, in der sie gleichzeitig verbunden sind und frei.“
Sie haben in einem Interview einmal sinngemäß gesagt, unser Gehirn wird so, wie wir es benutzen. Gleichzeitig aber stehen Sie den Möglichkeiten, das Gehirn in einer bestimmten Art zu trainieren, wie man einen Muskel trainiert, skeptisch gegenüber und weisen eher auf die Bedeutung von Begeisterung hin, auf die Notwendigkeit, sich als Mensch für etwas einzusetzen. Warum ist dieser Impuls der Begeisterung so wichtig?
Hüther:
„Wir haben im vorigen Jahrhundert ja geglaubt, das menschliche Hirn würde sich gar nicht ändern, es wäre durch genetische Programme zusammengebaut, also fast wie in einer Autofabrik: Man hat Einzelteile, Nervenzellen, man hat einen Bauplan, ein genetisches Programm – und dann kriegt man ein fertiges Auto oder ein fertiges Hirn. Damit fährt man eine Zeitlang rum, bis es sich abnützt. Zuletzt kommt das Auto auf den Schrottplatz und der Mensch ins Altersheim.
Das war ein sehr lineares Denken, das für das Leben so nicht funktionieren kann. Tatsächlich haben die Hirnforscher Ende des vergangenen Jahrhunderts mit Hilfe neuer bildgebender Verfahren viele Befunde zu Tage gefördert, die gezeigt haben: Nein, das menschliche Gehirn ändert sich – bis ins hohe Alter. Wenn der Mensch was anderes macht, bilden sich neue Netzwerke. Sie können jonglieren lernen oder ein Musikinstrument spielen – und ein halbes Jahr später kann man zeigen, dass da neue Schaltungen im Hirn entstanden sind. Allerdings hat man dann im Wahn der damaligen Zeit – dem einer Leistungsgesellschaft – geglaubt, das Hirn sei ein Muskel. Man muss es nur viel benutzen, damit es schön dick wird. Also hat man Hirntrainings verordnet.
Alle Menschen haben sich eingebildet, sie müssen sich nur richtig anstrengen, dann wird aus ihrem Gehirn auch noch mal etwas anderes werden. Und das war wieder falsch. So funktioniert das Hirn auch nicht, es ist keine Maschine, es ist auch kein Muskel, man kann es nicht allein auf Leistung trainieren, sondern das Hirn ist ein besonderes Organ, das aufpasst, dass es mir gut geht. Deshalb hat es eine Art Sensor für Wichtigkeit. Eine Sache muss wirklich wichtig sein, und zwar nicht für die anderen, sondern für mich, dann ändert sich das Gehirn.
Etwas wirklich Wichtiges erkennen wir daran, dass es uns unter die Haut geht, dass es uns begeistert, dass es uns interessiert, dass es uns etwas angeht. Immer, wenn das passiert, werden im Hirn bestimmte Zellgruppen aktiviert, im Mittelhirn, also tief unten, die haben wunderbare, lange Fortsätze – und immer, wenn die aktiviert werden, weil uns etwas unter die Haut geht, werden an den Enden dieser langen Fortsätze sogenannte „neuroplastische Botenstoffe“ ausgeschüttet. Die wirken tatsächlich wie Dünger auf das Netzwerk dahinter, das man im Zustand der Begeisterung so intensiv genutzt hat, zum Beispiel, um Probleme zu lösen, ein Tennisspiel zu gewinnen oder irgendetwas Schönes, Gestalterisches zustande zu bringen. Deshalb wird man bei dem, was man mit Begeisterung tut, so schnell so viel besser. Deshalb kann man sich das, was einem unter die Haut geht, auch so gut merken.
Deshalb ist es so wichtig, dass auch in unserem Schulsystem und in den Bildungseinrichtungen endlich diese Botschaft ankommt: dass es nichts nützt, wenn man sich anstrengt, dass man sich noch so sehr anstrengen kann mit den Hausaufgaben und mit dem Auswendiglernen – das geht rein und kommt gegenüber wieder raus –, wenn es nicht wirklich unter die Haut geht, wenn es nicht gedüngt wird. Wir müssten eigentlich eine Kultur entwikkeln, in der wir uns nicht gegenseitig dauernd entgeistern, sondern wir müssten versuchen, uns ein bisschen gegenseitig zu begeistern, müssten uns einladen und inspirieren, uns noch einmal auf etwas Neues, vor allen Dingen auf etwas, was uns unter die Haut geht, einzulassen.“
Meinen Sie, kann man Begeisterungsfähigkeit erlernen, indem man sich bewusst mit Dingen beschäftige? Oder ist die Begeisterungsfähigkeit von vornherein im Menschen angelegt?
Hüther:
„Das Interessante ist ja, dass sich Kinder offenbar schon mit einer unendlichen Begeisterungsfähigkeit auf den Weg machen. Kleine Kinder haben am Tag fünfzig- bis hundertmal einen Begeisterungsschub in ihrem Hirn, da wird fünfzig bis hundertmal diese Düngergießkanne mit den neuroplastischen Botenstoffen aktiviert, deshalb lernen sie auch so viel.
So, und nun schicken wir sie in die Schule, und dann müssen sie zum Studium, und dann geht der Mensch zur Arbeit. Sie ahnen schon, was passiert … Man muss eher etwas dafür tun, dass die Begeisterungsfähigkeit nicht verschwindet. Es wäre gut, wenn sie nicht so schnell verschwinden würde! Aber natürlich kann man sie bis ins hohe Alter wieder entdecken. Aber neu produzieren braucht man sie nicht. Jeder Mensch kommt mit einem riesigen Rucksack voller Begeisterung auf die Welt, aber bedauerlicherweise wird ihm der oft leergeräumt.“
Sie sind bekannt dafür, dass Sie Erkenntnisse aus der Gehirnforschung praktisch nutzbar machen wollen. Wie sind Sie denn auf diesen Weg gekommen? Hat es für Sie bei Ihrer Forschungsarbeit wichtige Aha-Erlebnisse gegeben?
Hüther:
„Ehrlich gesagt, habe ich nie geglaubt, dass man überhaupt Wissenschaft nur zum Selbstzweck betreiben könnte. Es ist mir bis heute eine ganz absurde und gruselige Vorstellung, dass es Menschen gibt, die einfach Wissenschaft betreiben um der Wissenschaft wegen. Das ist ähnlich wie Künstler um der Kunst willen Kunst machen. Ich glaube, dass wir soziale Wesen sind und auch das ganze Leben lang soziale Wesen bleiben, wenn wir nicht Pech haben und aus unseren sozialen Gemeinschaften hinausgejagt werden. Es mag Künstler gegeben haben, die ganz einsam geworden sind, weil sie keiner mehr mochte und weil sie nirgendwo mehr richtig dazugehören durften. Es mag in der Vergangenheit auch Wissenschaftler gegeben haben, die sich in die Wissenschaft geflüchtet haben, weil sie mit den Menschen nichts mehr zu tun haben wollten.
Wir sind aber in einem viel stärkeren Maße, als wir uns das zuzugestehen bereit sind, sozial organisierte Wesen. Es gibt uns eigentlich in Einzahl gar nicht. Kein Mensch könnte, wenn er wirklich alleine aufwachsen würde, irgendetwas. Er könnte nicht nur nicht sprechen – wir brauchen da gar nicht über Lesen und Schreiben oder über die Nutzung moderner Medien reden –, der Mensch hätte auch keine Mimik und Gestik, mit der er sich verbal und nonverbal verständigen könnte. Noch nicht einmal auf zwei Beinen würden wir alleine laufen lernen, wenn nicht irgendjemand da wäre, der uns zeigte, wie das geht, wenn wir nicht unseren Eltern nacheifern würden oder älteren Kindern, die schon auf zwei Beinen gehen können. Also haben wir uns möglicherweise mit unserer sehr individualistischen Vorstellung aus dem vorigen Jahrhundert doch ziemlich geirrt. In Wirklichkeit gibt es uns als Einzelwesen gar nicht – was nicht heißen soll, dass nicht jeder von uns ein einzigartiges, soziales Wesen ist. Das ist das Besondere am Menschen: Wir bilden keine Ameisenstaaten, wo alle gleich sind, sondern wir haben über die gesamte Evolution hinweg etwas entwickelt, was uns wahrscheinlich auch die Möglichkeit geschaffen hat, die wunderbaren Kapazitäten in unserem Gehirn auszubilden. Das nennt man individualisierte Gemeinschaft. Individualisierte Gemeinschaft ist etwas anderes als die Herde, wo alle hinter einem Leit-Büffel her rennen. Es ist auch etwas anderes als ein Ameisenoder Bienenstaat, wo über Botenstoffe alle so aneinander gekettet werden, dass sie wie ein einziger Organismus reagieren. Individualisierte Gemeinschaft heißt: auf jeden kommt es an. Wenn einer was will, kann er das allen anderen mitteilen und gleichzeitig kann keiner allein irgendwo auch nur einen Tag überleben.
Wir haben uns eingeredet, dass wir alleine leben könnten. Daraus ist eine sehr egozentrische Weltsicht geworden. Die Ergebnisse dieser bedauerlichen Entwicklung können wir heute ja überall auf der Welt besichtigen. So werden wir nicht mehr lange überleben können.“
Was müssten wir gesellschaftsweit ändern, um eine neue Richtung einzuschlagen, Potentiale zu entfalten und von der Egozentrik wegzukommen? Welche Ansatzpunkte sehen sie?
Hüther:
„Wissenschaft kann niemals sagen, wie man es machen muss. Wissenschaft kann nur helfen zu begreifen, worauf es ankommt. Was die Hirnforschung in den letzten Jahren herausgearbeitet hat, ist, dass es vielleicht darauf ankäme, anders miteinander umzugehen, dass wir eine andere Beziehungskultur entwickeln und dass wir vor allen Dingen damit aufhören sollten, uns gegenseitig wie Ressourcen zu behandeln. Das ist es ja, was uns passiert ist, weil wir in der Vergangenheit im wesentlichen alles, was es draußen gab, als Ressourcen ausgenutzt haben. Das gilt nicht nur für die Bodenschätze, das gilt auch für Pflanzen und Tiere, die wir als Nahrungsmittel-Ressourcen züchten und verwerten, das gilt sogar für Menschen. Wir haben andere Menschen zu Ressourcen gemacht – schon lange. Die Sklaven waren Ressourcen. Manche Menschen machen heute ihre eigenen Kinder zu Objekten ihrer Erziehungsmethoden. Wenn man aber als Mensch erleben muss, dass man zu einem Objekt gemacht wird – ist man nur noch ein Arbeiter, der dazu beizutragen hat, dass der Gewinn im Unternehmen steigt, oder man ist nur noch ein Schüler, der seine Pflicht als Schüler zu tun hat –, dann ist man nicht mehr eine Persönlichkeit, sondern nur noch als Funktion in einem System abgestempelt.
In diesem System kann sich aber kein Mensch halten, da kann keiner seine Potentiale entfalten, da bleibt ihm, wenn er überleben will, eigentlich nichts anderes übrig, als sich anzupassen. Indem ich mich aber anpasse, höre ich auf, etwas Eigenes zu wollen. Ich fange an zu denken wie alle anderen, eigne mir dasselbe Wissen an wie alle anderen und werde Teil dieses kollektiven Breis Angepasster.
Eine Gesellschaft versucht natürlich, ihre nachwachsende Generation immer wieder in diesen kollektiven Brei hineinzuziehen, weil dieser vertraut ist und auch ein bisschen Stabilität bietet … Besitzstandswahrung heißt das Stichwort dazu. Also werden die Objekte, die Kinder und Jugendlichen, mit Hilfe von Belohnung und Bestrafung angepasst, bis sie ihre eigenen Kinder auch wieder mit Belohnung und Bestrafung anpassen an das, was schon vorgegeben ist. Das ist eine Ressourcenausnutzungsgesellschaft, die den anderen als Objekt behandelt. Ich glaube, dass die Zeit gekommen ist, diese Art von Umgang miteinander zu beenden. Sie musste ja auch kommen, weil wir alle wissen, dass wir die Ressourcen, die es auf der Welt gibt, nicht beliebig lang ausbeuten können. Irgendwann sind sie verbraucht. Deshalb erleben wir jetzt einen neuen Übergang von der Kultur, die bisher alles beherrscht hat – der Kultur der Ressourcenausnutzung mit richtig schönen Hierarchien, die für das Funktionieren dieses Systems sorgen, zu einer Kultur, in der die Menschen anfangen, das zu machen, was das Schönste ist, was Menschen überhaupt machen können, nämlich sich gegenseitig helfen, um die in ihnen angelegten Potentiale zu entfalten.“
Wie Sie es einmal in einem Gespräch formuliert haben: „Zitronenbäume pflanzen statt Zitronen ausquetschen …“
Hüther:
„Wenn man ein Gleichnis für diese andere Kultur sucht, dann ist es schon sehr zutreffend, dass man sich als Bild beispielsweise eine Zitronenpresse vorstellt, die in der Vergangenheit Zitronensaft hergestellt hat. Dabei wurde immer nur das Auspressen von Zitronen optimiert, alle Ernten wurden zusammengekauft und es wurde Saft produziert. Was jetzt anstünde, wäre eben, dass man merkt: so viele Zitronenbäume, um weiter Saft produzieren zu können, gibt es nicht mehr. Jetzt wäre es an der Zeit, damit anzufangen, neue Zitronenbäumchen zu pflanzen, damit wieder Zitronen heranwachsen. Das ist Potentialentfaltung. Es ist eine andere Kultur, die sich nicht von oben nach unten entwickelt, die auch keiner anordnen kann.
Damit andere Menschen ihre Potentiale entfalten können, kann man sie nur einladen, ermutigen, ihnen die Gelegenheit bieten, selbst die Erfahrung zu machen, was noch alles in ihnen drinsteckt. Das heißt, es wird eine sehr liebevolle Kultur, in der nicht mehr einer auf Kosten von anderen lebt und sich ständig irgendwie hervortun muss.
Im Augenblick definieren sich schon Kinder dadurch, dass sie sagen: „Ich bin der, der das besser kann als die anderen.“ In Zukunft wird das anders gehen, in Zukunft wird man sagen: „Ich bin der, der mit diesen besonderen Begabungen, mit diesen besonderen Fähigkeiten, mit diesem besonderen Wissen, auf diese besondere Weise dazu beiträgt, dass das, was wir alle gemeinsam tun, nämlich diese Erde zu erhalten, auch wirklich gelingt.“
Die vielen „Schichten“ des Ichs
Diese potentialorientierte Ich-Positionierung führt uns zurück zu dem berühmten Zitat von René Descartes, das dieses Kapitel eingeleitet hat: „Ich denke, also bin ich“. Die Praxis zeigt, dass Gedanken sich kaum von persönlichen Erlebnissen und Empfindungen trennen lassen. Sie stehen also mit bewussten Erfahrungen in Verbindung. Aber wer erfährt? Was ist das „Ich“, von dem wir so selbstverständlich sprechen? Woher kommt dieses Etwas, das uns die Welt – und auch uns selbst – erleben lässt? Das sich einerseits Tag für Tag mit den Erlebnissen und Erfahrungen zu verändern scheint – und andererseits in seinem sonderbaren Eigenleben doch unberührt verbleibt von den Wachstums- und Alterungsprozessen des Körpers?
Diese Frage wird uns in der Folge noch öfter begegnen. Sie hat in der Vergangenheit schon viele Gelehrte und Theologen beschäftigt.
David Hume (1711–1776) zum Beispiel, ein schottischer Philosoph, formulierte etwa ein Jahrhundert nach Descartes sinngemäß, dass es sich beim menschlichen Ich um gar nichts Feststehendes, Unveränderliches handle, sondern um ein Bündel verschiedener Bewusstseinsinhalte. Mit dieser Ansicht könnte man Hume als Wegbereiter für die heutige Sichtweise bezeichnen, der zufolge unsere Ich-Wahrnehmung kein klar abzugrenzendes Bewusstseinsphänomen ist, sondern eine Sammelbezeichnung für mehrere unterschiedliche Zustände. Und zwar für:
| • | die Wahrnehmung der Umwelt („Ich höre Musik!“), |
| • | mentale „Innenwelt-Erfahrungen“ („Ich erinnere mich!“, „Darüber muss ich nachdenken!“), |
| • | körperliche oder seelische Bedürfnisse und Befindlichkeiten („Ich habe Hunger!“; „Ich habe Angst!“), |
| • | die eigene Identität („Ich bin der/die gleiche, die ich gestern war“), |
| • | den eigenen Willen („Ich möchte das jetzt tun!“), |
| • | Besitzverhältnisse („Das ist mein Körper!“), |
| • | das Sein in Raum und Zeit („Ich befinde mich jetzt zu Hause!“, „Ich erlebe den Sommer“) |
| • | die Unterscheidung zwischen äußerer Realität und innerer Vorstellung („Ich habe geträumt“ oder „Ich habe das wirklich erlebt“) |
| • | sogenannte selbstreflexive Wahrnehmungen („Wer bin ich?“, „Wie bin ich?“, „Weshalb bin ich so?“). |
Interessanterweise können einzelne dieser Ich-Erlebnisse ausfallen, ohne dass die anderen davon betroffen sind. Es gibt beispielsweise Gehirntumor-Patienten, die ihre selbstreflexive Ich-Wahrnehmung verloren haben. Sie wissen nicht mehr, wer sie sind und erkennen sich selbst nicht im Spiegel. Dennoch können sie als Ich ihre Umwelt wahrnehmen, ihren Körper spüren oder Zukunftspläne schmieden.
Manche Schlaganfallpatienten wiederum wissen sehr gut, wer sie sind oder wo sie sich befinden, aber sie haben jeden Bezug zu ihrem Körper verloren, fühlen sich als „Geister ohne Hülle“. Und dann gibt es beispielsweise Menschen mit neurologischen Störungen, die „nur“ ihre persönliche Verortung in Raum und Zeit eingebüßt haben. Sie erleben dadurch, an zwei Orten gleichzeitig zu sein, finden das aber durchaus normal.
Auch wenn bei einem gesunden Menschen alle diese unterschiedlichen „Ich-Verknüpfungen“ funktionieren, stehen im Alltag abwechselnd immer wieder andere Wahrnehmungsfacetten im Vordergrund: Wir denken beispielsweise über etwas nach, bei anderer Gelegenheit verspüren wir Durst, irgendwann einen Schmerz, danach führen wir ein Telefonat, wir rufen uns ein schönes Erlebnis in Erinnerung – und so weiter. Streng genommen sind all das unterschiedlichste Bewusstseinsleistungen, die wir aber wie selbstverständlich als einheitliches Ich-Erlebnis erfahren.
Die Fähigkeit des Gehirns, Einzelbilder oder Audio-Sequenzen zu einem Gesamterlebnis zu verknüpfen, zeigt sich übrigens auch beim Betrachten jedes Spielfilms: In Wirklichkeit werden dem Zuschauer dabei ja immer nur einzelne Szenen präsentiert, die unabhängig voneinander gedreht und dann in einer Abfolge von Nahaufnahmen, Totalen, „subjektiven“ und „objektiven“ Blickwinkeln aneinander gefügt wurden, wobei die inhaltliche Kontinuität aus dramaturgischen Gründen manchmal sogar gezielt durchbrochen wird. Dennoch gelingt es uns mühelos, den fertigen Film als geschlossene Erzählung zu erleben (es sei denn, der Regisseur hat versagt). Das Gehirn fügt die einzelnen „Puzzleteilchen“ selbsttätig zusammen und ist damit im Grunde der eigentliche „Filmproduzent“ – so, wie es inmitten der Vielzahl alltäglicher Eindrücke, Aufgaben und Erfahrungen das Erleben einer „Ich-Kontinuität“ ermöglicht.
Erstaunlich ist übrigens auch, wie das Gehirn arbeitet, damit sich für das Ich eine Erlebniskontinuität formen kann. Die objektive Wirklichkeit – soweit es eine solche ohne subjektives Bewusstsein überhaupt gibt [Anm.: siehe dazu Kapitel 5] – findet nämlich nicht als kontinuierlicher Strom über die Sinnesorgane Eingang in unser Bewusstsein, sondern in einem Takt von ungefähr drei Sekunden. In diesem Rhythmus entwickelt das Gehirn aus den verfügbaren Informationen jeweils eine neue „Insel der Gegenwart“, wie es der deutsche Psychologe Ernst Pöppel ausdrückt. Ein subjektiver Moment entsteht. Auf diesen Drei-Sekunden-Takt ist die gesamte menschliche Wahrnehmung abgestimmt. Man hat festgestellt, dass alle Verszeilen in der Lyrik, egal aus welchem Land, und auch musikalische Werke in diesem Rhythmus schwingen. In jedem Gespräch versuchen wir unbewusst, diesem „lebendigen Takt“ gerecht zu werden und setzen, sobald wir etwas sagen, unbewusst im Drei-Sekunden-Rhythmus kurze Pausen, die üblicherweise allerdings kaum bemerkt werden. Bewusst wird uns die Notwendigkeit dieses Takts allenfalls, wenn jemand, um ihn einzuhalten, unbewusst allzu viele „Äähs“ oder „Mmms“ in seine Rede einfügt – oder überhaupt keinen Rhythmus findet, weil er vom Blatt liest. Derart „taktlosen“ Vorträgen kann man auch bei geschliffenster Rhetorik nur schwer folgen. Viele Zuhörer suchen in solchen Fällen deshalb das Weite – entweder physisch oder indem sie einschlafen.
Solche Befunde aus der Gehirnforschung zeigen die enge Verknüpfung von Gehirnleistungen mit unserem Bewusstsein. Dennoch wurde das bewusste Ich des Menschen bis in die jüngste Zeit hinein immer als etwas Nicht-Physisches betrachtet.
Descartes meinte zum Beispiel, dass der immaterielle Geist, der allein den Menschen intelligent und bewusst mache, mit dem Körper verbunden und das Gehirn daher nur eine Kontaktstelle für den Geist sei. Theologen und Dichter wie Angelus Silesius (1624–1677) sahen im „mystischen Ich“ eine geistige Verbindungsmöglichkeit mit Gott. Und auch für die Wissenschaftler der Neuzeit stand bis vor wenigen Generationen außer Frage, dass es sich beim menschlichen Ich um nichts Körperliches handelt, sondern um etwas Geistiges, um etwas Freies, das über einen Willen verfügt und das befähigt ist, Verantwortung zu übernehmen.
Diese Sichtweise konnte zwar bis heute nicht widerlegt werden, weil ein Gegenbeweis – etwa durch die Erzeugung eines künstlichen Ich-Bewusstseins auf materieller Grundlage – nicht geführt werden konnte. Dennoch aber gehen viele Forscher davon aus, dass auch das Bewusstsein von einem Ich im Gehirn generiert wird, dass es also ebenfalls im Körper seinen Ursprung hat.
Die Quälerei mit den „Qualia“
Welche konkreten Belege gibt es nun aber dafür, dass unser Ich-Bewusstsein im Gehirn entsteht und seinen Sitz doch nicht, wie man so lange glaubte, in einer immateriellen Seele hat?
Mit Hilfe der modernen Visualisierungstechniken entdeckte man ein Phänomen bei konzentrierter Wahrnehmung: Es wurde dokumentiert, dass sich bei bewussten Tätigkeiten große Verbände von Nervenzellen zusammenschließen und gleichartige Signale aussenden. Bewusstsein zeigt sich demnach – im Unterschied zum Unbewussten – durch das Senden von elektrischen Impulsen im Gleichtakt. Das ist zwar kein Beweis dafür, dass unser Gehirn Bewusstsein generiert, zumindest aber dafür, dass Bewusstsein deutliche Spuren im Gehirn erzeugt.
Allerdings kommen solche Signal-Sendungen im Rahmen der gesamten Hirntätigkeit nur selten vor. Man weiß heute zuverlässig, dass uns die allermeisten Vorgänge unter unserer Schädeldecke – wahrscheinlich sogar über 95 Prozent! – überhaupt nie zu Bewusstsein kommen. Der bei weitem überwiegende Teil aller Denkprozesse läuft unbewusst ab. Dabei übernimmt unter anderem das, was wir gelernt haben oder was uns geprägt hat, das Steuer. Und es wäre ja auch ein Jammer, müssten wir zum Beispiel jeden Schritt steuern, bewusst immer ein Bein vor das andere setzen, um laufen zu können. Indem das Gehirn alle Alltagsroutinen unbewusst erledigt, kann das Bewusstsein sich auf das Wesentliche konzentrieren – auf das, was ihm wesentlich ist.
Allerdings bleiben wir dabei bis zu einem gewissen Grad im Bannkreis des großen Unbewussten gefangen: Alte Prägungen beeinflussen neue Entscheidungen, und es kostet gewöhnlich viel Mühe, eingefahrene Alltagsroutinen, festzementierte Haltungen oder gar Süchte zu durchbrechen.
In einem einfachen Bild: Wir erleben uns in einem „Bewusstseinsraum“, den wir mit den „Bausteinen“ der eigenen Wünsche und Entschlüsse mit konstruiert haben, dessen Kellertür allerdings in einen unermesslichen „Untergrund“ führt – oder, um das Bild nicht düster zu zeichnen, hinter dessen „Eingangstür“ sich eine unermessliche Weite auftut, die ebenfalls zu unserem „Ich“ gehört.
Dabei sollte vielleicht auf einen Begriffsunterschied hingewiesen werden, der im Alltagssprachgebrauch manchmal nicht berücksichtigt wird: Das Unbewusste ist nicht unbedingt das Gleiche wie das Unterbewusstsein. Als „unbewusst“ bezeichnen Psychologen und Hirnforscher heute einfach alle Prozesse im Gehirn, die sich dem Tages- oder Wachbewusstsein entziehen, also weit über 90 Prozent aller Denk- oder Schaltvorgänge.
Der Begriff „Unterbewusstsein“ ist demgegenüber schwerer zu definieren. Er stammt aus der Psychologie und beschreibt die Summe aller Erinnerungen, Eindrücke und persönlichen Motive, die zwar „irgendwo“ angelegt sind, die auch unsere Absichten oder Entscheidungen beeinflussen können, die aber eben unter der Schwelle unseres Bewusstseins liegen. Einen wissenschaftlichen Beweis für die Existenz eines Unterbewusstseins gibt es nicht, auch kein entsprechendes Hirnareal. Aber ein Teil dessen, was sich unbewusst in unserem Gehirn abspielt, hat offenbar das Potential, für bewusste Gedanken maßgeblich zu werden. Es gibt ja Eigenheiten oder persönliche Unzulänglichkeiten, die wir gern verdrängen, oder belastende Ereignisse, an die wir uns nicht erinnern wollen, die aber trotzdem unsere Entschlüsse beeinflussen. Sie gehören mit zu unserer Persönlichkeit, können sich auch in Empfindungen äußern, werden aber nicht zu bewussten Gedanken.
„Unbewusst“ oder „unterbewusst“ bedeutet also nicht, dass es keinen Bezug zum Ich gibt. Damit haben wir zu rechnen, wenn wir uns der Frage nach dem Wesen dieses persönlichen Ichs nähern. [Anm.: siehe dazu Kapitel 6]
Jedenfalls kann bis heute trotz detailliertester Gehirnscans und der jahrzehntelangen Dokumentation außergewöhnlicher neurologischer Krankengeschichten niemand behaupten, er wüsste, wie Bewusstsein entsteht. Immer noch ist das eines der größten Rätsel überhaupt.
Wir wissen, dass Gedanken und selbst Traumbilder sich aus den Gehirnströmen bis zu einem gewissen Grad „ablesen“ lassen. Wir haben auch gelernt, dass Bewusstsein sich im (gleichgetakteten) neuronalen Feuer zeigt, und dass die krankhafte Beeinträchtigung bestimmter Hirnareale Bewusstseinsleistungen verhindert, so wie umgekehrt durch die Stimulation von Arealen bestimmte Erlebnisse ermöglicht werden können.
Aber wer erlebt? Die Vermutung, das Gehirn würde ein Ich konstruieren, bleibt eine Theorie. Denn was ist das Wesen des bewussten, ichbezogenen Erlebens überhaupt?
Für diese wissenschaftlich unbeantwortete Frage wurde ein Fachbegriff geprägt: man spricht von „Qualia“. Damit ist aber nicht etwa die Quälerei angesprochen, die sich Forscher und Philosophen auferlegen, wenn sie nach dem Wesen des Bewusstseins suchen, sondern der Begriff steht für subjektive Erlebnisgehalte und -qualitäten.
Ein Beispiel aus dem Alltag: Ich schneide mir in den Daumen und erlebe deshalb Schmerz. Körperlich passiert dabei folgendes: Über die Nervenbahnen werden Reize zum Gehirn geleitet, dort verarbeitet, und als Reaktion folgt irgendeine Handlung. Wie kommt es aber zum Erleben des Schmerzes, das noch dazu für jeden Menschen anders ist und auch stark von der momentanen persönlichen Befindlichkeit abhängt? Es gibt nichts physisch Fassbares, demzufolge die Reizverarbeitung ein Schmerzerlebnis nach sich ziehen müsste!
Dieses kleine Beispiel steht exemplarisch für unser gesamtes Erleben: Es ist noch völlig ungeklärt, in welcher Verbindung neuronale Prozesse im Gehirn mit Qualia, also subjektiven Erlebnisgehalten stehen. Aber ohne Qualia wäre kein persönliches Bewusstsein möglich! Das, was das Leben für uns Menschen lebenswert macht, sind ja immer die subjektiven Erfahrungen; es ist nicht das objektiv messbare Feuerwerk der Neuronen im Gehirn, das auf Computerbildschirmen sichtbar gemacht werden kann.
In seinem Buch „Rosenrot – oder die Illusion der Wirklichkeit“ (München/Grünwald, 2013) weist der deutsche Philosoph Christian Zippel auch auf einen anderen Aspekt des Begriffs „Qualia“ hin. Diese subjektiven Wahrnehmungen sind demnach „vergleichbar mit einem ‚Icon‘ auf dem Desktop unseres Computers […] schön bunt, leicht erfassbar und unverkennbar“. In Wirklichkeit aber würden Qualia für Programme und „unbewusste Hintergrundinformation“ stehen, die in der Summe unsere Persönlichkeit prägen.
Doch sieht Zippel auch grundsätzliche Vorbehalte, den Begriff „Qualia“ auf die physikalische Ebene zu reduzieren, denn „die Physik – als Produkt des Bewusstseins – steht nicht über der Wahrnehmung, sondern eher daneben. […] Über etwas zu reden und es selbst zu erleben sind zwei Paar Schuh.“
Wie das Bewusstsein „Wirklichkeit schaltet“
Auch wenn die Forschung in den letzten Jahren einige beeindruckende Erkenntnisse über die bewussten und unbewussten Vorgänge im Gehirn gewinnen konnte und neue Begriffe geprägt wurden, um die schwer greifbare Individualität unseres Erlebens doch einer bestimmten Schublade zuzuordnen – die Kluft zwischen subjektiven geistigen Erfahrungen und den objektiv messbaren körperlichen Prozessen blieb immer noch ein Rätsel. Viele zentrale Fragen scheinen weiterhin offen. Nicht nur die große Grundfrage „Was sind Gedanken und wie entsteht Ich-Bewusstsein?“, mit der wir uns noch ausführlicher befassen werden, sondern auch wichtige Detailfragen: Wie kann das menschliche Bewusstsein auf den Körper einwirken? Weshalb gibt es psychosomatische Phänomene wie den Placebo-Effekt? Warum kann der Glaube eines Menschen konkrete Wirkungen entfalten?
Der Göttinger Gehirnforscher Professor Dr. Gerald Hüther meinte, die Physik habe uns bereits gelehrt, dass wir „mit der alten Trennung – dies ist körperlich und das ist geistig – sowieso nicht weiterkommen“.
Tatsächlich hat uns die Quantenphysik inzwischen an die Schwelle eines völlig neuen Weltverständnisses geführt – was sich allgemein aber leider noch nicht herumgesprochen hat. Üblicherweise denken wir (und dieses „wir“ umfasst auch viele Wissenschaftler) noch weitgehend in den Kategorien der sogenannten Klassischen Physik, die große Persönlichkeiten wie Galilei, Descartes und Newton im 17. Jahrhundert begründet haben [Anm.: siehe dazu Kapitel 5].
Diese Physik geht von einem deterministischen, mechanistischen Weltgeschehen aus, von der Vorstellung, dass alles einer linearen Kausalitätskette von Ursache und Wirkung folge und bei genauer Kenntnis der Ausgangsgrößen künftige Gegebenheiten exakt vorausgesagt werden könnten. Außerdem postuliert sie die Auffassung, dass die rein objektive Erforschung eines physikalischen Problems möglich wäre und die forschende Person und deren Bewusstsein keinerlei ungewollten Einfluss auf das experimentelle Ergebnis hätte. Henry Stapp, theoretischer Physiker am „Lawrence Berkely National Laboratory“, Kalifornien, brachte das Credo dieser Physik in einem Interview auf den Punkt: „Die klassische Weltsicht sagt aus, dass bei der Geburt des Universums alles einfach vorherbestimmt wurde und sich seither nur mechanisch vorwärts wälzt.“ („EnlightenNext“, 34/2010) Zudem ist es der Klassischen Physik zufolge möglich, jedes zu untersuchende Objekte zu zerlegen und aus den Einzelteilen das Wesen des Ganzen zu ergründen. Für einen freien Willen, der in das Weltgeschehen hineinwirkt, oder für die Einflüsse eines Bewusstseins, bietet eine solche Weltsicht keinen Platz.
Durch die Quantenphysik hat sich das geändert. Denn man fand unter anderem heraus, dass in der Welt des Allerkleinsten jede Messung, jede Beobachtung das Messergebnis beeinflusst. Überhaupt scheint die materielle Welt bei der Suche nach den winzigsten Materieteilchen in Nichts zu zerfließen. Irgendwann geht es nur noch um Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten, um die Beziehungen oder Wechselwirkungen, die zwischen den Teilchen bestehen. „Die Materie ist nicht aus Materie aufgebaut“, bringt es der bekannte Stuttgarter Quantenphysiker Hans-Peter Dürr in seinem Buch „Auch die Wissenschaft spricht nur in Gleichnissen“ auf den Punkt. Und er formuliert: „Die neue Weltsicht ist im Grunde holistisch, nicht atomistisch: es existiert eigentlich nur das Eine, das Ungetrennte, Untrennbare.“
Die revolutionäre Vorstellung, dass alles mit allem in Verbindung steht oder dass es einen „Raum von Möglichkeiten“ gibt, aus dem erst unter dem Einfluss von Bewusstsein die konkrete materielle Wirklichkeit „gerinnt“, bedingt einen Paradigmenwechsel der Sonderklasse. Die bisher gültigen, grundlegenden Rahmenbedingungen für wissenschaftliche Theorien sind in Frage gestellt. Wenn man aber bereit dazu ist, dies – wenigstens als Hypothese – zu akzeptieren, tun sich völlig neue Möglichkeiten auf, die Wirkungen von Gedanken und Bewusstsein auf die physische Welt zu erklären.
Freilich: Diesbezügliche Aussagen bewegen sich nicht immer auf gesichertem Terrain, aber Denkansätze, wie sie beispielsweise der saarländische Biologe und Quantenphilosoph Dr. Ulrich Warnke ins Spiel bringt, sind zweifellos faszinierend.
Wir werden uns später ausführlicher mit der Geschichte des heute vorherrschenden materialistischen Weltbildes befassen und die kritische Frage stellen, ob es überhaupt noch eine solide Grundlage für weiterführende wissenschaftliche Arbeiten bilden kann, vor allem, wenn es um das Wesen der Gedanken oder unseres Bewusstseins geht.
Ulrich Warnke gehört jedenfalls zu jenen Forschern, die mit einem klaren Nein auf diese Frage antworten. Für ihn steht nicht die Materie im Zentrum, sondern das Bewusstsein. „Ohne Bewusstsein existiert nichts“, formuliert er in seinem Buch „Quantenphilosophie und Spiritualität“. „Alles, was wir über die Welt wissen, alles, was unsere Welt ausmacht, ist an ein menschliches Bewusstsein gebunden. […] Folglich ist es ein Fehler, wenn wir Information und Bewusstsein einerseits und Spiritualität und Geist andererseits als vermeintlich unwissenschaftlich aus den Naturwissenschaften verbannen.“
Der Mann, der das sagt, hat etwas von einem Universalgelehrten (sofern die heutige wissenschaftliche Vielfalt und Tiefe die Verwendung eines solchen Begriffs überhaupt noch gestattet). Ulrich Warnke studierte Biologie, Physik, Geographie und Pädagogik und hatte als Universitätsdozent unter anderem Lehraufträge für Biomedizin, Biophysik, Umweltmedizin, Physiologische Psychologie und Psychosomatik sowie Bionik. Er forscht seit vielen Jahrzehnten auf dem Gebiet der Wirkungen elektromagnetischer Schwingungen und Felder auf Organismen, ist ein Kritiker der ausufernden Mobilfunk-Technologie, leitet eine Arbeitsgruppe „Technische Biomedizin“, ist Erfinder, „akademischer Oberrat“ an der Universität des Saarlandes und Gründungsmitglied der „Gesellschaft für Technische Biologie und
Bionik e. V.“
Seit einigen Jahren bildet die Quantenphilosophie einen Schwerpunkt seiner Arbeit, zu dem er bereits zwei vielbeachtete Bücher (2011 und 2013) veröffentlich hat.
Darin beschäftigt er sich unter anderem mit der spannenden Frage, wie das menschliche Bewusstsein, wie die Gedanken und Gefühle, die es erzeugt, in die materielle Welt hineinwirken. Warnke geht davon aus, dass das Bewusstsein den Körper benutzt,
„um Erfahrungen (Beobachtungen) zu machen. Die Körperkonstruktion dient dabei nur als Werkzeug, so wie wir Teleskope benutzen, um die Sterne im Weltraum zu betrachten. In Wirklichkeit sind wir reiner Geist in einem Messinstrument namens Körper. Erfahrungen zu machen ist ein Spiel von kosmischem Ausmaß. Die materielle Welt ist die Bühne oder das Spielfeld. Die Naturgesetze sind die Spielregeln.“
Zweifellos ist das eine andere Sprache, als man sie heute üblicherweise von Wissenschaftlern hört. Materialistisch orientierten Forschern, die die Welt als komplexe Maschine betrachten und ergründen wollen, wird eine solche Sicht der Dinge – vorsichtig ausgedrückt – überaus suspekt erscheinen. Doch sie ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern beruht im wesentlichen auf einer weitreichenden Interpretation von Beobachtungen im Bereich der Quantenphysik, denen zufolge Materie abhängig von Bewusstsein, also von Geist ist.
„Sie beschreibt die Materie als immaterielle Bewegung sich überlagernder Möglichkeiten, die erst durch unsere Aufmerksamkeit eine physische Form erhalten. Diese Deutung verändert unser Weltbild, weil sie den Begriff der Materie um eine geistige Komponente erweitert“, formuliert die Berliner Philosophin Nathalie Knapp in ihrem Buch „anders denken lernen“ jene Grundlagen, auf denen quantenphilosophische Überlegungen beruhen. Eine Basis, die sich auch als Brücke von der Forschung zur Spiritualität eignen könnte.
Es muss also nicht überraschen, wenn Ulrich Warnke im folgenden Gespräch über die Verbindung von Bewusstsein und Materie unter anderem auch seiner Überzeugung Ausdruck verleiht, neue wissenschaftliche Erkenntnisse würden sich bereits absehbar mit alten Weisheitslehren treffen und gemeinsam einen Schlüssel zu vielen Geheimnissen des menschlichen Seins formen.
Herr Dr. Warnke, es gibt zahlreiche Belege dafür, dass unsere Gedanken in Verbindung mit Empfindungen das Wohlbefinden maßgeblich beeinflussen – Stichwort Psychosomatik. Welche Mechanismen liegen dieser Wirkung aus Ihrer Sicht zugrunde?
Warnke:
„Wir können ein ganz einfaches Beispiel aus dem täglichen Leben nehmen: Ich rede jetzt. Mein Geist, als Wille, steuert dabei Materie, in jedem Augenblick meines Lebens, jedenfalls im Alltagsbewusstsein. Man kann nun sozusagen „hinunter marschieren“, sich also fragen: Was passiert elementar dabei? Man weiß, dass die Nerven und Muskeln verantwortlich dafür sind, dass ich reden kann. Damit Muskeln kontrahieren, müssen Membrane für bestimmte Minerale durchlässig gemacht werden, es entstehen also sogenannte „Aktionspotentiale“.
Damit sich Membrane verändern können, sind Proteine nötig, also Moleküle mit bestimmten Bindungen. Ich muss also mit meinem Geist, mit meinem Willen, in diese Verbindung hineinwirken, damit die Proteine in der Membran sich so ändern, dass ein Aktionspotential entstehen kann. Das heißt mit anderen Worten: Jeder Gedanke, der mit einem Gefühl verbunden ist – denn die Gefühle sind die hauptsächlichen „Schalter“ –, verändert Molekülbindungen.
Nun kommt etwas Interessantes: Man weiß inzwischen, dass Elektronen dafür maßgeblich sind. Diese Elektronen haben eine Eigenschaft, nämlich ein Rotationsmoment, „Spin“ genannt. Und genau diesen Spin der Elektronen kann ich mit meinem Bewusstsein verändern, so dass ich Materie beeinflussen kann. Und das gezielt zu tun, kann ich lernen.
Um auf die Psychosomatik zurückzukommen: Gedanken können die Materie zum Beispiel in Richtung Heilung verändern. Wichtig ist dabei, dass mein Körper eine Gewissheit haben muss, ein körpereigenes Wissen. Der feste Glaube an etwas kann eine Gewissheit erzeugen. Gewissheit entsteht durch Gefühle, nämlich Zuversicht oder Erwartung. Und diese Gefühlsmomente sind wiederum notwendig, damit die Information abgerufen wird, die sich ursprünglich aufgebaut hat, nämlich Gesundheit.“
Vermutlich erklären Sie so auch die Wirkung des Placebo-Effekts …
Warnke:
„Ja, aber es gibt nicht nur den Placebo-Effekt – „Ich werde gefallen“ –, sondern es gibt ja auch den Nocebo-Effekt – „Ich werde schaden“. Es kommt darauf an, welche Gefühle ich investiere. Wenn ich die Gewissheit habe – das körpereigene Wissen – dass ich heil werde, wenn ich also Gefühle der Zuversicht investieren kann, dann passiert das auch. Ich muss aber ganz sicher sein, mein Glaube darf keinen Zweifel beinhalten, sonst funktioniert das nicht. Es gibt dazu hervorragende Versuche, Doppelblindversuche, die immer wieder zeigen, dass tatsächlich meine Gedanken und die dabei investierten Gefühle die Heilung in Gang setzen – oder aber den Schaden, also auch die weitere Krankheit.“
Welche Schlussfolgerungen für die Heilkunde könnte, sollte man daraus ziehen?
Warnke:
„Nach meiner Ansicht wird dieses Potential nicht genügend genutzt. Ich kann nicht nur durch „Robotermedizin“ eine Heilung bewirken, denn Heilung ist eine Angelegenheit des Körpers selbst mit dem Geist, der dort investiert. Und ganz sicher ist der sogenannte Placebo-Effekt Hauptbestandteil der Heilung. Untersuchungen, in der Schweiz zum Beispiel, haben klar gezeigt: Nicht die eingesetzten Drogen oder Medikamente, nicht die eingesetzte physikalische Therapie war das Entscheidende, sondern das Vertrauen des Patienten in den Arzt, der sichere Glaube daran, dass dieser Arzt heilen kann.“
Welche Wirkungsmechanismen gibt es dabei? Welche Rolle spielt das Bewusstsein überhaupt, was bewirkt der Mensch als Geist?
Warnke:
„Ich will jetzt etwas Provokatives sagen, es wird mir aber niemand widerlegen können, nämlich: Wir können von dieser Welt nichts wissen, aber auch wirklich gar nichts wissen ohne die Funktion unseres Bewusstseins. Das heißt, alles, was wir kennen, alles, was wir sehen, alles, was wir bemerken, ist immer und ausschließlich durch die Brille eines menschlichen Geistes gelaufen, der ein Bewusstsein hat. Und wenn es nicht über mein Bewusstsein gelaufen ist, dann ist es über ein anderes menschliches Bewusstsein gelaufen, und ich habe mich dem angeschlossen.
Was ist Bewusstsein? Bei dieser Frage müssen wir unterscheiden: Es gibt ja nicht nur das Bewusstsein, wie es uns im Alltag immer wieder begegnet, sondern es gibt auch das Unterbewusstsein. Es ist längst bekannt, dass das Unterbewusstsein die Hauptfunktionen des Körpers steuert, nämlich 95 Prozent seiner Tätigkeit, und dass eben nur einen ganz kleiner Teil über das Bewusstsein läuft.
Das Bewusstsein setzt ein Ziel, analysiert, das Unterbewusstsein steuert aber alle Funktionen. Wir können Bewusstsein für uns als Schalter definieren, der Informationen in den Körper, in die Materie schafft. Das Unterbewusstsein begegnet uns dabei hauptsächlich im Traum, wobei wir mit diesem Unterbewusstsein viel breitere Möglichkeiten der Wahrnehmung haben als mit dem Alltagsbewusstsein. Es sieht so aus, als wäre da ein Schlüssel, wie wir unsere Wahrnehmung erweitern können. Wenn es nämlich gelingt, über das Unterbewusstsein und den Traum mehr Information in unseren Körper zu steuern als uns bisher üblicherweise in unserer Kultur beigebracht worden ist, dann würden sich enorme Perspektiven eröffnen. Dafür bietet sich der luzide Traum an.
Luzid bedeutet: Ich weiß, dass ich träume, und ich kann den Traum mit dem üblichen Tagesbewusstsein steuern – zum Beispiel in Richtung Heilung oder Schmerzlinderung. Ich kann mir aussuchen, was ich erlebe, weil ich es steuern kann. Und es kommt gar nicht drauf an, ob das jetzt eine Halluzination ist oder eine Vision, sondern die Erfahrung die mein Körper damit macht ist entscheidend. Diese Erfahrung behalte ich selbst dann noch, wenn ich diesen luziden Traum abstelle, weil er ja in die Materie hineingewirkt hat. Möglicherweise kann man in Zukunft Heilungen mit Hilfe dieses Mechanismus stark forcieren.“
Angenommen, dieses Potential, mit Hilfe des Unterbewusstseins unser Wohlergehen bewusst beeinflussen zu können, ist natürlich in uns angelegt – warum kommen wir dann so schwer in diese erweiterten Wahrnehmungen hinein?
Warnke:
„Unser Gehirn besteht, ganz einfach gesprochen, aus zwei Abteilungen, einem von der Evolution her uralten Teil, das ist das sogenannte ‚limbische System‘, das die Materie auf Grund der angeborenen Gefühle steuern kann. Auf der anderen Seite haben wir einen evolutionär neueren Teil des Gehirns, den sogenannten ‚Neokortex‘. Dieser Neokortex ist für Vernunft, für Analyse verantwortlich. Er sagt dem anderen Teil, wie er sich benehmen soll. Er zensiert das limbische System. Dieses System steht in direkter Verbindung mit einer kleinen Drüse, die genau im Mittelpunkt des Gehirns sitzt, der ‚Zirbeldrüse‘.
Wenn jetzt Gefühle entstehen, entweder angeborenerweise oder weil ich gefühlsmäßig auf meine Umgebung reagiere, dann werden durch die Zirbeldrüse körpereigene Drogen freigesetzt, die mir auch den Zugang zur sogenannten Metawelt oder Anderswelt öffnen können. Aber der Neokortex sagt: „Geh nicht zu häufig in diese Drogenausschüttung rein, sondern mache das, was der Alltag für dich darstellt.“ Aber es gibt einen Mechanismus, bestimmte Methoden, um den Neokortex zwar nicht abzuschalten, aber in der Aktivität zu hemmen und damit die Zensur zu unterbinden – und auch die plappernden Gedanken, die uns dauernd überfallen. Damit fällt weg, dass wir nur noch über die Vernunftebene handeln Mit Hilfe dieser körpereigenen Drogen, die nun verstärkt wirken können, haben wir wieder mehr Kontakt mit der Metawelt, womit wir den Erlebnissen des luziden Traumes schon sehr nah sind.
Früher hatten die Völker viel mehr Übung und Lernfähigkeit in Richtung „Neokortex abschalten“, das gehörte zu deren Leben. Aber wir wissen heute, dass es durch die Neuroplastizität des Gehirns möglich ist, auch in dieser Richtung durch regelmäßiges Üben zu lernen. Das könnte künftig eine Methode sein, Heilungsmechanismen in Gang zu setzen.
Theo Löbsak hat im 20. Jahrhundert den Menschen einmal als einen „Irrläufer der Evolution“ bezeichnet – eben deshalb, weil es offenbar zu einer Überentwicklung des Neokortex gekommen ist, durch die sich der Mensch selbst gefährlich werden kann. Das fügt sich gut zu dem, was Sie sagen: Wohl durch dieses überproportionale Wachstum sind wir im Vergleich dazu, was wir erleben könnten und gegenüber erweiterten Wahrnehmungsmöglichkeiten gehemmt. Sehen Sie jetzt eine Trendumkehr?
Warnke:
„Ja. Wir werden dieses Erleben eines übermäßigen Neokortex erst einmal hinter uns bringen müssen, damit etwas Neues entstehen kann. Das geht immer in einer Art Sinuskurve: Wir müssen erst einmal übermäßig etwas erfahren haben, um zu merken, dass wir zurück oder in eine andere Sphäre wechseln sollten. Dann wird entsprechend gegenkompensiert – bis diese Gegenkompensierung zu stark wird, und es wieder in eine neue, möglicherweise abermals falsche Richtung geht. Nur so kann sich aber Evolution vollziehen. Es muss immer etwas erkannt werden, das falsch läuft, damit gegengesteuert wird. Und ich glaube, genau das passiert jetzt.
Der Neokortex hat die Oberhoheit über unseren Körper bekommen. Es geht nur noch um Vernunft, um Analyse und um Ziele, die uns schaden, während das eigentlich Vitale in uns, das Erfahrungsammeln mit Hilfe von Empfindungen, zu wenig berücksichtigt ist. Es wird jetzt umgeschaltet werden.“
Sie haben ein beeindruckendes Buch mit dem Titel „Quantenphilosophie und Spiritualität“ geschrieben. Die Quantenphysik ist momentan ja in aller Munde. Man hat dabei den Eindruck, dass rundum schon alles „quantelt“, dass dieser Begriff für alles und nichts verwendet wird. Können Sie, auch als Untermauerung zu unserem Thema „Gedanken und Bewusstsein“, beschreiben, was aus Ihrer Sicht die wichtigsten Schlussfolgerungen aus der Quantenphysik sind? Was ändert sich im Weltbild im Vergleich zur Klassischen Physik? Und vor allem: Was ändert sich für unser Menschenbild?
Warnke:
„Es stimmt, der Begriff Quantenphysik wird inflationär benutzt. Es ist wirklich schlimm, wie viele Menschen dieses Wort in den Mund nehmen, ohne eine Ahnung davon zu haben. Über die wesentlichen Erkenntnisse aus diesem Bereich könnten wir schon seit mehr als 60 Jahren Bescheid wissen, aber sie werden nicht kolportiert, das heißt, die Medien haben dieses Wissen bisher zu wenig in die Gesellschaft gebracht. Nach heutiger – ich sage einmal vorsichtig: mehrheitlicher – Anerkennung geht es um folgende Zusammenhänge: Alles, was wir sehen, was wir Materie nennen, besteht aus Massen. Massen haben ein Gewicht, sie unterliegen der Schwerkraft; Elektronen haben eine Masse, Atomkerne haben eine Masse, alles besteht aus Atomkernen und Elektronen. Aber es gibt einen Raum zwischen Atomkern und Elektron, und der ist riesengroß. Wenn Sie den Atomkern so groß wie einen Fußball annehmen, 20 Zentimeter, dann wäre im Falle des Wasserstoffatoms das nächste Elektron in zehn Kilometer Entfernung. Das ist also ein Riesenraum, und der füllt auch uns fast vollständig aus. Zu 99 Komma – und jetzt kommen weitere neun Neunen – Prozent unseres Raumvolumens bestehen wir aus diesem masseleeren Raum. Es gibt keine Masse darin. Oder umgekehrt: Nur zu Null Komma – und jetzt kommen acht Nullen und dann eine Eins – Prozent bestehen wir aus Massen. Das ist ein so geringer Prozentsatz, dass man ihn eigentlich vergessen könnte.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Wenn wir schon vollständig aus so genanntem Vakuum bestehen – so heißt der Leerraum in der Physik – was steckt da eigentlich drin? Und hier gibt es ein Modell in der Quantenphysik – es heißt die „Kopenhagener Deutung“ –, das davon ausgeht, dass dieser Raum voll ist von Energie und Information, aber – und das ist jetzt wichtig – als sogenannte Virtualität, als Möglichkeit. Und diese Information, diese Energie, wartet darauf, in die Realität geschaltet zu werden.“
Mit dem „In-die-Realität-Schalten“ meinen Sie, dass aus dem allgemeinen Raum der Möglichkeiten eine konkrete Wirklichkeit entsteht, die wir sinnlich wahrnehmen können …
Warnke:
„Realität ist für uns westliche Menschen – in der östlichen Philosophie sieht es etwas anders aus – das, was mit Kräften arbeitet und mit Zeitoperationen. Was heißt das? Wenn wir ein Messgerät aufstellen, dann wird eine Energie übertragen, es entsteht eine Kraft, es ist etwas vorhanden – Realität. Und weil dieses Vorhandene anders aussieht als das vorher, sagen wir, es ist „Zeit vergangen“.
Kräfte entstehen immer erst an Massen, Zeit entsteht immer erst an Massen. Wir nennen diese Kraftoperation und diese Zeitoperation Realität. Man mag nun fragen: Ja, wer schaltet denn aus dem Virtuellen, aus dem Möglichen, in die Realität?
Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges: Die „Kopenhagener Deutung“ sagt, es ist eine Beobachtung, der damit verbundene Messvorgang selbst.
Diese Beobachtung ist an ein Geben von Sinn und Bedeutung gekoppelt. Eine Maschine kann das nicht. Wer aber gibt nun Bedeutung? Menschen oder andere Lebewesen – ein Bewusstsein ist notwendig! Wieder sind wir beim Bewusstsein. Wir geben Sinn und Bedeutung auch aus dem Unterbewusstsein – mit Gefühlen. Das ist sogar der Sinn der Gefühle.“
Die sinnlich wahrnehmbare Realität entsteht demnach durch das Einwirken von Bewusstsein.
Warnke:
„Wenn wir einer Beobachtung Sinn und Bedeutung gegeben haben, passiert etwas sehr Eigenartiges: Aus allen Möglichkeiten – das ist eine Überlagerung, ein Rauschen von allem Möglichen – entsteht eine sogenannte Entität. Man spricht vom „Kollabieren der Möglichkeiten“. Entität heißt das, was ein Sein hat, was die Information für eine Kraftübertragung darstellt. Damit sind wir soweit, dass wir etwas messen können, jetzt haben wir Realität.
Also, zusammengefasst: Die Quantenphysik, im speziellen Fall die Quantenmechanik, sagt: Es gibt ein „Meer aller Möglichkeiten“, sprich: den Vakuumbereich – wobei das ist ein schlechter Ausdruck ist, weil Vakuum immer ganz leer wirkt, aber der Raum ist ja voll von virtueller Energie. Und sobald wir aus diesem Meer aller Möglichkeiten eine Möglichkeit herausfischen, die wir mit Sinn und Bedeutung erkannt haben, entstehen Teilchen. Wir nennen diese Teilchen Quanten – es kann sich um Photonen handeln, oder um Gluonen, da gibt es viele Teilchen. Nun werden Kräfte übertragen, es entsteht Realität. Wichtig ist: Dieses Vakuum, sprich: das Meer aller Möglichkeiten, ist auch in uns. Wenn man es aus unserem Körper rausnehmen würde, blieben nur etwa 20 Mikrometer übrig. Man müsste uns mit dem Mikroskop suchen … Unser Übergewicht würden wir leider trotzdem behalten, weil die Massen ja da drin sind …“
„Vakuum raus“ steht als Diät wohl schon deshalb nicht zur Diskussion, weil das „Meer der Möglichkeiten“ ja nicht auf einen menschlichen Körper beschränkt sein kann.
Warnke:
„Ja, das Vakuum jedes unserer Körper geht fließend über in diesen Raum, dieser Raum geht fließend über in die Atmosphäre der Erde, fließend über in den ganzen Kosmos, ins ganze Universum. Der Raum des Universums, einschließlich meines Innenraums, ist identisch mit dem Meer aller Möglichkeiten. Und sobald ich etwas in die Realität geschaltet habe, ist es registriert von dieser universellen Speicherplatte, in der alles mit allem verbunden ist, und die Muster meiner Realität bleiben erhalten.
Man spricht diesbezüglich, – als Modell – von einer „Musterordnung der X-Teilchen“; man denkt, dass diese Information über „X-Teilchen“ repräsentiert wird. Was immer ich also durch mein Bewusstsein als Realität einspeichere, hier und jetzt, verbreitet sich sofort, quasi instantan, weil es keine Zeit gibt, ins ganze Universum. Und an jedem Ort des Universums könnte ich diese Information wieder herausholen und zu Kräften werden lassen.“
Sie zitieren diesbezüglich in Ihrem Buch den amerikanischen Physiker Jack Sarfatti, der sagt: „Mit jedem Gedanken, jeder Handlung beschreiben wir nicht nur unsere eigene kleine Festplatte, sondern speichern auch etwas im Quantenuniversum ab, was unser irdisches Leben überdauert.“ Kann man daraus, vereinfacht gesagt, folgern, dass unsere Gedanken, Gefühle und Empfindungen eine Wirkung haben, die über den eigenen Körper hinausreicht? Und dass damit auch unsere Gedanken mit einer großen Verantwortung verbunden sind?
Warnke:
„Absolut. Alles, was wir einspeichern, bleibt für immer erhalten. Was wir in die Realität geführt haben, kann diesseits, in der Materiewelt, gelöscht werden, aber im Meer aller Möglichkeiten ist es weiterhin vorhanden. Und damit ist eine Riesenverantwortung für die Menschheit verbunden.
Dafür gibt es inzwischen auch recht gut fundierte Experimente. Das „Global Conciousness Project“ [Anm.: mehr darüber finden Sie im Kapitel 3] zeigt beispielsweise: Immer dann, wenn viele Menschen gleichzeitig bestimmte Gefühle investieren, verändert sich die Elektronik, sprich die Elektronen. In einem Zufallsgenerator ist dann kein allgemeines Rauschen mehr da, sondern es geht in Richtung positiver oder negativer elektrischer Impuls.
Es gibt inzwischen sehr konkrete Hinweise, dass unsere Gedanken, die Gefühle, die wir innerhalb dieser Menschheit investieren, andere Menschen beeinflussen, die Natur beeinflussen, und dass diese Wirkung über die Generation hinaus besteht. Denn für diese universelle Speicherplatte gibt es ja keine Zeit, es ist alles gleichzeitig vorhanden. Das heißt, sie wird immer stärker formiert und kann auch entsprechend wieder abgerufen werden. Je unverantwortlicher wir mit diesem Prinzip umgehen, umso schlechter sieht es für die Menschheit aus.“
Insofern bedeutet die immer wieder zitierte Aussage der Quantenphysik, daß alles mit allem in Verbindung steht, also nicht nur eine Verbindung über den Raum, sondern auch zwischen Vergangenheit und Zukunft …
Warnke:
„Ja, ganz eindeutig ist das so. Außerdem ist folgendes interessant: Wie gesagt, nimmt das Unterbewusstsein, also der Teil in uns, der eigentlich alle Körperfunktionen steuert, 95 Prozent der Tätigkeit ein. Nur fünf Prozent laufen über die Gedanken, also über das Alltagsbewusstsein. Und jetzt kommt etwas sehr Spannendes: Es gibt inzwischen Physiker, die ein Modell geschaffen haben, das besagt, dass diese 95 Prozent, die das Unterbewusstsein repräsentieren, identisch sind mit den 95 Prozent der Energien im Universum, die als „dunkle Energie“ und „dunkle Materie“ bezeichnet werden. Die beiden zusammengenommen, dunkle Energie und dunkle Materie, machen 95 Prozent aller Energien aus; das, was wir bisher als so wichtig betrachtet haben, was wir sehen können, also die elektromagnetische Energie, nimmt nur fünf Prozent ein. Das ist ein neuer Ansatz, die Welt zu betrachten. Ich glaube, ein sehr erfolgreicher.“
Sie haben vorhin die Notwendigkeit angesprochen, Verantwortung wahrzunehmen? Haben Sie dafür konkrete Empfehlungen?
Warnke:
„Wenn wir diesen Mechanismus – den ich versuchte zu skizzieren und der sehr vereinfacht dargestellt ist, aber als Modell recht gute, plausible Grundlagen hat – kennen und ernst nehmen wollen, dann müssten wir, um uns selber nicht zu schaden, ein anderes Leben führen als das, was im Augenblick gesellschaftlich – ich sage wieder: mehrheitlich – anerkannt ist.
Wir würden versuchen, Empfindungen zu investieren, die die Materie aufbauend schalten, auch im Hinblick auf Heilung und Gesundheit, und die uns dementsprechend mehr Freude bringen können. Das, was wir damit geschafft haben – mehr Freude in die Welt zu bringen –, würde eingespeichert sein und mehrheitlich auch für nachfolgende Generationen zur Verfügung stehen.
Diese Verantwortung wahrzunehmen, würde uns sogar selbst guttun, und wir würden sie gerne wahrnehmen, wenn wir denn erkannt hätten, worum es geht. Es zeigt sich, dass die Evolution zunächst mehr oder weniger neutral gehandelt hat, was unsere menschliche Entwicklung anlangt. Es gab Völker, die im Hinblick auf die vorhin skizzierte Bedeutung des limbischen Systems, der Zirbeldrüse und der körpereigenen Drogen die Innenwelt verstärkt gesehen haben. Dann kam die Technik. Die hat uns genau in die falsche Richtung geführt, nämlich in die der analytischen Vernunft. Dabei haben wir nicht berücksichtigt, wie die Welt sich ändert, wenn wir ohne Empfindungen und ohne ausreichenden Kontakt zur Innenwelt nur noch auf Vernunftbasis arbeiten. Im Augenblick sind wir gerade wieder an einem Punkt angelangt, an dem viel schiefgeht, wo das Wissen um diese zweite Hälfte des Menschseins, die eigentlich im Gleichgewicht mit der anderen stehen sollte, immer dringender nötig ist.
Aber so läuft es. Je tiefer wir absinken, als umso wichtiger wird die andere Seite wiedererkannt werden. Inzwischen gibt es aus dem engeren Kreis der Physiker genügend Beispiele für die Beschreibung dieser neuen Welt. Ich denke, dass etwas passiert, sozusagen ein Paradigmenwechsel, von dem die Menschheit profitieren wird.“
In Ihrem neuen Buch „Quantenphilosophie und Interwelt“ beschäftigen Sie sich auch mit praktischen Nutzanwendungen dieser neuen Weltsicht. Was raten Sie?
Warnke:
„Eine praktische Anwendung tut einfach not. Wir müssen wieder etwas üben, das wir in unserer Gesellschaft bisher vernachlässigt haben, nämlich die Gedanken weitgehend abzuschalten, den Zensor des limbischen Systems zu stoppen, um dem Ursprung unserer Gefühle wieder eine größere Bedeutung zu geben. Wir können für die Zukunft lernen, diesen Mechanismus so einzustudieren, dass er genauso gewohnt wird wie unser heutiges tägliches Erleben in einer immer mehr technisch bestimmten Welt. Das funktioniert, wie man weiß, nach 14 Tagen. Wenn ich etwas übe, wie autogenes Training zum Beispiel, dann habe ich nach 14 Tagen ungefähr den Mechanismus automatisch drin. Wenn wir uns also eine Art Meditation – und es gibt weitere Methoden, es muss nicht Meditation sein – angewöhnen, dann kommen wir auch an Informationen heran, an die wir im Augenblick gar nicht denken können.
Das heißt, wir holen aus dem Meer aller Möglichkeiten – so nenne ich dieses Bewusstseinsfeld des Universums, das ja schon viele Erfahrungen von uns eingespeichert hat. Wir können ebenso auch vom Unterbewusstsein reden. Wir holen also aus diesem Feld etwas in uns hinein, was wir dann konkret umsetzen können. Man nennt das auch die Glaubenswelt. Es geht dabei aber um viel mehr als einfachen Glauben, es geht um etwas, das dann mit Kräften in uns hineingeschaltet wird.“
Das klingt so, als ob sich alt, vor allem östliche Weisheitslehren mit naturwissenschaftlichen Ansätzen treffen …
Warnke:
„Ja. Übrigens hat auch der Dalai Lama genau dieses Ziel: Er trifft sich mit Wissenschaftlern und versucht, Gemeinsamkeiten zwischen der Quantenphysik und den alten Traditionen herauszufiltern. Ich würde diesbezüglich auch die Alchemie erwähnen. Sie ist eine uralte Tradition, die geheim gehalten wurde, weil sie sehr viele Möglichkeiten beinhaltet, mit denen man auch Schlechtes anstellen kann. Aber wenn eine bestimmte Reife in die Gesellschaft kommt, werden wir genau diese alten, traditionellen Methoden wieder erwecken, um sie für uns nützlich zu gestalten.“
Erster Ausflug in das Reich des Glaubens
1941 formulierte Albert Einstein in einem Aufsatz mit dem Titel „Naturwissenschaft und Religion“ seine Ansicht über den Bezug des Glaubens zum Wissen: „Ein Bild mag dieses Verhältnis veranschaulichen: Naturwissenschaft ohne Religion ist lahm, Religion ohne Naturwissenschaft ist blind.“ (Zitat aus „Physik und Transzendenz“, 1986)
Freilich sprach Einstein mit dem Begriff „Religion“ keine bestimmte Konfession an, und auch nicht den Glauben an Wunder oder ähnliches. Aber er war davon überzeugt, dass eine streng wissenschaftliche Gesinnung, die „durch und durch von dem Streben nach Wahrheit und Erkenntnis erfüllt ist“, von einer Glaubensquelle gespeist werden müsse, die auf religiösen Gebiet entspringt. Und er sah die Ursache aller Konflikte zwischen Naturwissenschaft und Religion in verhängnisvollen Irrtümern, die nicht zwangsläufig zu bestehen brauchten.
Es wäre im Sinne einer einfachen, ungeteilten Wahrheitssuche ja wirklich erfreulich, wenn Brücken zwischen Glaubensinhalten – die sich, so Einstein, „mit der Bewertung des menschlichen Denkens und Tuns“ befassen – und wissenschaftlichen Erkenntnissen – die „von realen Tatsachen und Beziehungen zwischen ihnen“ sprechen – gebaut werden könnten. Vielleicht erweisen sich die Denkansätze, die sich aus der Quantenphysik ergeben, als geeignet dafür.
Die Frage nach dem Wesen der Gedanken oder überhaupt nach der menschlichen Innen- oder Seelenwelt ist jedenfalls naturgemäß auch eine religiös-spirituelle.
Unternehmen wir an dieser Stelle daher einen kurzen Ausflug in das Reich des Glaubens und gehen wir – im Sinne des traditionellen Menschenbildes – von der Existenz einer immateriellen Seele aus. Wenn diese der Träger von Bewusstsein wäre – welche Funktion hätte das Gehirn dann? Gibt es ein plausibles Alternativ-Szenario zu der Annahme, unser Ich würde durch das Gehirn generiert, ein Szenario, das aber die offensichtlichen Zusammenhänge zwischen dem neuronalen Feuer in unserem Schädel und den Bewusstseinsleistungen mit umfasst?
Im wesentlichen bieten sich wohl nur zwei Möglichkeiten an: Entweder das Gehirn erzeugt Bewusstsein – womit wir vor dem „Qualia-Problem“ stehen –, oder es vermittelt Bewusstsein nur. Nach diesem Modell, das heute vor allem von Sterbeforschern und spirituell orientierten Menschen vertreten wird, kann Bewusstsein grundsätzlich auch außerhalb der körperlichen Begrenzungen bestehen. Sofern es aber im physischen Umfeld funktionieren, also in der Lage sein soll, Eindrücke aufzunehmen und Willensentschlüsse zu etablieren, braucht das immaterielle Bewusstsein ein materielles Werkzeug, das seinen Ansprüchen gerecht wird – eben das Gehirn. Ist dieses – aus welchen Gründen auch immer – geschädigt oder nicht voll funktionstüchtig, dann kann natürlich auch nur unvollkommen Bewusstsein vermittelt werden. Krankheiten wie Schizophrenie oder der teilweise Verlust des Ichs könnten auch nach diesem unkonventionellen Konzept eine Erklärung finden.
Das Gehirn wäre aus dieser Sicht also ein Empfangsorgan, welches das immaterielle Bewusstsein empfängt und an den Körper überträgt; gleichzeitig aber auch ein Sendeorgan, weil es körperliche Reize oder Sinneseindrücke an das Bewusstsein vermittelt.
Demnach würde das menschliche Bewusstsein nicht aus dem Körper entstehen, sondern sich diesem nur anschließen – wodurch ein Vorgang im Raum steht, der in spirituellen Kreisen als „Inkarnation“ bezeichnet wird, als Eintritt der Seele „in das Fleisch“. Mit diesem Eintritt entwickelt sich das körperbezogene Tages- oder Wachbewusstsein, durch das der Mensch sein Ich definiert und das eng an die sinnlichen Wahrnehmungen und das Gedächtnis gekoppelt ist.
Prinzipiell aber könnte das menschliche Bewusstsein aus dieser Sicht als frei und unabhängig von der körperlichen Begrenzung betrachtet werden; es müsste nicht mit dem physischen Körper vergehen. Und es wäre auch nicht weiter verwunderlich, wenn Menschen schildern, in Todesnähe ihren Körper bewusst von oben beobachtet zu haben. Denn diesem Konzept zufolge würde nur die enge Bindung der Seele an den Körper und an das Gehirn das Erleben eines erweiterten Bewusstseins verhindern. Dagegen könnte man die Wirkung der von Ulrich Warnke angesprochenen körpereigenen Drogen – ebenso wie die Stimulation bestimmter Hirnregionen – so erklären, dass sie zu einer „Lockerung“ der Bindung des Bewusstseins an den Körper führen und eben dadurch Kontakte zur „Anderswelt“ (oder wie immer man eine Sphäre „jenseits der fünf Sinne“ nennen will) erlauben.
Auch das sogenannte Unterbewusstsein ließe sich in dieses Menschenbild zwanglos einordnen. Es wäre einfach jener Teil unseres eigentlichen, freien Bewusstseins, der nicht an das Gehirn gebunden ist, uns aber dennoch beeinflusst – etwa in Form von intuitiven Überzeugungen, Gemütswerten, Empfindungen oder auch Gewissensregungen. Interessanterweise geht der Begriff „Bewusstsein“ (lat. conscencia) auf den Begriff „Gewissen“ zurück, der wiederum mit „geistigem Wissen“ und im Sprachgebrauch mit „Geist“ und „Seele“ in Verbindung steht.
Eine solche Sicht der Dinge läuft dem modernen Welt- und Menschenbild freilich ziemlich radikal zuwider. Immerhin aber liefert sie für einige Phänomene rund um das menschliche Bewusstsein, wie zum Beispiel für sogenannte Ausleibigkeitserfahrungen, eine bildhafte Erklärung. Das „Seelenkonzept“ sollte daher nicht ganz außer Acht gelassen werden, solange es keinen schlüssigen Beweis dafür gibt, dass Bewusstsein tatsächlich auf materieller Grundlage entstehen kann.
Ein zweites Resümee: Ich erlebe, also bin ich!
Welcher Art unsere innere Natur letztlich auch sein mag, ob materieller oder immaterieller – sicher ist zunächst, dass uns das Thema Gedanken und Bewusstsein weit über Gehirnströme hinaus führt.
Unsere gedankliche Innenwelt wird nicht durch nackte, nüchterne Informationsfakten befeuert, sondern durch Empfindungen und Erlebnisse, die ihrerseits Gedanken verursachen – Erinnerungen, Wünsche, Hoffnungen, Erwartungen.
Als Resümee könnten wir also René Descartes Daseinsformel „Ich denke, also bin ich“ ohne weiteres erweitern in: „Ich erlebe, also bin ich!“