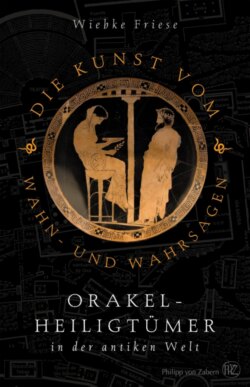Читать книгу Die Kunst vom Wahn- und Wahrsagen - Wiebke Friese - Страница 11
Ägypten
ОглавлениеAls Pharao Menkaure, der Erbauer der dritten Pyramide in Gizeh, in der Hoffnung auf eine lange Regierungszeit das Orakel von Buto befragt haben soll, erhielt er von der Göttin die Antwort, dass er nur noch sechs Jahre zu regieren hätte, im 7. Jahr aber würde er sterben (Hdt. 2,129–134). Und obwohl der Herrscher sich mit allen Mitteln bemühte, seinem Schicksal zu entrinnen, geschah es so, wie die Göttin vorausgesagt hatte – er starb im 7. Jahr nach der Verkündigung des Orakelspruches.
Diese von Herodot niedergeschriebene Begebenheit soll angeblich um das Jahr 2500 v. Chr. stattgefunden haben. Das altägyptische Orakelwesen entwickelte sich nachweislich aber erst im Neuen Reich (ab ca. 1550 v. Chr.), wobei die fast ausschließlich epigraphischen Quellen weitgehend in die ramesidische Zeit (1307–1070 v. Chr.) verweisen. Wichtigster Orakelgott Ägyptens war der Widdergott Amun. Zentrum seines Kultes und damit auch der Orakelbefragung war sein Heiligtum am Westufer des Nils in Theben. Von hier aus wurde der Kult im Laufe des 1. Jts. v. Chr. im gesamten Reich verbreitet. Neben Amun waren auch andere Götter in der Lage Orakel zu verkünden. Zu ihnen gehören Horus-khau in El-Hiba, Ptah in Memphis, Sutekh in Dakhla oder Ahmose in Abydos. Je nach Charakter und Funktion eines Gottes konnte die Thematik der Orakel variieren. Amunorakel betrafen vor allem justizielle Entscheidungen. Im offiziellen Bereich konnte dies die Besetzung einer vakanten Priesterstelle sein. Im sozial niederen Bereich ging es dabei vor allem um Eigentumsfragen, Strafmaße bei niederen Delikten oder das Festsetzen von Warenwerten. Das Orakel fungierte in diesem Kontext als endgültiges Gottesurteil, seine Entscheide wurden allgemein anerkannt und schriftlich festgehalten. Spätestens im Neuen Reich wurde das Orakel im Gottesstaat des Amun damit zu einem einflussreichen politischen Instrument.
Ganz andere Themen beschäftigten die Orakelstätten der Götter Mont, Mut oder Isis. So garantiert ein Orakel des falkengestaltigen Kriegsgottes Mont dem Bittsteller den Schutz vor verschiedenen exakt aufgelisteten Krankheiten. Frauen mit Kinderwunsch wandten sich schon in der Regierungszeit Ramses’ II. an die Göttinnen Mut oder Isis. Beim Volk besonders beliebt waren zudem die nach ihrem Tode in der 18. Dynastie vergöttlichten Freunde, der Pharao Amenhotep I. und sein Architekt Imhotep. Schon zu Lebzeiten standen sie im Rufe, weise zu sein, die kosmologische Ordnung zu gestalten und für das Wohl ihrer Untergebenen zu sorgen. Als erster König ließ sich Amenhotep ein Grab im Tal der Könige erbauen und legte damit den Grundstein für die dortige „Grabindustrie“. Imhotep wurde als sein Freund und Architekt mit dem Bau desselben beauftragt. Beide wurden besonders bei Themen angesprochen, die das unmittelbare Leben eines Individuums ansprachen: Schutz vor Krankheit, vor Kinderlosigkeit und materieller Not. Ihre einstige menschliche Existenz rückte sie dabei nicht nur spirituell, sondern auch räumlich näher an die Menschen und deren Probleme heran. So war ihre Verehrung nicht allein auf ihre Tempel beschränkt, sondern formulierte sich auch an Hausaltären oder im spontanen Gebet. Das Grab und damit der Haupttempel des Imhotep, von dem heute keine Architektur mehr erhalten ist, lag in Memphis. Erste epigraphische Hinweise finden sich im Neuen Reich und in der Spätzeit.
Wie aber befragte man einen Gott im Alten Ägypten? Ikonographische wie epigraphische Quellen weisen – je nach sozialem Status des Orakelklienten – auf zwei Hauptpraktiken hin: das prophetische Königs- und das Prozessionsorakel.
Prophetische oder Königsorakel, wie Herodot sie im oben genannten Beispiel beschreibt, waren im Alten Ägypten nur den Pharaonen vorbehalten. Bereits Königin Hatshepsut (1473–1458 v. Chr.) holte sich Rat beim Großen Thron des Amun, bevor sie auf eine Expedition nach Punt aufbrach. Thutmosis IV. (1411–1397 v. Chr.) befragte Amun in seinem Tempel nach dem Ausgang einer Schlacht gegen die aufständigen Nubier, woraufhin der Gott ihm „wie ein Vater zu seinem Sohne“ geantwortet haben soll. Umstritten ist, wie genau sich der Gott den Herrschern mitteilte. Glaubte man früher, dass etwa die Befragung durch die Königin Hatshepsut mit einer direkten Antwort des Gottes, also durch eine wie auch immer hervorgerufene göttliche Stimme, beantwortet wurde, interpretiert man heute die Textstellen dahingehend, dass Hatshepsut die Antwort in schriftlicher Form durch die Hand der Priester „vor dem Thron“, aber nicht „vom Thron“ selbst erhielt. In diesem Falle hatten die Priester genügend Zeit eine passende Antwort vorzubereiten.
Das wohl bekannteste Königsorakel Ägyptens aber wurde lange nach der Zeit der Pharaonen einem der berühmtesten Eroberer der Antike verkündet – Alexander dem Großen. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass der im Eroberungszug des Herrschers mitreisende Historiker Kallisthenes von Olynth dieses Ereignis ausführlich dokumentierte. Nachdem Alexander Ägypten eingenommen hatte, versuchte er seine Herrscherfunktion auch mythologisch zu festigen. Wie schon oft auf seinem jahrelangen erfolgreichen Feldzug praktiziert, opferte er zunächst in den wichtigsten Heiligtümern des Landes, wie etwa im Apistempel von Memphis. Im Anschluss folgte er dem Ruf des Amun und zog mit seinem Heer mehrere Tage durch die Wüste bis in die Oase von Siwa. Hier besaß der Gott ein berühmtes Orakelheiligtum, in dem er für die Pharaonen allein Antworten gegeben haben soll, die „wie die Hörner des Amun gewundenen“ waren (Servius, Vergilkommentar IV,196).
Von seinem Kommen informiert, empfingen die Priester des Tempels Alexander wie einen Pharao. Während sein Gefolge außerhalb des auf dem Hügel Aghurmi gelegenen Tempels wartete, betrat dieser allein das Allerheiligste, wo er der Statue des Gottes seine Fragen stellte, die er niemanden zuvor verraten hatte. Diodor zufolge fragte der Oberpriester ihn im Anschluss, ob er als Sohn des Amun – und damit als rechtmäßiger Herrscher über Ägypten – gekommen sei. Alexander bejahte dies und fragte ihn, ob sein Vater (Amun) ihm die Herrschaft über die Welt genehmige. Der Priester antwortete, dass Amun ihm den Wunsch mit absoluter Gewissheit gewährte. Als Alexander schließlich den Tempel verließ, sagte er zu seinen Begleitern, dass er genau das gehört habe, was er habe hören wollen. Wie aber konnte der Oberpriester gewusst haben, was Alexander den Gott gefragt hatte?
Ausgrabungen des Deutschen Archäologischen Instituts, die von 1994 bis 2009 in der Oase durchgeführt wurden, fanden eine Antwort auf diese Frage. Ein von der Rückseite des Hügels zu betretender Gang führte zunächst in einen schmalen Raum und von hier aus über eine Leiter in die flache Kammer über dem Allerheiligsten und der darin befindlichen Götterstatue. Diese scheint als Versteck genutzt worden zu sein, um die an den Gott gestellten Fragen zu belauschen (Abb. 2). In dem dahinterliegenden schmalen Raum könnte die Antwort Amuns im Anschluss an die Frage Alexanders formuliert und niedergeschrieben worden sein. Auf diese Weise hätte der Oberpriester dem Herrscher die Antwort umgehend nach dem Verlassen des Kultraumes präsentieren können.
Aber auch das Gefolge Alexanders konnte sich bei Amun Rat holen, denn um die vielen Fragen aus dem Volke zu beantworten, bedienten sich die siwischen Priester wie an vielen anderen Kultstätten Ägyptens des so genannten Prozessionsorakels. „Das Götterbild ist mit Smaragden und anderen Edelsteinen geschmückt … Es wird auf einem goldenen Boot durch 80 Priester herumgetragen, und diese schreiten willenlos, wohin auch immer der Wink des Gottes den Zug lenkt. Es folgen eine Menge Mädchen und Frauen, die während des ganzen Weges feierliche Gesänge vortragen …“ (Diod. 17,50–51). So beschreibt Diodor im 1. Jh. v. Chr. die Prozession der Amunstatue vor dem Heiligtum von Siwa. Bereits viel früher berichtet eine Stele im Amuntempel von Karnak über dieses Ritual, dass Thutmosis III. (1490–1436 v. Chr.) durch den Gott Amun zum König gewählt wurde, indem die Statue während einer Prozession durch die nördliche Hypostylenhalle vor dem jungen Prinzen anhielt und ihm durch Nicken bedeutete, ihr in den Tempel zu folgen, wo er schließlich zum Herrscher ausgerufen werden sollte. Da das gemeine Volk Ägyptens das Innere eines Tempels nicht betreten durfte, wurde die Statue des Gottes an besonderen Festtagen in ihrem Schrein auf eine Barke gestellt und in einer Prozession durch die Stadt getragen. Als Inkarnation des Gottes war das Götterbild dabei immer noch so heilig, dass es in der Regel durch einen Vorhang vor den Blicken der Gläubigen abgeschirmt wurde. Je nach Bedeutung des Gottes variierte der Umfang der Prozession. Priester, an besonderen Festtagen auch Tänzerinnen und Musikanten, begleiteten die Barke. In festgelegten Routen zog die Prozession zunächst durch das Heiligtum und dann weiter durch die Stadt. Auf seinem Weg hielt der Zug an bestimmten Punkten innerhalb und außerhalb des Heiligtums an, um bestimmte Opfer und Gebete entgegenzunehmen, anderen Göttern ihre Reverenz zu erweisen und vermutlich auch um die Fragen der Orakelsuchenden zu beantworten.
Hatte die Barke den Tempel verlassen, durfte der Ratsuchende nun vor den Gott treten. Im Amunheiligtum von Karnak vollzog sich die Befragung vermutlich an den so genannten Standorten des Herrn – rituell vorgeschriebene Wegstationen während der Prozession. Seine Frage stellte man entweder in einer mit ja oder nein beantwortbaren Form oder aber indem man der Götterstatue eine Liste mit Möglichkeiten vorlas. Der Gott gab seine Antwort, indem er die Barkenträger veranlasste, bei einer positiven Antwort die Barke nach vorne zu neigen bzw. sich bei einem „Nein“ zurückzubewegen. Neben mündlichen Fragen wurden dem Gott auch schriftliche vorgelegt, wobei die Frage in zweifacher Ausfertigung, mit einer negativen und einer positiven Variante auf Kalksteinplättchen, den so genannten Ostraka, formuliert wurde. Mehr als 100 dieser Plättchen wurden etwa in der ägyptischen Arbeitersiedlung Deir-el-Medina gefunden. Die Statue des Gottes nickte dann entweder in Richtung der einen oder anderen Antwort.
Während die Quellenlage für die beiden Methoden des Prozessions- und Königsorakel im altägyptischen Reich klar definiert ist, ist die Präsenz anderer Techniken in der Frühzeit Ägyptens stark umstritten. Mehrere Sarkophaginschriften der mittleren Königszeit aus Saqquara und Gebelein beschreiben z.B. detailliert den Vorgang, die eigene Seele im Traum auszusenden, um eine bestimmte Information aus der Unterwelt einzuholen. Der Ratsuchende hatte hierfür vor einer Tonstatuette zu beten, auf welcher der Name desjenigen eingraviert war, den man im Jenseits zu fragen gedachte. Ähnliches beschreibt eine Stele, die sich heute im Louvre befindet: „Spreche diese Worte über einem liegenden Schakal aus reinem Ton, dessen Vorderseite in Milch getränkt wurde … schreibe dein Anliegen auf ein Papyrus und stecke es in den Mund der Statuette und lege sie auf eine Kupferlampe. Wiederhole, was du aufgeschrieben in der Nacht, nachdem du mit dem Fuß auf die Erde gestampft hast“ (Louvre E 3229 5.9–14). Mit den offiziellen Orakeln des Amun hatten diese eher im Bereich der Magie anzusiedelnden Rituale jedoch nichts gemeinsam. Nicht zuletzt wegen ihrer justiziellen Funktion hatten die meisten altägyptischen Orakel keinen Raum für mystische oder interpretierbare Orakelantworten.
Dies änderte sich jedoch seit saitischer Zeit (664–525 v. Chr.), als sich durch den immer stärker werdenden Einfluss der Kulturen des nördlich gelegenen Mittelmeerraumes die Bandbreite der Orakelgötter und -techniken beträchtlich erweiterte. Herodot spricht nach seinem Besuch um 450 v. Chr. in Ägypten von Amun nur noch als von einen Orakelgott unter vielen (Hdt. 2.83,133,152,155,174). Dies bedeutete zwar nicht, dass die traditionellen altägyptischen Orakelformen in Vergessenheit gerieten. Besonders in den großen Orakelzentren Ägyptens, wie Theben oder Siwa, scheint das Barkenorakel immer noch präsent gewesen zu sein. Doch gerade im Bereich der nicht offiziellen Orakel gab es nun weit mehr Bedarf als früher. Spätestens seit dem 5. Jh. v. Chr. traten als Vertreter dieser neuen Glaubenshaltung besonders heilige Tiere als Orakelgeber hervor. Diese galten bereits im Alten Reich als Mittler zwischen Gott und Menschen. Neben den eher regionalen Orakeltieren wie dem Ibis aus Kasr El-Auguz, dem Widder von Médamoud oder dem Lamm von Bocchoris war das wichtigste vergöttlichte Tier der Apisstier. Dieser lebte in seinem Heiligtum bei Memphis, bis er eines natürlichen Todes starb und innerhalb von 70 Tagen einbalsamiert und in den Katakomben des Sarapisheiligtums von Saqqara bestattet wurde. Zu Lebzeiten des Tieres befragte man ihn, indem ein Priester das Verhalten des heiligen Stieres beobachtete. Entweder entschied das Tier durch die Wahl eines bestimmten Stalles oder aber durch das Annehmen oder Ablehnen des ihm gegebenen Futters. Daneben war es auch üblich, am Grab des verstorbenen Vorgängerstieres zu nächtigen und auf ein Traumorakel zu hoffen (Inkubation). In Saqquara schliefen die Klienten vermutlich in dem von Bäumen beschatteten Hof des Heiligtums, nachdem sie die Frage schriftlich in einer Kapelle neben dem Eingang zu den Katakomben niedergelegt hatten.
Abb. 2:Tempel des Amun. Oase Siwa. Frontansicht
Beim Tempelschlaf war es vor allem wichtig, den Göttern oder zumindest ihren Statuen so nahe wie möglich zu sein. Da aber ein normaler Ägypter auch in hellenistischer Zeit den Tempel der alten Götter immer noch nicht betreten durfte, legte man sich zum Schlafen kurzerhand an die Rückwand des hintersten Tempelraumes, denn hinter dieser befand sich in der Regel die Kultstatue des Gottes. Im Laufe der Zeit wurden an diesen Wänden so genannte Gegenkapellen errichtet. Dies waren meistens kioskartige Anbauten mit Reliefs der im Inneren aufbewahrten Götter. In dieser Form finden sie sich z.B. bei fast allen Haupttempeln in Karnak. Wie noch heute an den Wänden mancher katholischer oder griechisch-orthodoxer Kirchen konnten die Ratsuchenden hier ihre Fragen, Sorgen und Wünsche in den Stein ritzen oder auf Blechtäfelchen geschrieben anbringen. Typisch für diesen Orakeltyp war außerdem eine Öffnung in der Mauer, die zwar in der Regel zu hoch war, um ins Heiligtum blicken zu können, aber zumindest den Anschein verlieh, der Gott könne das zu ihm Gesagte auch tatsächlich erhören. Beispiele für eine solche Verbindung finden sich im Sarapistempel von Shenhur am Ostufer des Nils ebenso wie im Sarapistempel der Oase Kysis.
Wie in Griechenland galt der Tempelschlaf häufig der Heilung von Krankheiten. Spätestens seit hellenistischer Zeit entstanden in ägyptischen Heiligtümern, allen voran dem Hathortempel von Dendera, eigens errichtete so genannte Sanatorien, in denen die Kranken wie in den griechischen Asklepiosheiligtümern nicht nur schliefen, sondern auch heilendes Wasser tranken und von medizinisch geschulten Priestern behandelt wurden. Vor allem Sarapis wurde als bedeutender Heil- und Orakelgott verehrt. Zunächst hervorgegangen aus einer Verschmelzung der ägyptischen Götter Osiris und Apis übernahm er bald die Eigenschaften von vielen griechischen Göttern, allen voran von Zeus und dem Heilgott Asklepios. Ptolemaios I. (367–283 v. Chr.) ließ auf einen Traumbefehl hin die Statue des Pluto aus Sinope nach Alexandria bringen, wo er als neuer Gott Sarapis wirken sollte (Tac. hist. 4,83). Seine bedeutendsten Heiligtümer lagen in Memphis, Alexandria und in Kanopos im Nildelta. Mit seinen malerischen Gärten und Kanälen war Letzteres zugleich auch ein beliebtes Ausflugsziel alexandrinischer Lustreisender.
Neu an diesem hellenisierten Gott war, dass nicht nur seine weitläufigen Tempelanlagen, sondern auch das Allerheiligste von einem Gläubigen betreten, ja sogar die Statue selbst berührt werden durfte. So galt es als glückbringend, am Ende einer Pilgerreise ins Sarapisheiligtum von Alexandria den Fuß der riesenhaften Götterstatue zu berühren. Und nicht nur das – sie soll besonders wichtigen Bittstellern sogar aus ihrem eigenen Mund geantwortet haben. Glaubt man den bissigen Stimmen der frühchristlichen Kirchenväter, war dies natürlich alles nur Betrug. Der alexandrinische Bischof Theophilus berichtet etwa, dass sich die Priester in der ausgehöhlten Statue versteckten, um durch deren geöffneten Mund die Fragenden zu täuschen (Theod. hist. eccl. 5.23). Archäologisch lässt sich dieser Betrug nur selten belegen. Eine mit einer sprechenden Apisstatue in Verbindung gebrachte Apparatur wurde etwa in Kom el-Wist gefunden. Neben und hinter einer Kultkapelle wurde eine Statuenbasis mit vier Standlöchern gefunden, die in Verbindung mit einem engen Metallrohr stand. Hinter der Apsis versteckt könnte ein Priester mit Hilfe des Rohres eine vierbeinige Statue auf dem Sockel „zum Sprechen gebracht“ haben. Möglich ist natürlich auch, dass sich die Priester, wie im Amunorakel von Siwa, in kleinen Kammern neben, über oder im Allerheiligsten selbst versteckten und von da aus die Stimme des Gottes imitierten. Dennoch scheint diese Methode eher eine Ausnahme von der üblichen Praxis des Tempelschlafes gewesen zu sein.