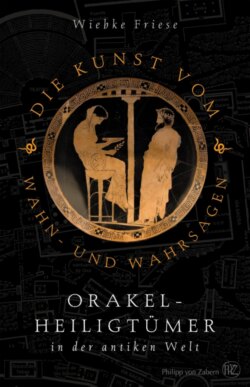Читать книгу Die Kunst vom Wahn- und Wahrsagen - Wiebke Friese - Страница 14
Das Heiligtum
ОглавлениеObwohl die ersten Siedlungsspuren bereits aus mykenischer Zeit stammen, ist der Tempel des Apollon mit seiner „schön fließenden Quelle“ erst in den homerischen Hymnen aus dem 7. Jh. v. Chr. erwähnt (Hom. h. 287). Ob der Kult damals bereits ein Orakel enthielt und wie es aussah, ist nicht bekannt. Bis in die römische Zeit lassen uns die schriftlichen Quellen hierüber weitgehend im Unklaren. Herodot stellte im 5. Jh. v. Chr. die Weissagungen der Pythia in ihrer Bedeutung zwar bereits über alle anderen griechischen Orakelheiligtümer (Hdt. 1,51), über das Aussehen des Heiligtums selbst aber berichtet er nur wenig (Hdt. 2,180 und 5,62). Euripides erwähnt kurze Zeit später immerhin einen heiligen Hain und die Kastaliaquelle sowie das Tempeladyton als Ort der Weissagung (Eur. Ion 144–149). Pindar schließlich überliefert einen recht phantastischen Mythos über die vier ersten Tempel Delphis, von denen der erste aus Lorbeerzweigen, der zweite von Vögeln und Bienen aus Wachs und Federn, der dritte von den Göttern aus Bronze und der vierte schließlich von Menschenhand aus Stein gearbeitet war (Pind. P 8,58). Aber erst in nachchristlicher Zeit erschließt sich mit den römischen Reiseschriftstellern Strabo und Pausanias ein heute rekonstruierbares Erscheinungsbild der delphischen Kultstätte (Strab. 8,6,14 und Paus. 10,5).
Ihre Beschreibungen waren es auch, die seit dem 15. Jh. immer wieder Abenteuerlustige aus aller Welt in die unwirtliche Gegend um den Parnass trieben. Doch was sie dort sahen, enttäuschte die meisten: Neben dem Stadion, der Kastaliaquelle und einigen zerstreuten Trümmern hatte sich von Delphis einstigem Glanz nichts erhalten. Die meisten der antiken Quadersteine waren in den Häusern des kleinen Dorfes Kastri (griech. Festung) verbaut, das sich über den Ruinen des Heiligtums erhob. In den Resten des Stadions weideten die Bewohner ihre Schafe. Nur die Mönche des kleinen Klosters über dem ehemaligen Gymnasion wussten noch, was sich unter ihrem Dorf verbarg. Erst 1840 begannen französische und deutsche Archäologen das Gelände systematisch zu untersuchen. Und schnell wurden sich die Forscher der Ausmaße ihres Fundes bewusst. Um jedoch an das antike Delphi heranzukommen, musste man unter den Häusern des Dorfes graben. Was aber sollte dann mit den etwa 300 Familien geschehen, die über der Ausgrabungsstätte lebten? Erst 1892 – nach jahrelangen zähen Verhandlungen – erreichte die französische Ausgrabungsbehörde École Française schließlich, dass die Bewohner in ein 2 km westlich errichtetes Dorf umgesiedelt wurden und Frankreich eine zehnjährige Grabungserlaubnis für Delphi übertragen wurde. Das französische Parlament stellte hierfür 500.000 Franc zur Verfügung – auch heute noch eine ansehnlich hohe Summe für eine archäologische Grabung. In den kommenden Jahren wurde Delphi zu einer der größten Ausgrabungsstätten der damaligen Zeit: Zwischen April und August 1895 arbeiteten ca. 200 Griechen, Italiener und Ottomanen zehn Stunden täglich auf über 2 ha Grabungsfläche. 75 von neun bis zehn Pferden gezogene Wagen liefen auf 4 km Schienen, um bis zu 400 cbm Schutt pro Tag abzutransportieren. Es gab eine Schmiedewerkstatt, eine Schreinerei und einen eigenen Mechaniker. Und dennoch war man Anfang des 20. Jhs. an vielen Stellen nicht einmal über die römische Schicht hinaus gekommen. Erst 1990 wurde das Innere des Apollontempels aufgrund neuer Untersuchungen rekonstruiert. Bis heute dauern die Grabungen und Restaurierungsarbeiten an – und fördern mit jeder Kampagne neue Erkenntnisse zutage.
Abb. 3: Delphi. Blick auf den Tempel.
„Es wird viel Verschiedenes über Delphi selbst erzählt und mehr noch über das Orakel des Apollon“ (Paus. 10,5,5), so beginnt Pausanias seine seitenlange Beschreibung Delphis, als er wenige Jahre nach Plutarch das Heiligtum besichtigt. Der Schriftsteller begann seinen Rundgang am Gymnasion, vorbei an der Kastaliaquelle, durch die Stadt Delphi bis zum heiligen Bezirk des Gottes, der „groß an Ausdehnung, zuoberst in der Stadt lag“ (Abb. 4). Bevor er durch das eher unscheinbare Tor in den heiligen Bezirk trat, musste er einen kleinen Platz mit Marktständen und fliegenden Händlern passieren. Hier gab es alles Mögliche und Unmögliche, was ein Pilger brauchen konnte: Weihgeschenke für den Gott, Souvenirs für zu Hause und Alltagsgegenstände für den täglichen Gebrauch. Doch auch innerhalb der Heiligtumsmauern herrschte alles andere als andächtige Zurückhaltung. Links und rechts der heiligen Straße, die sich zwischen den einzelnen Terrassen den Hang hinauf schlängelte, drängten sich bunt bemalte und aufwendig dekorierte thesauroi (Schatzhäuser), deren Beschreibung sich Pausanias eingehend widmet. Jede griechische polis (Stadstaat), die etwas auf sich hielt und die es sich leisten konnte, errichtete eines dieser tempelartigen Häuschen in Delphi. Das älteste der mehr als 30 ausgegrabenen Gebäude ist vermutlich das Schatzhaus des Kypselos aus der zweiten Hälfte des 7. Jhs. v. Chr. direkt unterhalb der Tempelterrasse. Besonders reich und prunkvoll ausgestattet waren die Schatzhäuser der Sikyonier (570 v. Chr./Nr. 121) und der Siphnier (525 v. Chr./Nr. 122). Wie wichtig den Stiftern dabei allein der äußere Schein war, zeigt die Tatsache, dass die aufwendige Dekoration in der Regel allein auf die zur Straße gerichtete Fassade beschränkt war. Die Seitenwände und auch das Innere der Häuser waren dagegen auffällig schlicht gehalten. Neben und vor den Häusern drängten sich zudem weitere besonders eindrucksvolle und wertvolle Weihgaben und Statuen, zu denen der Führer, der Pausanias begleitete, jeweils eine eigene Geschichte erzählen konnte.
Abb. 4: Delphi. Übersicht Heiligtum.
Nach einer ersten Biegung traf die heilige Straße auf die so genannte hálos (Heilige Tenne), einen runden Platz unterhalb des Tempels, wo in frühester Zeit vermutlich Rundtänze vorgeführt wurden, die sich seit klassischer Zeit im delphischen Fest der Septerien weiterführten. Hier versammelten sich auch die Festzüge zu den verschiedenen Kultplätzen im Heiligtum. Besonders wichtige Zuschauer nahmen zu diesen Veranstaltungen in der so genannten Halle der Athener (Nr. 313) Platz, die direkt an die Terrassenmauer des Tempels gebaut war. Seit hellenistischer Zeit wurden hier jedoch die Waffen und Schiffsheckziere der von den Athenern eroberten Feinde ausgestellt. In unmittelbarer Nachbarschaft erhoben sich schon seit der frühesten Bauphase die so genannten Felsen der Leto und der Sibylle, wo nach Pausanias in alten Zeiten die Sibylle Herophile gesessen und geweissagt haben soll. Eine Treppe neben der Athenerhalle führte direkt vor das wichtigste Bauwerk des Heiligtums – den Apollontempel (Nr. 422). Der früheste Kultbau stammte vermutlich aus dem 6. Jh. v. Chr. und lässt sich als 16 m × 40 m großer Ringhallentempel oder als 12 m × 30 m großer mit Marmor oder Tonziegeln gedeckter Antentempel rekonstruieren.
Nach einem Brand in den Jahren 548/47 v. Chr. wurde der so genannte Alkmaenoidentempel errichtet – benannt nach der Familie der Stifter, den Alkmaenoiden aus Athen. Für seinen Bau wurde eine Fläche von 4000 m2 freigeräumt und mit einer Polygonalmauer nach unten abgestützt. Der Tempel wurde vermutlich um das alte in seinen Grundmauern noch erhaltene adyton (das Allerheiligste) herum errichtet. Mit seiner dorischen Ordnung und den 6 × 15 Säulen folgte er einem eher altmodischen Plan. Seine Fassade wurde jedoch von den Alkmaenoiden großzügig mit parischem Marmor verkleidet. Dies geschah nicht ohne Hintergedanken: Der Tempel sollte auf diese Weise mit dem etwa gleichzeitig entstandenen Athenatempel auf der athenischen Akropolis mithalten können, der von den größten Konkurrenten der Alkmaenoiden, den Peisistratiden, in Auftrag gegeben worden war.
Doch auch dieser Tempel stand nicht lange. Ein Bergsturz zerstörte gegen Ende des 4. Jhs. v. Chr. den gesamten nordwestlichen Bereich des Heiligtums, einschließlich eines Teils des neuen Tempels. Auch heute noch wird die Gegend um den Parnass immer wieder von größeren und kleineren Erdbeben erschüttert. Zunächst wurde aus dem Material des eingestürzten Tempels eine neue Stützmauer, die so genannte Ischegaon, errichtet. Der neue, heute noch erhaltene Tempel besteht zu großen Teilen aus lokalem Kalkstein und korinthischem Poros und folgt in seinem Grundriss dem vorigen archaischen Tempel. Zum Eingang auf der Ostseite führte eine 7 m lange Rampe hinauf. Im Inneren der in schmale Seitenschiffe abgeteilten Cella verlief eine Säulenkollonade bis zum adyton, das sich auch im neuen Tempel nicht verändert zu haben scheint.
Hier nun im Allerheiligsten des Tempels saß die Pythia und verkündete ihre Prophezeiungen. „In das Innerste des Tempels dürfen nur wenige eintreten, und es ist dort eine Statue des Apollon zu sehen“ (Paus. 10,24,5). Mehr kann Pausanias nicht über das adyton berichten. Aus anderen Quellen wissen wir, dass es im hinteren Teil der Tempelcella und ein paar Treppenstufen unterhalb des übrigen Bodenniveaus lag. An den Wänden standen die Sprüche an die Sieben Weisen und ein Spruch, der einst an Homer gegangen sein soll. Neben der Erdspalte, über der die Pythia auf einem Dreifuß saß, um zu weissagen, mündete ein unterirdischer Kanal, der zur vor dem Tempel gelegenen Quelle der Nymphe Kassotis führte. Weiter standen in unmittelbarer Nähe zur Priesterin ein Lorbeerbaum (als heiliger Baum des Gottes Apollon), eine goldene und eine hölzerne Statue des Apollon und der so genannte omphalos (griech. Nabel), ein konischer Stein, der einem Mythos Pindars zufolge den Mittelpunkt bzw. „Nabel“ der Welt bezeichnete. Eine Kopie des Originals aus dem 4. Jh. v. Chr. ist heute noch im Museum von Delphi zu bewundern. Die steinernen Girlanden, die diesen Omphalos bedecken, bilden dabei wollene Bänder ab, mit denen der Stein im adyton an bestimmten Feiertagen umwunden wurde (Abb. 5).
Bevor wir uns nun den Diskussionen über das anschließen, was im Inneren des Tempels wirklich geschah, sollten wir zunächst unseren Rundgang mit Pausanias durch das Heiligtum beenden. Da dieser nicht gedachte, eine Anfrage an das Orakel zu stellen, wandte er sich wohl oder übel vom Tempel ab und betrachtete den gegenüberliegenden von den Bewohnern der Insel Chios gestifteten Altar (Nr. 417), bevor er eine Treppe hinauf zur so genannten Lesche (Nr. 605) stieg. Dabei handelt es sich um einen geschlossenen Rechteckbau, dessen Zugang an der Langseite lag und der im Norden durch die Temenosmauer und im Osten und Westen durch die Terrassenmauern eingefasst war. Im Inneren weisen vier Stützfundamente auf eine Holzsäulenkonstruktion hin. Eine Stiftungsinschrift auf der gegen das Tal gerichteten Terrassenmauer weist den Bau als die von den Knidiern gestiftete „Lesche“ (Nr. 538), einen multifunktionalen prunkvollen Versammlungsbau, aus. Pausanias rühmt den Bau vor allem wegen seiner berühmten Gemälde, auf denen unter anderem die Zerstörung Trojas und die Hadesfahrt des Odysseus abgebildet waren (Paus. 10,25,2).
Den krönenden Abschluss des heiligen Bezirks bildete das in den Hang hinter dem Tempel eingetiefte Theater. Schon im 4. Jh. v. Chr. fanden die musischen Wettkämpfe der delphischen Spiele in einem kleineren Holztheater statt. Im 2. Jh. v. Chr. wurde dieses durch ein größeres aus Stein ersetzt, das etwa 5000 Zuschauern Platz und einen atemberaubenden Blick über die Ebene bis zum Meer bot. Die sportlichen Wettkämpfe der pythischen Festspiele fanden im oberhalb des Heiligtums gelegenen Stadion statt.