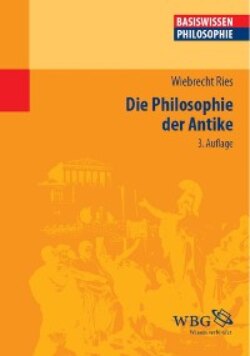Читать книгу Die Philosophie der Antike - Wiebrecht Ries - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
ОглавлениеDie Ursprünge der griechischen Philosophie liegen im Dunkeln. Im Licht der Überlieferung liegt ihr Anfang im 6. Jahrhundert v. Chr. am Rande der orientalischen Welt, in Ionien, und in den neu gegründeten Städten der griechischen Kolonien in Süditalien und Sizilien. Von dort griff sie auf die attische Halbinsel über, um dann im Athen des 5. vorchristlichen Jahrhunderts, zur Geburtsstunde der Demokratie in Sokrates gespiegelt, neu gegründet zu werden. Im Blick auf den Beginn der griechischen Philosophie und ihr einer Entdeckungsreise gleichendes Unternehmen, auf dem Hintergrund verblassender „Göttergeschichten“ in einer ganz neuen Weise nach dem Ursprung der Welt zu fragen und nach dem, was allem Seienden zugrunde liegt, stellt sich die Erinnerung an die Figur des Odysseus ein. Er ist „das mythische Urbild“ (W. Kraus) jener ionischen Seefahrer, die auf ihren Meerfahrten Handel trieben, aber auch ausfuhren, um fremde Städte und Denkweisen der Menschen zu erkunden, unbefangene Weltkenntnis zu erwerben und ihre Früchte, neues Wissen, in der Form der historia (Kunde) heimzubringen.
Die allmähliche Ablösung einer mythischen Weltdeutung als Götterordnung vollzieht sich im Rahmen spekulativ-erklärender Theoriebildungen über die natürliche Entwicklung der Welt. Auf sie bezogen sind die wesentlichen Fragen nach dem Anfang und Ursprung alles Seienden und einer in allem Werden und Vergehen waltenden substantiellen Ordnung. Die Frage des Mythos gilt dem Ursprung in einem zeitlichen Sinn: Die Entstehung der Welt aus dem Chaos. Die im Mythos erzählte Genealogie beschwört eine Vielzahl miteinander konkurrierender Ursprungsmächte, eine Kette von Revolutionen des jeweils jüngeren gegen das jeweils ältere Göttergeschlecht. Die Frage der vorsokratischen Philosophie nach der arche (Ursprung) richtet sich nicht auf den durch Zeugung und Paarung entstandenen Anfang der Welt, sondern gilt einem „Ursprung“, der nicht das einmal Gewesene, sondern das ständig Gegenwärtige und deshalb immer Seiende ist, aus dem das Sein der Welt im Horizont von Werden und Vergehen rational verständlich wird. Im Prozess dieses ganz neuen Fragens entwickelt sich die der klassischen griechischen Philosophie zu Grunde liegende Begrifflichkeit wie der ehrwürdige Begriff des Seins, der Begriff des Werdens, der Zahl, des Logos. Letzterer regiert als ein der Welt zugrunde liegendes Gesetz der Ordnung. Zugleich ist er das geheime Maß der Seele (Psyche als Teil des kosmischen Feuers), die nach Heraklit keine Grenzen hat. Dokumentiert ist dieser Prozess des Fragens nach den archai (Prinzipien) der Welt in der Ablösung einer poetisch-mythischen Erzähltradition durch die Prosa. Begünstigt wird er durch die Eigenart der griechischen Sprache. Sie ist, wie Tr. Georgiades in seinem grundlegenden Werk Musik und Rhythmus bei den Griechen (1958) hervorhebt, durch ihren Rhythmus zugleich Ausdruck einer sich in ihm bekundenden objektiven Ordnung. Die frühe griechische Philosophie sieht die Welt bestimmt durch polare Gegensätze: Eidos (Form) und Gestaltloses, klare Begrenztheit und umrisslose Tiefe, Licht und Dunkelheit, Sein und Werden. Sie begreift und ordnet die Welt in Gegensatzpaaren. Zeugen für diese Denkform sind in besonderer Weise das Seinsgedicht des Parmenides und die Logosphilosophie Heraklits, aber auch die Philosophie des Empedokles. Bei Parmenides wird alle benennbare Wahrheit der Sterblichen so radikal „gereinigt“, dass nur noch die Gewissheit des estin, Sein ist, übrig bleibt. Die traditionelle ionische Lehre von der Kosmogonie wird von ihm als „Doxa“ (Meinung) abgewertet. Hierin liegt ein erster Höhepunkt logischer Abstraktion. Zugleich aber ist das Proömium seines berühmten Lehrgedichtes, die Wagenfahrt zur Göttin, welche jenseits der Bahnen von Nacht und Tag die Wahrheit des Seins hütet, einer Grundform mythischer Erzählung zuzuordnen. Bei Heraklit entbirgt die in den festen Grenzen unserer Welterfahrung verborgene, nur im Licht des Logos aufscheinende „Harmonie der Gegensätze“ sich als die Einheit des Kosmos im Ganzen. Sie ist eingespannt in die gegenstrebige Fügung von Bogen und Leier des delphischen Gottes. Bei Empedokles wird der Wechsel der kosmischen Phasen zum Abbild in dem durch Liebe und Streit bewirkten Zusammentreten oder Auseinandergehen der Seinselemente. An ihm lässt sich die Verbindung zwischen anfänglich „wissenschaftlichem“ Denken und religiöser Lehre besonders gut beobachten: auf der einen Seite sein Lehrgedicht Physika mit seinen physikalischen Vorstellungen, auf der anderen Seite sein Reinigungsgedicht, die Katharmoi, bei dem es um das Schicksal der Seele geht. Eine Frage, die schon bei Heraklit größte Bedeutung besitzt, wenn er in ganz rätselhafter Weise den Logos der Seele in ein Verhältnis zu Leben und Tod stellt. Es ist stets diese dialektische Spannung von rationaler und mythischer Denkform, welche den Zauber der Abstraktion im Denken der griechischen Naturphilosophie bewirkt. Der von ihr tendenziell vertretene „Objektivismus“, der die Frage nach den Göttern zunehmend entbehrlich macht, findet seinen sinnfälligen Ausdruck in der sich in ihm spiegelnden Einheit von Philosophie als Seinsdenken und einer ganz anfänglichen Begriffstheorie. Diese „Einheit“ bildet sich allerdings erst allmählich im Übergang vom Prinzip des Lebens zum Prinzip des Geistes heraus. Das eleatische Seinsdenken und die heraklitische Logos-Lehre zeigen die Kühnheit dieses Übergangs so beeindruckend, dass es gerechtfertigt erscheint, Parmenides und Heraklit in den Mittelpunkt der Betrachtungen zu diesem Epochenabschnitt der griechischen Philosophie zu stellen.
Was dann die frühgriechische Philosophie als Erbe den auf sie folgenden Epochen der Philosophie übergibt, das ist ihr Weltbegriff. Er ist bestimmt durch zeitloses Sein und durch von der Zeit gewirktes Werden. Bei den ionischen Denkern entwickelt sich dieser Weltbegriff an der Physis, die in allem Werden und in der Mannigfaltigkeit ihrer Erscheinungen von ewiger Dauer ist. Jedoch haben die Vorsokratiker des 6. Jahrhunderts v. Chr. noch keinen Begriff von Physis entwickelt. Dies geschieht erst zur Zeit der Sophistik und vor allem bei Aristoteles. „Was diesen Denkern Einheit verleiht und was sie als erste Stufe des griechischen Denkens erscheinen lässt“, schreibt H.-G. Gadamer in Der Anfang der Philosophie (1996), „ist ihre Bereitschaft, sich vom Mythos zu trennen und den Gedanken einer beobachtbaren Realität auszudrücken, die sich in sich selbst trägt und ordnet.“1 Nach C. Hartshorne2 hat das naturphilosophische Denken der Vorsokratik den eigentümlichen Vorzug, nicht nur als ein traditional vermitteltes „Bildungswissen“ auf die Gegenwart einzuwirken, sondern vielmehr in seinen Modellen für die zeitgenössische Forschung (Schrödinger, Heisenberg, v. Weizsäcker) unmittelbar paradigmatisch zu sein.
Das Aufkommen der auf die menschliche Praxis ausgerichteten sophistischen Bewegung um die Mitte des 5. Jahrhunderts resultiert aus einer Krise tradierter Wahrheits- und Geltungsansprüche theoretischer Weltdeutungen wie normativer Rechtsordnungen. Sie ist Anzeichen einer Verlagerung des philosophischen Interesses an der Welt als dem Seienden im Ganzen auf den Horizont der menschlichen Praxis. Die skeptische Grundhaltung der Sophistik und die mit ihr verbundene Frage nach der Begründung von Werten führt in ihrer Konsequenz zum Ergebnis eines Werterelativismus und eines Erkenntniszweifels, der einen Pluralismus konkurrierender Deutungsperspektiven hinsichtlich Mensch und Welt freisetzt und damit die Möglichkeit der Gewinnung einer normativ absolut gesetzten und für alle Menschen verbindlichen Wahrheit bestreitet. Der positive Aspekt der Sophistik kann in ihrer Hinwendung zu einer rein menschlichen Erfahrungswelt gesehen werden, deren Ausdrucksformen sie in Sprache, Kunst, Politik, Ökonomie, Moral und Religion zu analysieren sucht. Auf der anderen Seite ist es unbestreitbar, dass die Sophistik Ausdruck einer geistigen Krise ist, wie sie die in ihrem Schatten stehenden Tragödien des Euripides sichtbar machen, wenn sich in ihnen die Disharmonie zwischen Schicksal und menschlichem Wert, zwischen den fernen Göttern und den ethischen Ansprüchen der Vernunft als unauflösbar erweist.3
Sokrates ist in der Entwicklungsgeschichte der griechischen Philosophie die entscheidende Zäsur. Mit ihm tritt alles bisherige Philosophieren in ein ganz neues Licht und strebt nach einer anderen Begründung, sodass es ein sachliches Recht gibt, die ihm gegenüber früheren Denker als „Vorsokratiker“ zu bezeichnen. Aus historischer Sicht repräsentieren die Vorsokratik und die sokratische Philosophie zwei Grundkonzeptionen des philosophischen Denkens: Sokratische Nachdenklichkeit gründet in der ethisch motivierten Frage nach dem agathon, dem Guten, und der einzig an ihm orientierten richtigen Verfasstheit des menschlichen Lebens; die Vorsokratik besitzt ihren Maßstab an der Physis, ihrem Werden und Vergehen, das als ontologische Grundgegebenheit angeschaut wird.
Die mit Sokrates beginnende epochale Wendung in der griechischen Philosophie zeigt sich vor allem an der besonderen Art seines Fragens. Sie richtet sich auf die eine für das Schicksal der Seele entscheidende, jedoch unbekannte ethische „Wissenschaft“ vom Guten, von der es für ihn nur ein Wissen des Nichtwissens gibt. Die ganze Welt der menschlichen Erfahrung wird in der sokratischen Frage nach dem Guten transzendiert. Erst in der Orientierung der Seele an dem Gedanken des Guten, der ihr als unumstößliche Gewissheit vor Augen steht, erreicht sie ihre wahre Vollkommenheit, ohne dass doch dieses Gute aus der Welt menschlicher Erfahrung abgeleitet werden kann.
Sokrates und sein Fragen gewinnt zeitlose Lebendigkeit durch die platonischen Dialoge. Durch sie sehen wir Sokrates, diesen kleinwüchsigen Bürger Athens mit dem hässlichen Gesicht eines Silen und der inneren Schönheit des wendigen attischen Geistes und seiner funkelnden Ironie, in unaufhörlichem Gespräch mit den sich um ihn versammelnden Menschen. Wir hören seine unablässig-eindringliche Frage, die nach Nietzsche die schöne Vieldeutigkeit des Mythos zerstört: ti estin, „was ist“ das, wovon wir sprechen, wenn wir reden? „Was ist“ das in einer Art von ungeklärtem Vorwissen immer schon vorhandene „Wissen“, das allem Handeln und Streben der Menschen zugrunde liegt? Es war diese Leidenschaft des unaufhörlichen Fragens hinsichtlich der entscheidenden Grundprobleme des menschlichen Daseins in der Polis und die Unbeirrbarkeit des sie leitenden Bekümmertseins um das Gutwerden der Seele, welche die Edelsten der athenischen Jugend geradezu verzauberte. Er erschien ihnen gleichsam wie der wiedergeborene attische Nationalheros Theseus. Hatte dieser im Mythos die Kinder Athens vor dem Minotaurus gerettet, so rettet für Platon Sokrates durch den wahren Logos die Jugend Athens vor unrechter Lebensführung.
Sokrates wurde von der herrschenden Demokratie wegen Unfrömmigkeit und Verführung der Jugend durch revolutionäre Ideen angeklagt und zum Tode verurteilt. Als „Diener seines Gottes“ (Apollon) verteidigte er vor seinen Richtern seine innere Berufung und sein philosophisches Tun und leerte, obwohl er die Möglichkeit zu fliehen hatte, in wunderbarer Gelassenheit den Giftbecher. Sein Tod wurde für alle Zeit zum Symbol für den Weisen, der in der Gewissheit, „dass es für einen guten Menschen kein Übel gibt, weder im Leben noch im Tod“ (Apologie, 41 c), sein Sterben meistert.
Die Hinrichtung des Sokrates im Jahre 399 v. Chr. war der entscheidende Anstoß, der Platon auf den Weg der Philosophie gebracht hat. Das Dialogwerk Platons kann auch als eine „Apologie“ des Sokrates verstanden werden und ein wesentlicher Teil seiner Philosophie sucht Antwort auf die Frage, wie Sokrates, der Gerechte, in einer ungerechten Welt überhaupt möglich war und was dies für ein Leben in der Polis bedeutet. Darauf deuten auch jene mit tiefer Ironie geschriebenen Alterssätze Platons: „Ich habe nichts über Philosophie geschrieben, und von Platon gibt es weder noch wird es eine Schrift geben, denn alle Schriften, welche als meine bezeichnet werden, sind Werke des Sokrates, welcher jung und schön geworden ist“ (Zweiter Brief 314 c).
In der Geschichte der Philosophie ist die Platonische Philosophie mit der Ideenlehre verbunden. Provozierend bleibt hierbei, dass sie bei Platon nirgends in voller Breite entwickelt und begründet ist. Zudem verweigert es der grundsätzlich dialogische Vollzug seines Denkens, sie in ein System von referierbaren Lehrsätzen zu transformieren. Dieser Umstand bedingt bis auf den heutigen Tag die Debatten und Kontroversen in der Platon-Diskussion um die ungeschriebene Lehre. Der Streit um die „Lehre“ Platons verweist auf eine alte Legende, die uns zwei spätantike Platonviten überliefern. Nach ihr träumte Platon kurz vor seinem Tod, dass er sich in einen Schwan verwandle, der von Baum zu Baum fliege und von den Jägern nicht gefangen werden könne. Diesen Traum soll ein Freund so gedeutet haben: Alle Interpreten würden sich fortan vergeblich bemühen, den Gesamtsinn der platonischen Philosophie zu erfassen, da jeder Platon aus seiner eigenen Sicht auslege. Es ist Absicht der hier vorgelegten Platon-Darstellung, bei allen sachlichen Information, die sie gibt, den „Vogel“ des Apollon nicht zu ergreifen, sondern nur auf ihn in seinem Flug hinzudeuten. Sie ist dem platonischen Dialog deshalb verpflichtet, weil dieser sich als eine offene Form erweist, in der sich das diskutierte Ideenwissen niemals erschöpft. In der mit ihr verbundenen Dialektik weist sie beständig auf das Eine hin, das Sein, das Gute, das in der Ordnung der Seele, der gerechten Verfassung der Polis und dem schön geordneten Aufbau des Kosmos aufleuchtet.
Ein Hauptakzent meines Platon-Kapitels liegt in dem geschichtlichen Sachverhalt, dass Platon die sokratische Frage nach dem Wissen des Guten aufnimmt und ihr als der legitime „Erbe“ des Sokrates eine „positive“ Antwort zu erteilen versucht. Auf diesem Weg wird er zum Schöpfer der mit eleatischem Seinsdenken tief verbundenen Ideenlehre und einer von der Orphik gespeisten Seelenlehre. Der Verbindung beider Lehren ist besondere Beachtung zu schenken, zumal der ontologische Dualismus (Ideenwelt – Erscheinungswelt) in der (mündlichen) Prinzipienlehre zu einer differenzierteren In-Beziehung-Setzung der Seinsbereiche Psyche, Polis, Kosmos erweitert wird, die in der Idee des Guten ihren höchsten und letzten Einheitsgrund besitzt. Das in den Texten reich entfaltete dialogische Denken Platons, einschließlich der darin enthaltenen Selbstdeutung, und seine auf eine Prinzipienmetaphysik hin ausgerichtete mündliche Lehre in der Akademie, überliefert durch die Schüler Platons, müssen zusammengedacht werden, will man nicht nur die Tiefe, sondern auch die Weite seines Geistes ermessen. Auf sie bezogen, verdient der Hinweis C. F. von Weizsäckers Beachtung, dass die platonische Philosophie aus dem Horizont unseres Lebensverständnisses heraus in dreifacher Weise interpretiert werden kann: moralisch-politisch, mathematisch-physikalisch, seelisch-mystisch.
Der bedeutendste Schüler Platons ist Aristoteles. Unter den großen Denkern der abendländischen Philosophie ist Aristoteles nicht nur der Meister begrifflicher Analyse, sondern auch der erste systematische „Biologe“, insofern sein ganzes Denken von den Erscheinungsweisen des Lebens beherrscht wird. Mit ihm beginnt in einem strengen Sinn das wissenschaftliche Philosophieren, das sich an sachlichen Problemen und ihren Lösungen orientiert. Aristoteles spricht nicht wie Platon als Künstler zu uns, sondern er wirkt faszinierend in der Nüchternheit seines streng sachbezogenen, phänomenologischen Denkens. Seine Logik entwirft eine formale Theorie der Schlussfolgerung, seine Metaphysik begründet Philosophie als Seinswissenschaft. Als Theoretiker der natürlichen Welt entwirft er eine Physik, die Veränderung und Bewegung zum Gegenstand hat, sowie eine Biologie und Psychologie als eigenständige Disziplinen. Seine Ethik und seine Politik bilden Grundlagen der praktischen Philosophie. Das Aristoteles-Kapitel, das den Aufbau des aristotelischen Wissenskosmos, spezifisch gegliedert in eine theoretische und eine praktische Hemisphäre, in seinen Grundzügen vorstellt, ist bemüht, die Philosophie des Aristoteles als eine Systematik der Erfahrungsgebiete und der ihr korrespondierenden anthropologischen Formen zu skizzieren.
Wie bei Platon findet man auch bei Aristoteles eine Philosophie des lebendigen Geistes. Das der theoria verpflichtete Dasein gilt ihm als die höchste Lebensform. Nicht zuletzt sind Platon und Aristoteles im Sinne einer spannungsreichen „Zweieinheit“ zu interpretieren, weil beide, wenn auch in unterschiedlicher Weise, in der Nachfolge des Sokrates das rationale Erbe des griechischen Geistes zu Ende gedacht haben. Platon und Aristoteles beziehen die zwei Hauptworte der griechischen Philosophie, arche (Grund) und telos (Ziel) in der Weise aufeinander, dass mit der Idee des Guten (Platon) und dem unbewegten Beweger (Aristoteles) der Grund alles Seienden benannt ist, auf den als Ziel zugleich alles Seiende in seinem Sein hingeordnet ist. In der platonisch-aristotelischen Verschränkung von Grund und Ziel alles Seienden ist die eigentliche Grundgestalt der abendländischen Metaphysik zu sehen.
Wenn im 13. Gesang der Odyssee „die helläugige Athene“ dem Odysseus die Hand streichelt und zu ihm sagt: „dich“ (den Sterblichen) und „mich“ (die unsterbliche Göttin), uns vereinigt in der Trennung, dass wir beide Geist haben, dann liegen in diesen Worten die Wurzeln des vielberufenen Intellektualismus der griechischen Ethik. Aus ihr erwächst der dem überpersönlich Guten verpflichtete geistige Charakter des Regenten in Platons Politeia wie die höchste Lebensform, welche die Nikomachische Ethik kennt: der bios theoretikos.
Die Philosophie im Zeitalter des Hellenismus ist charakterisiert durch die großen „Schulen“ der Stoa und derjenigen Epikurs. Sie sind Ausdruck geschichtlich gewandelter Sinnhorizonte, die sich im Gegensatz zur Philosophie der klassischen Epoche mit ihrer an der Ordnung des Kosmos, der Polis und der Seele orientierten Betrachtung des ewig Gültigen vor allem durch das Interesse an ethischen Orientierungsfunktionen in einer zunehmend unübersichtlich gewordenen Welt bestimmen lassen. Im Zeichen einer vor allem als Lebenskunst verstandenen Philosophie erwächst aus ihr das an Sokrates orientierte Ideal des Weisen, der in den geschichtlichen Wirren der Zeit und in den Bedrängnissen seines Lebens gelernt hat, sich autark auf sich selbst zurückzuziehen, indem er anerkennt, was in seiner beschränkten Macht steht, und der in einem „Zeitalter der Angst“ (E. Dodds) die Überwindung der Furcht und die Unabhängigkeit von den Wechselfällen des Schicksals als zentrale geistige Erfahrungen einübt. Es ist „das Glück des Nachmittags des Alterthums“ (F. Nietzsche) auf dem Hintergrund einer zunehmend bewusster werdenden Endlichkeit des menschlichen Daseins im Ganzen der natürlichen Welt, das beim Studium der hellenistischen Philosophie fasziniert. Die in der Stoa der römischen Kaiserzeit vorfindlichen Todesmeditationen (Seneca/Marc Aurel) besitzen als Gespräche mit sich selbst zeitlosen Wert.
In der Mitte des 3. Jahrhundert n. Chr. wirkt im kaiserzeitlichen Rom Plotin, der wichtigste Repräsentant des Neuplatonismus. In seinem Denken spiegelt sich die Weltstimmung der spätantiken und frühchristlichen Jahrhunderte: „Jenseitssehnsucht, Verfeinerung der Sinne und des Geistes, Weltflucht und religiöse Erregbarkeit“ (H.-G. Gadamer). Mit dem vor allem auf Platon gestützten Inhalt seiner Philosophie, dem Vorrang des Seelischen vor dem Stofflichen, der Schönheit der geistigen Welt und der unaussprechlichen Erhabenheit des obersten göttlichen Einen, berühren sich Grundelemente der christlichen Glaubenslehre. Einer der größten Lehrer der christlichen Kirche, Augustinus, verdankt Plotin Wesentliches. Der Deutsche Idealismus (Schelling/Hegel) ist tief von Plotin beeinflusst, Goethe bekannte sich zu ihm wie zu Spinoza. Für das Verständnis des mystischen Erbes des modernen Geistes gewinnt eine Betrachtung an Bedeutung, die an der Plotinischen Metaphysik die Bewegung des inneren „Aufstiegs“ der Seele in seiner reflexiven Rückbindung an die Einheit des absoluten „Grundes“, das Eine, bewusst werden lässt.4
Nach dem Aufriss der großen thematischen Komplexe der Geschichte der antiken Philosophie, werde ich im Folgenden zu ihrer inhaltlich vertieften Darlegung kommen. Über die mit ihr verbundenen sachlichen Informationen hinaus ist sie kein gelehrter Selbstzweck. Sie dient auch dem, was ich (im Anschluss an J. Assmann) das kulturelle Gedächtnis nennen möchte. Die Verlebendigung einer vielfach vergessenen Kontinuität zwischen den Griechen und uns, die bewahrte Erinnerung an die scheinbar geschichtlich so fern stehenden großen Gestalten der antiken Philosophie und die durch sie erschlossenen Erfahrungs- und Sinnhorizonte, soll nicht zuletzt die fatale Einseitigkeit unseres eigenen an den jeweiligen Tag verlorenen Denkens bewusst machen.