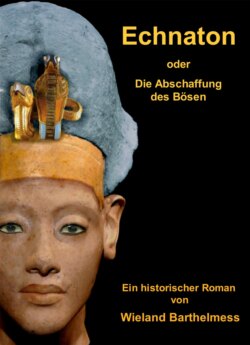Читать книгу ECHNATON - Wieland Barthelmess - Страница 3
Prolog: Ein Tag im Leben des Ani, Sohn des Imenhotep
ОглавлениеWer die Lüge vernichtet, fördert die gerechte Ordnung,
wer das Gute fördert, macht das Böse zunichte,
wie Sattheit den Hunger vertreibt,
Kleidung den Nackten bedeckt,
wie der Himmel heiter ist nach heftigem Sturm.
Die Klagen des Bauern
oder: Die Geschichte vom beredten Oasenmann
Ägypten, ca. 2000 v. Chr.
Der Charakter eines Mannes wird bestimmt durch seine Familie.
Altägyptische Weisheit
Breit und braun schob sich der Nil durchs Land.
Ani spürte einen Kloß im Hals. Würde er doch noch eine Zeit lang das mit ihm dahinrasende und dabei auch noch unberechenbar strudelnde Wasser unter sich ertragen müssen. Am frühen Morgen hatte ihn der Vater geweckt. Im Stall! Dorthin hatte man ihn zum Schlafen geschickt, weil Mutter schwer in den Wehen gelegen war. Anfangs hatte sie noch geschrieen, so dass Vater meinte, es sei besser, wenn Ani im Stall schliefe. Später hörte Ani nur noch ab und zu ein schwaches Wimmern, das er aber fast noch schlimmer fand als Mutters anfängliche Schmerzensschreie. Als der Vater ihn dann am Morgen sanft wachrüttelte, hatte Ani ihm nur ins Gesicht blicken müssen, um zu wissen, was geschehen war.
Kaum dass Ani ins Haus hinüberlaufen wollte, sah er das bereits ausgehobene Grab. Er erfror in seiner Bewegung und schlich sich schließlich langsam näher. Eine kleine zierliche Figur lag darin, eingewickelt in leinenen Tüchern. In ihren Armen ein ebenfalls in Leinen gewickeltes Bündel. Ani spürte wie sein Vater ihn von hinten fest umarmte. Er wäre sonst sicherlich gefallen.
Mit bloßen Händen hatten Vater und Sohn die trockene Erde in die Grube zurück gescharrt. Wie im ganzen Land war auch hier der Boden mehr Staub als Erde, wenn er denn nicht vom alljährlich herbeigesehnten fruchtbaren Nilschlamm bedeckt worden war. Zudem war er durchsetzt mit zahllosen Steinen, deren Geräusch, wenn sie auf die toten Körper fielen, Ani jedes Mal erschaudern ließ. Am Ende standen Vater und Sohn über und über mit Staub bedeckt und sahen aus wie graue Statuen aus Stein. Nur die Rinnsale, die aus ihren Augen drangen, schienen als Einziges auf Leben in diesen versteinerten Menschen hinzudeuten. Braun glänzte ihre feuchte Haut an den von den Tränen frei gewaschenen Stellen, die im Zickzack ihre Wangen hinunterliefen.
Seit zwei Tagen schon hatte Vater an dem Papyrusboot geflochten, das sie nun den Nil hinunter trug. Denn dass er würde fahren müssen, war klar: Entweder um der Göttin Mut für eine gesunde Geburt zu danken oder um Gott Amun zu besänftigen, der ihm in seinem Zorn Frau und Kind genommen hatte. So fuhren sie nun die etwas längere Strecke flussabwärts, um Amun ihr Opfer zu bringen. Ani hielt den Korb, in dem die dem Gott zugedachten Gaben verborgen waren, krampfhaft fest, damit sie nur nicht im Nil versanken. Der Fluss war in diesen Tagen derart reißend, dass Vater gemeint hatte, die Rückfahrt flussaufwärts sei ohne jeden Zweifel ausgeschlossen. Ihnen würde wohl nichts anderes übrig bleiben, als das Papyrusboot schließlich gegen etwas Essbares einzutauschen und dann zu Fuß wieder nach Hause zurückzukehren.
Obwohl Ani schon oft auf dem Nil unterwegs gewesen war, sei es zum Fischen, um Verwandte zu besuchen oder um Besorgungen zu erledigen, so war er doch nie bis in die große Stadt gekommen. Er staunte, als an ihr vorüberfuhr, weit genug entfernt, um Einzelheiten zu erkennen, doch nah genug, um zu spüren, dass die Stadt brodelte. Der Gute Gott, der Pharao, lebte dort und wachte über seine Kinder. Doch seine Mutter, so dachte Ani trotzig, würde er ihm dennoch nicht zurückgeben können. Obwohl die Tempel, in deren Inneren die Götter wohnten, dort tatsächlich wie weiße Berge in den Himmel ragten.
Noch bevor Atons Scheibe am höchsten stand, sah Ani sie: Irgendwo in weiter Ferne, am Rand des überschwemmten Landes, umwimmelt von Häusern und Hütten ragten die Pylonen der Tempel empor, an denen lange Stangen mit schlanken Bannern angebracht waren, die in der nahenden Mittagsglut tanzten. Der Wind, der in großer Höhe steter wehte, wie sein Vater ihm erklärt hatte, ließ sie sich winden wie lange Schlangen, die das Heiligtum bewachten. Soeben glitt ihr Boot am Tempel der Mut vorbei, wie Vater einsilbig anmerkte. Welch prächtiger Bau! Ani hatte noch nie ein derart großes Gebäude gesehen, das überdies noch mit bunten Reliefs geschmückt war. Doch der nur ein weiteres kurzes Stück flussabwärts gelegene Tempelbezirk des Amun übertraf Muts Heiligtum noch bei Weitem an Wucht und schierer Größe. Ani blieb der Mund offen stehen. Die beiden vor Jahrhunderten errichteten Obelisken überragten die Anlage, so dass ihre goldenen Spitzen das Sonnenlicht fingen und gleißend widerspiegelten. Fast konnte man meinen, eine kleine Sonne throne auf jeder der Spitzen. Diese Obelisken hatte Pharao Hatschepsut aufstellen lassen, von dem man sich erzählte, dass er eigentlich eine Frau gewesen sei. Aber gerne sprach man nicht darüber, denn allzu groß war die Verehrung und Hochachtung, die man diesem großen Herrscher entgegenbrachte, als dass man sie mit derart ungehörigen Dingen beflecken wollte.
Anis Vater ließ das Boot ans Ufer treiben, noch lange bevor sie die Anlagestelle des Amun-Tempels erreicht hatten. „Da sind mir zu viele Menschen unterwegs“, sagte er nur. „Nachher ist unser Boot noch verschwunden. Hier in der Stadt klauen sie alle wie die Paviane!“ Und in der Tat: Es herrschte quirliges Treiben am Bootssteg flussabwärts. Ein prächtiges Schiff, bewacht von mehreren Bewaffneten, lag dort vertäut. Es musste einem Fürsten gehören, so verschwenderisch war es bemalt und mit bunten Stoffen geschmückt. Es standen Dutzende von Leuten herum, die gafften und schwatzten. Unter ihnen priesen Wasserverkäufer ihr kühles Gut an, eine Frau mit schriller Stimme versuchte auf sich aufmerksam zu machen, um ihre Amulette zu verkaufen und eine Menge neugieriger Kinder wuselte herum.
So nah der dichte Schilfgürtel es zuließ, steuerte der Vater das Boot ans Ufer und befestigte es an einem aus dem Schlick heraus ragenden Ast. Ani erschrak, als er ins Wasser sprang und spürte, dass seine Füße sogleich im Schlamm versanken. „Ja, hier kannst du nicht stehen bleiben“, sagte der Vater, „hier musst du laufen!“ und reichte ihm den Korb mit den Opfergaben. Ani musste aufpassen, dass er sie auch sicher an Land brachte, denn nur so würde der zornige Gott zu besänftigen sein. Er merkte das Gewicht der Verantwortung, das auf seinen Schultern lag. Doch schließlich spürte er wieder festen Boden unter den Füßen. Zufrieden drehte der Vater sich um. „Unser Boot wird hier so schnell niemand entdecken“, meinte er halblaut. „Ich hoffe nur, dass wir selbst es nachher auch wieder finden.“
Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, wollte der Vater sich schon auf den Weg in Richtung Anlegestelle machen, als er mitten in der Außenmauer des Tempels eine kleine Pforte entdeckte. Sie war kaum auszumachen gewesen, war sie doch mit Mauerwerk bemalt, das sich aufs Genaueste dem echten Gemäuer anpasste. So war es nur aus allernächster Nähe möglich, sie tatsächlich auch als Täuschung zu erkennen. Prüfend klopfte der Vater dagegen - und in der Tat: Es klang, als ob es hohl dahinter wäre. Er drückte dagegen – und tatsächlich: Sie war nicht verschlossen. Vorsichtig drückte er sie auf, wobei sie seltsamerweise keinen Ton von sich gab. Also, dachte Ani, dürfte es nicht allzu selten geschehen, dass sie benutzt wurde. Hinter der Pforte war es stockdunkel und Ani konnte fühlen, wie kühle Luft aus dem Inneren des Tempels zu ihnen in die Mittagsglut strömte, angefüllt mit dem Duft von Weihrauch und Myrrhe. Ani erschauderte, denn er spürte, dass er dem Gott nahe war.
„Ja, hier haust Amun“, nickte der Vater wie zur Bestätigung, der ebenfalls den Duft des Gottes gerochen hatte. „Der Herrscher der Orakel, der Zürnende. Und keiner weiß so recht, warum er überhaupt zürnt.“ Vater nahm Ani den Korb aus den Händen. „Ich erledige das hier jetzt gleich. Und du bleibst auf der Stelle stehen und wartest, bis ich wiederkomme.“
„Nimm mich mit!“, flehte Ani, doch der Vater schüttelte den Kopf und sah ihn streng an. Schon war er im Dunkel des Tempels verschwunden, während Ani ihn noch rufen hörte: „Ihr heiligen Männer, wo seid ihr, um meine Gaben zu empfangen? Wo seid ihr, ich höre doch eure Stimmen?“ Nach einer Weile Grabesstille konnte Ani den Vater wie aus weiter Ferne abermals rufen hören: „Ihr heiligen Männer, für Gott Amun bringe ich meine Opfergaben. So zeigt euch und nehmt sie entgegen!“ Auf einen Wimpernschlag absoluter Ruhe folgte ein Schrei - dann noch einer und dann noch einer, gurgelnd und erstickend. Ani schreckte derart zusammen, so dass er unwillkürlich einen Schritt nach hinten tat. Er stolperte, er fiel, er hörte Schritte und Stimmen, er sprang auf, lief fort. Wohin nur? Wohin?
Plötzlich stand er vor ihm: Ein Junge – etwa in seinem Alter, vielleicht ein oder zwei Jahre älter. Nur so ganz anders sah er aus. „Verpetz mich nicht!“, sagte der andere außer Atem, was Ani zunächst verwirrte, klang es doch eher wie ein Befehl und weniger wie eine Bitte. Doch Ani spürte eine seltsame Komplizenschaft in sich aufkeimen, denn auch er wollte nichts anderes, als schleunigst wegzukommen von diesem grauenhaften Ort. „Komm!“, winkte er dem Jungen zu. „Im Schilf, da liegt unser Papyrusboot.“
Als Ani dem Jungen ins Boot half, sah er die schlammverschmierten goldene Sandalen an dessen Füßen. So etwas hatte er noch nie gesehen! Also nahm er die Füße des Jungen, einen nach dem anderen, und schwenkte sie im Flusswasser ab. „Du kannst mich doch nicht einfach anfassen“, staunte der fremde Junge, schaute dann aber doch ganz zufrieden drein, als seine Füße wieder sauber waren.
“Wieso denn das nicht?“, fragte Ani verwundert. Erst jetzt bemerkte er, was den Jungen so vollkommen anders aussehen ließ. Es war weniger die erlesene Kleidung, wie die goldenen Sandalen, der Schurz aus allerfeinstem Leinen, der breite Sonnenschutzkragen aus bunten Perlen oder das aufs Peinlichste in Falten gelegte Tuch, das von einem Goldreif auf dem Kopf des Jungen gehalten wurde. Diese Aufmachung erschien Ani schon eigentümlich genug, allein, weil sie von einer derartigen Gediegenheit war, wie er sie noch nie gesehen hatte. Was Ani sein Gegenüber so fremdartig erscheinen ließ, war vielmehr der gepflegte und wohlgenährte Körper des Jungen. Zudem war seine Haltung eigenartig gekünstelt. Er hockte nicht einfach auf den zu einem Boot gebundenen Papyrusstängeln, sondern er thronte geradezu auf ihnen. Es war offensichtlich, dass seine Haut nie lange der Sonnenglut ausgesetzt war. Sie war zwar nicht wirklich hell, allerdings auch keineswegs verbrannt, wie bei den Menschen zu Hause, die auf den Feldern arbeiteten. Außerdem war sie sauber und ohne jegliche Schrammen, Narben oder Pusteln. Und als Ani die gepflegten Hände sah, zischte er unwillkürlich mit den Zähnen.
„Was glotzt du denn so blöde?“ Der andere fühlte sich begutachtet, was ihm offenbar wenig behagte. „Ist das überhaupt dein Boot? Oder bist du so was wie ein Dieb?“
„Ich bin kein Dieb“, entgegnete Ani entrüstet, „genauso wenig wie ich ein Verräter bin.“
Erst jetzt nahmen sie die Priester wahr, die aus der Pforte hervorgequollen kamen und spähend sowie Verwünschungen ausstoßend an der Tempelmauer standen oder das Ufer absuchten. Der komische Junge schien Freude an der Szene zu haben, denn er duckte sich hinter das Schilf wie eine Katze, die sich auf einen Leckerbissen freut.
„Sollten wir nicht lieber abhauen?“, fragte Ani besorgt. „Der Fluss ist so reißend, dass wir längst weit weg sein werden, bis sie uns überhaupt gesehen haben.“
„Und dann?“, kam die Antwort. „Bis nach Malqata werden wir’s mit deinen armseligen Schilfbündeln wohl kaum schaffen.“ Dabei deutete der Junge auf ein in weiter Ferne liegendes flaches, aber weiträumiges Gebäude auf der anderen Seite des Nils.
„Was?!“, rief Ani fast ein wenig zu laut, um nicht die Priester auf sich aufmerksam zu machen. „Auf die andere Seite des Nils, in die Duat sollen wir fahren? Ins Reich der Toten und der Götter? Du bist doch nicht recht bei Trost?“
„Was für einen Blödsinn redet er daher?“ Der Junge funkelte ihn herrisch an. „Wer ist er überhaupt? Und was hat solch ein Bauernlümmel hier am Allerheiligsten des Tempels zu schaffen?“
„Dich in mein Boot retten.“ Ani blickte ihm fest in die Augen. „Wenn du willst, kannst du gerne aussteigen und zu deinen Priestern rübergehen.“
„Das sind nicht meine Priester. Das sind Amuns Priester.“
Ani meinte, etwas Feindseliges in der Stimme des Jungen zu hören. Und um der Maat Genüge zu tun, die Ausgewogenheit in allen Lebenslagen forderte, raunte er dem Jungen versöhnlich zu: „Ich bin übrigens Ani, der Sohn des Imenhotep.“
„Das passt ja gut!“ Der andere lachte. „Ich bin Amenhotep, der Sohn des Amenhotep.“ Stolz richtete er sich auf.
„Ja, komisch. Klingt ähnlich. Imenhotep – Amenhotep.“ Ani zuckte mit den Schultern.
„Du bist ja ein richtiger Bauerntrampel!“ Der Junge war begeistert und strahlte ihn an. „Imenhotep – Amenhotep. Das ist doch ein und dasselbe. Nur, dass ihr Bauern eben eine nachlässige Aussprache habt und euch schließlich auch noch an euer Genuschel gewöhnt habt und die Sprache verhunzt.“
„Warum beleidigst du mich?“ Ani wurde ärgerlich.
„Mein lieber Ani, das ist keine Beleidigung, sondern lediglich eine Feststellung.“
„Na, dann wirst du ja froh sein, wenn der Bauerntrampel dich von seinem verdreckten Papyrusboot runterschmeißt.“
„Ganz und gar nicht“, sagte Amenhotep versöhnlich. „Ich hab nämlich noch nie mit einem echten Bauerntrampel gesprochen. Meine Schwester Sit-amun und meine Base machen gerne eure Sprache nach und wir haben immer viel Spaß daran.“
„Wozu? Wenn ihr euch was zu sagen habt, dann sagt es in der Sprache, die ihr versteht. Und wenn ihr euch nichts zu sagen habt, dann haltet lieber das Maul.“ Ani war nun wirklich verärgert.
„Wie redest du mit mir?!“ Der fremde Junge wollte gerade vor Empörung aufspringen, als Ani ihn glücklicherweise noch rechtzeitig am Schurz packen und nach unten ziehen konnte, bevor er vom Ufer aus gesehen wurde.
„Pst! Sei still!“, wurde er von Ani angeherrscht. „Du willst doch unerkannt hier fortkommen. Was hast du überhaupt angestellt da drinnen? Vielleicht bist du der Dieb von uns beiden und hast dem Gott etwas von seinen Opfergaben stibitzt?“
„Ich darf doch bitten!“ Amenhotep sagte dies mit einer derartigen Entrüstung in der Stimme, dass Ani ihm augenblicklich glaubte, dass solch ein Gedanke ihm nie und nimmer in den Sinn gekommen wäre. „Ich habe der Wahrheit ins Gesicht geblickt“, sagte Amenhotep fast ehrfürchtig.
„Das ist meistens keine angenehme Begegnung.“
„Nein, meistens nicht. Aber man hat danach wenigstens Klarheit. Man weiß, von wem man belogen wird.“
„Ach komm, Amenhotep! Jeder von uns hat seine eigene Wahrheit. Ich hab meine, du hast deine, mein Vater hat seine und dein Vater ebenso.“
„Bauerntölpel-Blödsinn! Wir müssen uns nur trauen, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Wenn die Sonne aufgeht, ist die Nacht vorbei. Das ist die Wahrheit. Die Nacht ist voller Schrecken, Angst und Tod. Die Sonne ist Wahrheit und bringt sie ans Licht.“
„Oh je!“, Ani kicherte verhalten. „Da haben wir’s. Du bist der Sohn eines Priesters und redest deswegen solch ein Zeug daher. Womöglich bist du noch der Sohn eines Oberpriesters einer dieser verrückten Sekten.“
„Fast richtig!“, erwiderte Amenhotep und kicherte ebenfalls.
Plötzlich zogen sich die Priester zurück. Einer nach dem anderen verschwand wieder hinter der Pforte. Kaum war sie geschlossen, als sie abermals geöffnet wurde und zwei Priesterschüler etwas Schweres herausschleppten, ein Dritter hinterher.
Jetzt war es Amenhotep, der seinen neuen Freund im Boot zurückhalten musste. Und da er fürchtete, Ani könne jeden Augenblick anfangen, wie von Sinnen zu schreien, überlegte Amenhotep einen kurzen Atemzug lang, ob es denn nicht eine allzu widerwärtige Entweihung seiner selbst wäre, wenn er Ani den Mund zuhielte. Schließlich entschied er sich jedoch dafür, dass dies eine mit einem Kriegsfall vergleichbare Situation sei, die somit derartige Mittel erlaubte. Gerade noch rechtzeitig, denn Ani krümmte sich vor Schmerz, als hätte man ihm in den Magen getreten. Anis Tränen liefen über seine Hand, die er mit aller Kraft vor den Mund seines neuen Freundes hielt, während Amenhotep etwas Eigentümliches verspürte. Es war ein Gefühl, dass er bislang nur gegenüber seinen Eltern, Geschwistern, Verwandten und Freunden gekannt hatte. Außenstehende oder gar Fremde waren davon ausgeschlossen. Denn mit Menschen, die man nicht berührte, hatte man dort, wo er herkam, nur äußerst selten Mitgefühl.
Die Priester schleppten einen übel zugerichteten Toten heraus und schmissen ihn etwas flussabwärts wie ein Stück Abfall in den Nil. Ani krümmte sich vor Schmerz und versuchte, sich aus Amenhoteps Armen zu befreien, die bereits drohten, ihre Kraft zu verlieren. Also nahm Amenhotep Ani einfach fest in die Arme und strich ihm tröstend über den Kopf.
Schon längst waren die Priester wieder hinter der geheimnisvollen Pforte verschwunden, als Ani sich soweit beruhigt hatte, dass er versuchen konnte, sich zu erklären. „Das war mein Vater. Sie haben meinen Vater erschlagen! Warum nur? Warum? Er wollte Opfergaben bringen für Gott Amun, der in seinem Zorn mir erst heute im Morgengrauen die Mutter und die neugeborene Schwester genommen hat.“
Amenhotep hielt das schluchzende Bündel Mensch fest in seinen Armen, das binnen eines Tages alle seine Lieben verloren hatte. Fast meinte er, dieselben Schmerzen fühlen zu können wie Ani. Nur dessen langsam aufziehende Angst vor dem Morgen kannte er nicht. „Er hat das Allerheiligste betreten“, versuchte Amenhotep zu erklären. „Keiner darf das, nur der Pharao und der Oberpriester. Darauf steht der Tod.“
„Woher weißt du denn das?“
„Oh, so etwas bringt man mir im Unterricht bei. Und noch etliches anderes mehr…“
„Nein!“, unterbrach ihn Ani. „Ich meine, woher weißt du, dass mein Vater das Allerheiligste betreten hat? Er wollte nur Gott Amun opfern, um ihn gnädig zu stimmen.“
„Na, ich war doch dabei!“ sagte Amenhotep verwundert. „Plötzlich stand er da, wie aus dem Erdboden gewachsen und hatte einen Korb mit sich.“
„Ja, die Opfergaben. Hat Amun sie bekommen?“
Amenhotep stutzte. „Ja, sicher. Natürlich hat er sie bekommen. Dein Vater hat sie ihm direkt vor die Füße gelegt. Verstehst du denn nicht? Dein Vater ist mir nichts dir nichts in das Allerheiligste des Gottes Amun gelaufen, des Dunklen, den niemand erblicken darf. Er hat dem Gott ins Angesicht geschaut. Also musste er sterben.“
Ani wurde bleich vor Schrecken. „Aber er wollte doch nur die Opfergaben bringen. Und was hast du getan? Du hast einfach zugesehen, wie man einen unbescholtenen Mann umbringt?“
„Ich wusste ja nicht, dass es dein Vater war. Und dich kannte ich ja auch noch gar nicht. Er war einfach nur ein Mann, der am falschen Ort war.“
„Er ist tot! Für dich ist es lediglich ein Missverständnis, eine Bagatelle! Aber für mich war er der letzte Mensch, den ich noch hatte.“ Ani wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. „Jetzt sag mir, warum hast du dich dann überhaupt verborgen?“
„Der Gang führt direkt ins Allerheiligste.“
„Na und?“ Ani verstand nicht. „Du warst doch längst schon draußen.“
„Sicher. Aber wer durch diesen Gang kommt, war vorher zwangsläufig im Allerheiligsten.“
„Aha…“ Ani begann zu verstehen. „Warst du es etwa, der meinen Vater getötet hat?“
„Blödsinn! Ich hatte gerade eine Unterweisung durch den Oberpriester. Die letzte Tempelkammer vor dem Allerheiligsten ist von diesem nur durch einen halbdurchsichtigen Vorhang getrennt. Und hinter dem thront Gott Amun. Plötzlich stand dein Vater direkt neben dem Gott und legte ihm seine Gaben zu Füßen. Es gab einen unglaublichen Tumult. Ich habe ihn genutzt. Ich bin durch den Vorhang geschlüpft und habe Amun endlich ins Gesicht geschaut. Und soll ich dir sagen, was ich erblickt habe? Eine lächerliche Statue aus schwarzem Stein, leblos und starr. Ohne jedes Leben. Sie war noch nicht einmal von besonders erlesener Qualität. Irgendeine Statue wie sie in jedem Provinz-Tempel herumsteht. Ein Popanz, ein Mummenschanz, ein Spuk, um kleinen Kindern Angst zu machen.“
„Lass mich gehen, ich muss Vater suchen, damit ich ihn wenigstens richtig bestatten kann.“ Schon war Ani aus dem Boot gesprungen und hatte den Morast mit schnellen Schritten durchquert, um am Ufer entlang zu laufen bis zu der Stelle, wo die Priester den Leichnam ins Wasser geworfen hatten. Obwohl der Nil schnell dahinströmte war der Körper des Vaters nicht allzu weit abgetrieben worden. In einem Gestrüpp, das kaum noch aus der Flut herausragte, war er hängen geblieben. Schnell war Ani dorthin gewatet. Doch so sehr er auch zog und zerrte, das Wasser drückte den Leichnam immer stärker ins Gebüsch. „So hilf mir doch!“, rief er Amenhotep zu, der inzwischen ebenfalls das Boot verlassen hatte und am Ufer stand.
„Lass das!“, kam Amenhoteps Antwort. „Ich hole Hilfe. Und dann bekommt dein Vater die ihm gebührende Bestattung.“ Schon war er, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, in Richtung der Anlagestelle gelaufen. Ani sah ein, dass all seine Versuche nichts weiter bewirken würden, als dass der Leichnam vom Druck des Stroms nur noch tiefer ins Gebüsch gedrückt werden würde. So setzte er sich ans Ufer, aufmerksam darauf achtend, dass der Fluss den Körper nicht doch noch mit sich riss oder gar Krokodile sich daran zu schaffen machten.
Da saß er nun. Heute Morgen erst hatte er Mutter und Schwester in der kargen Erde begraben und nun starrte er auf den toten Vater, der der letzte Mensch war, den er auf dieser Welt noch hatte. Mit seinen ausgebreiteten Armen, die sich mit der Strömung bewegten, erinnerte ihn der tote Vater an einen Falken, der nahezu bewegungslos hoch über der Wüste schwebte. Ani fühlte sich einsam und verlassen. War er doch wie das Stück Treibholz, das er gerade vorbei strudeln sah. Es gehörte niemandem mehr und es trieb sinn- und zwecklos ins Nirgendwo. Wozu sollte er noch zurück in die elterliche Hütte? Das Land bebauen? Das konnte er niemals allein. Hatte es doch schon sein Vater kaum geschafft. Man würde ihn einfach von dem Stück Land fortjagen, das man seinem Vater zur Bewirtschaftung zugeteilt hatte. Er war jetzt wie einer der Köter, die ziellos umherstreiften und darauf hofften, von einer gnädigen Seele etwas Essbares zugeworfen zu bekommen.
Plötzlich schob sich ein mächtiger Schatten stromaufwärts. „Ani!“, hörte er rufen. „Ani, komm an Bord!“ Das prächtige Boot, das vorhin an der Anlegestelle dümpelte, hatte Segel gesetzt und war direkt auf ihn zugekommen. Eine Strickleiter hing an seiner Bordwand herunter, auf deren Höhe Amenhotep über die Reling lugte. Zwei Soldaten kletterten die Leiter hinunter und machten sich daran, Anis Vater aus dem Gestrüpp zu befreien. Sie legten ihn auf eine ebenfalls herabgelassene Bahre, die sogleich wieder an Bord gehievt wurde. Alles war so schnell vor sich gegangen, dass Ani seinem toten Vater kaum hatte ins Gesicht blicken können.
„Ani, komm mit an Bord!“ Amenhoteps Stimme war voller Mitgefühl. „Wir bringen ihn ins Einbalsamierungshaus, wo er siebzig Tage bleiben wird. Danach kannst Du ihn bestatten. Der Gute Gott hat sicherlich noch irgendwo ein freies Grab für einen verdienten Mann. Und du, komm mit und bleib bei mir. Hörst du, Ani? Wo sonst willst du denn hin? Du bist doch nun ganz allein. Und berührt hast du mich sowieso schon. Also kannst Du auch mein Diener sein.“
„Dein Diener?! Ich bin ein freier Mensch und diene nur dem Guten Gott!“
„Dann diene halt eben ihm!“, lachte Amenhotep vergnügt.
„Außerdem kann ich die Priester und Einbalsamierer überhaupt nicht entlohnen. Und was wird schließlich dein Vater sagen, wenn du noch einen weiteren Fresser anschleppst, der nichts Rechtes kann?“
„Du solltest dir eher Gedanken wegen meiner Mutter machen. Aber lass das alles mal meine Sorge sein. Und nun komm!“ Amenhotep machte Anstalten als ob er die Strickleiter hinunterklettern wollte. „Ich kann dich einfach auch abführen lassen. Ein Wort von mir und die Bewaffneten kommen dich holen.“
„Das traust du dich nur, weil ich ohne Vater und Namen wehrlos bin und niemand mehr für mich einsteht!“
„Du irrst dich, Ani. Ich bin es, der jetzt für dich einsteht.“
Ani stockte. Denn wieder hatte Amenhoteps Stimme denselben Klang lauterer Wahrheit, wie vorhin, als Ani ihn des Opferdiebstahls bezichtigt hatte. „Warum solltest du das tun? Ich bin doch nur ein Bauerntrampel?“
„Eben drum, Ani, eben drum. Komm! Und jetzt gib mir deine Hand.“ Amenhotep beugte sich weit nach unten, so dass man ihm sogleich zur Hilfe eilen wollte und ein gewaltiger Aufruhr an Bord entstand. Der wurde von Amenhotep jedoch schnell mit einem herrischen „Fort mit Euch!“ weggezischt.
Und da Ani keinerlei Ahnung hatte, was er überhaupt hätte tun sollen - sich den Nil hinab treiben lassen, in der Stadt um milde Gaben betteln oder nach Hause zurücklaufen, wo sowieso niemand mehr auf ihn wartete -, ergriff er Amenhoteps Hand. „Ich freue mich, dass du sie mir reichst“, sagte der, als er seinen neuen Freund an Bord zog.
Kaum hatte Ani die Planken des Schiffes betreten, meinte er, sich in einem Traum wieder zu finden. Eine Reihe Bewaffneter stand bereit, die ihn, einer wie der andere, misstrauisch, ja, feindlich beäugten. Und dennoch war die Schönheit, die ihn plötzlich umgab, dasjenige, was Anis Sinne am meisten beschäftigte. Unter einem weiten Baldachin lagen auf einem Podest, zu dem drei Stufen hinaufführten, Berge von Kissen. Saubere Kissen wohlgemerkt - die aussahen wie neu. Davor stand auf einem hohen Piedestal ein Räuchergefäß, das schwere, süße Düfte verbreitete. Auf einem mit bunten Einlagen geschmückten Tischchen leuchtete ein gefüllter Krug aus blauem Glas im Sonnenlicht, an dessen Außenwänden Wassertropfen perlten - so kühl war das Getränk in seinem Inneren! Gleich daneben stand in einem riesigen Topf ein seltsamer Baum, an dem bunte Schleifen zitternd im Flusswind flatterten. Ein aufgeregter Mensch, Ani konnte sich nicht recht entscheiden, ob er ihn für einen Mann oder eine Frau halten sollte, kam mit einer riesigen goldenen Wasserschale in Händen und einem blendendweißen Tuch über dem Arm auf ihn zu. Er trug ein golden gegürtetes dunkelviolettes, bodenlanges Gewand, in das man die Umrisse von Mandragora-Früchten eingewebt hatte sowie eine übertrieben gelockte Perücke, die ein prächtiger goldener Stirnreif krönte. Sein stark geschminktes Gesicht zeigte nichts als Unwillen. „Du hast ihn berührt, junger Herr“, sagte er vorwurfsvoll zu Amenhotep und hielt ihm die Wasserschale entgegen. Und als der nicht reagierte, versuchte er es abermals. „Du reichtest deine Hand, junger Herr. Dieser Mensch ist unrein, denn er ist nicht von deiner Art…“
„Lass das Wasser und gieß den Weihrauchbaum damit. Er sieht aus als ob er’s nötig hätte“, sagte Amenhotep bestimmt. Und da der Andere zögerte und den Eindruck machte, als habe er nicht recht verstanden, setzte Amenhotep nach. „Na los!“, lachte er und klatschte in die Hände, woraufhin der Violette unterwürfig davonlief. Die Soldaten grinsten. Und nachdem Amenhotep ihnen zugenickt hatte, verteilten sie sich zwanglos auf Deck.
„Ich will meinen Vater sehen!“, sprach Ani seinen Freund plötzlich an.
„Geduld! Komm jetzt, sei vernünftig und setz dich zu mir“, sagte Amenhotep freundlich. „Heute Abend kannst du deinen Vater noch einmal sehen. Wir bringen ihn jetzt sofort ins Einbalsamierungshaus. Lass sie ihn dort ein wenig vorbereiten, damit du dann heute Abend geziemend Abschied nehmen kannst.“
Gemächlich drehte das Schiff im Wind und trieb dem gegenüberliegenden Ufer des Nils entgegen, während die beiden neuen Freunde miteinander plauderten, Amenhotep auf den blitzsauberen Kissen sitzend und Ani auf einer der drei Stufen, die zum Podest emporführten. Amenhotep ließ den Violetten sogar noch ein zusätzliches Glas holen, was dieser eher widerstrebend tat. Ani hatte noch nie etwas derart Köstliches geschmeckt. Es war, als ob sich in seinem Mund eine Lotusblüte öffnete und schwere, süße Aromen freisetzte.
„Das ist Wein“, erkläre Amenhotep. „Er kommt aus den Gärten meiner Mutter im Fayum. Es ist der beste Wein im ganzen Land. Sogar die Achijawa wollten in eintauschen, die ja frech von sich behaupten, einer ihrer Götter habe ihnen das Wissen um den Weinbau geschenkt. Immer wieder haben sie nachfragen lassen. Aber meine Mutter hat verboten, dass je ein Tropfen ihres Weins Ägypten verlässt.“
Ani verstand nichts von alledem, was Amenhotep ihm sagte. Es war ihm auch einerlei. Denn er fühlte sich außerstande, noch über irgendetwas nachzudenken. Der kalte Wein machte ihn überdies müde und entspannt. Doch trotz allem, was ihm heute widerfahren war, fühlte er sich auf einmal seltsamerweise wohlig erschöpft und ruhig. Das Einzige, was zu wünschen er noch in der Lage war, wäre lediglich gewesen, dass diese Fahrt nie enden möge, so wohl fühlte er sich im Augenblick. Sie fuhren direkt auf das linke Ufer des Flusses zu, dort, wo irgendwann später die Sonne untergehen würde. Und obwohl er wusste, dass der Nil mit einem solchen Schiff schnell überquert war, hoffte Ani, dass diese Fahrt noch möglichst lange dauern würde.
Ani war nicht verwöhnt. So war er zwar enttäuscht, als das Schiff schnell einen breiten Kanal am anderen Ufer erreicht hatte, andererseits aber auch dankbar, dass ihm wenigstens diese kurze Dauer der Überfahrt geschenkt worden war.
Das Schiff ankerte vor einem großen Haus, direkt an der Mündung des Kanals, das leuchtend blau angestrichen war.
„Das hält die Fliegen fern“, erklärte Amenhotep. „Blau macht ihnen Angst. Weil sie dann glauben, sie flögen geradewegs in die Unendlichkeit des Himmels.“
Erst als man den Leichnam seines Vaters von Bord brachte, verstand Ani: Es war das Einbalsamierungshaus. Der Violette druckste vor Amenhotep herum. „Junger Herr, der Oberste der Einbalsamierer lässt nachfragen, ob es denn wirklich eine königliche Vorbereitung des Dahingeschiedenen für die Ewigkeit sein soll.“
„Selbstverständlich! Sag es ihm.“
Der Violette räusperte sich. „Derartige Vorbereitungen sind aber üblicherweise nur den Familienmitgliedern des jungen Herrn vorbehalten…“
„Ach, sei still und tu wie dir befohlen. Sag es ihm einfach!“ Mit einer beiläufigen Handbewegung schickte Amenhotep den vor Schreck kreidebleich Gewordenen fort. „Es ist der Vater meines Freundes. Und der gehört so gut wie zur Familie!“
Kaum hatten die Soldaten den Leichnam ausgeladen, setzte sich das Schiff wieder in Bewegung. Auf Anis entsetzten Blick meinte Amenhotep nur, dass er schließlich versprochen habe, dass Ani am Abend gebührend Abschied von seinem Vater würde nehmen können. Und auf ein Versprechen seinerseits ‑ Ani möge sich dies von nun an für alle Zeiten merken ‑ könne man sich jederzeit verlassen. Schnell jagte das Schiff den Kanal entlang, von dem plötzlich ein kurzer Stichkanal zu einem See führte, der von Dattelpalmen umstanden war. Es war wie das Traumbild einer Oase: Inmitten all des grau-gelben öden Sandes leuchtete ein tiefblauer See, umringt von hohen Palmen und regelrechten Blumenpolstern, die in allen Farben blühten.
„Den hat mein Vater meiner Mutter als Liebesgabe geschenkt. Als sie noch jung waren.“ Amenhotep deutete auf den See.
„Den ganzen See?“, fragte Ani ungläubig. „Dann muss dein Vater aber reich sein!“
„Tja“, nickte Amenhotep. „Das war in der Tat ein kostspieliges Unterfangen. Hier war ja gar nichts. Es dauerte ewig, bis das Becken ausgehoben worden war. Und die besten Architekten scheiterten daran, es schließlich auch dicht zu bekommen.“
„Und was macht deine Mutter nun mit ihrem See?“ Ani kam aus dem Staunen nicht mehr heraus.
„Sie fährt darauf spazieren.“
„Was? Sie fährt einfach nur darauf spazieren?“ Ani meinte seinen Ohren nicht trauen zu können. „Das kann sie doch genauso gut auf dem Nil machen.“
„Wo denkst du hin?“, kam entrüstet Amenhoteps Antwort. „Nur auf einem solchen Schiff wie dem unseren kann man den Nil sicher befahren. Bei all den Krokodilen und vor allem den zahllosen bösartigen Nilpferden ist Vorsicht geboten. Auf ihrem See aber kann sie, nur von ihren Zofen begleitet, nach Herzenslust spazieren fahren und ihre Ruhe genießen. Bei uns zu Hause sind ja immer und überall irgendwelche Menschen. Diener und Beamte, Wesire und Priester. Sogar der Zeugung der Kinder wünscht man beizuwohnen. Also hat mein Vater ihr diesen ganz persönlichen See geschenkt, den er selbstverständlich mit ihr bei einer gemeinsamen Bootsfahrt eingeweiht hat.“ Amenhotep zwinkerte.
„Ha“, schlussfolgerte Ani. „Und dabei bist du gezeugt worden!“
„Ich habe so sagen hören“, pflichtete Amenhotep schmunzelnd bei, wobei Ani sofort an seine eigenen Eltern denken musste, die ihn gewiss unter ganz anderen Umständen gezeugt hatten. Noch immer konnte er nicht fassen, was alles geschehen war und zwickte sich unauffällig ins Bein, um sicher zu gehen, dass er nicht träumte.
Am Ende des tief ins Land hinein führenden Kanals befand sich ein beeindruckend großes Hafenbecken, in dem mehrere Schiffe lagen. Eines von ihnen wurde gerade mit großem Geschrei ausgeladen. Fremdartige Tiere wurden von Bord geführt, die Ani noch nie zuvor gesehen hatte. Schwarz-weiß gestreifte, pummelige Pferde, fast mannshohe zottelige Affen, die artig an der Hand ihrer Pfleger von Bord gingen, riesige, in Käfige eingesperrte Löwen, die furchterregend brüllten und nervöse Leoparden, die unablässig fauchten und rastlos in ihren Gefängnissen auf und ab liefen. Am eindrucksvollsten fand Ani jedoch ein Tier mit turmhohem Hals, das aussah wie eine Kreuzung von Leopard und Dromedar. Es stank erbärmlich, was selbst aus der Ferne noch deutlich zu vernehmen war. Es wurde gerade die Rampe hinuntergeführt und stakste mit seinen langen, dürren Beinen unbeholfen über die Planken.
„Komm“, winkte ihm Amenhotep zu. „Der Trubel kommt uns sehr gelegen. Alle begaffen jetzt die Viecher, also werden sie uns kaum beachten.“ Und schon war er von Bord und nickte Ani aufmunternd zu. Der kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus: Es wurde geschrieen und gelacht, hierhin gerannt und dorthin, zwischendrin die allgegenwärtigen Wasserverkäufer aber auch Händler, die irgendwelche anderen Dinge anpriesen. Bald wäre Ani angst und bange geworden vor dieser ungewohnt riesigen und lauthals krakeelenden Menschenmenge, hätten sich ihnen nicht die Bewaffneten angeschlossen, die ihnen sogleich einen Weg durch die Massen bahnten. Eigentlich taten sie nichts weiter, als vor, neben und hinter Amenhotep und Ani zu gehen. Ihre schiere Gegenwart genügte jedoch, die Menschen wie selbstverständlich ausweichen zu lassen, so dass sich schnell eine Gasse bildete. Die meisten Menschen senkten sogar den Kopf, als ob sie einer ehrwürdigen Person Achtung darbieten wollten.
„Und du sagst noch, dass sie uns kaum beachten würden“, zischte Ani.
„Das tun sie doch auch gar nicht“, entgegnete Amenhotep belustigt. „Die glotzen alle nach den Tieren hin. Und wer im Weg steht, weicht aus und senkt den Blick. Was meinst du, was sonst hier los wäre, wenn nicht gerade stinkende und geifernde Bestien ausgeladen werden würden.“
Fröhlich marschierte Amenhotep weiter, während Ani die Augen überzugehen drohten. Was von weitem wie ein einziger lang gezogener Gebäudekomplex ausgesehen hatte, stellte sich von nahem als regelrechte Stadt heraus, die sich vom Hafen bis zu einem teilweise grotesk verschachtelten, riesigen Bauwerk erstreckte. Jetzt, während der Nilflut, stand die dem Fluss zugewandte Seite mitten im Wasser. Trutzig ragten dort die Mauern empor. Aber dennoch wirkte der Bau nicht einschüchternd, abweisend oder gar feindlich. Die vielen Anbauten, die in den unterschiedlichsten Stilen ausgeführt und ebenso bunt bemalt waren, ließen ihn sogar freundlich, ja, heiter, wenn auch wehrhaft erscheinen.
Amenhotep bemerkte Anis Interesse. „Das ist der Harem. Jede der Frauen bekommt ihr eigenen Gemächer, die sie selbstverständlich ganz nach ihrem Geschmack ausstatten darf. Sie sollen sich ja auch zu Hause fühlen. Ich wohne gleich daneben.“
„Aha“, dachte Ani, „dann ist er wohl der Sohn von irgendeiner der Haremsdamen.“ Weitere Überlegungen konnte er nicht mehr anstellen, da sie gerade an einer Töpferwerkstatt vorüberkamen. Noch nie hatte Ani derart bemalte Gefäße gesehen. Und er kannte sich ein wenig darin aus, denn seine Freundin Sahirah … Nun, er nannte sie seine Freundin, während sie ihn hingegen hartnäckig als einen guten Bekannten zu bezeichnen pflegte. Jedenfalls war seine Freundin Sahirah die Tochter eines Töpfers und Ani hatte fast all seine freie Zeit in dessen Werkstatt verbracht. „Dieses Hellblau ist wunderbar“, entfuhr es ihm. „Wie bekommen sie das nur hin? Und dann die Ornamente! So beschwingt und heiter!“
„Ach was!“, staunte Amenhotep. „Ich dachte dein Vater war Landmann.“
„War er auch.“ Und knapp erzählte Ani die Geschichte von Sahirah.
„Und warum zeigt sie sich dir gegenüber so spröde, deine Sahirah?“ Amenhotep war auf einmal sehr viel mehr an einer womöglich tragischen Liebesgeschichte interessiert, als an Anis Wissen über das Töpferhandwerk.
„Nun ihr Vater ist Töpfer und führt eine eigene Werkstatt. Mein Vater ist…“ Ani stockte. „Mein Vater war nur Pachtbauer.“
„Ich verstehe.“ Amenhotep nickte. „Wir sollten dafür sorgen, dass solche Dinge zukünftig aufhören. Und jetzt spute dich ein wenig. Wir sind schon spät dran. Und weder meine Mutter noch mein Vater schätzen Unpünktlichkeit.“
Ani nahm sich fest vor, bei allernächster Gelegenheit einen ausgedehnten Streifzug durch die seltsame Stadt zu unternehmen. Denn alles, was hier gefertigt wurde, schien gediegener und von weitaus besserer Qualität zu sein als alles, was er bislang gesehen hatte. Sogar die Straße war sauber. Zwar gab es auch hier Schweine, die sich um den Unrat kümmerten und grunzend umherstanden. Aber der Dreck sammelte sich hier in Gossen, um die sich die Schweine versammelten, und war nicht wie sonst überall wild verstreut.
Erst als sie es durchschritten, nahm Ani wahr, welch großes und prächtig ausgeschmücktes Tor die Stadt mit ihrem Lärm und Gestank vom Inneren des Gebäudekomplexes abschirmte. Die Torflügel waren aus wertvollstem Zedernholz, das noch immer duftete, so alt es auch sein mochte. Zwei Bewaffnete winkelten zum Gruß ihre Speere an als Amenhotep an ihnen vorbeilief und ein runder Mann mit einem enormen Perlenkragen und einem mindestens ebenso eindrucksvollen, dicken Bauch stellte sich ihnen in den Weg.
„Junger Herr, hat dein Begleiter schon die notwendige Reinigung erhalten, um das Innere betreten zu dürfen?“
Amenhotep packte Ani stumm am Arm und schob ihn dem dicken Mann entgegen. Der nahm Amenhoteps Berührung mit einem erstaunten Gesichtsausdruck zur Kenntnis. „Bring ihn nachher zu mir“, sagte Amenhotep. „Und sei gut zu ihm, hörst du?!“ Und schon war er verschwunden.
„Na komm!“, meinte der Dicke und gab Ani einen sanften Klaps auf die Schulter, wischte sich aber sogleich verstohlen die Hand an seinem Schurz ab. „Ich heiße Rechmire. Und ich bin dafür verantwortlich, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Das heißt, dass du jetzt erst einmal tüchtig gewaschen wirst. Dann kommt die Wolle von deinem Kopf.“ Rechmire warf einen heimlichen Blick auf Anis Haare und nickte stumm, als ob er seine Ahnungen bestätigt sah. „Und etwas Frisches zum Anziehen für dich werden wir auch noch finden. Hast du bestimmte Wünsche?“
Ani muss ihn angesehen haben wie ein Schaf beim Blöken. Denn Rechmire lachte nur laut und knuffte sein überfordertes Mündel in die Seite. „Na komm, mein Kleiner, jetzt wird’s erstmal schön nass und frisch. Wie heißt du überhaupt?“
Ach, war das herrlich in diesem kleinen, dunklen, kühlen Raum! Nur durch ein sternförmiges Fenster drang ein Strahl des Sonnenlichts herein, das sich in unzähligen schwebenden Wassertröpfchen spiegelte, sie tanzen ließ und Abermillionen von Farben hervorzauberte. Kurze Augenblicke nur leuchteten sie auf, die mit keiner Macht der Welt zu bannen waren. Noch nie hatte Ani eine solch liebevolle Zuwendung erfahren wie in diesem Bad. Sicher, seine Mutter hatte ihn auch manchmal fürsorglich gewaschen. Aber meistens war ja kaum einmal richtig Zeit dazu. So lange die Sonne schien, war man auf dem Feld. Und war man endlich zu Hause, dann war man meist müde und wollte nur noch essen, trinken und schlafen. „Ach …“ Ani seufzte leise. „Essen, trinken und schlafen …“
„Geduld … Hab nur Geduld …“, sagte eine der drei Dienerinnen, die aus ständig neu gefüllten Schalen lauwarmes Wasser über ihn gossen. „Hier, wo du jetzt bist, kommt alles zu seiner Zeit.“ Doch wie zum Protest meldete sich Anis leerer Magen und knurrte erbärmlich wie ein Straßenköter. Das Gelächter der drei jungen Mädchen muss bis weit in die Stadt hinein zu hören gewesen sein.
Nachdem man ihn gewaschen, rasiert und danach abermals gewaschen hatte, fühlte Ani sich frisch und fast wie neu geboren. Rechmire legte ihm die Hand auf die Schulter. „Da du noch nie heiligen Boden betreten hast, müssen wir dich nun rituell reinigen.“
„Und was bedeutet das?“ Ani fürchtete das Schlimmste.
„Keine Angst, dies geschieht nur einmal. Und es tut auch nicht weh. Es ist nur ein wenig warm – und dann auch wieder kalt zugleich.“
Drei Mal musste Ani von einer Wanne mit kochend heißem Wasser in eine andere umsteigen, die mit Wasser aus der tiefsten und kühlsten Zisterne gefüllt war, die Ani sich vorstellen konnte. Jedes Mal war er froh, in das andere Becken gestiegen zu sein, bereute diese Freude aber auch jedes Mal keine drei Wimpernschläge später. Schließlich landete er in einem weiteren Gemach auf einem angenehm kühlen marmornen Tisch. Niedrige Bogengänge trennten den Raum von einem wunderschönen Garten. Eigentlich war es gar kein Garten, überlegte Ani, sondern nur eine saftige Wiese auf der bunte Blumen wuchsen. Doch ihm fiel schnell auf, dass es nur drei Arten von Blumen waren, die hier standen: Margeriten, Kornblumen und Mohn.
„Es ist eine wunderschöne Farbzusammenstellung, nicht wahr?“ Amenhotep war in seiner Ungeduld zurückgekommen, um nach seinem Schützling zu sehen. „Das Weiß der Wahrheit, das Blau der Ewigkeit und das Rot der Liebe. Und unter allem: das Grün der Zuversicht. Mein Vater hat sich das ausgedacht. Hübsch, nicht wahr?“
„Oh, es ist bezaubernd“, pflichtete Ani ihm eifrig bei. „Es ist so einfach, so grundsätzlich - einfach nur schön. Dein Vater ist ein wahrer Künstler. Er dichtet und malt und musiziert nicht mit Worten, Farben oder Tönen, sondern mit der Natur. Er muss ein großer Gärtner sein!“
Jetzt stand Amenhotep mit offenem Mund da. „Na, das musst du ihm aber nachher gleich sagen. Und zwar genauso wie du es eben zu mir gesagt hast. Er wird dich lieben dafür. Er wird dich bestimmt zu seinem Hofdichter machen oder so was. Hast du doch mit deinen Worten sein Herz genau getroffen. Und dies nur, weil du seine Wiese gesehen hast.“
Ani kam gar nicht mehr dazu, etwas zu erwidern, da ihn plötzlich eine Schar von freundlich dreinblickenden Dienerinnen umringte. Eine fummelte an der linken Hand, eine andere an der rechten, eine schabte am linken Fuß, die nächste am rechten, eine zupfte an irgendwelchen übersehenen Härchen, eine weitere massierte den kahlen Kopf und von beiden Seiten wurde Anis Gesicht überdies mit irgendwelchen Dingen beschmiert. Doch während all der Zeit sah er nur in die Gesichter von bildhübschen, freundlich lächelnden Mädchen, die ihm Gutes tun wollten. Sie waren in wunderschöne weiße Gewänder gekleidet, die eigentlich gar nicht da waren, so durchsichtig waren sie. Es ist ein eigentümlicher Reiz, dachte Ani. Sie sind bekleidet, doch ihre Gewänder schenken die Möglichkeit, dass man ihre makellosen Körper mit den Augen genießen darf. Wie viel Schönheit hatte er heute schon sehen dürfen! Und wie gerne hätte er jetzt auch mit seinen Fingern genießen wollen, was seine Augen voller Freude betrachten durften.
„Daran darfst du hier, in diesem Haus, noch nicht einmal denken!“, unterbrach Amenhotep die Sinnesfreude seines Freundes, die sich in unwillkürlichen Regungen zeigte. „Sie sind Dienerinnen fürwahr. Aber das heißt nur, dass sie dazu da sind, dir die Fingernägel zu feilen und dich hübsch zu schminken. Sie sind die Besten ihrer Zunft und eine Zierde für das Große Haus. Dabei sind sie nebenher so freundlich und gestatten dir, dich währenddessen an ihren schönen Körpern zu erfreuen. Für alles andere aber, wie kochen, Sandalen reparieren oder was auch immer, sind sie nicht zuständig. Dafür gibt es andere Diener und Dienerinnen. Und sie werden ihr Bestes geben, dessen sei versichert, dich in ihrem jeweiligen Bereich zufrieden zu stellen.“
Ani wurde rot, denn er fühlte sich ertappt. Wortlos hielt ihm Amenhotep eine runde Bronzescheibe an einem Stiel vors Gesicht, die blank poliert war. Ein Schrei des Entsetzens entfuhr Ani, so dass die soeben noch freundlich lächelnden Dienerinnen mit etlichen Ahs und Ohs erschrocken beiseite sprangen. Nach einem Augenblick der Stille brachen alle in albernes Gekicher aus, das Ani jedoch noch mehr reizte. Erst als er sah, das Amenhotep und Rechmire am lautesten von allen lachten, warf er abermals einen Blick in den Spiegel. „Aber das ist doch einfach lächerlich. Ich sehe aus wie eine schlecht bemalte Statue in irgendeinem Tempel. Und diese Perücke! Wie grässlich! Das bin nicht ich!“
„Doch, Ani“, erwiderte Amenhotep mit aufrichtiger Freundlichkeit. „Das bist du. Und du wirst es auch immer bleiben, egal womit man dich behängt. Sieh nur hin: Das ist Ani. Und der Rest von dem, was du siehst, ist ein bisschen Farbe, ein bisschen Schmuck, Tralala eben, um deine Schönheit zu unterstreichen. Und niemand im Land weiß verborgene Schönheit besser zu entdecken, als unsere liebreizenden Dienerinnen.“ Amenhotep machte eine knappe Geste, woraufhin die Gepriesenen geziert wie sich im Wind wiegende Lilien wieder verschwanden. „Hier im Großen Haus lieben wir es, ein wenig extravaganter zu sein. Wir gehen nicht mit der Mode, wir machen die Mode. Und so ist es unabdingbar, zumindest auf der Höhe der Zeit zu sein. Darum deine Aufmachung. Es ist ein blödes Spiel, ich weiß, aber wir alle haben auch schon sehr viel Spaß daran gehabt.“
„Ich hab keinerlei Ahnung wovon du überhaupt redest. Aber lass mich wenigstens diese blöde Perücke abnehmen.“ Und schon schwebte sie an Anis Hand durch die Luft.
„Ach - gar nicht mal so schlecht“, Amenhotep schien von dem Anblick sogar ganz angetan zu sein. „Was meinst du denn, Rechmire?“
„Oh, bei Fragen der Mode fühle ich mich nicht wirklich zuständig …“, versuchte der Oberhofmeister einer Blamage zu entgehen.
„Ach was?!“, meinte Amenhotep erstaunt. „Einerlei! Ich finde Ani ohne Perücke tatsächlich auch besser. Und da die Mädchen ihn nicht übertrieben geschminkt haben, kreieren wir heute eben einfach die allerneueste Mode des Hohen Hauses, die Landmann–Mode. Und statt erlesener Duft-Essenzen nehmen wir schlichtes Rosenwasser.“ Wie aus dem Nirgendwo erschien eine der tänzelnden weißen Lilien und besprengte Ani mit besagter Essenz.
„Na, dann können wir ja jetzt gehen“, sagte Ani missmutig und Rechmire kicherte.
Als sie über den weitläufigen Hof gingen, fiel Ani auf, dass ihn kaum noch jemand anstarrte oder sich nach ihm umdrehte. Amenhotep meinte, er kenne eine Abkürzung, die jedoch durch derart viele dunkle Flure und Räume führte, dass Ani schon argwöhnte, sie hätten sich verlaufen. Plötzlich blieb Amenhotep jedoch stehen und begann, Anis verrutschten Schmuckkragen gerade zu ziehen. „Wenn wir uns verschnauft haben, gehen wir rein. Und denk einfach nur daran, dass du bist, wer du bist.“
„Mach ich“, nickte Ani und schon öffnete Amenhotep die Tür. Sie entließ sie in einen langen Flur, dessen Wände über und über mit Schilf und Gras bemalt waren. Lotus reckte seine Blüten, eine Ente zog mit ihrer Kükenschar durchs Schilf, dort kletterte eine winzige Maus gewagt auf einem Blatt herum und über alldem schwirrten Libellen, Schmetterlinge und Vögel. Ani konnte kaum an sich halten, so begeistert war er von seinen Entdeckungen an den Wänden. „Hat sich das auch dein Vater ausgedacht?“, fragte er ehrfürchtig.
Amenhotep nickte stolz. „Mein Vater.“ Und schon öffnete er die prachtvoll bemalte Tür am Ende des Flures.
„Da bist du ja, mein Junge!“ Eine schwarze Frau saß in einem goldenen Sessel und streckte Amenhotep ihre Arme entgegen. „Fast mussten wir auf dich warten. Und sag, wen hast du denn da mitgebracht?“
Amenhotep wollte gerade ausholen, um seine und Anis Geschichte zu erzählen, als eine weitere Tür aufgestoßen wurde und ein imposanter Mann eintrat. Seine Gegenwart erfüllte sogleich den ganzen Raum, ja, er beherrschte ihn vollkommen. Er war zwar nicht übermäßig groß, doch durchaus gut genährt, was jedoch bei seinem kräftigen Körper überhaupt nicht nachlässig aussah. Er war ganz gewiss niemand, der sich gehen ließ, sondern ein Mann in den besten Jahren, der offensichtlich zu genießen wusste. Auf seinem rundlichen Leib saß ein enormer Schädel, der dieselbe längliche Form hatte wie Amenhoteps Kopf. Sein spitzes Kinn ließ einen starken Durchsetzungswillen erkennen und die zahlreichen Fältchen um die Augen verrieten, dass er offensichtlich gerne lachte. Ani war beeindruckt. Der Mann beugte sich zur schwarzen Frau hinunter und küsste sie zärtlich auf die Stirn. Erst jetzt hatte Ani ihr Gesicht richtig sehen können. Sie war von einer eigenartigen Schönheit. Ein wenig streng und herb vielleicht, aber mit unglaublich wachen Augen, die unter schweren Lidern in die Welt guckten. Sie war das Gegenteil ihres stattlichen Mannes. Zart und elegant, aber keineswegs zerbrechlich. Die ausgeprägten Falten, die sich von ihrer Nasenwurzel aus über die Wangen zogen, hatte Amenhotep offenbar von ihr geerbt.
„Und wen hast du uns denn da mitgebracht, Ameni?“, fragte der Vater schließlich interessiert.
Schau an, dachte Ani, wie die Menschen sich einander angleichen, wenn sie nur lange genug miteinander leben. Sie stellen sogar dieselben Fragen im gleichen Wortlaut.
„Ich dachte mir“, erwiderte Amenhotep selbstsicher, „dass es wohl an der Zeit wäre, dass ich mir einen eigenen Leibdiener zulege. Das ist Ani, der Sohn des Amenhotep.“ Freundlich legte er die Hand auf die Schulter seines Freundes und drückte ihn fest nach unten, damit dieser eine Verbeugung machte.
„Und woher kommst du, Ani, Sohn des Amenhotep?“ Die schwarze Frau sah ihn forschend an.
Natürlich wusste Ani, dass der Weiler, aus dem er kam, zu einem Verwaltungsbezirk gehörte. Doch der Name wollte ihm vor lauter Aufregung nicht einfallen. Für ihn und seine Leute war es einfach nur ihr Zuhause. „Von flussaufwärts“, stammelte er also nur.
„Oh, Ani der Sohn des Amenhotep von flussaufwärts“, wiederholte die schwarze Frau ohne jeden Anklang von Spott in der Stimme. „Tritt näher, Ani!“ Kaum dass er vor ihr stand, griff sie ihm ins Gesicht und zog seinen Unterkiefer nach unten. Wie einem Gaul auf dem Pferdemarkt schaute sie ihm in den Mund. „Oh je! Schlechtes Brot aus schlechtem Mehl. Die Zähne sind schon tüchtig abgeschliffen von dem vielen Sand im Mehl. Na, das wird sich ja jetzt ändern.“ Mitten in ihrer Begutachtung stockte sie plötzlich, trafen sich doch ihre und Anis Blicke. Sie sah die Demütigung darin, die sie ihm mit ihrer Untersuchung zugefügt hatte. Schnell ließ sie von ihm ab. „Schau doch nicht so traurig, Junge!“ Ihre Stimme klang nun weich und warm. „Es wird dir hier gut gehen. Also freu dich!“
Mit knappen Worten berichtete Amenhotep, was Ani widerfahren war. „So so, ein Bauernbub“, meinte der Vater nachdenklich. „Ein richtiger Bauernbub. Aber jetzt sag du mir“, meinte er zu Amenhotep gewandt, „was du hinter dem Allerheiligsten des Amuntempels zu schaffen hattest? Solltest Du nicht von Anen in die Heiligen Handlungen eingewiesen werden?“
Stolz blickte Amenhotep seinem Vater ins Gesicht. „Das wurde ich auch. Aber nachdem Anis Vater für einen solchen Aufruhr gesorgt hatte, habe ich es gewagt, ins Allerheiligste zu schlüpfen.“
„Oh“, riefen Vater und Mutter einstimmig und sahen sich an.
„Sie belügen uns“, sagte Amenhotep mit halblauter Stimme, als ob er verhindern wollte, dass andere Ohren seine Worte hörten. „Es gibt keinen Gott im Allerheiligsten. Nur eine noch nicht einmal übermäßig kunstvoll ausgeführte Statue aus schwarzem Stein. Ein Götzenbild, wie in jedem beliebigen Schrein im Land. Und bei ihrer albernen Prozession während des Opet-Festes schleppen sie diese Statue in einer mit Schleiern verhängten Sänfte herum und tun so, als säße der leibhaftige Gott darin.“
Amenhoteps Eltern sahen sich vielsagend an.
„Wir werden noch Zeit finden, ausführlicher darüber zu reden“, beendete der Vater das Thema. „Ein frischer Abend unter dem Sternenhimmel, wird sich bald schon finden. Dann können wir Näheres bereden.“
Amenhotep wusste, dass er bald Gelegenheit haben würde, diese ihn beschäftigenden Dinge mit der ganzen Familie zu besprechen. Also wechselte er eifrig den Gesprächsstoff. „Ani hat übrigens dein Garten vor der Halle der rituellen Reinigung überaus gut gefallen.“ Dabei gab er seinem Freund einen Schubs, damit er etwas sage.
„Ja“, nickte Ani. „Und die Malerei hier im Flur … Einfach nur schön.“
„Ani meinte, dass du ein großer Gärtner wärst. Ein wahrer Künstler, der statt Worten, Farben und Tönen die Natur nutzt, um ein Kunstwerk zu erschaffen.“
„Ach, da schau an!“ Der Vater schaute überrascht drein, freute sich aber offensichtlich über das unerwartete Verständnis für seine Absichten. „Das erstaunt mich aber jetzt …“ Und zu seinem Sohn gewandt, fuhr er fort: „Jetzt erzähle du mir aber erst einmal, warum es gerade Ani sein soll, der dein Leibdiener wird.“
Amenhotep druckste zunächst ein wenig herum, fasste sich aber schließlich ein Herz und nannte seine Beweggründe. „Er ist der Sohn eines Pachtbauern. Er steht ganz allein in der Welt und muss niemand anderem gegenüber loyal sein. Und er kennt all die Intrigen und das Gerede des Palastes nicht. Er ist auf niemandes Seite - außer auf meiner. Und er ist überdies vollkommen unschuldig und unverdorben. Einen klugen Kopf hat er obendrein. Es war sicherlich kein Zufall, dass wir uns heute unter diesen Umständen begegnet sind. Mir scheint, es steckt ein höherer Wille dahinter. Ich möchte, dass er mein Freund wird und hoffentlich auch immer bleibt.“
„Nun, dann wollen wir mal sehen, wie er sich so anstellt als dein neuer Freund.“ Liebenswürdig blickte der Vater in Anis Gesicht. Und an seinen Sohn gewandt fuhr er fort: „Dein Bruder findet ein verwaistes Kätzchen und schleppt es mit sich herum, du aber gleich einen Bauernbuben … Nun denn! Die Einbalsamierung dauert siebzig Tage. Über diese Zeit mag er also bei dir bleiben, Ameni. Wir werden dann sehen, ob er sich bewährt. Am Tag, wenn er seinen Vater beerdigt, werden wir wissen, ob wir ihn bei uns behalten wollen oder nicht.“
„Oh, danke Vater!“, die Erleichterung war deutlich in Amenhoteps Stimme zu hören. „Ich würde ihn gern ständig um mich haben. Darf er auch mit mir in die Palastschule gehen?“
„Nun, ein wenig mehr Bildung wird ihm sicherlich nicht schaden. Und wer weiß, vielleicht gibt es noch jede Menge verborgener Talente in ihm zu entdecken. Du weißt ja, dass ich seit jeher der Meinung war, dass edle Abkunft nicht unbedingt auch eine edle Gesinnung und außerordentliche Begabungen gewährleistet.“ Mit diesen Worten sah er seiner Frau ins Gesicht und küsste zärtlich ihre Hand. „Sei so lieb und kümmere dich darum“, meinte er zu ihr gewandt. „Er braucht auch eine eigene Wohnung …“
„Oh, kann er vorerst nicht auch bei mir wohnen?“ Amenhotep war ganz aufgeregt.
„Nun, für die siebzig Tage der Einbalsamierung mag das wohl angehen. Für später sehen wir dann. So wie es zurzeit aussieht, werden wir sowieso bald wieder größere Umbauten im Palast in Auftrag geben müssen.“ Der Vater blickte seine Frau bedeutungsvoll an.
„Hat Tuschratta geschrieben?“, fragte sie.
„Ja, das hat er. Eben kam der Bote aus Mitanni. Er würde mir seine Tochter Taduchepa gerne zur Frau geben.“
„Das ist ja wunderbar!“, rief Amenhoteps Mutter, was Ani ein wenig befremdete. „Endlich wärt ihr dann Brüder. Und der Frieden wäre gesichert. Ein für alle Mal. Haben sich all die endlosen Verhandlungen dann doch noch gelohnt. Welch schöne Nachricht!“ Voller Begeisterung sprang sie auf und küsste ihren Mann auf die Wange. „So und nun lasst uns schnell in den Speisesaal gehen. Die Kinder warten schon und ihre Mägen sind gewiss längst am Knurren.“
„Meiner knurrt auch“, pflichtete Amenhoteps Vater bei. „Und auf unser anschließendes Mittagsschläfchen freue ich mich auch schon.“ Als ob Amenhotep und Ani plötzlich Luft wären, gingen sie, einander an Händen haltend, an ihnen vorbei auf eine weitere Tür zu, hinter der Diener warteten, die sie eilfertig öffneten. Noch bevor sie die Tür durchschritten hatten, konnte Ani sehen, wie Amenhoteps Vater den Po seiner Frau zärtlich streichelte. Es schien ihr zu gefallen. Denn sie lachte ein so herzliches Lachen voller Glück, dass Anis Seele vor Freude jubelte, während Amenhotep nur ein Kichern unterdrückte.
Kaum war die Tür geöffnet worden, verstummte das laute Geschnatter im Speisesaal. Ani kam mit dem Zählen gar nicht mehr nach, denn überall lagen sie auf dicken Polstern herum: Mädchen – und zwar jeden Alters. Jede von ihnen hatte zwei oder drei Zofen, die zumeist im Alter ihrer Herrin waren und sie befächelten, an ihrer sowieso kaum vorhandenen Kleidung herumzupften oder auch Senet mit ihnen spielten. Inmitten der heiteren Schar saß ein missmutig dreinblickender junger Mann. Ani sah sofort, dass er keine Jugendlocke mehr trug. Er hielt sich den Bauch und hatte die Augen verdreht, als die Tür aufgegangen war.
„Ah, welch Anblick!“, rief Amenhoteps Vater mit gespieltem Erstaunen. „So viele schöne Wesen auf einen Streich. Meine Goldstücke! Meine Rosenknospen! Meine kleinen Göttinnen!“ Unverhohlen genoss er die Zuneigung, die ihm aus leuchtenden Mädchenaugen entgegenstrahlte. Dann ging er schnurstracks auf den Mürrischen zu. „Und dir knurrt sicher schon der Magen, Thutmosis. Ist es nicht so?“
„Ja“, kam beleidigt die Antwort. „In diesem Weiberhaufen wird auf die Wünsche und Bedürfnisse eines Kriegers ja kaum Rücksicht genommen.“
„Kaum“, bestätigte der Vater und grinste breit. „Da kann ich dir nur beipflichten.“
„Papperlapapp!“ Amenhoteps Mutter ging auf die Jüngste unter den Mädchen zu. Die Kleine konnte gerade erst gehen und fing ausgerechnet jetzt, wo das Geschnatter ihrer Geschwister aufgehört hatte, lauthals an zu schreien. „So ist sie nun mal, unsere Nebet-tah“, sagte Amenhoteps Mutter und alle lachten.
„Nebet-tah bedeutet Herrin des Palastes“, klärte Amenhotep Ani auf. „Sie hält uns alle wahrlich auf Trab.“
„Amenhotep!“ Ani nahm die Gelegenheit wahr, um seinen Freund endlich fragen zu können. „Dein Vater“, flüsterte er, „der ist doch nicht wirklich Gärtner, nicht wahr?“
„Was redest du da?“ Dieses Mal war es Amenhotep, der nicht wusste, wovon überhaupt die Rede war. „Wieso Gärtner? Er denkt sich so einen Garten oder solche Malereien doch nur aus. Machen dürfen es dann andere, die auch was davon verstehen. Es sind wahre Künstler, Meister ihres Fachs, die…“
„Aber was ist dein Vater dann eigentlich?“
Amenhotep staunte. „Du hast es noch immer nicht kapiert? Na, da scheint mir also doch was dran zu sein, dass die Bauern allesamt ein wenig schwer von Begriff sind.“
Ani meinte, den Boden unter sich zu verlieren. Nur Amenhoteps Geistesgegenwart war es zu verdanken, dass er kein Aufsehen verursachte. Denn schnell hatte der ihn auf eines der Polster gesetzt und ihm einen Becher mit Wasser gereicht. Ani konnte den Becher kaum an den Mund setzen, so sehr zitterte seine Hand.
„Was ist denn mit dem los?“, fragte das Älteste der Mädchen, die schon fast zur Frau geworden war. „Und wer ist das überhaupt?“
Als habe er sie überhaupt nicht wahrgenommen, sagte Amenhotep zu Ani: „Das ist Sit-amun, meine älteste Schwester. Sie ist ständig schlecht gelaunt und dabei auch noch wahnsinnig neugierig.“
„Blödmann!“, konterte die so unvorteilhaft Vorgestellte beleidigt und schon war sie aufgestanden und gegangen.
„Sag mal Ani, hast du wirklich nichts geahnt?“ Amenhotep begriff jetzt erst, dass sein Freund tatsächlich völlig unvorbereitet in diese Gegenüberstellung mit einer ihm vollkommen fremden Welt geraten war.
„Man wird mich pfählen“, stammelte Ani verzweifelt, „man wird mich vierteilen, mich den Krokodilen zum Fraß vorwerfen…“
„Na, wenn schon, dann den Hyänen. Das ist passender“, versuchte Amenhotep die Situation mit einem wenig gelungenen Witz aufzulockern.
„Ach, Amenhotep“, raunte Ani, „ich hab dem Guten Gott in die Augen geschaut! Man wird mich töten dafür. Bring mich wieder fort von hier. Ich gehöre nicht hierher. Ich bin der Sohn eines Bauern. Ich habe noch nicht einmal jemals mit unserem Ortsvorsteher gesprochen. Wie kann ich dann… hier… mit…“ Ani sah sich hilflos um. „Ich meine… Ich traue mich noch nicht einmal, es auszusprechen …“
„Ach was!“, wiegelte Amenhotep ab. „Da wirst du dich ganz schnell dran gewöhnen, glaub mir.“
„Und was ist, wenn dein Vater, der Gute Gott, er möge leben eine Million Mal eine Million Jahre, mich anspricht?“
„Wozu sollte er? Du bist doch nur mein Leibdiener.“
„Oder die Gute Göttin“, Ani wurde wieder schwindelig, „sie möge leben eine Million Mal…“
„Hör auf mit dem Geschwafel!“, unterbrach ihn Amenhotep. „Wenn wir unter uns sind, unterlassen wir diese Floskeln. Draußen ist es natürlich etwas anderes. Da liegen alle vor meinem Vater im Staub.“ Und mit gedämpfter Stimme fuhr er fort. „Meine Mutter ist übrigens nicht die Gute Göttin. Diesen Titel gibt es nicht. Was sie allerdings außerordentlich ärgert.“ Amenhotep kicherte. „Sie ist die Große Königliche Gemahlin und Mutter des Thronfolgers Thutmosis. Ich weiß gar nicht, was sie will: Mehr geht doch nun wirklich nicht.“
Als hätte sie gespürt, dass über sie geredet wurde, stand Amenhoteps Mutter plötzlich vor ihnen, die zufrieden an ihrer Brust nuckelnde Nebet-tah auf dem Arm. „Das arme Jungchen ist fahl wie Natronsalz“, sagte sie zu ihrem Sohn. „Achte mal ein bisschen besser auf ihn. Er hatte heute einen schlimmen Tag, der Arme. Schau, dass er was zu essen bekommt.“
Wie Traumgesichte schossen die Bilder durch Anis Kopf. Die eingewickelte tote Mutter, auf deren Körper er die Erde gehäuft hatte. Seine Schwester, die ihr neues Leben kaum gekostet hatte und von der er noch nicht einmal wusste, wie sie überhaupt aussah. Der totgeschlagene Vater, dessen Körper man den Krokodilen vorgeworfen hatte und der jetzt im Einbalsamierungshaus lag …
Doch als riesige, silberne Platten hereingetragen wurden, die über und über mit den erlesensten Leckereien bedeckt waren, meldete sich Anis Magen abermals und gab jenes entsetzliche Knurren von sich, das vorhin schon die Dienerinnen im Bad erschreckt hatte. Alle starrten ihn an, denn es war just in jenem Augenblick mucksmäuschenstill geworden. Erst als Pharao lauthals in Gelächter ausbrach, lachte der ganze Saal mit. Ani spürte, wie ihm die Röte ins Gesicht stieg. Und da er nicht wusste, was er zu seiner Entschuldigung hätte vorbringen können, zuckte er nur verlegen mit den Schultern.
„Iss kein Brot, während der andere dasteht und du ihm nicht die Hand ausstreckst“, zitierte Amenhoteps Mutter aus einem alten Weisheitsspruch. „Denn das Brot ist in Ewigkeit hier, während der Mensch nicht für immer bleibt …“ Sie seufzte und lächelte schließlich. „Also dann wollen wir heute mal nicht so streng sein und darauf bestehen, dass Ani, wie es sich eigentlich geziemt, mit den anderen Dienern speist. Seid lieb Mädchen und reicht ihm, was immer er begehrt.“ Und schon erschien unter Anis Nase ein köstlich duftendes Plätzchen aus Hirseteig, auf dem süß-sauer eingelegtes, gebratenes Entenfleisch mit Zwiebelsprossen ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ. „Ich bin Henut-tau-nebu“, sagte das Mädchen, das ihm den Bissen reichte, „und das ist meine Schwester Iset.“ Auch Iset bot Ani ein Plätzchen an, auf das man eine würzig riechende Paste verteilt hatte. Und da Ani zögerte, sagte sie mit warmer, dunkler Stimme: „Das ist Boutarikh – gewürzter und getrockneter Fischrogen. Er ist köstlich, du wirst sehen.“ Und in der Tat meinte Ani, dass ihm diese eigentümliche Paste die Tür in eine neue, so ganz andere Welt aufgestoßen hätte. Denn zum ersten Mal in seinem Leben hatte er das Gefühl, nicht nur zu essen, um satt zu werden, sondern auch und vor allem, um zu genießen.
„Ho ho ho“, polterte plötzlich Amenhoteps Vater los. „Was ist denn hier los?! Ein Diener wird von Prinzessinnen gefüttert, während euer alter Vater unbeachtet und einsam herumsitzt und Hunger leidet!“ Augenblicklich stürzten sich alle seine Töchter, außer der Jüngsten Nebet-tah, die endlich in den Armen ihrer Mutter eingeschlummert war, auf ihn und verwöhnten ihn mit den köstlichen Leckereien. Er lachte lauthals und ließ sich die Aufmerksamkeiten bereitwilligst gefallen.
Nachdem die silbernen Platten eine nach der anderen leer geräumt worden waren, erhob sich Pharao, hakte sich bei seiner Frau unter, die noch immer das schlafende Kind auf ihrem Arm trug und sagte mit einer Stimme, die keinerlei Widerspruch zuließ: „So, nun ist die Zeit der Mittagsruhe. Ein wenig später als sonst, aber genauso nötig wie immer.“ Und schon waren er und seine Frau verschwunden.
„Und wer bist Du?“ Thutmosis hatte sich wie zufällig neben Ani gesetzt und beäugte ihn von oben bis unten. „Ein halb verhungertes Findelkind vom Lande“, warf Sit-amun schnippisch ein und machte dabei den Dialekt der Bauern nach. „Ein armer Kerl, dem die Götter übel mitgespielt haben!“ Iset und Henut-tau-nebu hatten sich zwischenzeitlich bestens über den Neuankömmling informieren lassen und waren wild entschlossen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Lebensfreude des vom Schicksal so arg Getroffenen wieder zu beleben. „Er hat binnen eines Tages Vater, Mutter und die Schwester verloren“, erklärte Iset voller Mitgefühl. „Wie grausam die Götter doch manchmal sein können“, räsonierte Henut-tau-nebu. „Aber unser Vater, der Gute Gott, wird schon schützend seine Hand über ihn halten.“
„Ich bin es“, meinte Amenhotep stolz, „der seine schützende Hand über ihn hält.“
„Und warum?“, fragte Thutmosis neugierig. „Was sind seine Vorzüge, dass du ihn ständig um dich haben möchtest?“ Er schaute Ani auf eine Art und Weise an, als ob er damit bislang Unentdecktes an ihm aufspüren könnte.
„Weil er nichts von alledem weiß, was uns hier in unserem finsterem Gemäuer umtreibt“, gab Amenhotep zur Antwort. „Und weil er ein kluger Kopf ist. Und weil ich ihn vor einem unwürdigen Dasein gerettet habe.“
„Du weißt, dass Dankbarkeit sich oft rasch abnutzt“, gab Thutmosis zu bedenken. Und an Ani gewandt fuhr er fort: „Hast du schon mal ein Chepesch-Schwert geführt?“ Ani schüttelte den Kopf. „Weißt du mit Pfeil und Bogen umzugehen?“ Ani schüttelte abermals den Kopf. „Dann wirst du wohl auch nicht wissen, wie man einen Speer schleudert.“
„Ich bin der Sohn eines Pachtbauern.“ Ani richtete sich auf. „Ich kann dir sagen, wann die günstigste Zeit zur Ernte ist. Ich kann dir sagen, wie man Tongefäße herstellt. Auch kann ich dir sagen, wie man die Bewässerungskanäle verbessern kann, damit die Ungleichheit in der Wasserversorgung endlich aufhört. Außerdem kann ich dir sagen, wie man die Steuern gerechter erheben könnte. Vor allem aber weiß ich, dass nichts von Menschenhand Geschaffenes schöner sein kann als die Natur selbst.“
„Na, da schau an!“ Thutmosis war sichtlich beeindruckt von Anis Worten, die dieser ohne jede Spur von Dünkel vorgebracht hatte. „Du musst dich hier in unserer Schlangengrube aber ein wenig vorsehen, mit dem, was du von dir gibst. Unser Vater schätzt die Künste so sehr, dass er hier die besten Handwerker, selbst aus den entferntesten Ländern beschäftigt. Wenn einer von denen dich so reden hört, hast du dir schnell einen neuen Feind gemacht. Und sei versichert: Die Zahl der Feinde wächst hier im Palast von ganz allein. Unser Vorsteher der Kornkammern wird dich solche Dinge nämlich ebenso wenig gern sagen hören wie unser Wesir.“
„Es tut mir leid, wenn ich etwas Falsches gesagt habe“, entschuldigte sich Ani. „Es ist besser ihr lasst mich wissen, was ich nicht sagen darf.“ Alle lachten und Ani wurde rot. „Ich meine natürlich die Umgangsformen.“
„Vergiss sie, die Umgangsformen“, Thutmosis legte Ani kurz die Hand auf die Schulter. „Jedenfalls so lange wir hier unter uns sind. Ich glaube aber nun zu wissen, warum mein kleiner Bruder will, dass du an seiner Seite bleibst.“
Selbst Sit-amun, die über Amenhoteps schnippische Bemerkung in Bezug auf ihre Neugier noch immer verstimmt war, blickte nun etwas weniger finster auf den Neuankömmling. „Was du über die Schönheit der Natur gesagt hast, hat mir ausnehmend gut gefallen“, meinte sie versöhnlich.
„Ja, ausnehmend gut“ pflichteten Iset und Henut-tau-nebu einstimmig bei, so als hätten sie es eingeübt und nickten kräftig mit den Köpfen. Waren sie doch von Anfang an von Amenhoteps neuem Freund angetan und hingen mit strahlenden Augen an seinen Lippen.
„Da siehst du es!“, lachte Amenhotep. „Du musst nur von Schönheit reden und schon hast du die Frauen auf deiner Seite. Aber nicht nur die. Die Zeiten werden sich ändern, Ani. Mein Vater hat begonnen, was Thutmosis beenden wird. Es werden nicht mehr Kraft und Gewalt regieren, sondern Klugheit und Schönheit. Die Vernunft wird zukünftig die große Eroberin sein – und nicht mehr die Gewalt.“
„Ich wünschte, es wäre schon soweit“, seufzte Thutmosis und klatschte in die Hände, woraufhin ihm ein Diener eine junge Katze brachte, die er liebevoll in Empfang nahm und sogleich zärtlich streichelte. „Aber noch muss ich, dem Wunsch des Pharao entsprechend, das Kriegshandwerk erlernen. Meine Kinder und Enkel werden es aber hoffentlich nicht mehr tun müssen. Nicht wahr, Ta-miat?!“ Er herzte das schlummernde Fellknäuel und drückte es innig an seine rechte Wange. „Die ist mir zugelaufen“, sagte er zu Ani gewandt. „Die Soldaten haben mit ihren Streitwagen die Mutter und den Rest des Wurfes totgefahren. Da hab ich sie mitgenommen, weil sie ja überhaupt niemanden mehr auf der Welt hatte. Und jetzt ist sie mein bester Freund.“
Amenhotep schaute Ani verlegen an und lächelte gequält.
„Wie ich sehe, hat sie sich vollkommen eingewöhnt“, sagte Ani und schaute Amenhotep fest in die Augen. „Dann ist sie sicherlich die glücklichste Katze der Welt.“
Eine dicke alte Dame mit einem mütterlichen Gesicht, die während der ganzen Zeit irgendwo im Hintergrund saß, räusperte sich. „Der Gute Gott sprach von den Segnungen der Mittagsruhe …“ Und schon sprangen alle auf und liefen plappernd davon.
„Komm, Ani“, winkte ihm Amenhotep. „Ich zeig dir jetzt meine Wohnung.“
Wieder liefen sie durch unzählige dunkle Flure. Vorbei an der Wäschekammer, deren Tür man offenbar vergessen hatte, zu schließen, so dass Ani raumhohe Regale voller sorgfältig zusammengelegter, blendend weißer Leinentücher erkennen konnte; vorbei an der Küche, in der Dutzende von Dienern und Dienerinnen Speisen vorbereiteten; vorbei schließlich auch an einer prächtigen Wohnung, deren Eingangstür weit offen stand. Amenhotep blieb kurz stehen und lugte hinein. Eine nicht mehr ganz junge, in dicke fremdländische Gewänder gekleidete Frau kniete vor einem Räuchergefäß und knetete wollüstig stöhnend ihre Brüste. „Schawuschka, Schawuschka, thisch atai Schawuschka“, wiederholte sie in einem fort.
„Das ist Giluschepa, die Tochter des Königs von Mitanni, eine Nebenfrau meines Vaters“, erklärte Amenhotep und tippte sich dabei an die Stirn. „Sie ist nicht mehr ganz richtig im Kopf, seit sie vor ein paar Jahren ihr Neugeborenes verloren hat. Mein Vater hat sie auch schon lange nicht mehr besucht. Kein Wunder!“ Und mit den letzten Worten schloss Amenhotep leise die Tür.
Endlich waren sie vor Amenhoteps Wohnung angelangt, was dieser sogleich stolz verkündete. Er öffnete die Tür, hinter der eine ältere Frau in einem Sessel saß wo sie offensichtlich auf ihn gewartet hatte. Sie sprang auf, verbeugte sich und gab Amenhotep schließlich einen Kuss auf die Stirn. „Das ist Subira“, meinte er zu Ani. „Sie war früher meine Amme. Nun ist sie mir die zweite Mutter. Also sieh dich vor! Du weißt ja, wie Mütter sein können.“ Kaum hatte er es ausgesprochen, merkte Amenhotep, dass dies eine wenig feinfühlige Bemerkung gegenüber Ani war, der ja erst im Morgengrauen seine eigene Mutter verloren hatte. Er sah wie seinem Freund die Tränen in die Augen schossen. „Ich kann mich nicht bei dir entschuldigen, mein Freund. Mein Stand lässt es nicht zu. Aber es schmerzt mich, dein Leid zu sehen. Glaub es mir.“ Freundschaftlich legte er Ani den Arm auf die Schulter. „So und jetzt zeige ich Dir erst einmal wie ich wohne.“
Es waren Dutzende von Zimmern, die Ani nun zu sehen bekam. Subiras Schlafgemach, Subiras Wohngemach, Subiras Badezimmer, Vorratsraum, Küche, allgemeines Wohngemach, allgemeines Liegezimmer, allgemeiner Abtritt, Amenhoteps Badezimmer, Amenhoteps Schlafgemach und so weiter und so fort. Dazwischen immer wieder ungeöffnete Türen, in denen ‑ wie Amenhotep ein wenig gelangweilt aufsagte – banale Dinge wie Wäsche, Geschirr, Essenzen, Kunstgegenstände, Schminkutensilien und aller möglicher Krimskrams aufbewahrt wurden. Ani ließ die Worte ungedeutet in seinen Ohren verschwinden. Sein Kopf war endgültig voll. Was war an diesem Tag nicht alles geschehen? Was hatte er nicht alles gesehen? Amenhotep bemerkte, dass sein Freund nicht mehr in der Lage war, all die Eindrücke aufzunehmen. Er machte Subira ein Zeichen und nahm Ani an der Hand, um ihn auf die Veranda zu führen, die mit einem Bogengang vom allgemeinen Aufenthaltsraum abgeteilt war. Zwischen den einzelnen Pfeilern waren bunte Zeltbahnen aufgerollt, die zum Schutz vor der Sonne heruntergelassen werden konnten. Ani seufzte vor Glück als sie ins Freie hinaustraten. Ein Garten, wie er ihn noch nie gesehen hatte, weitläufig und ringsum mit hohen Hecken umgeben. Der Nil musste rechter Hand sein, denn man hörte von dort ab und zu ein Nilpferd schnauben oder Schiffer einander irgendwelche Dinge zurufen. Blumen blühten in allen Farben und bildeten Ornamente auf den großzügigen Beeten. Auch hier, so dachte er, malte, modellierte, dichtete und musizierte man mit der Natur. Ja, es hatte sogar den Anschein, als ob man hier versuchte, die Natur noch ein wenig perfekter zu gestalten. Etwas nach rechts versetzt, in der Nähe der Hecke zum Nil, stand ein Sonnenschattentempel, auf den sie zugingen. „Den habe ich mir vom Sohn des Hapu errichten lassen.“ Forschend blickte er in Anis Gesicht. „Eigentlich ist er gar kein Bauwerk, weißt du, sondern vielmehr eine begehbare Skulptur. Sieh nur, sie ist aus reinstem weißem Marmor geschlagen. Und ihre Pfeiler sind den Stämmen von Bäumen nachempfunden, die nach oben ihre Äste ausbreiten.“ Und in der Tat sah Ani ein kunstvolles, sich zu einer Kuppel wölbendes Gespinst aus marmornen Ästen, in die man Blättern nachempfundene Scheiben aus grünem Malachit gehängt hatte. Sie waren so dünn geschliffen, dass die Sonne hindurch scheinen konnte und ein flirrend grünes Muster auf den weißen Marmorboden zauberte. Und wenn ein Wind wehte, bewegten sich die Malachitblätter gar, so dass man meinen konnte, unter einem echten Blätterdach zu sitzen.
„Du wirst müde sein, Ani“, sagte Amenhotep fürsorglich. „Ich zeige dir jetzt erst einmal deine Zimmer. Wenn du magst, kannst du ja noch ein wenig ruhen.“
Ani war erleichtert, dass die Gästewohnung, vollkommen schlicht und neutral eingerichtet war. Das Wohngemach war großzügig genug, hatte Unmengen sauberer Kissen, die sorgsam überall drapiert waren und es hatte Zugang zu einem eigenen, abgetrennten Garten. Wie jener vor der Reinigungsstube war er mit Mohn, Kornblumen und Margeriten bepflanzt. Eine marmorne Sitzbank stand in einer in die Hecke geschnittenen Nische, die ab der Mittagszeit köstlichen Schatten spendete. Ihr gegenüber stand in einer ebensolchen Nische eine lebensechte Statue des Guten Gottes. Er trug die blaue Chepresch-Krone, die im Sonnenlicht funkelte und hielt mit beiden Händen ein Opfertablett vor seinem Körper, auf dem sich allerdings nichts befand. Nichts anderes, als alles um ihn herum, war also eine Gabe des Guten Gottes, wusste Ani das Standbild zu deuten. Wer hier wohnte, wurde stets daran erinnert, wem er dies zu verdanken hatte.
Das Schlafgemach war deutlich kleiner, aber es war über und über mit Pflanzen und Blumen und Tieren bemalt, so dass man glauben konnte, man läge inmitten einer saftigen Wiese im sprichwörtlich lieblichen Fayum. Dem Lauf der Sonne folgend hatte man kleine Öffnungen in der Außenwand freigelassen, durch die das Sonnenlicht eindringen konnte. Mit jeweils darüber angebrachten Holzklappen, die bunt bemalt waren, konnte man die gewünschte Helligkeit mit wenigen Handgriffen einstellen. Erst jetzt sah Ani, dass das Blau des über der Landschaft gemalten Himmels zur Decke hin immer dunkler wurde, bis er dort selbst schließlich Nachtblau war. Tausende von Sternen waren hineingemalt. Sogar das Band der Hathor war deutlich zu erkennen. Ani fielen einige größere Sterne auf, die allesamt in ihrer Mitte einen runden schwarzen Fleck hatten. Amenhotep bemerkte, dass Ani danach sah. „Das sind Rohre, die aus der Zwischendecke kommen, wo der kühle Nordwind eingefangen und nach unten geleitet wird. Es sind köstliche Nächte hier in Malqata, du wirst sehen.“ Ani konnte in Amenhoteps Gesicht deutlich lesen, wie glücklich es ihn machte, dass er dem Freund solche Wohltaten angedeihen lassen konnte. „Ich lass dich jetzt“, sagte der und wandte sich zum Gehen. „Ruh dich ein wenig aus, denn es war ein langer, schwerer Tag für dich. Ich werde dich zur Zeit holen lassen, damit wir noch vor der Nacht wieder vom Einbalsamierungshaus zurück sein werden. Möchtest du noch einmal baden oder mit Öl massiert werden? Hast du Hunger oder Durst? Sag es einfach Subira, sie wird Dir jeden Wunsch erfüllen.“
„Ich wurde heute schon zur Genüge gebadet“, lachte Ani. „Und der armen Subira will ich keinesfalls zumuten, mich auch noch massieren zu müssen.“
„Dummkopf!“ Amenhotep schmunzelte. „Ich sagte dir doch schon: Für so etwas haben wir Fachkräfte. Und zwar die besten im ganzen Land. Und nun ruh dich aus.“ Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, verließ Amenhotep den Raum.
Tief ausatmend legte sich Ani auf das Bett. Was für ein Tag! Was für ein Schicksal! Was für ein Leben! Er konnte noch immer nicht recht glauben, was alles ihm während dieses einen halben Tages widerfahren war. Alles und jeden, der ihm etwas bedeutete, hatte er verloren und sein eigenes Ende war nur eine Frage der Zeit. Doch gleich darauf hatte er ein neues Leben gewonnen. Er erschrak, denn der Gedanke schoss ihm durch den Kopf, dass für sein Glück der Vater, die Mutter und die kaum geborene Schwester ihr Leben hatten geben müssen. Würde es ihn nicht lebenslang verpflichten, darauf zu achten, dass ihr Tod nicht sinnlos gewesen war? Über all diesen Gedanken fiel Ani in einen tiefen, traumlosen Schlaf.
Irgendetwas kitzelte an Anis Nase. Ohne die Augen zu öffnen, schlug er nach dem vermeintlichen Krabbeltier. Doch es blieb hartnäckig und kitzelte abermals. Langsam kam Stück für Stück die Erinnerung in Anis erwachenden Geist. Hatte er das alles nur geträumt? Er riss die Augen auf – und erschrak sich fast zu Tode. Vor ihm saß eine lächelnde Dienerin, die ihn mit einer Feder kitzelte. Sie war so schön wie alle Mädchen, die er bislang im Palast gesehen hatte. „Prinz Amenhotep erwartet dich“, sagte sie so freundlich und zugewandt, so dass er fast erwartete, sie würde ihm noch einen Kuss auf die Stirn geben. Stumm lächelte sie ihn an. Ein langes „Ohhh“ war schließlich alles, was aus seinem Mund kam. Es war also doch kein Traum! Obschon er einen Augenblick lang überlegen musste, ob er nicht doch tot war und ihm nun die Göttin Maat mit ihrer Feder gegenübersaß. Fahrig sah er sich um, konnte aber außer einem Diener mit einem Wasserbecken in Händen nichts erkennen, was auch nur entfernt an Osiris erinnert hätte - und der hätte ja im Falle seines Todes unbedingt anwesend sein müssen. Also genoss Ani den Anblick des Mädchens und das Gefühl nicht nur am Leben zu sein, sondern zugleich auch ein neues Leben geschenkt bekommen zu haben.
„Wie alle aus der göttlichen Familie liebt auch der Prinz Pünktlichkeit“, sagte die Dienerin wie eine Freundin, die einen gut gemeinten Ratschlag gibt. „Seine Hoheit, der Prinz, freut sich so sehr darauf, dich wieder zu sehen, dass er es kaum erwarten kann. Vielleicht magst du ja seiner Qual…“
Im selben Augenblick flog die Tür auf und Amenhotep kam hereingestürmt. „Na los! Husch, husch! Aufgestanden! Gesicht waschen, neu schminken und dann los!“ Er hielt inne und lachte dann laut, als er dem übertölpelten Ani ins Gesicht sah.
„Es tut mir leid“, stammelte der, „aber ich bin so was nicht gewohnt.“ Amenhotep schien nicht zu verstehen. „Na, all das hier: Saubere Kissen und kühle Luft, lächelnde Mädchen mit gurrenden Stimmen … Eben alles hier.“
„Ha, ich sagte dir doch schon: Du wirst dich ganz schnell daran gewöhnen!“ Amenhotep gab dem Diener einen Wink, der sich augenblicklich daran machte, dem zunächst widerstrebenden Ani das Gesicht zu waschen. Kaum hatte er es ehrfurchtsvoll trocken getupft, erschien der vorhin noch Violette mit den eingewebten Mandragora-Früchten, den Ani vom Schiff her kannte. Inzwischen trug er ein Gewand aus einem seltsamen Gewebe, das Ani bislang nur bei der irrsinnig gewordenen Nebenfrau Pharaos gesehen hatte. Auf seinem Kopf thronte eine derart groteske Perücke, dass Ani ein Lachen nur mit Mühe unterdrücken konnte.
„Eure Hoheit, verzeiht!“, schnaubte der Atemlose. „Min-kamutef hat sich verletzt, so dass ich ihn vertreten muss.“
„Was ist geschehen, Schesehmu?“, fragte Amenhotep besorgt.
„Wir übten neue Perücken-Kreationen“, dabei deutete er auf das zerzauste Gebilde auf seinem Kopf. „Und mein armer Min-kamutef hat sich seine sonst doch so geschickten Händchen verbrannt.“
„Schlimm? Braucht er einen Arzt?“
„Ach was! Man weiß doch, wie schreckhaft der Kleine ist. Ich habe ihm aber zur Sicherheit gleich einen dicken Salbenverband gemacht …“
Während des ganzen Gesprächs fuhrwerkte Schesehmu wie ein von Schakalen Getriebener in Anis Gesicht herum und hielt ihm unvermittelt einen Spiegel vor. „Ich hab ihn nur ein wenig abgepudert und seine schönen Augen mit einem sehr schlanken Lidstrich betont. Um die Augenbrauen muss ich mich später einmal ausgiebiger kümmern. Heute habe ich sie nur ein bisschen nachgezogen, damit seine erwachende Männlichkeit…“
„Das hast du hervorragend gemacht, Schesehmu. Wie immer“, sagte Amenhotep schnell, griff seinen Freund bei der Hand und zog ihn aus dem Raum. Lachend liefen sie durch meilenlange Flure, ohne so recht zu wissen, warum sie eigentlich so ausgelassen waren. Vielleicht, dachte Ani, weil sie im Augenblick nichts weiter als Freude am Leben hatten.
Der Innenhof, auf dem sie plötzlich standen, war schnell überquert, auch wenn Ani sich zusammenreißen musste, nicht nach den einzelnen Pflanzen zu sehen, die in zahllosen Kübeln überall herumstanden. Blüten, die er noch nie zuvor gesehen hatte, leuchteten im warmen Nachmittagslicht. Fremdländische Bäume spendeten ihren Schatten und seltsame Büsche verbreiteten würzige Düfte. Er nahm sich fest vor, so bald als möglich, dorthin zurückzukehren, um sich daran satt zu sehen. Schon waren sie im nächsten Innenhof, der wiederum vollkommen anders gestaltet war. Seine Säulen waren bunt bemalt und seine Mitte bildete ein großes Wasserbecken, auf dem alle Arten von Lotus blühten. Der Duft war atemberaubend. Amenhotep zupfte Ani am Arm. „Sag mal, stimmt es, dass ihr Bauern Lotus esst?“
„Wenn wir am Verhungern sind, dann schon. Na, und die Kinder versuchen natürlich immer, an die Knollen heranzukommen, denn die schmecken ein wenig süß.“
„Dafür haben wir Honig. Ihr etwa nicht?“
„Honig ist eine Speise für Götter. Wer von uns Bauern einen Bienenstock ausnimmt, dem wird die Hand abgeschlagen.“
„Oh!“
Und schon waren sie im zentralen Hof angelangt, den Ani sofort wegen des Badehauses wiedererkannte. „Endlich einmal etwas, das ich wieder erkenne und das mir nicht neu und unbekannt ist“, lachte er und winkte auch aus eben demselben Grund Rechmire zu, der noch immer darauf achtete, dass alles mit rechten Dingen zuging. Offenkundig schien der sich über Anis Begrüßung zu freuen, denn er lächelte herzlich zurück, zwinkerte ihm zu und deutete sogar eine Verbeugung an.
Schon waren sie durch das große Tor gelaufen und befanden sich inmitten der Handwerkerstadt. War Ani der Trubel bei seiner Ankunft schon beträchtlich vorgekommen, so machte ihm der gegenwärtige Rummel regelrecht Angst. Zwar hatte sich auf Rechmires Anweisung hin wieder ein Trupp von sechs Bewaffneten um sie gebildet – zwei vorneweg, einer links, einer rechts und zwei hinterher -, der dafür sorgte, dass sie unbehelligt durch die Menschenmassen kamen, doch es wurde überall derart aufgeregt umhergerannt, geschrieen, gefeilscht sowie seine und Amenhoteps Gegenwart kommentiert, dass Ani fürchtete, der Mob könnte sich irgendwann, aus welchem Grund auch immer, auf sie stürzen. Doch demütig machte man den Weg frei, verbeugte sich ehrfurchtsvoll und rief ihnen Glückwünsche für Millionen und Abermillionen von Jahren zu. Ein paar Vorlaute fragten sogar nach, wer es denn sei, der die Ehre habe, den Prinzen begleiten zu dürfen. Die Frage schien viele der Menschen zu beschäftigen, denn je näher sie dem Schiff kamen, desto häufiger wurde sie gestellt. Als dann eine Frau, die offenbar zum Schrein der Hathor unterwegs war, um ihr Blumen zu opfern, aus vollen Händen Blütenblätter auf sie regnen ließ, brach Ani in ein fast schon hysterisches Gelächter aus. Amenhotep schaute ihn ratlos an. „Ich habe dir bei der Ankunft heute Mittag doch gesagt, dass wir froh sein könnten, dass zur selben Zeit die Tiere ausgeladen wurden, da wir somit weniger Beachtung fänden.“ Und da Ani noch immer Mühe hatte, sich zu beherrschen und unentwegt gluckste, setzte Amenhotep herrisch hinzu: „Ab morgen wirst du erst einmal Unterricht nehmen. Man wird dir als Allererstes beibringen, was man hier bei Hofe tut und was nicht. Blödes Lachen gehört jedenfalls nicht dazu. Das Benehmen eines Menschen zeigt nämlich seine Gesinnung - und seine Herkunft.“ Wobei Amenhotep das Wort „und“ besonders betonte.
„Ach, Amenhotep, ich bin ein einfacher Bauernsohn! Gestern noch hat man Dreck nach mir geschmissen und heute streut man Blütenblätter auf mich.“
„Nun, dein Benehmen zeigt zwar deine edle und reine Gesinnung …“ Stolz hob Amenhotep den Kopf, als sie gerade über die ausgelegten Planken das Schiff betraten. „Aber warum solltest du ungefragt und völlig grundlos jedermann deine Herkunft mitteilen?“ Amenhotep sah Ani fragend an. „Ach, und übrigens: Die Blütenblätter hat man für mich gestreut, du gingst bloß daneben. Vergiss das nicht.“
„Ich weiß, wem ich das alles verdanke“, sagte Ani ohne jeden Anklang eines spöttischen Untertons. „Und ich weiß natürlich auch, dass du es bist, dem die Blumen galten. Doch sie fielen auch auf mich. Auf mich, der heute vor Mittag noch ein ganz anderes und vor allem ein sehr viel kürzeres Leben vor sich hatte. Dass es noch heute Blütenblätter auf mich regnen würde, hätte ich nie gewagt, mir auch nur träumen zu lassen, als ich heute Morgen erwachte.“
„Ich verstehe“ nickte Amenhotep. „Aber gewöhne dich dennoch bald an den Gedanken, dass die Blütenblätter nur für mich sind.“ Missmutig hielt er nach dem Kapitän des Schiffes Ausschau. „Wann fahren wir endlich, Arhonuphis?“
Keinen Atemzug später legte das Schiff unter dem Jubel der Menschen ab und nahm schnell Fahrt auf. Amenhotep hatte es sich wieder auf dem Podest mit den zahllosen sauberen Kissen bequem gemacht und schaute unbeeindruckt von den Heilrufen der Menschen starr geradeaus. „Weißt du, Ani, die Verhaltensregeln, die du ab morgen lernen wirst, sind vor allem dazu da, damit du weißt, wie du dich zu verhalten hast. Sie geben dir Sicherheit und Selbstvertrauen. Wenn du weißt, wie du dich angemessen zu benehmen hast, kann dich keine auch noch so ungewöhnliche Begegnung mehr verunsichern.“
„Aber meinst du nicht, Amenhotep, dass die Menschen dir so oder so zujubeln werden, egal was du tust und wie du dich verhältst?“, fragte Ani unsicher. „Du bist der Sohn des Guten Gottes und alleine dafür lieben sie dich.“
„Wir alle müssen ihnen dennoch Tag für Tag beweisen, dass wir ihre Zuneigung und ihr Vertrauen auch verdient haben.“ Amenhotep hob die Arme wie zum Gebet. „Wir sind größer als sie und sie wollen sich an uns aufrichten. Wir sind es, die ihnen den Weg zeigen müssen für ein dem Gott gefälliges Leben. Wir sind es, die an ihrer statt und für sie zu den Göttern sprechen. So wie der Pharao Jahr um Jahr mit seinen Bittgebeten dafür sorgt, dass die Nilflut wiederkehrt ohne ihre Häuser und Dörfer zu zerstören, so gewährleistet er jeden Tag aufs Neue die Wiederkehr des Aton am östlichen Horizont, der glänzenden Sonnenscheibe, die allein erst Leben möglich macht. Wir sind die Garanten, dass die Maat, das Gleichgewicht der Dinge, erhalten bleibt. Ohne uns sind sie wie verwilderte Kinder, die ziel- und ratlos durch das Leben irren. Doch wären wir nicht anders als sie, nämlich den Göttern näher und ähnlicher, würden sie das Vertrauen in uns verlieren und bald schon würde das Chaos herrschen. Wie zu Urzeiten, bevor Isis und Osiris dem Horus das Leben schenkten, damit er über die Menschen herrschte.“
Ani hörte schweigend zu. In der Welt, in der er bislang gelebt hatte, waren die mächtigen Götter fern. Einfache Menschen wie er hatten keinerlei Zugang zu ihnen und mussten deren Priester bitten, für sie zu sprechen. So, wie sie hofften, dass der Pharao sich mit Fürbitten an die Götter um ihr Schicksal kümmern würde. Direkt ansprechen konnten sie nur die unzähligen Halbgötter und Dämonen wie Bes oder Tawret und natürlich den widderköpfigen Basepef. Sie waren für die alltäglichen Dinge zuständig, wie eine glückliche Empfängnis, eine problemlose Geburt oder eine auskömmliche Ernte. Die anderen Götter jedoch waren schlichtweg zu groß und viel zu mächtig, als dass sie sich um das Schicksal der einfachen Menschen kümmern würden. „Ich bin dumm und ungebildet und weiß von alledem nichts“, meinte Ani. „Und deshalb vermag ich mir kaum vorzustellen, dass es fast ebenso viele Götter gibt wie Menschen auf der Welt. Doch vielleicht sind die vielen Götter ja auch nur unterschiedliche Namen für ein und dasselbe, einzelne Charakterzüge einer einzigen göttlichen Seele, eines einzigen göttlichen Wesens.“
Amenhotep wurde bleich und sah seinen Freund erstaunt an. „Du darfst so etwas keinesfalls in der Öffentlichkeit sagen!“, zischte er und klopfte auf das Polster neben sich, damit Ani dort Platz nehme. „Es ist Häresie, was du da sagst, schlimmste Ketzerei.“
„Das tut mir leid“, stammelte Ani. „Ich wollte niemanden mit meinen dummen Überlegungen verletzen.“
„Dann schweig!“ Amenhotep sah sich unauffällig um. „Wo hast du das denn überhaupt her?“ Er machte eine wegwerfende Handbewegung. „Sprich niemals mehr darüber – außer im Kreise der Familie. Vielleicht sind deine Gedanken ja weniger dumm als du glaubst. Aber außerhalb der Mauern des Palastes, darfst du sie nie wieder äußern. Verstehst du mich?“
Ani nickte stumm, ohne auch nur im Entferntesten zu ahnen, welche Bedeutung und schließlich auch Folgen, das soeben Geäußerte hätten. Er war einfach nur erstaunt, Amenhotep so aufgewühlt und furchtsam zu sehen. Hatte er doch immer gedacht, dass ein Sohn des Guten Gottes, äußern könne, was immer er wolle.
Das blaue Haus der Meister der Einbalsamierung hob sich deutlich vom Braun des dahinströmenden Nils ab. Ein paar Atemzüge noch und er würde seinen Vater noch einmal sehen können. Einerlei wie sich sein Schicksal nach den siebzig Tagen der Vorbereitung für die Ewigkeit auch gestalten sollte, ob er den Palast wieder verließ oder aber dort bleiben würde - sein altes Leben war endgültig dahin. Ein Ehrenkuss auf Vaters Hand würde die letzte Berührung sein, die ihn noch mit seiner alten Welt verband. Ani kamen die Tränen. Hätte einer der Götter, die vielleicht nur ein Einziger waren, ihm die Möglichkeit gegeben, diese neue Welt von Sauberkeit, Reichtum und Wohlgerüchen gegen das Leben seiner Eltern und der kleinen Schwester einzutauschen - er würde nicht einen Augenblick zögern, deren Leben zu erbitten.
Das blaue Haus war kühl. Ani zog ein Schauer über den Rücken als sie eintraten. Er bemerkte, dass es Amenhotep ebenso erging. Die Luft brummte von den tiefen Stimmen, die in fernen Räumen geheimnisvolle Rituale vollzogen. Es roch eigenartig schwer und süßlich - wie beim Schlachter in Anis Dorf. Ani wollte den Gedanken besser nicht zu Ende denken … Die Glut Dutzender von Räuchergefäßen reinigte mit ihren Aromen die Luft, die mit erstaunlich stetem Zug den Raum durchwehte. In einem winzigen Nebenraum, der eher einem in den Fels gehauenen Alkoven glich, lag sein Vater auf einer Bank aus leuchtendem Marmor. Aus drei kleinen Luken, die man in der Decke ausgespart hatte, trafen die Sonnenstrahlen allein auf die marmorne Bank und brachten sie solcherart zum Leuchten. Ani musste schlucken, denn so hatte er seinen Vater noch nie gesehen: Ein Schendschut aus edelstem Leinen bedeckte seine Lenden, ein geflügelter Skarabäus lag auf seiner Brust und sein Gesicht sah geschminkt um Jahre jünger aus. Rasiert und frisch gewaschen konnte er sich nun auf seine letzte Reise vorbereiten lassen. Fast mochte Ani meinen, der Vater schliefe nur. Er wollte schon eintreten, um seinen Vater zu berühren, als einer der beiden Balsamierer, die sie hereingeführt hatten, sich ihm in den Weg stellte. „Es ist besser so. Glaub es mir“, hörte Ani ihn in einem Tonfall sagen, der erkennen ließ, dass er diesen Ratschlag schon tausendmal gegeben hatte. „Wir tun unser Bestes. Doch manchmal reicht selbst das nicht aus. Es ist besser, du siehst nicht seine andere Seite.“
„Ich danke dir“, sagte Ani tonlos. Woraufhin ihm der Balsamierer die hohle Hand entgegenstreckte. Amenhotep warf etwas hinein und Ani meinte, etwas Goldenes gesehen zu haben, bevor die Hand sich flink und fest darum schloss.
„Der Oberste der Balsamierer lässt noch fragen, ob es denn tatsächlich eine königliche Vorbereitung für die Ewigkeit sein soll.“
„Das hat er heute Mittag schon gefragt, obwohl ich klare Anweisungen gegeben hatte.“ Amenhoteps Stimme klang kalt und gebieterisch. „Sollte er noch einmal fragen, lasse ich ihm die Ohren abschneiden. Sag es ihm! Und du, Ani“, wie selbstverständlich legte er dem Freund die Hand auf die Schulter, „bist du bereit, für heute Abschied zu nehmen? Wenn dein Vater für die Ewigkeit vorbereitet ist, wirst du ihn wieder sehen. Und wie ein guter Sohn wirst du dann das Mundöffnungsritual an ihm vollziehen.“
„Einen Augenblick noch“, flehte Ani. „Ein Ehrenkuss noch. Ich werde ihn ja nie mehr wieder sehen …“
Gerade als sie das Einbalsamierungshaus verlassen wollten, kam ein dunkel gekleideter Mann aus einer der Nischen hervor und verbeugte sich tief.
„Ah, dich kenn ich“, schmunzelte Amenhotep nach kurzem Überlegen. „Du bist der Schatzmeister des Hauses, nicht wahr?“
„Hehehe“, mit falschem Lachen versuchte der Beamte, die Peinlichkeit zu umgehen. „Unsere Kasse ist so gut wie leer. Die Außenstände, du verstehst. Wir müssen aber neue Essenzen besorgen und Wachs und Leinenbinden werden auch knapp. Insbesondere die königlichen…“
„Ich verstehe.“ Ohne eine Miene zu verziehen, streifte Amenhotep einen der goldenen Reifen von seinem Arm. „Und die Begleichung durch die Staatskasse dauert dir zu lange, nicht wahr?“ Mit spitzen Fingern hielt er den Reifen in die Luft und ließ ihn schließlich in die begierig darunter gehaltenen Hände des Schatzmeisters fallen. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, verließen der Prinz und sein Begleiter das Haus.
„Aber Amenhotep“, Ani war erschüttert über die Tatsache, dass selbst ein Prinz für alles bezahlen musste. Dachte er doch, dass der sich einfach nehmen könne, was immer er wollte. „Dein Armreif! Er war sicher ein Erinnerungsstück. Vielleicht sogar ein Geschenk.“
„Und ob“, lachte Amenhotep. „Von Sobekmose, dem Vorsteher des Schatzhauses.“ Und gleichgültig fügte er hinzu: „Ich werde mir gleich morgen einen neuen bei ihm holen.“
„Einfach so?“
Amenhotep zuckte mit den Schultern. „Natürlich einfach so.“
Schweigend fuhren sie im letzten Licht der Abendsonne den Kanal zurück. Ani war froh, der ungewohnten Kälte des Einbalsamierungshauses entkommen zu sein. Er spürte wie die warmen Strahlen der Sonne ihn zu liebkosen schienen; wie Hände, die sanft seine Haut streichelten, die Wärme und Leben brachten. Von irgendwo her glaubte er, leise Musik zu hören. Tatsächlich: Jemand spielte auf einer Harfe und sang leise eine Melodie dazu. Amenhotep deutete auf das Größte der Häuser, die vereinzelt an ihnen vorüberzogen. „Unsere Musikschule. Mein Vater liebt Tanz und Musik über alles. Stell dir vor, letztes Jahr hat er Aha, einen Lauten-Spieler, zum Oberhofmeister und Vorsteher der königlichen Musikschule gemacht. Das war vielleicht ein Gerede. Aber“, Amenhotep hob anerkennend den Finger, „Aha hat sich bewährt. Na, du wirst ihn ja bald kennen lernen. Er ist für die musikalische Unterhaltung bei Hofe zuständig und schenkt uns immer wieder wundervolle Abende. Vater hat ihn nämlich die besten Musiker des Landes hier in seiner Schule versammeln lassen, um diese Kunst auf neue Höhen zu heben.“
„Dein Vater ist ein wahrer Künstler“, sagte Ani beeindruckt. „Man wird sich auf alle Ewigkeit seiner erinnern. Und zwar nicht, weil er die Fremdländer mit Feuer und Schwert unterworfen hat, sondern weil er allerorten Schönheit und Kunst erblühen ließ. Er bringt den Menschen das Licht der Anmut.“
„Genau das ist er“, bestätigte Amenhotep nickend. „Ein Künstler. Aber die Widerstände sind nicht zu unterschätzen. Als er die Musikschule gegründet hatte, gab es großes Geschrei im ganzen Land. Es sei nur Tempeln gestattet, Musiker auf Dauer zu beschäftigen. Vater hat sich durchgesetzt.“
„Der Gute Gott ist mutig, stark und ewiglich strahlend.“
Amenhotep lachte. „Das ist er, wie Gott weiß. Sein zweiter Horusname lautet „Starker Stier, Herrscher der Herrscher“. Diesen Namen hat er sich also selbst in sein Lebensbuch geschrieben. Das verpflichtet. Aber meine Mutter hat ihn gezähmt. Sie bewegt in manches Mal zu konzilianterem Verhalten, als es meiner Meinung nach nötig wäre. Im Fall der Musikschule hat man sich spitzfindig einfallen lassen, dass der Palast ja genauso wie ein Tempel als heiliger Bezirk angesehen wird, er also auch über eigene Musiker verfügen können muss. Eine weitere große Niederlage für die Amun-Priester. Denn jetzt ist die Musik frei, außerhalb ihrer Kontrolle, mit der sie dieses verboten und jenes gestattet haben.“ Ani konnte die Freude darüber in Amenhoteps Gesicht deutlich sehen. „Thutmosis und ich hätten die Gelegenheit genutzt, um es auf ein endgültiges Kräftemessen mit der Amun-Priesterschaft ankommen zu lassen. Wir hätten sie vernichtet. So aber haben wir sie noch immer am Hals. Aber Thutmosis’ Zeit wird kommen. Und ich hoffe, dass er sie dann nutzen kann. Er ist manches Mal so wankelmütig und schwach …“ Amenhotep stockte und erschrak sich offenbar über seine eigenen Worte. „Ani, was ich eben gesagt habe, bleibt ungesagt, verstehst du? Ich werde meinem Vater gegenüber immer loyal sein. Und später einmal, in eine Million Mal eine Million Jahren, ebenso meinem Bruder. Ani, ich möchte, dass du bei mir bleibst, weil ich einen Freund brauche. Einen Freund, dem ich all das erzählen kann, was ich sonst niemandem zu sagen wage. Einen Freund der nicht Speichel leckt und kriecht, sondern mir ehrlich sagt, wenn ich seiner Meinung nach ungerecht bin oder in die Irre gehe. Und Ani – solltest du wem gegenüber auch immer je ein Wort darüber verlieren, was ich jetzt oder in Zukunft sage, so werde ich dir die Zunge herausschneiden, dir die Ohren mit flüssigem Blei verschließen und deine Augen mit glühenden Eisen ausstechen lassen. Also erspare mir und dir diese scheußliche Prozedur. Es bräche mir das Herz.“ Amenhotep lächelte.
„Ich werde versuchen, dir zu genügen“, sagte Ani ohne zu lächeln. „Du hast mir ein neues Leben voller Wohltaten geschenkt. Und so gehört es dir. Doch vielleicht bist du es, der mich fortschickt nach den siebzig Tagen … Mein Schweigen aber, das schwör ich dir.“
„Wer weiß“, Amenhoteps Miene hatte wieder jenen Ausdruck angenommen, den er üblicherweise außerhalb des Palastes aufsetzte. „Vielleicht schick ich dich ja wirklich wieder weg. Wir werden sehen …“ Mit einem Strahlen in der Stimme sagte er plötzlich: „Sieh nur, dort, Ani, dort in der Ferne! Das Haus der Millionen von Jahre, das mein Vater sich erbauen lässt, damit man sich auf alle Ewigkeit an ihn erinnern möge. Und schau nur, wie die versinkende Sonne den beiden Statuen am Eingang ihre letzten Strahlen schenkt. Von der anderen Seite des Nils, von Waset aus sieht man ihre Häupter von einem Strahlenkranz aus Sonnenlicht umgeben. Es ist wirkliche Magie. Dies sind die größten Statuen, die jemals aus Stein gehauen wurden. Sie allein werden auf alle Ewigkeit von Vaters Größe künden.“ Und obwohl sie weit entfernt am Rande des überschwemmten Fruchtlandes in den Himmel ragten, war Ani von ihrer schieren Größe überwältigt. Es musste wahrlich ein Gott sein, wer solches erbauen konnte. „Weißt du, Ani, wo ich nun schon einmal dabei bin, dir meine Geheimnisse anzuvertrauen … Mein Vater möchte, dass ich eines Tages Onkel Anen in seiner Führerschaft der Amun-Priester ablöse.“
„Oh“, entfuhr es Ani. Zwar hatte er keinerlei Vorstellung welche Art von Bedrohung die Amun-Priester darstellten, aber dass Amenhotep nicht gut auf sie zu sprechen war, hatte er inzwischen mehr als einmal mitbekommen. Zudem waren sie es gewesen ‑ und das brachte sein Blut in Wallung ‑, die seinen Vater erschlagen hatten.
„Mein Bruder Thutmosis und ich sind uns einig, dass ich dereinst unter seiner Herrschaft die Ressorts Kunst und Propaganda beaufsichtigen werde. Ich werde seinen Ruhm in den erlesensten Reliefs verkünden und ihn die beeindruckendsten Bauwerke errichten lassen. Es wird nicht leicht sein, das Haus der Millionen Jahre meines Vaters zu übertreffen. Aber ich habe schon ein paar Ideen …“ Amenhotep zwinkerte. „Es wird jedoch, so hoffe ich inständig, noch lange bis da hin sein. Zunächst muss ich die Eltern erst einmal davon überzeugen, dass ich nicht der Richtige bin für den Amun-Kult. Mein Onkel Anen, der Bruder meiner Mutter, ist schon seit Jahren Zweiter Prophet des Amun. Die Priester verhindern mit allen Mitteln sein Weiterkommen. Und dabei glaubt er inzwischen sogar wahrhaftig an ihren Mummenschanz. Die haben tatsächlich sein Innerstes von Oben nach Unten gekehrt. Was meinst du, welche Aussichten ich dann erst hätte, der ich diesem finstren Kult so überhaupt nichts abgewinnen kann. Hätte die große Tetischeri seinerzeit nur nicht die Unterstützung der Amun-Priester nötig gehabt … Nun“, Amenhotep richtete sich auf, „das ist Politik. Und damit wirst du, nehme ich an, noch nicht vertraut sein. Kannst du eigentlich schreiben?“
„Schreiben?“ Ani lachte. „Ich kann das Anch-Zeichen in den feuchten Nilschlamm malen. Mehr aber nicht.“
„Auch das wirst du von morgen an lernen.“
Der Hafen von Malqata war so gut wie menschenleer, als sie schließlich dort ankamen. Die Schiffe, es lagen etliche vor Anker, waren für die Nacht vertäut und die Sonne schickte noch ein letztes Glühen über die Felsen im Westen, dort wo die großen Herrscher des Reichs in ihren geheimen Gräbern verborgen lagen. Ein paar Händler verstauten ihre Waren, während ansonsten kaum noch jemand unterwegs war. Es war die Stunde der Hunde, wie Ani diese Tageszeit nannte. Die Köter führten sich auf, als sei die Zeit ihrer Herrschaft endlich angebrochen. Schlichen sie untertags mit eingezogenen Schwänzen zwischen den Menschen umher, so fochten sie jetzt offen ihre Revierkämpfe aus, bei denen alles, was sich bewegte - und sei es der Sohn des Königs -, mit lautem Gebell und Geknurr angegangen wurde. Doch die Soldaten der Eskorte brauchten beim Marschieren nur einen Stein nach ihnen zu stoßen, und schon waren sie jaulend und winselnd davongelaufen. Die Soldaten machten sich einen Spaß daraus, immer wieder über Steine zu stolpern, um den feigen Kläffern zu zeigen, wer hier der Herr war. Amenhotep schmunzelte nur und freute sich am Spaß seiner Leute. Dennoch war es Ani wohler, als sich endlich die duftende Zedernholztür mit einem sanften satten Ton hinter ihm schloss; konnte er sich doch nur zu gut an frühere Begegnungen mit Straßenkötern erinnern, die weniger glimpflich ausgegangen waren.
Rechmire stand breitbeinig und lächelnd da. Ergeben verbeugte er sich vor Amenhotep. „Seine Majestät, dein Vater, er möge leben eine Million mal eine Million Jahre, erwartet dich, sobald der Mond sich zeigt. Er möchte heute Abend alle seine Lieben um sich haben.“
„Alle?“, fragte Amenhotep irritiert.
„Fast alle. Dein Onkel Anen ist verhindert, ist er doch mit den Vorbereitungen für das Opet-Fest beschäftigt. Aber dafür wird der andere Bruder deiner Mutter Teje, sie möge leben eine Million mal eine Million Jahre, Eje, der Vorsteher der Pferde, kommen.“ Und da Amenhotep ihn fragend ansah, setzte er mit einem Lächeln hinzu: „Mit beiden Töchtern.“
Amenhotep strahlte und Rechmires Augen glänzten vor Glück, weil er dem Sohn seines Herrn mit seiner schlichten Nachricht eine solche Freude machen konnte. „Mein Prinz, es freut mich ganz besonders, dir noch sagen zu dürfen, dass die Mutter des Horus im Nest, die Königsmutter Mutemwia, ebenfalls anwesend sein wird. Sie ist unmittelbar vor dir mit dem Schiff aus Achmim angekommen.“
Fast glaubte Ani, Amenhotep wolle den dicken Rechmire in den Arm nehmen und küssen, denn er strahlte über das ganze Gesicht. „Großmutter“, rief er voller Freude. „Sie ist wieder gesund?! Mein Vater hat der Göttin Sachmet versprochen, siebenhundert ihrer Statuten im Heiligtum der Mut aufstellen zu lassen, wenn sie nur Großmutter wieder gesund werden lässt. Weißt du, wo sie jetzt gerade ist, Rechmire?“
„Sie hat soeben ihr altes Appartement bezogen und erfrischt sich etwas von der Reise.“ Rechmire räusperte sich. „Sie äußerte sich erfreut, etwas zur Ruhe kommen zu können.“
„Ich verstehe“ sagte Amenhotep und reckte den Hals nach dem Himmel. „Nun, lange wird es nicht mehr dauern, bis der Mond sich zeigt. Ich werde mich bis dahin gedulden. Komm, Ani, wir nehmen ein Bad, suchen uns was Nettes zum Anziehen aus und Schesehmu kann uns dann neu schminken.“ Schon hatte er Anis Hand ergriffen und zog ihn mit sich fort.
Glücklich war Ani eigentlich nicht, schon wieder gebadet zu werden. So viel Wasser wie an diesem Tag hatte noch nie seine Haut berührt. Aber es tat gut, den Staub der Wüste loszuwerden. Die sanfte Dienerin, die ihn in dem kleinen, vollständig mit Marmor ausgekleideten Badezimmer unablässig mit Wasser begoss, das sie singend aus einem großen Holzzuber schöpfte, tat das ihre, dass er sich umsorgt und behaglich fühlte. Schließlich tupfte ihn jene Dienerin, die ihn vorhin mit der Feder geweckt hatte, mit weichen Tüchern ab. Inzwischen wusste Ani, dass sie Merit-amun hieß - er hatte sie einfach nach ihrem Namen gefragt - und er musste sich eingestehen, dass sie eine durchaus begehrenswerte Frau war.
Die Kleidung, die Amenhotep ihm hatte bringen lassen, fand Ani eigentümlich. Er hatte keinerlei Vorstellung davon, wie man ein derart gefälteltes Stoffgebilde zu einem Schurz binden konnte. Merit-amun nahm ihm diese Aufgabe ab. Zum Schluss legte sie ihm einen Schmuckkragen aus Hunderten von farbigen Fayenceperlen um, die Margeriten, Kornblumen und Mohnblüten darstellten. Die Perlen waren so fein gearbeitet, dass man bei den Kornblumen sogar die Schuppung der Blütenkelche erkennen konnte. „Das ist die neueste Mode unter den jungen Leuten“, sagte Merit-amun stolz darauf, ihren Herrn, dem sie dienen durfte, so vorteilhaft aussehen lassen zu können. Als Ani ging, um Amenhotep in seiner Wohnung zu treffen, war er befangen, wie er sich von Merit-amun verabschieden sollte. Also sagte er einfach das, was er zu Hause auch immer gesagt hatte. „Gute Nacht, Merit-amun. Schlafe gut und lass die Träume dir etwas Schönes zeigen.“ Als er gegangen war, ging Merit-amun schweigend in die Knie und barg den Kopf in ihren Armen.
Als Ani den allgemeinen Aufenthaltsraum betrat, saß Amenhotep in einem bequemen Sessel und hatte sich gerade von Schesehmu im Schein zahlreicher Öllämpchen schminken lassen. „Oh, der Diener und Herzensfreund seiner Majestät des Prinzen sieht aus wie einer der edelsten Fürsten des Landes“, meinte der Oberschminkmeister salbungsvoll. „Der Schmuckkragen ist einfach entzückend! Unterstreicht er doch das Rustikale in seinem Wesen.“
Amenhotep schaute Ani von seinem Sessel aus abwägend an. „Jetzt, mein guter Schesehmu, ist es an dir, das Rustikale noch eindeutig als Überhöhung erscheinen zu lassen.“
Mit aufmerksamer Hingabe widmete sich der Oberschminkmeister der Herausforderung. „Ich würde die Lider mit gemahlenem Lapislazuli betonen wollen“, überlegte er mit sich Selbstgespräche führend. „Und man sollte den edelsten Kohol aus Bleiglanz verwenden, um die Lidstriche weit über die Augenwinkel hinaus zu führen. Das betont die edle Anmut der Schläfen. Für die Wangen ebenfalls Bleiglanz, selbstverständlich ausgeglüht. Das ergibt ein kräftiges Rot, das einem Landmann wohl anstehen möchte. Und zum Schluss noch eine schlichte Perücke aus libyschem Haar, das sieht ein wenig verwegener aus.“ Voller Hingabe kramte Schesehmu in seinem riesigen Schminkkasten, dessen beeindruckende Größe sich noch verdoppelte, nachdem er ihn aufgeklappt hatte.
„Also, wenn man mich fragen würde“, druckste Ani herum, „ich würde auf die Perücke lieber verzichten wollen.“
„Ohne Perücke? Mit kahl geschorenem Kopf?“ Schesehmu stand das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. „Das ist bei Hofe aber nicht üblich. Außer, man gehört zur Dienerschaft.“
„Es ist bestimmt unwahrscheinlich heiß unter solch einer Perücke“, gab Ani zu bedenken. „Und offen gestanden, ekelt es mich davor, die Haare anderer Menschen auf dem Kopf zu tragen.“
Amenhotep lachte laut. „Wollten wir nicht sowieso eine neue Mode kreieren? Die Landmann-Mode?“
So galt es dann als abgemacht, dass Ani die Perücke erspart blieb. Und selbst das drastische Rouge der Wangen musste Schesehmu wieder etwas abwischen, was er unter halblautem Klagen und Gezeter widerstrebend tat.
Zufrieden schaute Amenhotep Ani ins Gesicht. „Interessant“, nickte er schließlich. „Man wird über deine Aufmachung reden. Und nun los, der Mond geht gerade auf.“
Subira hatte Amenhotep mit einem Kuss auf die Stirn verabschiedet sowie Ani noch einen frisch gepflückten Strauß mit Kornblumen in die Hand gedrückt, als sie Amenhoteps Wohnung verließen. Ani hatte erwartet, dass sie, so wie des Nachmittags, zu zweit durch die endlosen Flure, Innenhöfe und Räume toben würden, um auf die Dachterrasse des Pharao zu gelangen. Aber er sah sich getäuscht. Eine Sänfte mit vier Trägern und einem nubischen Fächerträger stand bereit und sollte sie - Amenhotep in der Sänfte, während Ani nebenher lief - in einer gemächlichen Prozession zum königlichen Appartement bringen. Es schien Ani eine Ewigkeit zu dauern, bis sie durch prächtig ausgeschmückte Flure geschritten waren, leere Säle durchschritten hatten, um endlich vor der Wohnung des Königs anzukommen. Zwei Bewaffnete standen vor der Türe, verneigten sich und öffneten sie ehrerbietig.
Ani sah sich abermals getäuscht, hatte er doch ein prächtiges Gemach voller Gold und Pretiosen erwartet. Doch das Appartement des Königs war ebenso schlicht und zweckdienlich eingerichtet wie das Gästezimmer, das ihm in Amenhoteps Wohnung zugeteilt worden war. Die Wandmalereien waren allerdings von einer derartigen Qualität und Detailgenauigkeit, dass es Ani schlicht den Atem verschlug. Am liebsten wäre er sofort hierhin und dorthin gelaufen, um jede der wirklichkeitsgetreuen Einzelheiten zu begutachten, die er bereits aus der Ferne entdecken konnte. Doch schon hörte er Rechmires Stimme, gerade als sie die Terrasse betreten wollten: „Prinz Amenhotep, die Frucht des Leibes der Großen Königlichen Gemahlin Teje und Sohn des Guten Gottes, er möge leben eine Million mal eine Million Jahre“. Zunächst küsste Amenhotep die Rechte seines Vaters und drückte sie anschließend an seine Stirn, dann gab er seiner Mutter einen ehrfürchtigen Kuss auf die Stirn, die aber darauf bestand, dass er sie auch auf die Wange küsste. Schließlich aber sprang er wie ein kleiner Bub auf eine alte, doch rüstige Frau zu, die auf einem goldenen Sessel thronte und ihn schon die ganze Zeit über angestrahlt hatte. Sie saß auf dem bei weitem prächtigsten Möbelstück in der ganzen Wohnung, wie Ani erstaunt feststellte. Stürmisch umarmte Amenhotep sie, was diese sich strahlend gefallen ließ und küsste immer wieder ihre Hände. Dies musste die Königsmutter Mutemwia sein, die neben Teje mächtigste Frau des Reiches, vermutete Ani. „Mein Liebling“, sagte sie mit einer von jahrelangem Hanfkonsum rauchigen Stimme, „mein Herz jubelt, dich wieder zu sehen. Du bist ja fast zum Mann geworden, in der Zeit meiner Krankheit. Wann kommst du mal wieder nach Achmim, um mich zu besuchen? Unsere Bildhauerwerkstatt ist eine Zierde für das ganze Reich. Ein ganz junger Bildhauer, kaum älter als du, vermag uns alle in Erstaunen zu versetzen. Er ist der Meister der wirklichkeitsnahen Wiedergabe. Du wirst seine Arbeit lieben!“ Schon hatte Amenhotep neben ihr Platz genommen und hielt zärtlich ihre Hand, als ob er fürchtete, sie könne jederzeit davonlaufen. Stumm stellte sich Ani hinter ihn und reichte ihm in einem unbeobachteten Augenblick den Kornblumenstrauß, den Amenhotep sogleich teilte, um die eine Hälfte seiner Mutter und die andere der Königsmutter Mutemwia zu übergeben. Seine Schwestern quittierten diese herzliche Geste mit gerührten Ahs und Ohs und selbst Pharao lächelte zufrieden. Ani sah sich um. Alle anderen Anwesenden, bis auf einen älteren Mann, der leicht versetzt hinter Sit-amun saß, hatte er schon anlässlich des gemeinsamen Mittagsmahls kennen gelernt. Nebet-tah lag in einer vergoldeten Wiege, die neben ihrer Mutter stand, und schlummerte friedlich. Henut-tau-nebu und Iset ließen kaum einen Blick von ihm und schmachteten ihn regelrecht an, was Ani ein wenig irritierte, denn er konnte nicht recht einschätzen, was überhaupt ihr Interesse hervorgerufen hatte: Der seltsame Schurz, der bunte Schmuckkragen, die fehlende Perücke oder gar er selbst. Währenddessen spielte Thutmosis geistesabwesend mit seiner Katze, die er auf dem Schoß hielt. „Ihr Mädchen“, sagte Pharao plötzlich, „was guckt ihr ständig nach Amenhoteps Diener hin? Ist es sein neuartiger Schmuckkragen oder sein perückenloses Haupt, was euch so fasziniert?“ Ani meinte einen Anklang von Eifersucht in der Stimme des Guten Gottes zu hören. „Seine ganze Erscheinung“, entgegnete Iset mit strahlenden Augen. „Ja, sieh doch nur“, pflichtete Henut-tau-nebu ihr bei, „wie edel einfache Bauern sein können!“ Ani war heilfroh, dass Rechmire gerade eben die letzten Gäste ankündigte und das Thema somit erledigt war: „Der Vorsteher der Pferde und Bruder der Großen königlichen Gemahlin, der ehrenwerte Eje mit seiner Gemahlin Tij und den Töchtern Nofretete und Mutnedjmet!“
Noch nie hatte Ani ein schöneres Menschenkind gesehen als die älteste Tochter des Vorstehers der Pferde. Und er hatte, so wahr er hier stand, an diesem sonderbaren Tag die schönsten Frauen und Mädchen des ganzen Landes gesehen. Nofretete, so musste er sogleich feststellen, trug ihren Namen wahrlich zu Recht. Denn er bedeutete nichts weiter als „Die Schöne ist gekommen“. Sie trat zu den anderen auf die Terrasse und genoss es sichtlich, dass sich alle an ihrer außergewöhnlichen Schönheit ergötzten. Nach den üblichen Begrüßungen – der Pharao küsste sie sogar auf die Stirn, was Teje mit einem leichten Kräuseln ihrer Brauen zur Kenntnis nahm - setzte sie sich seitlich hinter Thutmosis, der ihr gerade einmal halbwegs freundlich zunickte. Ani konnte sich an ihrer Erscheinung gar nicht satt sehen. Wie Amenhoteps Mutter Teje hatte sie eine natürliche, majestätische Ausstrahlung. Nur dass sie von einer derart perfekten Schönheit war, dass Ani fast glauben wollte, der von Großmutter Mutemwia soeben hoch gelobte Bildhauer in Achmim habe sie aus einem Block Rosenquarz geschlagen und von den Göttern zum Leben erwecken lassen. Nofretete bemerkte Anis Blicke, sah ihm ins Gesicht und lächelte kurz. Doch wie vollkommen anders war ihre jüngere Schwester! Ein dickliches, vorlautes Kind, das einen tiefschwarzen Zwerg mit sich führte, den es soeben erst von ihrem vollkommen in sie vernarrten Vater geschenkt bekommen hatte. „Heute erst ist er zusammen mit den wilden Bestien aus Nubien oder Punt oder woher auch immer bei uns angekommen. Ist er nicht niedlich?“, rief sie verzückt und klopfte dem kleinen, kaum ebenso großen Mann auf den Kopf. „Los, tanzen!“, plärrte sie ihn an, was er aber nicht verstand und sie nur aus traurigen Augen ansah. „Lass es gut sein“, meinte Tij, der man die Ähnlichkeit mit Mutnedjmet, ganz im Gegensatz zu Nofretete, deutlich ansah, so dass man sofort Mutter und Tochter in ihnen erkannte. „Er ist ja schon ganz durcheinander unser armer Däumling und muss erst einmal unsere Sprache lernen.“ Und an den Zwerg gewandt fuhr sie freundlich fort: „Nicht wahr? Du ganz müde. Viel Tanzen machen heute. Schwere Beine, nicht?“ Und an die Runde gerichtet, meinte sie schließlich. „Wenn er nur nicht so hässlich wäre, der kleine Wicht. Ich verrate aber nicht zu viel, wenn ich euch sage, dass er nicht überall so winzig ist. Meine Dienerin war vorhin regelrecht erschüttert, als sie ihn gebadet hat.“ Beifall heischend blickte sie in die Runde, strich aber schließlich ihr mit Goldfäden durchwirktes Kleid glatt, als sie merkte, dass niemand Lust verspürte, auf ihre Bemerkung weiter einzugehen. Amenhoteps Onkel Eje lächelte verlegen und versuchte das Thema zu wechseln, indem er Thutmosis nach seinen Fortschritten in den militärischen Disziplinen fragte. Unwillig und maulfaul murmelte der irgendetwas vor sich hin, was niemand so recht verstand.
„Da du weißt, Thutmosis“, Pharaos Stimme hatte einen ärgerlichen Ton angenommen, „dass man - so man überhaupt etwas zu sagen hat – immer darauf achten soll, dass diejenigen, an den man sich richtet, das Gesagte auch verstehen. Also muss ich bei deinem Gemurmel davon ausgehen, dass du uns also nichts zu sagen hast.“ Thutmosis guckte beleidigt und kraulte die Katze derart heftig, dass sie schließlich fauchte. „Setz die Katze runter und schau mir ins Gesicht. – So und jetzt mein lieber Sohn, sage mir, was dich so störrisch werden lässt.“
„Ich werde kein Pharao des Krieges und der Gewalt“, sagte Thutmosis unerwartet fest. „Wozu soll ich dann das Morden und Totschlagen lernen?!“
„Damit du deine Herrschaft verteidigen kannst, falls es nötig sein sollte.“ Pharaos Stimme klang nun wieder sanft und beherrscht. „Halte durch, mein Junge. Nach dem Opet-Fest kannst du dann nach Men-nefer gehen. Ich glaube es wird dir ganz gut tun, mal aus dem Palast und seinen Gepflogenheiten herauszukommen.“
„Und in Men-nefer werde ich dann zum Hohepriester des Ptah gedrillt. Ich will nicht diese blöden Ämter und auch das altertümliche Zeugs will ich nicht lernen.“
„Du wirst eines Tages Pharao, mein Sohn. Du solltest also schon wissen, wessen König du dann bist. Dein Bruder wird Schwager Anen ablösen und wird Hohepriester des Amun. Es wird dir helfen, wenn du erst einmal diese Widerstände los sein wirst, glaub es mir.“
Amenhotep schaute betreten, fasste sich aber dann doch ein Herz. „Ich wollte dich eigentlich fragen, lieber Vater, ob du mir die Quälerei bei den Amun-Priestern nicht ersparen könntest. Ich hab ihn heute gesehen ihren angeblich lebendigen Amun. Er ist ein billiges Stück schwarzer Stein. Und er ist so tot wie ein Stein nur sein kann. Es ist lediglich ein Popanz, der nur dazu taugt, den Menschen Angst einzujagen und ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Der ganze Amun-Kult dient nur dazu, dass einige sich die Taschen voll stopfen können. Fast sind sie schon reicher und mächtiger als der Pharao selbst. Denn sie behalten alles für sich, während du den Menschen Gutes tust, ihnen Tempel schenkst und Brot und Bier. Warum fordert dies die Maat nicht auch von den Amun-Priestern? Lass mich nicht bei diesen selbstsüchtigen Menschen! Ich habe andere Gedanken …“
„So, so, so!“ Bis weit zum Nil schallte Pharaos Stimme. „Meine Söhne haben andere Gedanken. Das klingt ja fast nach einer Palastrevolution! Der eine möchte dies nicht und der andere jenes. Ihr seid aber nun mal als Gottessöhne geboren! Meint ihr, mich hat man gefragt? Damals, ich war kaum halb so alt wie ihr, als mein Bruder starb und ich Thronfolger wurde? Vier Jahre später hat man mir die Krone aufs Haupt gesetzt.“ Er atmete tief durch. „Söhne, ich weiß es ist schwer, aber es geht um eure Zukunft.“ Da war sie wieder die Stimme des Guten Gottes. „Denn ohne das Wissen, das ihr euch wohl oder übel aneignen müsst, werdet ihr eure Feinde nie richtig einschätzen können. Man wird euch hinwegfegen unter irgendeinem Vorwand und den fettesten der Amun-Priester mit einer meiner Rosenknospen vermählen.“
„Ihhh“, riefen die Mädchen wie aus einer Kehle.
Pharao lachte lauthals. „Ein Glück, dass meine liebe Teje mir auch meine Rosenknösplein geschenkt hat. Mein Herz hätte so viel weniger zum Jubeln, wenn ich nur meine beiden Söhne hätte!“ Und an sie gewandt fuhr er fort: „Was sind das denn so für Gedanken, die ihr hegt? Lasst uns doch alle daran teilhaben.“ Der Gute Gott lehnte sich in seinem Sessel zurück.
„Ja, also …“ wollte Amenhotep gerade anfangen, von seinen Plänen zu berichten, als Pharao die Hand hob. „Psssst - dein Bruder ist der Thronfolger. Er spricht zuerst.“
Als müsse er erst überlegen, sah Thutmosis in die nachtschwarze Luft. „Also, wenn ich erst mal Pharao bin, dann müssen sowieso alle tun, was ich will.“ Frech schaute Thutmosis seinem Vater ins Gesicht und zuckte mit den Schultern. Ani fürchtete, dass ihm die Knie versagen könnten, erwartete er doch Blitze aus des Guten Gottes Augen und Beben, die alles verschlangen.
„Schwager Eje“, sagte der Pharao stattdessen mit ruhiger Stimme, „meinem Sohn Thutmosis scheint die militärische Umgebung wirklich nicht gut zu tun. Benenne mir bitte einen Lehrer, der geeignet ist, ihm gleich ab morgen Unterricht zu erteilen, welches die Rechte, aber auch Pflichten eines Herrschers von Ägypten sind. Mir scheint es da noch gehörige Wissenslücken zu geben. Wenn das Opet-Fest beendet ist, wünsche ich, dass er unverzüglich nach Men-nefer reist, um dort im Tempel des Ptah zu erfahren, was es bedeutet Mensch zu sein und was es braucht, um ein Gott zu werden.“ Pharao wandte sich nun Amenhotep zu. „So, und nun zu dir, Amenhotep. Welches sind deine Gedanken?“
„Ich glaube an die Kraft der Schönheit.“ Die Terrasse summte von leise dahingehauchten Ahs. Fast hätte Ani gekichert, hatte ihm nicht Amenhotep selbst vor wenigen Stunden gesagt, dass man nur von Schönheit zu reden brauche, um die Herzen der Frauen zu gewinnen? Aber auch der Pharao lächelte wissend. „Ich möchte meinen Bruder in eine Million Mal eine Million Jahren dahingehend unterstützen“, fuhr Amenhotep fort, „indem ich die Kunst, die von der Größe Pharaos berichtet, zur vollen Blüte bringe. Sie soll künden von der ewigen Macht des gottgleichen Königs und von der ewigen Dauer Ägyptens. Sie soll Schönheit bringen in den Alltag der Menschen und sie soll sie wissen lassen, wem sie ihr Glück zu verdanken haben. Für jetzt und für alle Zukunft. In Achmim so hört man sagen, formiert sich soeben eine Schule, die Kunst völlig anders versteht. Sie wollen nicht mehr mittels altüberlieferter Abbilder darstellen, die im Grunde nichts weiter sind als bildhaft ausgeführte Symbole. Sondern sie wollen die Wirklichkeit einfangen, so wie sie tatsächlich ist.“ Ani sah sich unbemerkt um und ertappte Ejes Frau Tij dabei, wie sie ihre Gesichtshaut straff zog, wohl in dem Gedanken, von einem der neuen Künstler der Wirklichkeit entsprechend abgebildet zu werden. „Wir müssen den Menschen Freude am Dasein geben und sie befreien von den Ängsten ums Diesseits und Jenseits. Eine neue, eine wahre Kunst wird ihnen den Weg weisen, um sich von altem Aberglauben zu befreien und die Vernunft in ihr Herz zu lassen.“ Ein kurzes Raunen huschte kaum merklich wie eine Fledermaus über die Terrasse, nur die alte Mutemwia ließ ein knappes Bravo hören.
„Wo hast du denn solche Reden zu führen gelernt?“ Pharao war sichtlich beeindruckt und sah seinen Schwager Eje fragend an, als ob der ihm den Lehrer nennen könne, der seinen Sohn so vortrefflich unterrichtet hat. Doch der grinste nur vielsagend.
„Von Mutter“, lächelte Amenhotep. „Was meinst du wie viele deiner Reden und Ansprachen wir schon gemeinsam verfasst haben.“
„Ach was?!“ Pharao richtete sich auf, sah Teje an und tätschelte ihre Hand, bevor er sie ganz fest hielt und drückte. „Nun also, um die Sache endgültig abzuschließen. Du gehst morgen gemeinsam mit deinem Bruder in den Unterricht über die Rechte und Pflichten eines Pharaos. Das kann auch dir nicht schaden. Außerdem kannst du Thutmosis dann immer daran erinnern, falls er einmal etwas davon vergessen haben sollte. Und nimm deinen Diener da gleich mit.“ Der Gute Gott deutete auf Ani und sah ihm mitten ins Gesicht. „Was der eine verschläft, hört der andere mit. Dein Diener wird dich an die richtigen Worte erinnern und du deinen Bruder. Und nach dem Opet-Fest, mein lieber Amenhotep, wirst du genug über die Amun-Adepten wissen, um nach Achmim zu gehen. Da magst du dich dann um die Erneuerung der Kunst Ägyptens bemühen.“ Alle klatschten Beifall und da Ani so begeistert war von der Weisheit des Guten Gottes, klatschte er selbstvergessen mit - bis Amenhotep ihm den Ellenbogen in die Seite stieß. „Was fällt dir ein?!“
Stolz sah sich Pharao um. „Irgendwelche Einwände? Hat irgendwer noch irgendwas dazu zu sagen?“ Er genoss es, in den Gesichtern die Bewunderung für die Weisheit seiner Entscheidungen lesen zu können, ja, er badete in ihrer Zuwendung und kostete den Augenblick aus. „So und jetzt lasst uns eine Kleinigkeit zu uns nehmen, auf dass Leib und Seele erfreut werden!“
Teje klatschte in die Hände, woraufhin Dutzende von Tabletts hereingetragen wurden, auf denen gebratene Täubchen, Fasanen und Enten, Fisch, Gemüse und Ochsenfleisch angerichtet waren. Dazu marschierten vier Harfenisten, drei Oud-Spieler, etliche Schlagwerker, zwei Oboe-Spielerinnen, zwei Flötisten und sechs Sängerinnen auf, angeführt von einem Mann, der aus einem Relief auf einer der Tempelwände entsprungen sein könnte, so wohlgewachsen war er. Das musste Aha sein, dachte Ani, der Oud-Spieler, der sich in höchste Höhen erhoben hatte. Und richtig, er nahm sein Instrument zur Hand und spielte eine einfache Weise, welche die Gespräche der Speisenden nicht störte, sondern sanft umschmeichelte. Je mehr aber gegessen und vor allem von Tejes köstlichem Wein getrunken wurde, desto lauter und munterer wurden die Stimmen, so dass Aha immer mehr Instrumente zum Einsatz brachte. Der Gute Gott sprach mit seiner Großen königlichen Gemahlin ‑ sicherlich über seine beiden Söhne, wie Ani dachte. Sit-amun schien dem hinter ihr Sitzenden durchaus zugetan zu sein, denn wann immer es ging, berührte sie ihn beiläufig, wie es eben zufällig in einem lebhaften Gespräch geschehen kann. Mutnedjmet quälte ihre Mutter mit ständig derselben Frage, nämlich ob sie ihrem Zwerg nicht doch den Schurz abnehmen dürfe und Amenhotep plauderte angeregt mit seiner Großmutter, die er so viel erzählen ließ, dass sie kaum zum Essen gekommen war. Ani gab ihm einen vorsichtigen Wink, was Amenhotep zunächst verärgerte. Als er aber verstand, worauf er aufmerksam gemacht werden sollte, drehte er sich zu Ani um und blinzelte ihm anerkennend ins Gesicht. Im selben Moment bemerkte Ani, dass der Gute Gott ihn die ganze Zeit beobachtet hatte - und wurde rot. Ohne sich auch nur im Geringsten darum zu scheren, ob denn etwa die Umsitzenden seine Worte ebenfalls hören konnten, beugte sich Pharao zu seiner Frau. „Der neue Diener da, den Amenhotep heute angebracht hat, der scheint mir einen guten Einfluss auf den Jungen zu haben. Muss ich schon sagen.“
„Ja, mein Herz“, entgegnete Teje. „Dasselbe habe ich eben auch gedacht.“ Sie nickte heftig. „Noch ein Täubchen?“
Ani meinte zu glühen und versuchte verzweifelt, irgendwohin zu sehen – in eine der Fackeln vielleicht oder ein Öllämpchen -, wo er soviel Ablenkung zu finden hoffte, dass er nichts mehr von all dem Gerede um sich herum wahrnehmen würde. Er konnte und wollte sich nicht anmaßen, die göttlichen Menschen zu belauschen - und dabei auch noch ihre Worte und ihr Verhalten auszudeuten. Andererseits hatte er gerade eben erst wegen seiner Aufmerksamkeit Amenhoteps Anerkennung bekommen. Er begriff nun, warum Amenhotep ihn brauchte: Er sollte das zweite paar Augen und Ohren in seinem Rücken sein. Ani sollte dem Prinzen als aufrichtiger Freund mit all seinen Sinnen und all seinem Verstand beistehen. Und das war er ihm schuldig. Er, der hier bei den Göttern stand, um ihnen zu dienen und ihr irdisches Dasein zu verschönern. Er hätte schon genauso gut von einem Nilpferd zerquetscht, von Straßenkötern zerfleischt oder von einem Betrunkenen erschlagen worden sein können, wenn ihm nicht Amenhotep von seinem Schiff herunter die Hand gereicht hätte. Mehr denn je hatte Ani das Gefühl, seinem eigentlichen Schicksal entronnen zu sein. Und doch, so überlegte er, was würde es letzten Endes bedeuten, wenn er umdächte und somit heute erst sein eigentliches, sein wahres Leben begonnen habe.
Die dröhnende Stimme des Guten Gottes riss Ani aus seinen Betrachtungen. „Ihr Lieben! Ihr wisst es längst, warum ich euch alle heute Abend geladen habe. Aber dennoch freue ich mich, euch jetzt ganz offiziell mitteilen zu können, dass mein Erstgeborener und der Erbe meines Thrones, Prinz Thutmosis, vom Fleische meiner Majestät wie vom Fleische der Großen königlichen Gemahlin Teje mir seine Braut vor Angesicht gestellt hat, die er zu heiraten gedenkt: Nofretete, die Tochter des Eje, des Vorstehers der Pferde und Schwagers meiner Majestät, Bruder der Großen königlichen Gemahlin, Teje, von seinem Fleisch und dem Fleische der gerechtfertigten Mut-nofret, meiner königlichen Schwester, mit der ich Vater und Mutter gemeinsam hatte und die schon bei den Göttern weilt. Wenn im nächsten Jahr im Monat Mehir während des zweiten Peret die Sonne am tiefsten steht, soll die Hochzeit sein. Die Vorhersagen der Astrologen empfehlen dieses Datum. Von einer früheren Vermählung wird abgeraten.“ Und an die Brautleute gewandt fuhr er fort. „Liebe Kinder, ich wünsche euch stets eine Fülle von Achtung und Zuneigung, die ihr einander schenkt. Und lasst die Liebe wachsen, wenn sie wachsen will. Deine Mutter, Thutmosis, und ich haben unsere Ehe, wie ihr ja alle wisst, von hinten aufgezäumt. Bei uns war die Liebe zuerst und ließ erst später die Achtung und Zuneigung wachsen. Wir hatten Glück, dass unsere Liebe stark genug war, dass sie dies und noch so vieles mehr ertragen konnte. Kein Herrscher dieses Landes kann sein Amt ausfüllen, wenn er nicht einen Menschen an seiner Seite hat, dem er voll und ganz vertrauen kann, der sein zweites Ich ist, der ihn spiegelt und ergänzt. Niemand ist geeigneter für diese schwere Aufgabe als Nofretete, die schon seit Jahren vorbereitet wird auf ihr Amt als Große königliche Gemahlin. Sie ist eine Zierde dieses Hauses, sie ist eine Zierde ganz Ägyptens und der Ruhm ihrer Schönheit möge nie verblassen.“
Es wurde herzlich applaudiert und alle rannten durcheinander und küssten und beglückwünschten sich. Allein der Gute Gott blieb schmunzelnd auf seinem Thron sitzen und gab schließlich Aha ein Zeichen, woraufhin alle Instrumente auf einmal einsetzten und plötzlich eine Riege der allerhübschesten Tänzerinnen über die Terrasse wirbelte. Einmal mehr war Ani sprachlos über den schieren Überfluss an Schönheit, der hier bei Hofe versammelt war. Teje setzte sich seufzend neben ihren Mann: „Schon wieder ein Ballett.“ Sie versuchte, so auszusehen, als ob sie sich bemühte, ihre Langeweile zu verbergen. Ani war beeindruckt von ihren schauspielerischen Fähigkeiten. Pharao war’s hingegen einerlei. Er hatte nur Augen für die Tänzerinnen, die er eine nach der anderen mit wissenden Blicken liebkoste. Kaum war die Musik zu Ende, erhob er sich, was natürlich ein ungeheures Durcheinander verursachte, da alle Anwesenden sich ebenfalls erheben mussten. Er verabschiedete sich kurz und knapp, indem er etwas von Verpflichtungen murmelte, die niemandem den Abend verderben lassen sollten. Teje begleitete ihn ins Haus zurück, kam aber sogleich wieder.
„Ist er denn noch immer ein so hungriger Stier?“, fragte Mutemwia missbilligend. „Sein Vater war genauso. Der Harem kam gar nicht mehr zur Ruhe.“
„Denk aber bloß nicht, dass er ausgehungert dort hingeht“, lachte Teje. „Wir hatten heute Mittag erst ein wenig Freude aneinander. Aber jetzt, am Abend muss es eben unbedingt was anderes sein. Los Kinder“, Teje klatschte in die Hände. „Wir können auch ohne euren Vater fröhlich sein und feiern. Aha, lass deine Leute etwas Heiteres spielen. Und du, Thutmosis, kümmere dich endlich einmal um deine schöne Braut.“
Thutmosis drehte sich zu Nofretete um. „Na, Braut. Wie soll ich mich denn um dich kümmern?“
„Am liebsten höflich“, sagte Nofretete nett und verbindlich. „Wie vereinbart. Ich bin dazu da, an deiner Seite zu stehen. So, wie deine Mutter an deines Vaters Seite steht. Es ist meine Aufgabe, dir zu helfen und dich zu unterstützen, wo immer es mir möglich ist. Und dafür - habe ich Respekt verdient.“
„Dieser gelangweilte Schnösel!“ zischte Amenhotep Ani ins Ohr. „Da hat er die schönste Frau der Welt und die intelligenteste noch obendrein und er behandelt sie wie irgendeine Dienerin. Ich würde sie ehren, ihre Schönheit und Klugheit tagtäglich preisen, wenn ich an seiner Stelle wäre. Auf Lotusblüten und Rosen würde ich sie betten.“ Als hätte sie seine Worte gehört, blickte Nofretete Amenhotep ins Gesicht und lächelte kaum merklich, senkte aber schnell wieder ihre Augen.
„Was ist nur mit deinem Bruder los“, fragte Mutemwia und zupfte Amenhotep am Arm. „Ich werde aus dem Jungen einfach nicht schlau. Er müsste glücklich sein, solch eine Frau an seine Seite gestellt zu bekommen. Aber dein Großvater war auch so. Erst als ich deinen Vater geboren hatte, erwachte seine Liebe zu mir.“
„Großmutter“, Amenhotep wurde ganz aufgeregt, „hast du die neuen Reliefs gesehen, die Vater im Tempel des Amun hat anbringen lassen?“
„Du liebe Güte!“, Mutemwia verdrehte die Augen. „Ich habe mir davon erzählen lassen. Gesehen habe ich sie noch nicht.“
„Er berichtet darin, wie er von Gott Amun und dir gezeugt wurde.“ Amenhotep zitierte: „Also verwandelte Gott Amun sich in ihren Gatten, den König von Ober– und Unterägypten, Thutmosis. Er fand Mutemwia ruhend in der Schönheit des Palastes. Sie erwachte durch den Geruch des göttlichen Dufts und schrie auf. Er ging direkt auf sie zu und tat, was immer er mit ihr tun wollte.“
„Nun ja“, meinte Mutemwia augenzwinkernd, „ein wenig anders habe ich es schon in Erinnerung. Geschrieen habe ich jedenfalls nicht.“ Sie lachte. „Diese Inschrift ist nichts weiter als eine politische Notwendigkeit. Die Amun-Priester können sich ja wohl kaum gegen den leiblichen Sohn ihres finstren Gottes wenden. Dein Vater hat das sehr geschickt angestellt. Es wird Zeit, dass mit diesen Ränkeschmieden ein für alle Mal aufgeräumt wird! Wir Frauen der Mut hatten wahrlich schwere Zeiten, seit Tetischeri mit Hilfe der Amun-Priester die Restauration Ägyptens eingeleitet hat. Damals war noch längst nicht entschieden, ob Amun über der Göttin Mut steht. Aber man hat sie zu einer Gemahlin Amuns erniedrigt und ihre Anhänger nach Achmim vertrieben. Erst als unsere Ahnin Mut-nofret mit dem Usurpator Thutmosis I. den späteren Pharao Thutmosis II. gezeugt hatte, waren sie wieder in der ihnen gebührenden Rolle als Gottesmütter anerkannt. Fast hätte Hatschepsut es ja geschafft, dass sich zukünftig auch Frauen als Herrscher durchsetzen können. Und jetzt?“ Mutemwia richtete sich auf. „Jetzt ist meine Nichte Teje, die Tochter meines Bruders Juja und seiner Gemahlin Tuja, die Große königliche Gemahlin des Pharao. Sie ist ihm Auge, Ohr und Mund. Nichts in der Außenpolitik des Landes hätte Bestand ohne sie. Und die Tochter meines Neffen Eje, des Bruders der Großen königlichen Gemahlin Teje, wird zur Großen königlichen Gemahlin des zukünftigen Pharaos.“ Mutemwia sah Amenhotep forschend an. “Und du, mein Liebling, wirst eines Tages Mutnedjmet ehelichen, Ejes andere Tochter, damit die Göttlichkeit der Frauen der Mut ein für alle Mal festgeschrieben wird.“
Amenhotep verzog das Gesicht. „Das dumme, eitle Ding. Schau sie dir doch nur an, Großmutter. Sie ist nur an Schmuck und Kleidung interessiert. Und an Zwergen aus dem Lande Kusch. Man würde es kaum für möglich halten, dass Nofretete und sie Schwestern sind.“
„Halbschwestern, wohlgemerkt“, verbesserte ihn Mutemwia. „Als Ejes Frau Mut-nofret, die Schwester deines Vaters, bei Nofretetes Geburt starb, war der Arme vollkommen verzweifelt und einsam. Aber Eje wäre nicht Eje, wenn er nicht eine passende Lösung gefunden hätte. Keiner spricht darüber“, Mutemwia beugte sich wie eine Verschwörerin zu Amenhotep hinüber, „aber es gibt Grund zu der Annahme, dass Eje dem Schicksal kräftig nachgeholfen hat. Nahm er doch seine Base Tij bei sich auf, damit sie Nofretete als Amme diente. Sie hatte erst kurz zuvor auf unerklärliche Art und Weise ihr Kind verloren, das aus einer so unbotmäßigen wie illegitimen Beziehung entsprungen war. Tij mag etwas einfältig sein, aber sie liebt Nofretete wie ihre eigene Tochter und hat sie auch entsprechend großgezogen. Dafür war Eje ihr ewig dankbar und nahm sie schließlich zur Frau. Man mag es kaum glauben, aber er liebt das schlichte Seelchen aufs Innigste. Und seit sie ihm Mutnedjmet geboren hat, ist er überglücklich und verzieht das Kind zu einem rechten Fratz. Da steht dir also etwas bevor, mein armer Amenhotep!“
„Vielleicht hätte ich ja Thutmosis noch überreden können, dass er statt Nofretete Mutnedjmet zur Ehefrau nimmt“, überlegte Amenhotep. „Sie würde so viel besser zu ihm passen. Und Nofretete zu mir.“
„Pst, mein Liebling“, Mutemwia nahm Amenhoteps Hand. „Das darfst du noch nicht einmal denken, kommt es doch Hochverrat gefährlich nahe.“
Ani war vollkommen verwirrt. In seiner Naivität hatte er immer geglaubt, dass allein die Zuneigung darüber entscheiden würde, wer mit wem das Leben teilte. Aber hier im königlichen Palast gab es offenbar andere, wichtigere Gründe. Er sah, wie Nofretete und Amenhotep versteckte Blicke austauschten und einander anlächelten. Aber Ani bemerkte auch, dass Thutmosis ihre Blicke gesehen hatte und schubste Amenhotep schnell wie aus Versehen an. Der drehte sich verärgert um. Doch zu spät … Wortlos reichte Thutmosis der hinter ihm sitzenden Nofretete seine Katze und ging zu Amenhotep hinüber. „Also von mir aus kannst du sie haben“, sagte er leise zu seinem Bruder, „die Schöne, die da gekommen ist. Vater wird aber kaum mit sich reden lassen, denke ich, hat man sie doch intensiv auf ihre Rolle als Große königliche Gemahlin vorbereitet. Man erwartet sich allenthalben viel von ihr.“
„Sie ist klug und unendlich schön, Bruder“, erwiderte Amenhotep. „Eine Zierde für das Große Haus. Ja, eine Zierde für das ganze Land. Du kannst froh und stolz darauf sein, sie an deiner Seite zu haben.“
„Wenn schon.“ Thutmosis machte sich daran, zu seinem Sessel zurückzukehren und wandte sich noch einmal um. „Wahrscheinlich bin ich es nur, der hier fehl am Platze ist.“ Nachlässig ließ er sich auf seine Sitzgelegenheit fallen und schnipste, ohne sich umzudrehen, mit den Fingern nach Nofretete. „Katze!“, meinte er einsilbig. Und da Nofretete seinen Befehl überhört zu haben schien und sich weiterhin zärtlich um das behaglich schnurrende Fellknäuel in ihrem Schoß kümmerte, wiederholte er mit scharfer Stimme: „Katze! Na los, gib sie mir!“
„Ach, Thutmosis, so lass sie mir doch noch ein wenig“, bettelte Nofretete. „Schau nur, wie zufrieden sie schlummert und schnurrt. Sie fühlt sich wohl bei mir.“
„Die Katze her!“ Thutmosis’ Stimme hatte einen herrischen Ton angenommen.
„Du bist hier nicht auf dem Exerzierplatz, mein künftiger Gemahl.“ Nofretete blieb standhaft. Aber da alle schon nach ihr sahen, versuchte sie um des lieben Friedens willen, das Kätzchen von ihrem Schoß zu nehmen. „Sieh nur, Thutmosis! Sie möchte bei mir bleiben. Sie hat sich richtiggehend festgekrallt im Stoff meines Kleides.“ Mit ausgefahrenen Krallen und einem armseligem Miauen versuchte die Katze hartnäckig, ihre Vertreibung von Nofretetes Schoß zu verhindern.
„Du sollst mir meine Katze wiedergeben!“ Schon war Thutmosis aufgesprungen und funkelte Nofretete an. Als er sah, wie sehr das Kätzchen sich wehrte, packte er es unsanft im Nacken und riss es derart brutal von Nofretete weg, dass ihr Kleid Fäden zog. Die Katze maunzte erbärmlich und wand sich in seinem Griff. Sie schlug sogar nach ihrem Peiniger und hinterließ blutige Kratzer auf seiner Hand. „Du kleines Mistvieh“, brüllte der wie von Sinnen. „Ich werde dir zeigen, was es heißt, meine Wünsche zu missachten!“ Thutmosis holte weit aus und schlug das Kätzchen gegen die nächstbeste Wand. Es gab ein seltsames klatschendes und knirschendes Geräusch und in seinem Todeskampf zappelte, bog und wand sich das Tier, so dass alle entsetzt aufschrieen. Thutmosis griff erneut zu und schleuderte die Katze abermals gegen die Wand. Und da das Tier noch immer zuckte und sich sterbend auf den Boden übergab, holte er mit dem rechten Fuß aus und trat wie in einem Blutrausch auf sie ein. Immer und immer wieder. Als sie endlich reglos liegen blieb, gab er ihr einen letzten Tritt, so dass sie abermals gegen die Wand prallte und schließlich mit verdrehten Gliedmaßen liegen blieb.
Das Entsetzen verschlug allen die Sprache, während Thutmosis mit blutverschmierten Sandalen wieder auf seinem Sessel Platz nahm und wortlos vor sich hin starrte. Eje war der Erste, der sich von seinem Schreck erholt hatte. „Nun, ich denke, es ist an der Zeit, dass wir aufbrechen.“ Seiner Frau Tij liefen die Tränen über die Wangen und Mutnedjmet war das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Ihr Zwerg zitterte am ganzen Leib, denn offenbar befürchtete er, dass dies eine übliche Umgangsart mit niedriggestellten Kreaturen bei Hofe war. So schnell als irgend möglich gingen Eje und seine Familie ins Haus zurück, wohin Teje sie zum Abschied begleitete. Schnell war sie wieder zurück auf der Terrasse, hob die tote Katze auf und legte sie wortlos in Thutmosis’ Schoß. Eine Weile blieb sie schweigend stehen. Schließlich gab sie ihm eine schallende Ohrfeige. „Noch bist du nicht Pharao“, herrschte sie ihn an. „Und ich frage mich, ob es überhaupt wünschenswert ist, dass du diese schwere Bürde eines Tages übernehmen sollst. So“, rief sie den anderen zu und klatschte in die Hände, „die Vorstellung ist zu Ende. Es tut mir leid, dass dieser schöne Abend so enden musste.“ Einer nach dem anderen verließen ihre Kinder mit ihren Dienern im Gefolge die Terrasse. Und als Ani Amenhotep folgte, der seine Großmutter untergehakt hatte, um sie zu ihrer Sänfte zu begleiten, konnte er sehen wie Thutmosis tränenüberströmt die tote Katze auf seinem Schoß streichelte. „Ta-miat“, schluchzte er, „ich habe es doch nicht so gemeint!“
„Ich bin erschüttert“, sagte Mutemwia nachdem sie in ihrer Sänfte Platz genommen hatte. „Ich fürchte, ich werde heute Nacht kein Auge zutun. Pharao wird morgen eine Entscheidung treffen müssen, denn der Mord an einer Katze außerhalb eines Tempels gilt als Kapitalverbrechen! Und wie er schließlich die Göttin Bastet besänftigen möchte, wage ich mich gar nicht zu fragen. Ach mein Liebling“, meinte sie zum Abschied zu Amenhotep, „ich hoffe nur, dass dein Bruder uns nicht alle noch ins Unglück stürzen wird. Er macht mir manchmal Angst.“ Und mit diesen Worten verschwand sie auf ihrem Tragstuhl in den Fluren des Palastes.
Mit gesenktem Kopf ging Ani neben Amenhoteps Sänfte her. „Nun kennst du sie ein bisschen besser, meine ehrenwerte Familie“, sagte Amenhotep tonlos. „Dass dieser Tag aber auch so enden musste …“
Kaum waren sie vor seiner Wohnung angelangt, sprang Amenhotep aus seiner Sänfte und schickte die Träger fort. Noch hatte er die Türe nicht vollständig geöffnet, als Subira ihn schon in die Arme nahm. „Mein armer Junge“, sagte sie sanft, „Was für schreckliche Dinge doch geschehen.“
„Ach“, entgegnete Amenhotep. „Es hat sich also schon herumgesprochen.“ Und zu Ani gewandt meinte er: „Du siehst, nirgendwo verbreiten sich Neuigkeiten so schnell wie im königlichen Palast. Mein Vater wird sicherlich noch heute Nacht von den Vorgängen erfahren. Und dann kann ich nur für Thutmosis hoffen, dass er seinem König und Vater nicht allzu bald unter die Augen kommt. Lass uns schlafen gehen, Ani. Es war ein langer Tag und du wirst mindestens ebenso müde sein wie ich. Was du heute alles, an diesem einen Tag erlebt hast, erleben andere Menschen nicht in ihrer ganzen Lebenszeit.“ Amenhotep legte Ani die Hand auf die Schulter. „Schlaf gut jetzt. Morgen früh werde ich dich holen lassen, damit wir dann gemeinsam in den Unterricht gehen können, wie mein Vater es angeordnet hat.“ Mit müden Augen blinzelte er Ani an, nickte ihm zum Abschied zu und verschwand in seinem Schlafgemach.
Als Ani die ihm zugewiesene kleine Wohnung betrat, sah er, dass Merit-amun auf ihn gewartet hatte. „Was? Du schläfst noch nicht?“, fragte er erstaunt.
„Es geziemt sich nicht, für eine Dienerin zu schlafen, solange ihr Herr noch wach ist“, sagte Merit-amun mit sanfter Stimme und befreite Ani von seinem Schmuckkragen. „Wünschst du noch ein Glas Sauermilch?“
„Wasser, nur noch ein wenig Wasser für die Nacht“, entgegnete er geistesabwesend, genoss er doch das nie gekannte Gefühl, dass jemand auf ihn gewartet hatte. Auch, wenn es nur eine Dienerin war.