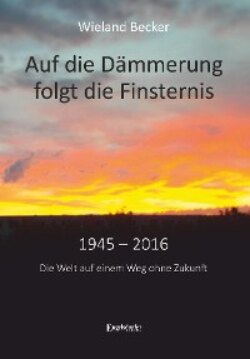Читать книгу Auf die Dämmerung folgt die Finsternis - Wieland Becker - Страница 6
I. Momente des Nachdenkens
ОглавлениеWenn vom Vereinten Europa in politischen Erklärungen oder medialen Betrachtungen die Rede ist, lese oder höre ich vom Euro, von Wirtschaft, Sicherheit, Abschreckung, Krisen und Nationalismus u. a., aber so gut wie nichts von Kultur und Kunst. Es gab Zeiten, an die ich mich noch gut erinnere, da galten auf der einen Seite Kunst und Kultur als identitätsprägend gerade in ihrer Vielgestaltigkeit, aber auch in ihren nationalen und internationalen Wirkungsmöglichkeiten im freien Austausch von Gedanken, Ideen, Hoffnungen und Enttäuschungen. Gerade in den Zeiten des Kalten Krieges konnten – allen Sanktionen oder Pressionen zum Trotz – die politischen Grenzen überwunden werden. Es sagt aus meiner Sicht viel über den Zustand des europäischen Projekts aus, auch wenn ich weiß, dass es viele Initiativen an der Basis und einige Events gibt, Austausch von Schülern und Jugendlichen, ebenso wie Verlage, die weltoffen Bücher von Autoren aus aller Welt verlegen. Aber das reicht nicht aus. Besonders deshalb nicht, weil es die eigentlich überflüssige Debatte über die „Deutsche Leitkultur“ eine nationalistische Gesinnung offenbart, der dem regionalen wie dem universellen Charakter der deutschen Kulturlandschaft widerspricht, sondern die Kultur zu einem Leitinstrument machen will. Mal abgesehen davon, dass Kultur ungeeignet ist, geistig-kulturelle Entwicklungen leiten zu können. Leitungsfunktionen gehören zur Politik und wenn sie auf ein anderes Nationalgefühl aus ist, dann muss die es selbst schaffen. Kultur kann dafür nicht in die Pflicht genommen werden.
Es ist seit grauen Vorzeiten ein ewiger Streit um den angeblichen Gegensatz von Kunst und Unterhaltung – zwischen hohem Anspruch und trister Trivialität. Dem entgegen zu stellen ist, dass Kunst unterhalten will und kann und Unterhaltung anspruchsvoll zu sein vermag. Es ist noch nicht lange her, als ich mir mal wieder die Programme von über 50 deutschsprachigen TV-Sendern betrachtete. Deutschsprachig sind sie natürlich alle, ihre Programme sind ein „Mix“ deutscher und amerikanischer (synchronisierter) Filme und Serien, die offensichtlich die einzigen „Produkte“, die würdig sind, dem Zuseher präsentiert zu werden. Gelegentlich sind auch britische, kanadische oder französische Filme oder Serien im Angebot. Im Kino sieht nicht anders aus, auch wenn kommunale Kinos und Spielstätten oder Programmkinos ein alternatives Angebot präsentieren. Mit Blick auf den Film der europäischen Länder, kommt man zur Erkenntnis, dass offensichtlich der einstige „Eisernen Vorhang“ noch immer existiert. Exemplarisch dafür steht zum einen die Entsorgung der Filmgeschichte von den Filmen der östlichen Hemisphäre, vom Werk Andrej Tarkowskis oder Larissa Schepitkos, „einstmals“ zwei sowjetische Regisseure von Weltbedeutung, gleichermaßen gilt das für drei der international wichtigsten polnische Künstler Andrzej Wajda, Andrzej Munk und Krzystof Kieslowski, und so kann es nicht mehr verwundern, dass selbst ein in Ost und West weithin bekannter ungarischer Regisseur wie István Szabó keiner Erwähnung wert ist. Gut, man kann sich gut dahinter „verschanzen“, dass Film halt vor allem eine Art Wirtschaftsgut darstellt, das sich rechnen oder Quoten bringen muss. Wechselt man in die Literatur dürfte die Bilanz kaum weniger einseitig ausfallen. Betrachtet man die aberhundert tagtäglichen Sendeplätze der Sender, die mit hunderten miserablen Filmen made in USA bestückt werden, darf man fragen, ob es wirklich unmöglich sein soll, einen bescheidenen Beitrag zur Präsentation des Films der Mitglieds-Staaten der EU zu leisten. Schließlich preisen diese Medien das offenkundig kulturfreie aber wunderbare Werk der europäischen Gemeinschaft. Nicht dass ich wirklich überrascht war, schließlich habe ich die Erfahrung, wie man – ungewollt – zum „Weltenwanderer“ werden kann, als ich – ohne mich selbst bewegen zu müssen – von der östlichen in die westliche Welt „gewandert“ wurde. Unbestreitbar deshalb, weil die östliche Welt in sich zusammengebrochen war, das einmalige aber auch zugleich wirklich letzte Verdienst ihrer politischen Führungen. Aber deshalb Kunst und Kultur einer ganzen Epoche zu entsorgen und weiterhin zu ignorieren?
Dass die erwähnte Überraschung derart gering war, ergab sich aus einer anderen nachhaltiger Erfahrung: Eine der hervorstechenden Eigenheiten dieser westlichen Welt ist, dass sie sich in Permanenz vor allem mit sich selbst beschäftigt und sich in der Regel gleichermaßen feiert. Deshalb fehlt es an Interesse an Kunst und Kultur anderer Regionen. Ebenso ist sie weder willens noch fähig, die ungeheuer groß Not der Welt und deren Ursachen zu sehen. Nicht etwa weil sie mit Blindheit geschlagen ist, sondern weil sie diese Not und ihre Ursachen – sehend – nicht wahrnimmt. Es ist übrigens völlig gleichgültig, ob Arroganz und/oder Ignoranz die Gründe dafür sind. Aber schon immer galt die „Formel“: Wer ein politisches bzw. gesellschaftliches System für vollkommen hält, befindet sich schon längst im Niedergang. Eine Erkenntnis, die 1989 mit dem Ende der sozialistischen Staaten ihre bislang letzte Bestätigung erfuhr.
Angesichts dieser „triumphalen“ Selbstgefälligkeit der westlichen Demokratien und dem fatalen Fehlen an Vorstellungen zu Zukunfts-Aufgaben und –Planungen von einer friedlicheren und gerechteren Welt, konnte der Titel dieses Buches nicht anders lauten, als „Auf die Dämmerung folgt die Finsternis“ (wobei ich um Verständnis bitte, dass dieser auf mein früheres, weithin unbekanntes Buch „Abenddämmerung im Westen“ Bezug nimmt). Es wäre auch wichtig, sich an die Erkenntnis „Wer kein woher hat, hat kein wohin“ zu erinnern. Die nicht zuletzt darauf aufmerksam macht, dass jede Analyse der Gegenwart ohne die Verknüpfung mit vergangenen Ereignissen und Erfahrungen unzulänglich bzw. unbrauchbar ist, gerade wenn es um die zukünftigen Wege geht. Deshalb müsste die Geschichte der Jahrzehnte nach dem Ende des II. Weltkrieges und nach dem Ende der Konfrontation der zwei dominierenden Machtblöcke endlich frei von allen Vorurteilen, die in der einstigen „bipolaren“ Welt meinungsbildend waren, aufgearbeitet werden. Mit dieser Arbeit soll dazu ein Beitrag geleistet werden. Es erscheint mir aber ein eigentlich aussichtsloses Unterfangen zu sein, nach der dramatischen, gewaltfrei herbeigeführten Wende von 1989 zu erklären versuchen, warum man – also auch ich – im Projekt Sozialismus lange Zeit einen Weg in eine bessere Zukunft sah. Trotzdem muss es versucht werden, darüber zu berichten, welche Gründe es dafür gab. Sicher erkannte man früher oder später, dass die gesellschaftlichen Entwicklungen zur Deformation der ursprünglichen Idee geführt haben. Die eigenen Hoffnungen auf eine „Wende“ hin zur Besinnung auf einen „Sozialismus mit menschlichen Antlitz“ ging irgendwann endgültig verloren. Ob die Idee selbst gescheitert ist, bleibt trotz aller Zweifel offen. Sicher war und ist dagegen, dass sie auf unabsehbare Zeit bedeutungslos als alternative Zukunfts-Gestaltung geworden ist.
Da es inzwischen „Pflicht“ geworden ist, jeden, der es „wagt“, die USA grundsätzlich zu kritisieren, Antiamerikanismus zu unterstellen, versichere ich freiwillig, dass die USA das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ war und ist, das beispielhaft für den technischen Fortschritt steht, herausragende Wissenschaftler, Politiker, Künstler hervorgebracht hat, also ein Land ist, dass Kritik nicht zu fürchten braucht.