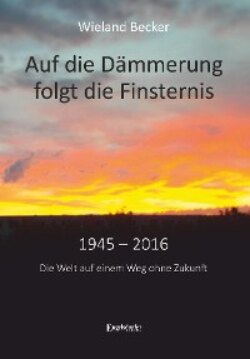Читать книгу Auf die Dämmerung folgt die Finsternis - Wieland Becker - Страница 7
II. Vorbemerkungen
ОглавлениеIn fernen Zeiten galt es Bericht zu geben, von großen Mächten, von wackeren Helden und erschütternden Ereignissen – in Erzählungen, Heldenliedern, Sagen oder Legenden. Aus diesen erfuhren die Nachkommenden vom Kampf des Guten gegen das Böse, von den einsamen Streitern für Gerechtigkeit, von Liebe und Tod, von Treue und Verrat, von Widerstand und Intrigen. Nicht immer siegte das Gute oder der selbstlose Streiter für Gerechtigkeit, ebenso oft triumphierte das Böse. Selten waren die Gesänge über den Alltag der einfachen, zumeist armen Menschen, die keinen Platz an der Tafel der Reichen hatten, aber ihr Leben lang hart arbeiten mussten. Die Vorfahren derer also, die auch heute ihr Brot mit all ihren Kräften verdienen müssen. Auch wenn der Fortschritt längst die Welt zum Besseren umgestaltet haben soll, betrifft das in Wahrheit nur einen kleinen Teil der Menschen. Der größere Teil lebt in Verhältnissen, die der Fortschritt bis heute nicht erreicht hat, auch wenn er als Hightech-Bohrturm oder als monströses Hochhaus neben den Hütten der einfachen, armen Leute steht. Anstelle der „analogen“ ist die „digitalisierte“ Welt getreten; gepriesen schlechthin als die „Informationsgesellschaft“ – in der tatsächlich Informationen in nicht mehr vorstellbaren Unmaß zur Verfügung stehen. Ob die Menschheit wirklich besser informiert ist, erscheint allerdings immer unwahrscheinlicher. Anstelle eines differenzierenden Wissens, das aus Meinungen und Gegenmeinungen gebildet wird, ist ein einseitiges, reduziertes Konglomerat von Kenntnissen getreten, wo nur noch nach dem gesucht wird, was diese Kenntnisse bestätigt. Oder nach einem Glauben, einer Religion, die die Vielfalt der Informationen „ordnet“. Wenn dazu noch „gepredigt“ wird, dass „die Zukunft schon heute“ sei, dann zählt die Zukunft in Wahrheit gar nichts mehr. Alles bleibt, wie es ist, wenn es nicht noch schlechter kommt…
Vergessen sind die einstigen großen Versprechungen auf eine bessere, vor allem gerechtere Welt aus den Frühzeiten des Christentums, des Bürgertums mit „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ und des ursprünglichen Kommunismus, der gleiche Rechte und Pflichten in Sinne einer neuen Gerechtigkeit erkämpfen wollte. Am Ende zählte immer aufs Neue allein die Macht der wenigen über die vielen.
Inzwischen scheint der globale Wandel von 1989 irgendwie ziemlich lange her zu sein. Immer weniger Erdbewohner können oder wollen sich noch erinnern, dass sie in einer bipolaren Weltordnung gelebt haben. Auf der einen Seite die westliche kapitalistische Welt, die ihre alleinige Führungsrolle durchsetzen wollte und sich auf Demokratie, Menschenrechte und vor allem auf die Freiheit berief, auf der anderen die östliche sozialistische Welt, die sich auf die Idee einer gerechten Welt – in der die Arbeitenden herrschten – berief. Diese beiden Lager setzen oft auf Konfrontation gelegentlich auf Koexistenz – die Gefahr eines dritten nuklearen Weltkriegs war latent. Auch wenn dieser ausblieb, war die Zeit mit beiden Systemen alles andere als friedlich. Vor allem das westliche System war stetig bereit, für seine Interessen auch auf das Militär zu setzen. Es kam auf fast allen Kontinenten zu mörderischen Bürgerkriegen, Militärputschen, Aufständen… Das östliche System galt für seine „Herrscher“ als das Modell, dem allein die Zukunft gehörte und deshalb gültig für die gesamte Welt wäre. Trotzdem oder deshalb waren sie unfähig zu erkenne, dass ihre Welt sich wirtschaftlich im Niedergang befand, immer weiter erstarrte und verkrustete, während sich das eigene Volk erst abwandte und sich schließlich erhob, um ihre Herrschaft mit dem Jahr 1989 zu beenden. Kein Zweifel, selbst der Westen hatte nicht damit gerechnet. Aber die herrschenden Eliten nahmen gern zur Kenntnis, dass ihr größter Gegner sich in Nichts auflöste. Sie sonnten sich in dem Gedanken, dass sie endlich allein über den Erdball herrschten. Dass damit eben auch eine weitaus höhere globale Verantwortung verbunden war, fand in den strategischen Planspielen der politischen Führungen keinen Raum. Den einstig Entwurf einer sozialen Marktwirtschaft war schon vor dem Jahr 1989 durch einen Paradigmenwechsel zur uneingeschränkten Freiheit der Märkte aus der Welt geschafft mit Wesenskern und Triebkraft des ordinären Kapitalismus, dem Streben nach maximalem Profit, lange, bevor das neue Jahrtausend begann.
Der große Entwurf des neuen Weltbildes westlicher Strategen orientierte sich zweifellos am Aufbau des Universums. Die westliche Welt war also die neue „Sonne“, um die sich die anderen Staaten als Satelliten bewegten. Den Denkern war natürlich klar, dass sich ein Teil dieser Satelliten auf einer von der „Sonne“ eingeforderten Bahn bewegte, andere dagegen nicht. Es gab also viel zu tun, um diesen mit allen Mitteln klar zu machen, dass sie sich der „Sonne“ zu unterwerfen hätten. Mit dem neuen Jahrtausend sah sich – unerwartet – das westliche Weltbild ernsthaft infrage gestellt, als zwei übergroße „Gestirne“ zurückkehrten und anfingen, sich auf den Weg ins „Zentrum“ zu machen, um die Geschicke der Welt entschieden mitzubestimmen. Da war die Empörung riesig, und fast umgehend fiel der Westen zurück in das gerade überwundene alte Denken der Ost-West-Konfrontation. Zuvor erbrachte die „Disziplinierung“ von widerspenstigen vor allem islamischer Staaten bereits ein neues offenkundig notwendiges Feindbild. Ein Feindbild, was immer dann ins Feld geführt wird, wenn Demokraten und Menschenrechtsschützer ihre Forderungen mit Waffengewalt durchzusetzen willens sind.
Aus der universellen „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ die 1948 verkündet wurde, wurden die Menschenrechte zu einem Privileg der westlichen Welt erhoben. Das Bekenntnis, alleiniger Wahrer der Menschenrechte zu sein, führte zur Postulierung einer moralischen und kulturellen Überlegenheit gegenüber allen anderen, die im krassen Gegensatz zur ursprünglichen Universalität steht. Vielleicht wäre es hier sinnvoll, auf einen „Dualismus“ hinzuweisen, dass es nicht allein um Menschenrechte, sondern gleichermaßen um Menschenpflichten gehen müsste. Wenn ein Mensch oder gar eine Gesellschaft das Recht auf Toleranz einfordert, dann sollte für dieselben auch die Pflicht zur Toleranz verbindlich sein. Wer – wie die westliche Welt – von anderen die Einhaltung der Menschenrechte verlangt, sollte eigentlich beispielhaft sein. Entgegen aller Deklarationen, blieb die westliche Welt den Beweis dafür oft mehr als schuldig.
Die Eskalation militärischer und paramilitärischer Gewalt im Namen von Demokratie und Freiheit mit ihren verheerenden Konsequenzen war und ist kein Thema kritischer oder selbstkritischer Analysen der westlichen Eliten in Politik, Wirtschaft und Publizistik. Aber genau das ist ein schwerwiegendes Symptom eines systemischen Niedergangs, ganz abgesehen von der Frage, welche existenzbedrohenden Lasten den anderen Ländern der Welt aufgezwungen wurden. Und letztlich bleibt die Frage aller Fragen: Gab es wirklich nur diesen Weg in eine westlich dominierte unipolare Welt?
Zwei Hinweise zum folgenden Text sind an dieser Stelle angebracht: Wie man so schön sagt, folgen die Darstellungen in den einzelnen Abschnitten im Prinzip der Chronologie der Ereignisse mit unregelmäßigen Ausnahmen, wenn diese über erheblich längere Zeiträume andauerten.
Als zweiter Hinweis muss hier notiert werden. Ein neues Zitatenrecht fordert bei längeren Zitaten die Genehmigung von Verlagen bzw. Urhebern. Bei Nichtbeachtung kann geklagt werden. Der Sinn dieser Regelung erscheint dunkel, schafft aber Raum für eine neue Art „Zensur“. Wer „Belege“ für Kritik an seinen Äußerungen verhindern will, hat nun alle Möglichkeiten. Der Autor sieht sich deshalb gezwungen, anstelle von Zitaten, die in der Fußnote zu belegen wären, „indirekt“ den Autor zu Wort kommen zu lassen, den er eigentlich lieber wörtlich zitiert hätte.