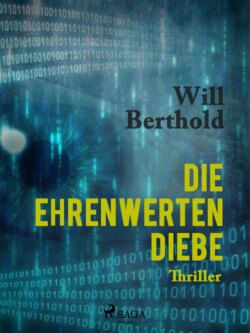Читать книгу Die ehrenwerten Diebe - Will Berthold - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеEs war noch nicht einmal acht Uhr, und das Telefon schlug an wie ein Kettenhund.
Ich nahm den Hörer nicht ab, ich hatte gerade festgestellt, daß die Leitung über Nacht angezapft worden sein mußte, und ich brannte darauf zu erfahren, wem ich diese Aufmerksamkeit zu verdanken hatte.
In diesen Dingen kenne ich mich aus.
Der Untergrund ist mein Fach, eine stumme, hinterhältige Front mein Metier. Dabei bin ich weder Kriminalist noch Agent, noch Spion, noch Detektiv.
Eigentlich bin ich nur ein Privatmann.
Das Klingeln verstummte, der Sprechautomat mußte sich jetzt eingeschaltet haben, und meine Stimme würde vom Tonband leiern:
»mike fabian ist zur zeit ausser haus. sie können eine nachricht hinterlassen. danke für ihren anruf. das gerät schaltet nach dreissig sekunden ab. bitte sprechen sie jetzt …«
Die Abhörvorrichtung war ein winziges Kästchen an der Unterseite des Telefongerätes. Wann immer ich angeläutet wurde, klingelte es auch bei meinem Gasthörer. Er konnte ganz in der Nähe oder auch über Hunderte von Kilometern Entfernung meine Gespräche belauschen oder auf Tonband aufzeichnen.
Ich hatte solcherlei Spielereien oft genug selbst etabliert.
Meine Freunde, Partner und Klienten mieden grundsätzlich mein Telefon und nutzten es nur im äußersten Notfall als eine Art Lockruf.
Ich ging ins Bad, um mich zu rasieren. Ich bin ein Morgenmuffel, und so mußte ich erst sehen, wie ich die Augen aufbekam. Nach einer Weile bemerkte ich, daß ich vergessen hatte, das Licht über dem Wandspiegel einzuschalten.
Ich holte es nach und musterte verdrossen mein verschlafenes Konterfei:
Graue Augen. Volle Haare. Kein Fett und wenig Falten. Daß ich 42 war, ließ sich nicht leugnen. Ich stand in dem Lebensabschnitt, in dem nach einem gängigen Schlagwort unserer Zeit die Midlife Crisis drohte – und ich war noch immer Junggeselle. Ich bin weder ein Kostverächter noch ein Hagestolz, und manchmal träume ich von der Ehe wie ein Falschmünzer vom Geld. Aber es lag an den Umständen, daß ich mehr in Frankfurt, Bonn, Düsseldorf, London, Rom, Paris und New York anzutreffen war als in meinem hübschen Bungalow über dem Ostufer des Starnberger Sees.
Obwohl mir vor gut zehn Jahren zwei Patente gestohlen worden waren, hätte ich von den übrigen drei gut und gerne leben können – aber für einen Privatier war ich doch wohl noch ein wenig zu jung.
Ich war immer schon ein neugieriger und ehrgeiziger Bursche gewesen. Und so hingen meine Titel Dr. jur. und Dipl.-Ing. wie ungetragene Maßanzüge im Schrank.
Ich hatte besessen an einer Idee gearbeitet, an einem Tonbandgerät, das weder Netz noch Batterie als Energiequelle benötigen, sondern als eine Art Selbstversorger über Solarzellen den Strom aus dem Sonnenlicht beziehen sollte.
Fünf harte Jahre lang war ich mit diesem Problem schlafen gegangen und wieder aufgestanden, unter Verzicht auf die Freuden des Lebens.
Als ich vor dem Ziel gestanden hatte und zwei entscheidende Patente anmelden wollte, mußte ich feststellen, daß mir ein Dieb zuvorgekommen war.
Ein ungetreuer Mitarbeiter hatte sich von ihm einkaufen lassen, ihm meine theoretischen und praktischen Berechnungen überlassen, und so stand ich mit leeren Händen vor dem Patentamt und mußte noch gegen den Ruf ankämpfen, ein Plagiator zu sein.
Niemals fand ich mich damit ab – und so begann meine zweite Laufbahn. Ich wurde ein Wirtschafts-Kriminalist, arbeitete in einem Grenzbereich der Legalität, in dem sich Polizei und Staatsanwaltschaft nicht selten die Zähne ausbeißen. Ein Niemandsland von Manipulation und Spekulation ist der Tummelplatz der ehrenwerten Diebe, der steifen Gentlemen mit den blütenweißen Kragen und den geschönten Lebensläufen. Das Repertoire der gutgetarnten White Collar-Täter reicht von der Bestechung über die Erpressung bis zum Mord.
Ich hatte Erfolg. Ich fiel auf. Man hörte mich als Sachverständigen bei Patent-Prozessen. Und hinter verschlossenen Türen beriet ich die Spitzenmanager der Industrie, wie sie sich gegen unlautere Machenschaften abschirmen könnten. Nach Expertenschätzung arbeiten in der Bundesrepublik mindestens 1500 ausländische Industrie-Spione; es können genausogut 3000 sein. Nach einer weiteren Annahme von Sachverständigen verliert allein die deutsche Industrie durch die Ausspähung von Konstruktions-Unterlagen, Produktions-Verfahren, Marketing-Konzeptionen, Export-Offensiven und geplanten Neuentwicklungen alljährlich drei Milliarden Mark; es können genausogut sechs Milliarden sein.
In Klartext übersetzt bedeutet das, daß Schmarotzer der Wirtschaft den Erfolg aus dem Mark saugen und dabei Hunderttausende von Arbeitsplätzen gefährden. Von Steuer-Delikten will ich hier gar nicht reden, sondern das Thema mit der Feststellung abtun, daß jeder von uns nur die Hälfte an Rabenvater Staat abführen müßte, wenn alle Bürger steuerehrlich wären.
Das Leben hatte mir ein Spezialgebiet zugewiesen. Ich wurde Einzelgänger in einem Untergrund, der nicht ungefährlicher ist als die militärische Spionage.
Ich sah durch die große Panoramascheibe auf den See. Ein schöner Tag. Schon früh am Morgen waren Segler und Wasserskiläufer unterwegs. Gegenüber auf dem Platz in Feldafing tummelten sich die ersten Golfer, aber während ich das Tonband meines Telefon-Automaten zurückspulte, wußte ich bereits, daß es für mich heute weder Wassersport noch Rasenspiel geben würde; heute so wenig wie gestern und noch weniger als morgen.
»Siebener«, meldete sich eine feste Stimme. »Erbitte dringenden Rückruf.«
Der Anrufer war der Leiter des Referats ZS im Bundeswirtschaftsministerium, das so etwas wie ein Überwachungsamt für geheime Staatsaufträge ist.
Wenn ein so hoher Beamter kurz vor acht Uhr morgens persönlich anrief, dann war die Sache heiß und ein neuer Fall nicht weit.
In meiner Garage standen vier Autos, nicht aus Notwendigkeit, es war ein Hobby.
Die meisten Flitzer lieh ich mir bei den Automobilwerken, mit denen ich häufig zusammenarbeitete, einfach aus; ich hatte nun einmal Freude ander Geschwindigkeit und am technischen Fortschritt.
Nicht nur bei Automobilen.
Mein ganzes Haus war mit Robotern bestückt, und viele davon hatte ich selbst entworfen und gebastelt, zum Beispiel einen stummen Diener, der automatisch Staub saugte und auf Knopfdruck in die Küche stelzte, um die Spülmaschine anzustellen.
Unter meinen Produkten gab es viele überflüssige Spielereien, aber die Sicherungsanlage rings um meinen Bungalow entsprach fast der Tresor-Abschirmung einer Großbank.
Wer immer in mein Haus eingedrungen war, um meine Telefonleitung anzuzapfen – er mußte ein ebenbürtiger Gegner sein. Freilich konnte er nicht wissen, daß ich mir ein Telefongerät dreimal anzusehen pflegte, bevor ich es einmal benutzte.
Vielleicht ginge die Reise über Land. Ich wählte den schweren Jaguar, fuhr am Ostufer des Starnberger Sees entlang, erreichte über Percha die Autobahn nach München, stellte fest, daß ich nicht verfolgt wurde, und trat das Gaspedal durch.
In wenigen Minuten erreichte ich den Stadtrand von München, verließ den Mittleren Ring, zwängte meinen Wagen durch ein Gewirr kleiner Gassen und fand eine Telefonzelle, die von Häusern wie von Wächtern umstellt war.
Ich läutete Bonn an; die Geheimnummer des Ministerialrats hatte ich im Kopf; ich konnte unter Umgehung des Vorzimmers direkt mit ihm sprechen.
»Es brennt«, sagte er in seiner knappen Art. »Können Sie die Maschine um neun Uhr einundzwanzig nach Köln-Wahn noch erreichen?«
»Mit etwas Glück«, entgegnete ich.
»Ich habe einen Platz für Sie gebucht«, schloß er das Gespräch. »Mein Fahrer wird Sie abholen.«
Ich fuhr zügig zum Flughafen München-Riem und rollte dabei mitten in mein vorderhand interessantestes Abenteuer.
Am Flugplatz passierte ich die üblichen Kontrollen zum Schutz vor Luft-Piraterie, ungeduldig, doch gefügig ließ ich sie über mich ergehen: Schließlich sollte der Düsenriese auf dem deutschen Regierungsflughafen und nicht in der Wüste hinter Amman landen.
Ich stapfte über das Rollfeld, kletterte über die Bodentreppe in den gedrungenen Rumpf der Maschine, schnallte mich an und las eine Tageszeitung. Ich kam nicht weit.
Hübsche, wippende Beine irritierten mich, sie waren lang und wirkten irgendwie melodiös, mustergültig geformt, und sie wuchsen aus hochhakkigen Schuhen schier endlos nach oben.
Die Sitzlehnen beschnitten mein Blickfeld, ich konnte nur die Beine sehen, die im Mittelgang auf und ab gingen, flott, stelzend, überlang.
Sie mußten der Stewardeß gehören, von der sonst nichts zu sehen war.
Unvermittelt beugte sich ein lächelndes Gesicht über mich.
»Tag, Mike«, sagte die dunkelhaarige Bordfee mit den tiefblauen Augen. »Freut mich, daß wir wieder einmal miteinander fliegen.«
»Ganz meinerseits, Ellen«, sagte ich zu der Stewardeß vieler Flüge und Bekannten einiger Drinks in den Vertragshotels der Lufthansa. »Ich konnte dich nicht an deinen Beinen erkennen. Entweder lassen meine Augen nach, oder es gibt zu viele hübsche …«
»Das muß ja richtig beinlich sein für einen Mann«, erwiderte die Stewardeß lachend und ging weiter.
Der Jet donnerte über die Zementpiste, die Schnauze bohrte sich schräg in den Himmel, die Boeing ging auf Kurs.
Keiner meiner Mitreisenden trug ein bekanntes Gesicht.
Ich war ziemlich sicher, nicht beschattet zu werden.
Seit gut zehn Jahren sammelte ich diesbezügliche Erfahrungen, so häufig, daß ich zu einem As der industriellen Spionage-Abwehr geworden war.
Über die Schlachten dieser heißen Front schweigen die Zeitungen, denn es kommt fast nie zu Gerichtsverhandlungen. Falls man aber doch über die Täter in den weißen Hemden zu Gericht sitzt, kommen oft lächerliche Strafen heraus.
Die Situation will es, daß die Justiz mit veralteten Gesetzen gegen den modernsten Zweig des Verbrechens vorgeht. Während den Männern auf der Anklagebank ein ganzes Arsenal raffinierter elektronischer Erfüllungsgehilfen zur Verfügung steht, kämpft Justitia noch immer mit Pfeil und Bogen.
Alljährlich werden zwischen den Alpen und der Nordsee an die 50000 Wanzen verkauft, wie man die Abhörgeräte nennt: Es gibt in Kugelschreiber eingebaute Mikrofone, ganze Spionage-Koffer, Wanzen im Aschenbecher, Hochleistungs-Mikrofone mit einer Betriebsdauer von 150 Stunden auf eine Entfernung von 250 Metern. Mehr als zwei Dutzend Händler haben sich auf den Verkauf von Mini-Spionen spezialisiert und sichern sich durch das Kleingedruckte ab:
Der besteller wird darauf hingewiesen, dass in der bundesrepublik mikro-elektronik-geräte ohne export- und ausfuhr-nach-weis erworben, jedoch nicht in betrieb genommen werden dürfen.
Auf deutsch heißt das: Wasch mich, aber mach mich nicht naß.
Und so kam zum Beispiel Bundesanwalt Felix Kaul zu der Feststellung, daß die ehrenwerten Diebe heute in der Lage sind, ›das gesamte wissenschaftliche und technische Potential der Bundesrepublik auszuforschen‹.
Schon bei einem meiner ersten Aufträge – die deutsche Tochterfirma eines US Chemie-Giganten hatte sich an mich um Hilfe gewandt – stellte ich fest, daß durch den Diebstahl eines neuen antibiotischen Medikaments dem Konzern ein unwiederbringlicher Schaden von hundert Millionen Dollar entstanden war.
Seitdem hetzten mich die Aufträge.
Ich reiste kreuz und quer.
Meine Spesen waren üppig, doch Geld interessierte mich weniger als ein gespenstisches Phänomen unserer Zeit. Eine Seuche, ansteckend wie die Pest, grassierend unter dem Motto: Die Konkurrenz schläft nicht, die Konkurrenz spioniert.
Ich stieß auf eine russische Denkschrift, in der behauptet wurde, daß die westliche Welt an der Industrie-Spionage zugrunde gehen würde.
Ich erlebte aber auch, daß auf Kongressen Amerikaner und Russen Schulter an Schulter gegen den Verrat ihrer technischen, elektronischen, chemischen und biologischen Geheimnisse kämpften.
Ich will mich nicht bescheidener geben als ich bin: In dieser unsichtbaren Drecklinie wurde ich zu einer Kapazität, fast zu einer Institution. Ich machte Fabrikmauern undurchsichtig, ich beriet die Unternehmer, wie sie Forschungslabors gegen die Außenwelt abschirmen, wie sie Experimentier-Werkstätten schalldicht und kamerablind machen könnten.
Bei allen meinen Fällen stand ich auf dem Boden des Gesetzes, auf der Seite der Bedrängten.
Wenn ich auch bei der Wahl meiner Methoden nicht gerade zimperlich bin – ein bißchen Michael Kohlhaas ist immer dabei.
Mein seltsamer, selbstgewählter, faszinierender und verdammter Beruf forderte mir freilich eine harte Diät vom Leben ab: Keine Familie. Wenig Freunde. Noch weniger Frauen und für die wenigen Freunde und noch weniger Frauen am wenigsten Zeit.
Wir flogen mit Rückenwind, eine Schönwetterbrücke trug uns, sechs Minuten vor der Zeit landeten wir in Köln-Wahn.
Ich verabschiedete mich mit sanftem Bedauern von Ellen, stapfte durch die Sperre und erkannte unter den Wartenden den Fahrer von Siebener.
Er ging stumm voraus, ich folgte ihm.
Er hielt den Wagenschlag, er wußte, daß ich vorne neben ihm Platz nehmen würde, und erst als ich mich gesetzt und die Tür geschlossen hatte, begrüßte er mich: »Guten Tag, Herr Fabian.«
Er sprach kein Wort mehr auf der Fahrt nach Bonn.
Er bog in den Hof des Ministeriums ein, stieg aus:
»Ich darf Sie zum Herrn Ministerialrat …«, lud er mich ein.
Der Mann geleitete mich nicht in das Büro Siebeners, sondern in einen der abhörsicheren Räume, die es jetzt fast in allen Bonner Ministerien gab. Dem Laien mögen solcherlei Maßnahmen übertrieben, ja sogar ein wenig lächerlich vorkommen, aber amerikanische Firmen sind längst dazu übergegangen, zerlegbare Konferenzräume zu schaffen, die vor wichtigen Besprechungen Millimeter um Millimeter durchröntgt werden.
»Fein, daß ich Sie erreicht habe«, begrüßte mich der hohe Beamte. »Sie kennen Herrn von Kettener?«
Als mir der Generaldirektor der ELUX-Werke die Hand reichte, wußte ich, daß es sich bei diesem Auftrag um eine elektronische Erfindung handeln mußte, mein ganz spezielles Fachgebiet.
»Die Hamburger ELUX-Werke haben sich mit einem Hilferuf an das Bundes-Wirtschaftsministerium gewandt«, erläuterte Siebener. »Wenn wir diese mysteriöse Geschichte nicht in den Griff bekommen, droht der deutschen Export-Wirtschaft unübersehbarer Schaden.«
Ich wußte, daß der Ministerialrat einer der fähigsten Bonner Beamten war, trotzdem überraschte mich sein rascher, präziser Vortrag:
Unter der werksinternen Bezeichnung XYZ-Gerät war der erfolgreichen Hamburger Firma in Zusammenarbeit mit einem amerikanischen und einem englischen Partner eine bahnbrechende Erfindung geglückt: ein billiges, exaktes Radargerät, das sich in jedes Kraftfahrzeug einbauen ließ und das, gekoppelt, mit Lenkung und Bremsen, künftig Zusammenstöße so gut wie unmöglich machen würde.
Eine Revolution der Verkehrssicherheit.
Ein Vorgriff auf die Welt von morgen. Wenn man weiß, daß sich jedes Jahr auf der Welt Millionen von Verkehrsunfällen ereignen und die alljährlichen Todesopfer des Straßenverkehrs eine Stadt wie Frankfurt bevölkern könnten, war es klar, wie revolutionär die ELUX-Entwicklung sein würde. Weltweit müßte man sich um das Patent reißen und es in Gold aufwiegen.
»Diese Erfindung, die wir von Staats wegen fördern«, erläuterte Siebener, »nennen wir sie einmal Auto-Radar, ist längst aus dem Experimentierstadium heraus. So sind die ELUX-Werke gerade dabei, die Patentschrift zu erstellen.«
Damit war, und das wußte ich aus eigener Erfahrung, der kritische Punkt einer jeden Erfindung erreicht. Die Patentämter in allen Ländern der Welt arbeiteten zwangsläufig langsamer als Gottes Mühlen und keineswegs gründlicher.
Wenn dem rechtmäßigen Erfinder Einzelheiten des beantragten Patents gestohlen wurden, konnte ein Konkurrent ihm mit dem Lizenz-Antrag zuvorkommen oder die Patentierung auf Jahre hinaus verzögern.
»Wir wissen mit Sicherheit«, übernahm jetzt der Vorstandsvorsitzende der ELUX-Werke das Wort, »daß wichtige Einzelheiten des XYZ-Gerätes bereits in unbefugte Hände geraten sind.«
»Woher wissen Sie das?« unterbrach ich ihn.
»Wir haben schon seit Monaten energische Sicherungen eingeschaltet. Ich darf Ihnen sagen, daß das Bundeskriminalamt, daß Spezialisten aus Wiesbaden seit langem unsere Hausgäste sind. Daß unser Werkschutz ausgebaut wurde. Daß Sie in Deutschland der fünfte Mensch sind, der überhaupt von dieser Erfindung erfährt.«
»Die anderen vier?« fragte ich.
»Ministerialrat Siebener. Unser Chefkonstrukteur. Ein technisches Vorstandsmitglied und ich.«
»Und die übrigen Herren Ihres Vorstands?«
» … kennen nicht die Einzelheiten, wie sie bereits verraten wurden.«
Selbstlos und korrekt hatte sich der Generaldirektor sozusagen an die Spitze der Verdächtigen gesetzt, hatte freiwillig sein und seiner Kollegen Privatleben bis in die peinlichsten Einzelheiten durchleuchten lassen – ohne Befund.
»Und aus amerikanischen oder englischen Quellen können die Werkspione nicht schöpfen?« fragte ich.
»Ausgeschlossen«, erwiderte er. »Wir wissen, daß die verratenen Informationen aus Deutschland stammen – aus dem allerengsten Kreis von vormals vier und seit einer halben Stunde fünf Mitwissern.«
»Und warum haben Sie sich einen fünften Geheimnisträger geschaffen?«
»Weil Sie vielleicht der einzige sind, der uns noch helfen kann«, erwiderte Generaldirektor von Kettener. Mit einem fragilen Lächeln setzte er hinzu: »Verzeihen Sie – aber Sie sind doch ein Eierkopf mit Boxhandschuhen.«
»Danke für die Blumen«, ging ich auf seinen Ton ein, »und Vertrauen ehrt.«
»Wir haben uns da etwas einfallen lassen«, übernahm Siebener wieder das Gespräch. »Der Personalchef der ELUX-Werke erreicht demnächst die Pensionsgrenze. Sie werden als sein angeblicher Nachfolger eingearbeitet. Sie erhalten einen neuen Namen, feine Papiere, erstklassige Referenzen.« Der Ministerialrat bot uns Cognac und Kaffee an. »Kein Mensch – nicht einmal die Kriminalbeamten – erfährt Ihre wahre Identität.« Er lächelte ein wenig schadenfroh. »Ein ganz guter Test, nach beiden Seiten, nicht?«
»Schön«, erwiderte ich. »Ich fasse also zusammen: fünf potentielle Täter. Auf keinem lastet auch nur der Schatten eines Verdachts. Keine weiteren Mitwisser. Elektronische Spionage laut Feststellung des Bundeskriminalamts ausgeschlossen. Trotzdem Verrat am laufenden Band.« Ich zündete mir eine Zigarette an. »Stimmt das?«
»Exakt«, erwiderte Siebener.
»Wann erhalte ich die Papiere?«
»Wenn Sie wollen, heute noch«, erwiderte er.
»Stellen Sie solche bitte auch für meine Frau aus«, bat ich.
»Aber Sie sind doch Junggeselle«, wandte er überrascht ein.
»Nicht bei diesem Einsatz! Übrigens wird mein Telefon seit heute angezapft«, stellte ich fest. »Glauben Sie, daß es mit dieser Sache zusammenhängt?«
»Das möchte ich nicht annehmen«, entgegnete der Ministerialrat gedehnt. »Aber das werden wir gleich mal feststellen.«
Ich wußte, daß er Postfahndung, Bundeskriminalamt und, falls nötig, auch noch den Verfassungsschutz hinter dem Mann herhetzen würde, der seine Ohren in die falsche Hörmuschel hielt.
Ein wenig war ich schon gespannt, wie meine neue Frau aussehen würde, auch wenn es im Schlafwagenzug von München nach Hamburg keine Hochzeitsnacht geben könnte.
Ich wechselte bei jedem Fall meine Mitarbeiter aus, und dabei bemühte ich ziemlich regelmäßig den bekannten Fachjuristen Dr. Georg Brettner.
Er war ein Freund nach Maß. Ein erfolgreicher Patentanwalt, kein Papierwurm, sondern ein exzellenter Praktiker. Deshalb beschäftigte er eine Reihe von Leuten für Aufträge, wie sie nicht jeden Tag in einer Anwaltskanzlei vorkommen.
»Ich brauche eine Frau«, hatte ich am Telefon verlangt.
Das Gespräch lief über Verzerrer, ein dritter konnte es im Klartext nicht mithören. »Heute noch. Für etwa eine Woche.«
»Und hübsch soll sie sein?« fragte mich Georg.
»Womöglich«, antwortete ich. »Aber viel wichtiger wäre, daß sie intelligent ist.«
»Gut« erwiderte der Patentanwalt. »Ich schick’dir mein bestes Stück heute abend direkt an den Schlafwagen.«
Abteil 1 und 2 waren für Martin und Helga Bauer gebucht.
Ich gab dem Schlafwagenschaffner meine Fahrkarte und beantwortete seinen fragenden Blick: »Meine Frau kommt gleich. Sie kauft nur noch ein paar Zeitschriften.«
Ich sah einer hübschen großen Blondine entgegen, stellte fest, daß sie auf Abteil 1 zuging.
»Tag, Liebling«, begrüßte und küßte ich sie. »Du kannst ja sogar pünktlich sein.«
Wir schlossen die Türen, lachten lauthals und musterten uns ausgiebig. Wir fanden offensichtlich Gefallen aneinander. Das besagte persönlich gar nichts, war aber für den Auftrag nicht so unwichtig.
»Was hat Ihnen Georg über Ihren Einsatz gesagt?« fragte ich.
»Nur daß ich Ihre Frau bin.«
»Gratuliere«, sagte ich lachend. »Wird man mir eine so junge und hübsche Frau abnehmen?«
»Das ist doch zur Zeit die große Mode«, erwiderte sie lachend.
Der Schaffner klopfte an die Tür.
Ich setzte mich rasch neben Helga Bauer, alias Eva Steiner, rückte wie erschrocken ein wenig von ihr ab und sah zu, wie der Mann die bauchige Flasche Blauburgunder entkorkte.
»Prost, Helga«, sagte ich, als er gegangen war, »ist dir klar, daß wir uns duzen müssen?«
»Aber ja.«
»Arbeitest du schon lange für Dr. Brettner?«
»Nicht in dieser Weise«, erwiderte sie. »Eigentlich bin ich Referendarin. Keine Eltern mehr. Während meines Studiums war ich gelegentlich Babysitter. Jetzt versuch ich mich mitunter auch als Gelegenheits-Mannequin.«
»Sicher mit Erfolg«, erwiderte ich. »Wir brauchen eine Legende: Warum hast du mich geheiratet?«
Sie sah mich an, als betrachte sie mich zum erstenmal.
»Zwei Drittel Liebe«, erklärte sie lapidar, »ein Drittel Geld.«
»Einverstanden«, stimmte ich zu.
Dann leerten wir eine Pulle Rotwein so rasch, als müßten wir uns Mut für die Nacht antrinken.
Jeder hatte sein eigenes Abteil.
Die Verbindungstür stand offen.
Ich lag rauchend auf meinem Bett und hörte, wie sich meine angebliche Frau nebenan auszog. So verfänglich die Situation schien, schließlich war ich nur beruflich mit ihr verheiratet. Um diese Feststellung nebst Konsequenz kam ich nicht herum, aber ich war ein Mann, Adams Bruder, verdammt noch mal, und dadurch ein Schwein aus der Herde Epikurs, um mich klassisch auszudrükken, und das Geschlecht stellte nun einmal seine Anforderungen an den Mann. In gewisser Hinsicht reagieren wir Männer auf weibliche Reize alle gleich; es macht uns oberflächlich, aber ohne diese fatale Eigenschaft wären wir keine Männer. Ein Mann ist ein Individuum, das hinter Eva her ist wie ein Jagdhund hinter dem falschen Hasen, ohne zu begreifen, daß er ihn nie einholen wird.
Das Spiel kommt teuer: Vom Geld ganz abgesehen, zahlen wir zum Beispiel dafür mit einer um sechs Jahre verkürzten Lebenserwartung. Ich weiß nicht, ob ich mich schlaflos der Philosophie des Verzichts überließ, nur weil mir die Lage zur Wahl stellte, eine Situation auszunutzen oder eine Gelegenheit zu verschlafen.
Jedenfalls fand meine neue Assistentin ihre Rolle offenbar mehr erfreulich als beängstigend.
»Wie ist das mit dem Gutenachtkuß?« rief sie durch die offene Tür.
»Wird sofort erledigt, Liebling«, antwortete ich, stand auf, ging hinüber und küßte sie mit scheinheiliger Sachlichkeit.
»Du taugst wohl mehr zum Sherlock Holmes als zum Liebhaber«, sagte sie mit einem hintergründigen Lächeln.
»Alles zu seiner Zeit«, brummelte ich und ging durchaus unlustig in das Nebenabteil.
Ich konnte nicht schlafen: Vielleicht lag es an der Duftglocke, die im Abteil schwebte, ein Gemisch von Guerlain und Evas Haut. Außerdem schaukelte ich auf einem Achsenbett. Jedenfalls zählte ich die Bahnhöfe einzeln mit. Und am meisten ärgerte mich dabei, daß meine Begleiterin tief und sorglos schlief. Ich versuchte mich auf Hamburg zu konzentrieren, verglich ähnliche Fälle.
»Schläfst du schon?« fragte Eva alias Helga unvermittelt.
»Schön wär’s«, antwortete ich.
Sie kam in mein Abteil; sie trug ein gewisses Lächeln, ein durchsichtiges Nachthemd und die Haare offen. Sie stand auf hohen Absätzen, beugte sich zu mir herunter und fragte: »Hast du Feuer?«
»Aber ja«, entgegnete ich. »Hier, in meiner Jackentasche. «
»Du willst dir wohl nicht die Finger verbrenn nen?« versetzte sie.
»So ist es«, erwiderte ich. »Übrigens sollte man im Schlafwagenabteil nicht rauchen.«
»Man sollte überhaupt vieles lassen«, konterte sie und ging wieder zurück.
»Wolltest du mich provozieren?« rief ich hinüber.
»Testen«, sagte Eva lachend. »Du hast bestanden.«
Ich drehte mich auf die andere Seite und hoffte, daß meine morganatische Ehefrau über Nacht nicht auch noch meine traumatische werden würde.
Endlich schlief auch ich ein. Schon bald weckte uns der Schaffner mit dem Frühstück.
»Kommen wir also zur Sache«, wandte ich mich an meine Pseudo-Frau. »Erstens brauche ich dich als Staffage, doch kannst du mir auch sonst behilflich sein. Noch ein Brötchen?«
»Nein, danke.«
»Du besichtigst Werkswohnungen, die bald frei werden und in unmittelbarer Nähe des Fabrikgeländes liegen. Du erzählst überhaupt, wie verliebt du bist – verstell dich eben ein bißchen! – und daß wir bald Kinder haben wollen. Wieviel eigentlich?« unterbrach ich meine Anweisungen.
»Beginnen wir mit zwei«, erwiderte sie lächelnd.
»Gut«, meinte ich. »Ein Junge und ein Mädchen.« Wir lachten beide.
»Du redest mit den Leuten wie ein Wasserfall – wenn’s auch schwerfällt.«
»Wenn’s sein muß, bin ich eine richtige Plaudertüte«, erwiderte sie.
»In Ordnung: also Mund auf, Augen auf und viel Glück.«
Der Zug lief in Hamburg ein.
Wir nahmen ein Taxi. Ein Hotel brauchten wir nicht zu suchen, es war vereinbart, daß wir im Gästehaus der ELUX-Werke wohnen sollten.
Helga alias Eva spielte ihre Rolle mustergültig, und ich ertappte mich dabei, daß ich ihre Zärtlichkeiten erwiderte, ohne an meinen Auftrag zu denken – ich nahm mir einiges vor für die Siegesfeier, aber davon waren wir noch weit entfernt.
Die Herren, mit denen mich noch am Vormittag Generaldirektor von Kettener bekanntmachte, verhehlten nur sehr oberflächlich, daß sie mich für einen lästigen Eindringling und protegierten Parvenü hielten. Noch schlimmer ging es mir mit Kriminalkommissar Sperber, der wie ein Hamster aussah und die Polizeifahndung nach den Werkspionen leitete.
»Wo kommen Sie denn so plötzlich her?« fragte er und musterte mich wie ein ausgestopftes Krokodil.
»Steht alles in meinen Papieren«, erwiderte ich. »Im übrigen sollten Sie Ihre Manieren etwas aufbügeln lassen.
Normalerweise komme ich mit Kriminalbeamten sehr gut aus, aber mit Sperber verband mich keine Liebe auf den ersten Blick. Der Mann war verbittert, weil er nicht vorankam. Polizisten sind gewohnt, mit Dieben, Räubern, Einbrechern und Mördern umzugehen, aber nicht mit Straftätern, die als Rechtsanwälte, Marktforscher, Unternehmensberater, Werbefachleute, Steuerberater, Computer-Spezialisten und Börsen-Jobber auftreten und – vielleicht – zu den ehrenwerten Dieben gehören.
Hier ist der normale Kriminalbeamte hoffnungslos unterlegen. Um den White Collar-Tätern ebenbürtig zu sein, müßte er Wirtschaftswissenschaft, Juristerei und Ingenieurwesen zugleich studiert haben und dazu noch ein ausgebildeter Kriminalist sein.
Deutschlands größtes Versandhaus zum Beispiel hatte durch den Verlust seiner Kundenkartei einen Schaden von mehr als einer Million erlitten. Die Firma gab für private Ermittlungen über 300000 Mark aus. Die Spur führte zu einer Briefkastenfirma in Vaduz, die das von ugetreuen Mitarbeitern unterschlagene Material – Mikrofilme, Magnetbänder, Lochkarten und Geschäftskorrespondenz – auswertete und an eine Schmuckwarenfirma in Pforzheim verkaufte.
Sie konnte – Ausnahme der Regel – tatsächlich vom Gericht für den Schaden haftbar gemacht werden; aber nicht die an sich zuständige Polizei hatte den Fall gelöst, sondern hochqualifizierte und hochdotierte Privatfahnder, die sich das Versandhaus leisten konnte. Andere geschädigte Firmen konnten schon deswegen keine ähnlichen Untersuchungen anstellen, weil sie durch unlautere Machenschaften in den Konkurs getrieben worden waren.
Sperber trat auf der Stelle. Polizeiliche Routine rotierte längst im Leerlauf. Der Mann war froh, daß er etwas Neues zwischen den Zähnen hatte, und ich überlegte, wie lange er brauchen würde, um in mir den Konkurrenten zu entdecken. Jedenfalls war mir klar, daß er noch an diesem Tag meine Referenzen einzeln zerlegen würde.
Da der Personalchef ›erkrankt‹ war, besetzte ich sein Zimmer.
Obwohl ich mir zunächst nur die Akten der XYZ-Mitwisser vornahm, brauchte ich einen ganzen Tag, um mich durchzubeißen. Die Vernehmung, der sich die drei Vorstandsmitglieder freiwillig unterzogen hatten, war offensichtlich zu einer Zerreißprobe geworden: Kriminalkommissar Sperber hatte weder ihnen noch sich etwas geschenkt.
Der distinguierte, würdige Generaldirektor mußte zugeben, daß seine Ehe unter einer schweren Krise litt, weil er mit einer Freundin liiert war, die im Alter seiner jüngsten Tochter stand.
Der technische Direktor gestand Schulden ein, die aus einer verfehlten Aktien-Spekulation entstanden waren, zudem blieb die Affäre mit einer inzwischen längst entlassenen Sekretärin nicht verborgen.
Am peinlichsten war die Inquisition zur Probe für den Chefkonstrukteur verlaufen – ich kannte ihn dem Namen nach von zahlreichen Veröffentlichungen in Fachzeitschriften: Sein einziger Sohn verbüßte gerade in einer Strafanstalt eine dreijährige Gefängnisstrafe wegen Betrugs im Rückfall.
Handschriftliche Anmerkung eines Polizeibeamten: ›Ein Anruf bei der Gefängnisleitung hat ergeben, daß der Betreffende tatsächlich noch einsitzt.‹
»Ach, nein«, sagte Kriminalkommissar Sperber (er war eingetreten, ohne anzuklopfen), »das ist ja lustig. Sie wühlen in meinen Vernehmungsprotokollen, während ich mich mit Ihren Bewerbungsunterlagen befasse.«
»Würden Sie bitte das nächstemal anklopfen?« fragte ich ihn.
»Entschuldigen Sie«, erwiderte er. »Sie wissen doch, daß wir Polizisten ungehobelte Burschen sind.«
Vor allem wußte ich, wie gefährlich er war. Ich sollte erleben, daß er sich durchaus glatt und höflich zu benehmen wußte – er provozierte nur, wenn er seinen Gesprächspartner aus der Reserve locken wollte.
»Sie scheinen ja ein außergewöhnlich tüchtiger Mann zu sein«, kam der Polizeibeamte zum Thema. »Trotzdem hätte ich gern von Ihnen erfahren, welche Leiche Sie mit dem Generaldirektor im Keller haben?«
»Was heißt das?« fuhr ich ihn an.
»Sie wissen doch ganz genau, daß außer dem Hausherrn kein Mensch von Ihrem Eintritt in die Firma begeistert ist.«
»Das ist mir gleichgültig.«
»Ihre Frau kommt besser an als Sie«, fuhr er betont beiläufig fort.
»Immerhin.«
»Nur ist sie leider nicht Ihre Frau«, stieß er zu. »Jedenfalls weiß das Standesamt von keiner Traung.«
»Gut«, schaltete ich schnell. »Wir sind nicht verheiratet. Ist das ein Verbrechen?«
»Das nicht«, erwiderte er gedehnt, »aber doch eine Lüge – wenn nicht vielleicht doch ein Anstellungs-Betrug.« Er genoß seinen Triumph. »Und wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch …«
»Ich hab’ zu tun«, entgegnete ich mit gespieltem Ärger.
Die kleine Panne, die mir unterlaufen war, bewies mir nur, wie ausgezeichnet die von Generaldirektor von Kettener – unter Mitwirkung Siebeners – beschafften Unterlagen gewesen sein mußten.
Ich kam nicht weiter. Es erging mir wie Kriminalkommissar Sperber. Trotz meiner Fachausbildung verbiß ich mich in Nebensächlichkeiten – letztlich war es nur Beschäftigungs-Theorie.
Innerhalb des Werks gab es lediglich drei Mitwisser, und diese waren lupenrein. Wissentlicher Verrat schien auszuscheiden, also konnte es sich nur um unbewußten handeln.
Ich aß mit dem Generaldirektor im Kasino.
›Noch ein paar Fragen‹, sagte ich. »Die Herren des Vorstands nehmen hier täglich ihr Essen ein?«
»Fast immer«, entgegnete er.
»An einem Tisch?«
»Manchmal«, erwiderte er. »An sich wird ja selten über berufliche Dinge gesprochen, aber wenn man so aus den Sielen kommt, neigt man natürlich dazu, über seine Arbeit zu sprechen.«
Es gab Paprikaschoten, ich biß auf ein Pfefferkorn und schluckte es hinunter, spülte etwas Rotwein hinterher. Küche und Service waren übrigens ausgezeichnet. Der Kellner André, der uns bediente, hätte jedes Grandhotel geziert.
»Zahlen Sie denn so gut, daß Sie sich ein so hervorragendes Personal leisten können?«
»Die meisten sind schon sehr lange bei uns, und mit André haben wir einfach Glück gehabt.«
Wir erhoben uns, ich begleitete den Genereddirektor in sein Büro, eigentlich nur, um ihm meinen Mißerfolg einzugestehen.
»Wie weit ist Ihr Patent eigentlich schon in unrechte Hände geraten?«
»Wichtige Einzelheiten wurden verraten«, erwiderte er. »Aber ich darf annehmen, daß das Herzstück unserer Erfindung …«
Wir begegneten meiner klatschsüchtigen Leih-Frau.
»Was Neues?« fragte sie.
»Nein«, antwortete ich, »das heißt eigentlich …«
Sie hatte Angst, sich lächerlich zu machen, aber vielleicht war sie doch auf einen Hinweis gestoßen: In einer Wohnung öffnete man ihr nur zögernd, wobei sich eine Frau wie erschrocken einen riesigen Kopfhörer vom Schädel riß.
»Und wo war das?« fragte ich rasch.
»Kopernikusstraße 16.«
Wir gingen in das Büro des Generaldirektors, er wollte sich die Wohnungs-Unterlagen kommen lassen und sah unwillig dem eintretenden Kriminalkommissar Sperber entgegen.
Der Mann schoß auf mich zu, baute sich auf: »Ich eröffne Ihnen, daß Sie vorläufig festgenommen sind.«
»Ach nein«, antwortete ich.
»Und nun erklären Sie mir, wo Sie Ihren Sender versteckt haben!« fuhr er mich an.
Der Hausherr wollte eingreifen, um das Mißverständnis aufzuklären, aber ich winkte ihn mit den Augen zurück.
»Hören Sie sich das einmal an«, fuhr der Kriminalbeamte fort.
Er stellte ein Taschentonbandgerät auf den Schreibtisch. Und auf einmal quäkte meine Stimme:
»Noch ein paar Fragen.« Nach einer kurzen Pause fuhr ich fort: ›Die Herren des Vorstands nehmen hier täglich ihr Essen ein?‹
»Das sind doch Sie«, sagte Kommissar Sperber.
»Allerdings«, erwiderte ich trocken. »Wo ist das nächste Krankenhaus?«
»Wieso?« fragte er entgeistert.
»Kommen Sie!« forderte ich ihn auf.
Ich hatte die Lösung des Rätsels gefunden.
Wir rasten los. Es ging um Minuten. Ich war entschlossen, mir auf schnellstem Weg den Magen auspumpen zu lassen. Ich erinnerte mich plötzlich an das Pfefferkorn, auf das ich gebissen hatte.
Es war eine scheußliche Prozedur, aber sie half.
Eine Stunde später – inzwischen wußte Kriminalkommissar Sperber natürlich längst, wer ich war – hatten wir einen Mini-Mini-Sender in der Hand, sozusagen eine Magen-Wanze.
»Sehen Sie«, sagte ich. »Das ist das ganze Geheimnis. Irgend jemand schmuggelt unseren Geheimnisträgern diese übrigens hinreißend und völlig neuartig konstruierten Mikrofone in den Leib. Das Sendehaus im eigenen Bauch. Und irgendwo in der Nähe sitzt dann ein Kerl am UKW-Empfänger und registriert aus vielen kleinen Einzelheiten das große Ganze. Kapiert?«
»Und ob«, erwiderte er. »In ein paar Stunden liefere ich Ihnen die Täter.«
Er hielt Wort.
Den vorbildlichen Kellner André schnappte er als ersten. Der Mann war deswegen am verdächtigsten, weil er erst die kürzeste Zeit im Kasino arbeitete. Er wurde durch die Mangel gedreht und nannte die Namen seiner Komplizen, die noch am gleichen Tag in der Kopernikusstraße 16 festgenommen werden konnten.
Die Täter spionierten im Auftrag eines ausländischen Konzerns, der das XYZ-Patent an sich reißen wollte.
»Sie haben uns einen ungeheuren Dienst erwiesen«, verabschiedete mich Generaldirektor von Kettener.
»Nicht ich«, erwiderte ich. »Wir haben einfach Glück gehabt.«
Wir fuhren zurück.
Helga hieß wieder Eva, und die Verbindungstür zwischen unseren Abteilen war geschlossen. Was meine Assistentin anbelangte, bedauerte ich ein wenig, daß der Fall so rasch geklärt worden war. Ich überreichte ihr einen üppigen Scheck. Sie bedankte sich, damit trennten sich eigentlich unsere Wege.
»Werden wir uns einmal wiedersehen?« fragte ich beim Abschied.
»Überlassen wir es doch dem Zufall«, erwiderte sie lächelnd.
»Vorsicht«, sagte ich. »Ich handle mit Zufällen.«
»Fürchtet ihr den bösen Mann?« erwiderte sie, und ich sah ihr nach, als sie mit lässigen Schritten auf das Taxi zuging.
Kurze Zeit später kam die nächste Überraschung: Ein Kriminalbeamter, der öfter mit mir zusammengearbeitet hatte, teilte mir mit, daß mein Telefon von einem gewissen Färber angezapft worden sei.
»Kennen Sie den Mann?« fragte er.
»Nein.«
»Wir stellen gerade fest, wer er ist«, entgegnete der Beamte.
Ich hatte eine Vorahnung, daß diesmal nicht der Fall auf mich, sondern ich auf den nächsten Fall zukommen würde …