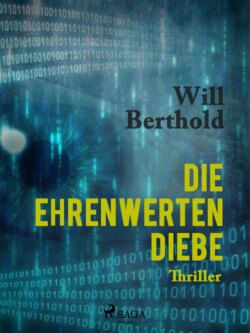Читать книгу Die ehrenwerten Diebe - Will Berthold - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеEigentlich ging mich die Sache nichts an, aber wie immer stellte mir die Neugier ein Bein, und so stolperte ich bereitwillig in meinen nächsten Fall. Abenteuer ist mein täglich Brot, aber selbst in meiner Branche war diese Geschichte einmalig.
Die Polizei lieferte mir frei Haus einen Täter, aber ich wußte nicht, welches Delikt er plante. Irgendwo gab es eine Firma, die mich dringend brauchte, aber ihr Hilferuf mußte versickert sein.
Ich war meinen Gegenspielern vom Start weg um einen Zug voraus und tappte dabei noch völlig im dunkeln.
»Färber heißt der Mann, der Ihr Telefon angezapft hat«, sagte Kriminalkommissar Niebler und setzte in seinem typischen Telegrammstil hinzu: »Also Färber, achtundzwanzig, gelernter Elektrotechniker, arbeitet nicht. Hat aber Geld. Jedenfalls gibt er an wie drei Hochstapler zusammen.« Der Kriminalbeamte war untersetzt, korpulent. Man sah ihm die Wendigkeit nicht an, die sein Handwerkszeug war.
»Und wie haben Sie diesen Burschen so schnell gefunden?« fragte ich.
»Na ja«, gestand er mit einer Spur Widerwillen. »Eigentlich durch einen Zufall. Ein Postbeamter hatte ein schlechtes Gewissen und vertraute sich seinem Abteilungsleiter an – der Rest war reine Routine.«
Also Färber hatte sich in einer Kneipe mit einem Bauarbeiter der Bundespost angefreundet und ihn überredet – angeblich einer Wette wegen –, ihm kurzfristig Uniform und Dienstwagen zu überlassen. Meine neue Haushälterin – sie war noch nicht eingearbeitet – hatte ihn für einen Beamten des Störungsdienstes gehalten und bereitwillig in mein Haus am Starnberger See eingelassen. So einfach sind mitunter Dinge, die man sich nicht erklären kann.
»Weitere Informationen über diesen Färber?« fragte ich.
»Soviel Sie wollen«, erwiderte Niebler. »Der Mann war früher in der Entwicklungshilfe tätig.«
»Wo?«
»Irgendwo im Nahen Osten. Nähere Einzelheiten folgen. Dann lebte er eine Weile in Frankfurt. Vor einer Woche ist er nach München gezogen, hält sich in einer Schwabinger Pension auf, lebt von Frauen oder von Verbrechen. Oder von beidem.« Der Kommissar entnahm seiner Brieftasche ein Foto, reichte es mir. Er hatte überlange Arme, so daß seine Hände wie verkümmert wirkten. Aber dieser Eindruck war trügerisch. Der Mann war gewohnt, beidhändig zuzugreifen.
Das Foto zeigte ein hübsches leeres Gesicht, leicht blasiert und schon ein wenig verlebt.
»Sein Revier ist das Dachschwimmbad im Hotel Bayerischer Hof«, fuhr der Beamte fort. »Da finden Sie ihn fast jeden Nachmittag. Mädchen sind ihm lieber als Frauen, aber er nimmt, was er bekommt. Liebt feines Essen. Trägt Maßanzüge und ist passionierter Pfeifenraucher.« Niebler steckte das Foto wieder ein. »Sie können sich vorstellen, daß ich mir diesen Burschen gern vorknöpfen würde. Aber wie ich Sie kenne, stellen Sie wieder keinen Strafantrag.«
»So ist es«, erwiderte ich.
»Aber der Mann wollte doch schließlich nicht nur Ihr Liebesleben belauschen«, entgegnete Niebler gereizt.
»Liebesleben ist gut«, antwortete ich, »aber Weihnachten ist öfter.«
Wir hatten schon oft und nicht erfolglos zusammengearbeitet, wiewohl seine Prinzipien mit meinen Praktiken haderten.
Färbers sportive Nachmittagsbeschäftigung war eine erstklassige Gelegenheit, ihn unauffällig kennenzulernen. Vielleicht sollte auch ich einmal wieder schwimmen, ohne dabei baden zu gehen.
Er vollbrachte gerade einen mustergültigen Kopfsprung – ich erkannte ihn sofort; er war der Typ, der auf alles flog, was sich bewegte. Hübsche Badenixen führten ihre Reize vor, und die Herren in den Jahren, die man die besten nennt, weil die besseren vorbei sind, zogen den Bauch ein und sahen verdrossen zu Aldo Färber, der ihnen den Flirt stahl.
Vielleicht hatte man diesem Kopfspringer auch mein Foto gezeigt, deshalb wollte ich mich nicht über Gebühr sehen lassen, aber Färber hatte nur Augen für die Mädchen, und das zu Recht:
Ein Rudel gut gewachsener Nixen lächelte und plätscherte, zeigte viel Haut und wenig schlechte Laune. Kein Wunder, daß nicht nur das Wasser hohe Wellen schlug.
Ich versteckte meinen Kopf hinter einer Zeitung und merkte, daß die Bikini-Mädchen meine Gedanken durcheinanderbrachten, weil sie mich an Versäumnisse erinnerten.
Natürlich hatte ich gelegentlich einen Anlauf in das Privatleben unternommen, doch fast immer versperrte mir ein neuer Fall den Reiseweg. Von einem Drei-Wochen-Urlaub auf den Bermudas konnte ich allenfalls träumen wie ein Lottospieler vom Hauptgewinn.
Einen Auftrag hatte ich gerade mit Glück und Erfolg erledigt, einen zweiten als zu undurchsichtig abgelehnt. Ein dritter war geplatzt, bevor ich mich überhaupt mit ihm befassen konnte: Ein kleines, aber erstklassiges Kamerawerk hatte eine neue Kunststoff-Linse erfunden, ein Weltpatent beantragt und alles auf diese Trumpfkarte gesetzt.
Bevor das Patent noch erteilt werden konnte, war die Erfindung, wie auch immer, in falsche Hände gekommen, und Kameras mit Kunststofflinsen aus Billigst-Ländern überschwemmten den Markt.
Das Kamerawerk war in den Konkurs gegangen, sein Inhaber hatte sich erschossen – und auf einmal haderte ich nicht mehr mit einem Beruf, der mir keine Zeit ließ, die Honorare, die er mir reichlich schenkte, auch auszugeben.
Aldo Färber stieg aus dem Bassin, schüttelte sich und schlüpfte in einen flauschigen Bademantel. Er ging auf seinen Platz zu und griff sich aus einem hübschen Etui eine Tabakspfeife – und auf einmal wußte ich, wie ich ihm Gleiches mit Gleichem vergelten konnte.
Er hatte seine Pfeifensammlung in einem prächtigen Futteral untergebracht, weiches Leder, innen gefüttert, offensichtlich sein ständiger Begleiter, wie auch Status-Symbol.
Ich wartete, bis der Mann wieder mit den Mädchen schäkerte. Dann schob ich mich unauffällig auf seinen Platz vor.
Mit ein paar Handgriffen hatte ich ein Mini-Mikrofon – letzter Schrei aus Japan, bezogen über Amerika – in seiner Pfeifentasche eingebaut. Dieser fast unsichtbare Spion, eine sogenannte Wanze, war nicht ungefährlich: Wenn man ihn im Privatleben verwendete, würde es bald kein Privatleben mehr geben – aber ich hatte keine Bedenken, etwas Verbotenes zu tun, schließlich war es auch nicht erlaubt gewesen, in mein Haus einzudringen, um eine Abhörvorrichtung an meinem Telefon zu installieren.
Gerade wollte ich mich wieder unauffällig wegschieben, als ich mit Namen angerufen wurde.
»Tag, Mike« lächelte mir eine rotblonde Attraktion zu. »Das ist eine Überraschung!«
»Weiß Gott«, erwiderte ich, hakte Miriam unter, zog sie weg und erinnerte mich, daß ich mich in einem Vertragshotel mehrerer Luftfahrtlinien befand.
»Wir haben uns ja mindestens zwei Monate nicht gesehen«, begrüßte ich die Stewardeß.
»Zweieinhalb«, verbesserte sie. »Spendierst du mir einen Drink?«
Wir zogen uns an und gingen an die Bar. Miriam kehrte in Rekordzeit zurück. Ich will nicht behaupten, daß sie angezogen noch hübscher war, aber jedenfalls konnte sie sich auch in Kleidern sehen lassen, zumal in ihrer fliegerblauen Uniform mit dem schrägen Käppi, unter dem eine Flut rotblonder Haare hervorquoll.
»Fliegst du auf der Überseeroute?« fragte ich sie.
»Bis vor kurzem«, antwortete Miriam. »Zur Zeit bin ich im Europaverkehr. Weißt du: Hamburg, München, Rom und zurück.«
Einen Moment lang überlegte ich, ob es nicht besser wäre, diesen dummen Färber bei seinen Kopfsprüngen zu lassen und einfach mit Miriam auszubrechen.
»Nachdenklich?« fragte sie mich.
»Am liebsten würde ich mit dir kommen«, entgegnete ich.
»Am liebsten würde ich hierbleiben«, sagte sie.
»Solange du in der Welt herumfliegst, kann ich ja gar nicht bei dir landen«, alberte ich weiter.
»Willst du das?« kicherte die Stewardeß.
»Dumme Frage«, wich ich aus.
»Alberne Antwort«, konterte sie, drückte ihre Zigarette aus und sah auf die Uhr, denn ihr Flugzeug ging in 50 Minuten.
Wenn ich mich beeilte, konnte ich Färbers Pension noch vor ihm erreichen. Ich trug mich unter falschem – übrigens amtlich genehmigtem – Namen ein und ging sofort auf mein Zimmer. Es war klein und nicht übertrieben sauber. Aber ich bewaffnete mich mit Geduld und einer Flasche Rotwein, denn ich konnte mir vorstellen, daß mir dieses Stundenhotel die Stunden vorrechnen würde.
Mein Gegenspieler ließ sich Zeit.
Ich las eine Golfzeitschrift, um wenigstens theoretisch meinem – meist ausfallenden – Freizeitsport zu frönen.
Kurz vor Mitternacht meldete sich zum erstenmal der Mini-Sender aus dem Pfeifenetui (vermutlich lag es auf Färbers Nachttisch).
»Du tust mir weh«, jammerte ein Mädchen.
»Wie die Liebe, so die Hiebe«, erwiderte der Bursche großspurig.
»Und du betrügst mich auf Schritt und Tritt.«
»Überschätz mich nicht«, entgegnete Färber gönnerhaft.
Was nunmehr kam, war ohne Belang, es sei denn, man schätzte Einblicke in leicht verwelkte Liebespraktiken. Jedenfalls wußte ich, daß meine Wanze einwandfrei arbeitete. Sie war so konstruiert, daß sie sich, um Strom zu sparen, erst bei einem gewissen Geräuschpegel automatisch einschaltete und dabei im gleichen Moment mein Tonband in Betrieb setzte. Selbst wenn ich über Färbers Bettgeflüster eingeschlafen wäre, hätte ich es mir am nächsten Morgen als Tonkonserve vorgähnen lassen können.
Im übrigen hoffte ich, daß er bald einschlummern, würde, denn die Mini-Batterie hielt höchstens vier bis fünf Stunden.
Zum Glück ermüdete Färber rasch.
Kurz nach acht Uhr meldete sich der illegale Sender wieder:
»Mach schnell, Mädchen«, sagte Färber, »ich erwarte Besuch.«
Nicht nur er, auch ich.
Ich schnellte vom Bett hoch und warf einen Blick durchs Fenster. Der Tag muß mit dem linken Bein aufgestanden sein. Schwabing zeigte das Gesicht einer gealterten Frau.
Eine halbe Stunde später ging meine Rechnung auf.
» … außerdem brauche ich Geld«, sagte ein Mann mit blecherner Stimme.
»Das Allerneueste!« höhnte Färber. »Und dabei kommen wir keinen Schritt weiter.«
»Ich mußte ganz dringend nach Paris. Mit dem Generaldirektor … Ist mit der gleichen Maschine angekommen.« Der Mann mit der blechernenStimme sprach schnell, so als müßte er sein Schlechtes Gewissen überrunden: »… Abschluß … sehr bald. Wo, weiß ich nicht … Vielleicht London.«
»Und was ist mit diesem Fabian los?« fragte Färber.
» … direktor will sich heute mit ihm in Verbindung setzen«, erwiderte der Unbekannte. »Heute vormittag noch.« Der Rest war nicht mehr deutlich. Die Batterie war am Ende – und ich am Anfang der Lösung.
Eine verrückte Geschichte. Ich brauchte nur noch auf den Mann zu warten, der mich um Hilfe bitten würde.
Schon in meinem Garten hörte ich das Telefon. Ich stürmte ins Haus, aber der Teilnehmer am anderen Ende der Leitung hatte schon aufgelegt.
Zehn Minuten später klingelte es wieder.
»Gut, daß Sie da sind, Herr Fabian«, sagte ein Mädchen mit erleichterter Stimme. »Wir haben schon ein paarmal versucht, Sie zu erreichen.«
»Wer sind wir?« unterbrach ich sie.
»Sekretariat Frommleben«, erwiderte die Anruferin. »Kann mein Chef Sie heute vormittag noch aufsuchen? Oder kommen Sie zufällig noch einmal nach München?«
»Wo sind Sie?« fragte ich.
»Im Hotel Continental!«
»Gut«, antwortete ich. »Erwarten Sie mich in einer knappen Stunde.«
Ich fuhr wieder nach München. Frommleben war für mich nicht nur ein Name, sondern auch ein Begriff. Der Chef der ferwag vertrat 100000 Aktionäre, etwa die gleiche Zahl Arbeitnehmer und einen Jahresumsatz von rund sieben Milliarden Mark. Er war der erste Mann eines Weltkonzerns, dessen Interessen über Bergbau, Mineralöl bis zur Stahlveredelung reichten.
Der Portier riß die Tür auf.
»Sie werden schon erwartet, Herr Fabian«, raunte er mir zu. »Suite Nummer drei.«
Als ich mit meinem Aktenköfferchen in der Hand die Treppe hochhastete, kam ich mir vor wie der Weihnachtsmann mit dem Gabensack.
»Man hat Sie mir empfohlen, Herr Fabian«, begrüßte mich der Spitzenmanager. Er war Schwergewicht, nicht nur im Berufsleben. Er sah aus wie ein Mann, der über dem Erfolg Herz und Kreislauf vergißt. »Ich wollte mich schon vor drei Tagen mit Ihnen in Verbindung setzen, aber Paris ist mir dazwischengekommen.«
»Einen Moment, bitte«, unterbrach ich ihn, sah mich um und schaltete im hoteleigenen Radio flotte Musik ein: Hätte es Aldo Färber heute morgen nicht versäumt, wäre ich mit leeren Händen hierhergekommen.
Der Generaldirektor betrachtete mich verständnislos. Sicher verstand der Chef des ferwag-Konzerns mehr von Produktion, Marktanalyse und Unternehmensführung als von der modernen Seuche Industriespionage.
»Ich habe das alles für Hirngespinste gehalten«, begann er. »Aber gestern abend sind irgendwelche Banditen in unsere Hauptverwaltung eingedrungen, haben den Nachtwächter niedergeschossen und den Tresor gesprengt.« Außer Atem setzte der Manager hinzu: »Wir sehen alle schon Gespenster.«
Es war verständlich. Die neu entwickelte Ölsonde (SL) war eine Sensation auf dem Weltmarkt. In jahrelanger Arbeit hatte die Firma sie entwikkelt. Es war eine komplizierte technische Geschichte, aber man konnte sie mit der Feststellung zusammenfassen, daß sie die kostspieligen Ölschürfungen um ein rundes Drittel verbilligen würde.
Es war nicht nur eine großartige, sondern eine zeitgemäße Innovation. Die Energiekrise beutelte die Weltwirtschaft. Erdöl wurde immer teurer und rarer. Es war ein Gebot der Stunde, neue Quellen zu erschließen, wie zum Beispiel die Engländer und Norweger in der Nordsee. Sie taten es mit ungeheurem Aufwand; wenn man ihn tatsächlich um ein Drittel verringern könnte, wären die Milliarden wiedergewonnen, die die Ölverteuerung verschlang.
Die amerikanischen Ölmultis hatten längst großzügige Offerten gemacht; aber mit EWG-Rückendeckung aus Brüssel wollten die ferwag und Frommleben die revolutionäre Neuerung nicht verkaufen, sondern nur vermieten. Sie sollte allen Interessenten zugute kommen, zum Nutzen des Verbrauchers und zum Profit der Erfinderin.
Seit einigen Wochen jagten Unbekannte hinter der SL-Sonde her. Der Konzern hatte längst die Polizei eingeschaltet. Vergeblich.
»Und der Eindruck gestern?«
»Die Burschen haben eigentlich nur bedeutungsloses Zeug ergaunert«, erklärte der Generaldirektor. »Wir haben alle Pläne und die Patentschrift auf Anraten der Kriminalpolizei in einem Banktresor deponiert. Ich wollte Sie auf den Rat des Ministerialrats Siebener hin schon vor drei Tagen aufsuchen …«
»Wer wußte davon?« unterbrach ich ihn.
»Meine Sekretärin.«
»Wer noch?«
Der Generaldirektor überlegte angestrengt: »Dr. Ott, mein persönlicher Referent.«
»Beide verläßlich?« fragte ich.
»Fräulein Hübner ist schon seit einundzwanzig Jahren bei uns«, erwiderte der Generaldirektor gereizt.
»Und Dr. Ott?«
»Ein erster Mann«, entgegnete Frommleben. »Ich habe ihn selbst von der Universität geholt. Sein einziges Laster ist der Ehrgeiz.« Überzeugt setzte er hinzu: »Für beide würde ich meine Hände ins Feuer legen.«
Es war zum Glück nur eine Redensart; der ferwag-Chairman hätte sich die gepflegten Hände gerantiert verbrannt. Ich schaltete das Radio etwas leiser und entnahm meiner Aktentasche ein Mini-Tonbandgerät. Ich hatte es etwas ungenau zurückgespult, aber deutlich sagte eine blecherne Stimme: » … direktor will sich heute mit ihm in Verbindung setzen … Heute vormittag noch.«
Ich brauchte Frommleben nur anzusehen: Zuerst drohten die Augen aus seinem Kopf zu quellen, dabei stieg sichtbar sein Blutdruck.
»Aber das ist doch … das ist …«
»Ihr famoser Herr Dr. Ott«, erwiderte ich: »Vermute ich richtig?«
Er schwieg betroffen.
»Trau schau wem«, setzte ich hinzu.
Dann sprach ich mit dem ersten Mann des Misch-Konzerns ab, wie wir die Laus im eigenen Pelz imschädlich machen könnten.
Wir bauten eine erstklassige Falle auf. Geld spielte keine Rolle. Ich schöpfte aus dem vollen. Zugleich setzte Kriminalkommissar Niebler, nach Überwindung ersten Mißtrauens, seine besten Leute auf Dr. Heinrich Ott an. Schon bald wußten wir, daß der Ungetreue außer seinem Ehrgeiz doch ein zweites Laster hatte: Es hieß Leila, war 27 Jahre alt, Tochter eines ägyptischen Vaters und einer deutschen Mutter, im Libanon aufgewachsen.
Überraschend trommelte Frommleben die Herren seines Vorstandes zusammen. Außer den leitenden ferwag-Direktoren waren nur sein persönlicher Referent und ich anwesend.
»Meine Herren«, begann der Gastgeber, »zunächst einmal darf ich Ihnen Herrn Fabian vorstellen, den ich für uns verpflichten konnte. Er ist ein bekannter Experte in der Abwehr von Industriespionage. Und ich bitte Sie alle, ihn nach Kräften zu unterstützen.«
Ich verbeugte mich knapp.
Der Spitzenmanager fuhr fort: »Wir wollen keine Zeit verlieren. Wir werden jetzt sofort die SL-Verträge mit den Engländern, Italienern und Franzosen unter Dach und Fach bringen. Um kein Aufsehen zu erregen: in Rom. Ich brauche nicht zu betonen, daß Ort und Termin streng vertraulich sind.« Der Industrieboß war ein besserer Schauspieler, als ich es erwartet hatte.
Dr. Heinrich Ott saß mit ausdruckslosem Gesicht in der Runde. Er brauchte Geld, viel Geld für die anspruchsvolle Leila. Und so würde er die Geheiminformationen unverzüglich verraten und unsere Gegenspieler im Dunkel würden alles auf eine Karte setzen, um die SL-Pläne in letzter Sekunde noch in die Hand zu bekommen.
Dabei bot ich mich als Zielscheibe an.
Vorsorglich hatte ich sämtliche Plätze des LH-Fluges 121 Köln-Rom aufgekauft. Wer an diesem Tag mit der Maschine von Köln nach Rom fliegen wollte, kam unweigerlich auf die Warteliste, und diese Namen sah ich mir natürlich genau an.
Die meisten Interessenten wichen auf einen anderen Flug aus. Nur ein Bewerber blieb hartnäkkig: Aldo Färber. Er bot dem Angestellten eines Reisebüros für drei Tickets zunächst 100, später 300 Mark Trinkgeld.
Dem Manne konnte geholfen werden – und wir wußten nunmehr, daß unsere Gegenspieler ihren Anschlag auf die ferwag-Erfindung während des Flugs inszenieren würden. Vermutlich sollte nach berüchtigtem Beispiel die Maschine auf eine Wüstenpiste im Nahen Orient entführt werden.
Die Polizei war alarmiert, interpol eingeschaltet. Mein Plan rollte exakt, bis auf eine Einschränkung: Generaldirektor Frommleben ließ sich nicht vom Mitfliegen abhalten. Schließlich gab ich nach, denn dadurch saß auch Dr. Ott gleich in der Falle.
Es war ein prächtiger Tag, zumindest meteorologisch. Eine Schönwetter-Brücke wölbte sich von Nord nach Süd.
Ich hatte, unauffällig, jedoch schwer bewacht, falsche SL-Pläne bei der Bank abgeholt und war auf dem Weg zum Flughafen Köln-Wahn absichtlich Umwege gefahren.
Auf meine Veranlassung wurde unser Gepäck sorgfältig geröntgt. Auch wenn Färber und Dr. Ott nicht danach aussahen, könnten sich Fanatiker doch mit uns in die Luft sprengen. Vor anderen Waffen, die sie vermutlich mit ihrem Handgepäck einschmuggelten, hatten wir keine Angst.
Als ersten sah ich Kriminalkommissar Niebler. Ihn erwartete der erste Flug seines Lebens, und Angst stand in seinem Gesicht. Eine unfreiwillige Tarnung? Ihm folgte ein ganzer Pulk sorgfältig ausgewählter Kriminalbeamter, ausnahmslos Freiwillige.
Die erste Überraschung erlebte ich an der Landetreppe: Sie war angenehm, rotblond, und hieß Miriam.
Es war Zufall, daß uns die befreundete Stewardeß während des Fluges begleitete, und man soll Zufälle feiern, wie sie fallen – wenn ich das auch erst nach der Arbeit, in Rom vorhatte.
Sorgfältig abgeschirmt stieg der Generaldirektor, begleitet von Sekretärin und persönlichem Referenten, in den bauchigen Rumpf der 737. Dr. Ott hatte keine Farbe im Gesicht. Er war zerstreut. Seine Augen stahlen sich immer wieder zu einem Liebespaar, das nicht von der Polizei gestellt worden war. Unschwer zu erraten, daß das rassige Mädchen, eng an einen großen stämmigen Burschen mit bräunlicher Hautfarbe gelehnt, Leila sein mußte.
Schaukelnd rollte der Riesenvogel über die Piste und wartete auf die Starterlaubnis aus dem Flugturm. Wir legten die Anschnallgurte um und ließen uns von Miriam Zeitungen und Bonbons anbieten.
»Bist du privat oder dienstlich unterwegs?« fragte sie mich.
»Privat, natürlich«, antwortete ich.
»Das trifft sich gut«, versetzte die Bordfee lächelnd. »Ich habe in Rom einen freien Tag.«
»Gekauft«, erwiderte ich lachend.
Wir drückten die Zigaretten aus. Dann donnerte die Boeing über die Piste und bohrte ihre Schnauze in den Himmel. Ich saß Schulter an Schulter mit Leila. Unauffällige Regie von beiden Seiten.
Sie turtelte mit ihrem Begleiter.
Die Kriminalbeamten lasen Zeitung.
Dr. Heinrich Ott ging auf die Toilette, aber sie war versperrt, denn hier hielt sich während des ganzen Fluges ein Kriminalbeamter versteckt.
Wir hatten den Überfall ein dutzendmal im Sandkasten geprobt. Nichts konnte schiefgehen – falls er stattfand.
Das kriminelle Kleeblatt ließ sich jedenfalls Zeit. Wir überflogen den Alpenkamm. Die Sonne vergoldete die Grate und Zacken.
Ich nahm Miriam beiseite.
»Ich muß dir etwas gestehen«, begann ich vorsichtig.
»Liebst du mich?« fragte sie.
»Das auch«, antwortete ich. »Aber ich bin doch nicht so privat hier, wie du denkst.«
»Das habe ich auch nicht anders erwartet«, erwiderte sie mißtrauisch und setzte hinzu: »Aber bei unserer Verabredung in Rom bleibt es doch?«
»Ganz bestimmt«, versprach ich, »vorausgesetzt, daß du mir einen Wunsch erfüllst, ohne viel zu fragen.«
»Bitte!«
»Sag deinem Captain, daß er die nächsten zwanzig Minuten die Cockpittür von innen verriegeln soll.«
»Warum das? Erwartest du einen …«
»Genau das«, unterbrach ich Miriam. »Aber das soll unter uns bleiben. Sei unbesorgt, die Passagiere sind fast alles Kriminalbeamte.«
Sie ging nach vom. Ich erwartete einen Tobsuchtsanfall des Flugkapitäns, aber er ließ sich weder sehen, noch war er zu hören. Die Stewardeß kam zurück und nickte mir wie eine Verschwörerin zu.
Nichts Verdächtiges geschah – und für mich zeichnete sich bereits eine riesige Blamage ab.
»Doch nicht hier, Omar«, schob Leila ihren Begleiter sanft von sich weg.
Dr. Ott warf ihr einen gequälten Blick zu.
Omar sah auf die Uhr:
»Noch einundzwanzig Minuten!« rief er so laut, als wollten es alle wissen.
Es war das Stichwort für Färber.
Er stand auf und gähnte demonstrativ.
Er vergewisserte sich, daß Omar nach hinten ging, Richtung Toilette.
Es waren die längsten Sekunden meines Lebens.
Färber versuchte, die Tür des Cockpits aufzureißen. Es mißlang – es mußte mißlingen, dank Miriam.
»Alle sitzenbleiben!« schrie Omar vom Schwanzende der Maschine.
Er hielt eine Plastikpistole im Anschlag.
Leila kramte in ihrer Tasche.
Ich griff nach ihrer Hand und drehte sie um.
»Wenn Sie Ruhe bewahren, passiert Ihnen …«
Omar kam nicht weiter.
Der Beamte aus der Toilette hatte ihn von hinten niedergeschlagen. Zwei, drei Kollegen kamen ihm zu Hilfe, und auch Leilas Pistole polterte jetzt zu Boden.
Im gleichen Moment wurde Färber überwältigt.
Handschellen klickten.
Es war nicht ein Wort gefallen.
Der Fall stand vor dem Ende.
Die Tür zum Cockpit öffnete sich, und der Flugkapitän gratulierte uns.
Gleich nach der Überrumpelung klappte Dr. Ott zusammen. Das Entsetzen lief über sein Gesicht wie kochende Milch. Bevor wir sicher landeten, erlebte er seinen Absturz.
Noch an Bord legte er ein Geständnis ab und erklärte sich bereit, freiwillig nach Deutschland zurückzufliegen.
Leila spuckte vor ihm aus, und Omars finsteres Gesicht ließ erwarten, daß wir nie erfahren würden, ob hinter dem verunglückten Anschlag auf die SL-Ölsonde eine private Verbrecherbande oder eine politische Terrororganisation gestanden hatte.
Vielleicht würde später Färber reden, aber er war sicher auch nur ein gekauftes Werkzeug von Dr. Ott, auf den Leila mit Hilfe einer vorgetäuschten Autopanne angesetzt worden war.
Auf dem römischen Flugplatz Fiumicino warteten bereits Polizeiwagen, um die Täter in das Gefängnis zu überführen. Wichtiger war freilich, daß die ferwag künftig ungestört ihre Erfindung verwerten konnte.
Der Generaldirektor bedankte sich überschwenglich. Zum Feiern hatte er keine Zeit. Mit der nächsten Maschine mußte er wieder zurück.
Miriam stand in der Nähe.
»Auf, zu unserem Stadtbummel!« sagte ich.
»Weder Via Veneto noch Trastevere«, erwiderte sie verärgert, »sondern Beirut.«
Miriam mußte für eine erkrankte Kollegin entspringen, und so trafen wir wieder einmal eine Vereinbarung für München, die wir diesmal – vielleicht – einthalten würden.