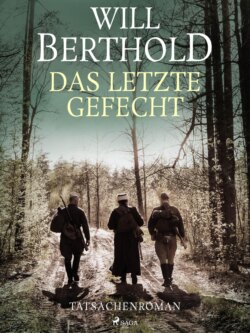Читать книгу Das letzte Gefecht - Tatsachenroman - Will Berthold - Страница 4
Tunisgrad
ОглавлениеNordafrika, Ende Oktober 1942: Die noble Gesellschaft tanzt im Ballsaal des ersten Hauses im französischen Algier, und sie tanzt auf einem Vulkan. Die Nacht hat heiße Hände, sie ist feuchtfröhlich und stürmisch. Trotz der vielen Uniformen ignoriert man den Krieg, obwohl er langsam von Osten nach Westen sich Frankreichs nordafrikanischem Besitz nähert. Das Publikum ist erlesen, doch gemischt: schwitzende US-Diplomaten im Frack, erfolgreiche Geschäftemacher beim Flirt, schöne Frauen und Gentleman-Typen dubioser Herkunft, eine Atmosphäre, wie sie der Kultfilm »Casablanca« meisterlich festhielt.
Eine arabische Band peitscht die Gäste mit wilden Rhythmen. Die Damen, Französinnen und Hängengebliebene aus vielen europäischen Ländern, wirken elegant und verführerisch. Sie tragen Roben, wie sie nur Paris zaubern kann – dabei ist Paris längst von den Deutschen besetzt.
»Permettez-vous, Madame?« fragt US-Vizekonsul Miller die ungekrönte Ballkönigin des Abends.
»You’re welcome«, entgegnet Nicole Lemaire höflich. Die Französin ist an die achtundzwanzig, reich und unabhängig. Meergrüne Augen. Blauschwarze Haare. Ein Dekolleté, das so viel Haut zeigt, daß man Appetit auf die ganze Nicole bekommt.
»Sie sind hier die Schönste«, raunt ihr der Amerikaner zu.
»Und Sie der größte Schmeichler«, entgegnet die junge Frau lachend. »Wußte gar nicht, daß ihr Yankees das fertigbringt.«
Rings um das Parkett sitzen Gäste und verfolgen die beiden mit ihren Blicken. Wo sich zwei Menschen treffen, sind in diesem heißen Oktober mindestens drei Geheimdienste vertreten, aber man tanzt, lacht und parliert. Ein langer, ausgelassener Monat voller Feste und voller Gerüchte geht zu Ende. In einem Winkel, den der Zweite Weltkrieg noch ausgespart hat, denn die Kanonen donnern auf der anderen Seite Nordafrikas. Sehr weit ostwärts: bei El Alamein.
Seit ein paar Tagen, seit dem 24. Oktober, drehte sich das Wüstenkarussell wieder. Die »Operation Lightfoot« des neuen englischen Oberbefehlshabers Montgomery, eine gewaltige Offensivanstrengung, war angelaufen. Der Durchbruch soll gelungen sein, aber das ist nur Hörensagen, und wer wird schon an einem so festlichen Abend darüber nachgrübeln? Man scheint sich vielmehr den Kopf darüber zu zerbrechen, wer bei Nicole Lemaire das Rennen machen wird, als wer die blutige Wüsten-Samba gewinnt.
Man lebt im französischen Kolonialreich trotz des Krieges wie Gott in Frankreich: flotte Feste, dicke Geschäfte. Und wer sich Sorgen macht, hat auch Likör. Der Alkohol fließt in Strömen auf diesem turbulenten Schauplatz.
Frankreichs nordafrikanische Kolonien werden von Generalresidenten verwaltet. Sie sind neutralisiert, ihre Verwaltung ist der Vichy-Regierung loyal ergeben, und der Oberkommandierende, General Alphonse Juin, hat sein Wort gegeben, daß er die Neutralität der französischen Truppen wahren und nicht gegen die Deutschen arbeiten wird. In London hält General Charles de Gaulle als Vertreter des Freien Frankreichs flammende Appelle vor dem Mikrophon; sie finden zunächst keinen großen Anklang, denn die Militärs – immer geneigt, Befehlen zu gehorchen – betrachten den Abgefallenen als Verräter.
Einig sind sich die Kolonialfranzosen nur in ihrem Haß gegen die Deutschen, die ihr Mutterland überrollt und besetzt haben. Auch ihre Verachtung gegen die Italiener ist einstimmig. Man bewertet Mussolini, der in Frankreich eingefallen war, als es sich, von den Deutschen besiegt, nicht mehr wehren konnte, als einen Leichenfledderer. Haß und Abneigung treiben aber die Franzosen – die sich für gute Patrioten halten – noch lange nicht in die Arme der Engländer, die gegen die Deutschen und Italiener kämpfen.
Die Franzosen halten den früheren Bundesgenossen vor, daß sie sich in Dünkirchen zurückgezogen hatten, ohne die französischen Waffenbrüder zu verständigen, daß ihnen die Briten die »Spitfires« vorenthalten hatten und daß schließlich die englische Flotte nach dem Waffenstillstand die französische im Hafen von Mers El Kébir, in der Nähe von Oran, im Schlaf überfallen und sie – um sie nicht den Deutschen in die Hände fallen zu lassen – erbarmungslos zusammengeschossen hatte, wobei 1297 französische Matrosen gefallen waren.
Man lebt in Algier, in Tunis und in Marokko in den Tag hinein und feiert die Feste, wie sie fallen. Amerika liegt zwar mit Deutschland im Krieg, ist aber gegenüber Frankreich neutral. Wenn die Franzosen die Yankees auch weit höher einschätzen als der Reichsmarschall Göring, der spöttelnd immer wieder feststellt, sie könnten nur »Rasierklingen herstellen«, so haben sie doch zunächst einmal in Fernost im Kampf gegen die Japaner eine Schlappe nach der anderen hinnehmen müssen. Die USA haben den abwartenden Franzosen erst einmal zu zeigen, was sie zu leisten vermögen. Man hängt in Algier wie in Vichy der Beurteilung an, die in ihrem Sachbuch »Unternehmen Sonnenaufgang« die Autoren Bradley F. Smith und Elena Agarossi mit den Worten wiedergeben: »Mit dem größten wirtschaftlichen Kriegspotential der Welt, mit einer Armee von der Größe der schwedischen und mit einer Marine, die zum großen Teil auf dem Meeresgrund von Pearl Harbor lag, trat Amerika in den Zweiten Weltkrieg ein ...«
Einstweilen beschränken sich die Yankees im Umgang mit den Franzosen auf eine lebhafte diplomatische Tätigkeit. An Nordafrika scheint ihnen besonders zu liegen, denn hierher haben sie gleich elf Vizekonsuln entsandt. Einer von ihnen nennt sich Miller und absolviert sonst ganz andere Tänze, aber er bewegt sich geschickt und rhythmisch. Es ist auch nicht schwer bei einer Frau wie Nicole, die jede Schwingung des Partners auffängt, in deren Armen Herren zu Männern werden.
Links herum, rechts herum.
Ihre Haare streifen sein Gesicht, und der Yankee spitzt die Lippen. »Kennen Sie den Offizier an der Bar?« fragt er unvermittelt.
»Monsieur Prenelle?«
»Er ist Ordonnanzoffizier bei General Mast.«
»Und?« fragte Nicole.
»Scheint heute Liebeskummer zu haben«, entgegnet der Amerikaner. Er lächelt knapp: »Vielleicht könnten Sie ihn aufheitern.«
»Und warum sollte ich das tun?« fragt die Französin halblaut.
»Er ist amüsant«, erwidert der Diplomat. »Außerdem gehört er zu den Vertrauten des Generals Mast – und ich muß mit ihm sprechen. Unauffällig.« Er geleitet seine Tänzerin zurück zum Tisch. »Es ist brandeilig – Sie würden mir einen großen Gefallen tun.«
Der Amerikaner entfernt sich, fast gleichzeitig kommt der deutsche Attaché Melzer: schlank, glatt, kalt. Für Unbeteiligte sind diese Feste in Algier von unfreiwilliger Komik: Da stehen sich Feinde als Diplomaten auf neutralem Boden stocksteif gegenüber, reden kein Wort miteinander, intrigieren: um Frauen, um Nachrichten.
Ihre Uniform ist der Frack, das Sektglas ihre Waffe.
»Würden Sie auch mir einen Tanz schenken, Gnädigste?« fragt der deutsche Diplomat.
»Ich tanze mit allen«, antwortet Nicole, »so sie tanzen können.«
»Ich hoffe es zu können«, erwidert der Attaché steif. Die junge Frau weiß, daß er etwas ganz anderes von ihr will als einen Tango.
»Ich habe Nachricht – von Ihrem Bruder«, sagt er während einer eleganten Wendung.
»Von Pierre?« fragt die Französin eine Spur zu rasch.
»Er heißt jetzt Peter«, versetzt der Diplomat mit trockenem Hohn. »Er wurde soeben zum Leutnant befördert.«
»So –«, erwidert Nicole erschrocken.
»Ja. Besondere Auszeichnung – in einem Fallschirmjägerregiment.«
»Und wo – wo ist Pierre jetzt?«
»In Italien. Vielleicht bald auf dem Sprung nach Nordafrika.«
»Tun Sie mir einen Gefallen?« fragt Nicole, eine Elsässerin, geborene Molitor, verwitwete Lemaire, seit ihr Mann, ein Weingutsbesitzer, vor eineinhalb Jahren bei Sedan gefallen ist.
»Zwei, Madame«, verspricht der Diplomat mit einem anzüglichen Lächeln.
»Würden Sie bitte«, antwortete Nicole hastig, »Ihr Wissen für sich behalten?«
»Sie möchten keinen Mann in der Familie, der für uns kämpft?« erwidert ihr Tanzpartner ironisch. »Obwohl Ihr Bruder natürlich nach unserer Auffassung Deutscher ist – wie Sie ja eigentlich auch. Vielleicht werden Sie sich nach unserem Endsieg daran erinnern.«
»Vielleicht«, spöttelt Nicole. »Aber bis dahin bleibe ich Französin.«
»Dann fällt es Ihnen um so leichter«, erklärt Attaché Melzer kalt, »festzustellen, welche Offiziere im Stab der Generäle Mast und Juin im Falle eines Falles zu den Anglo-Amerikanern überlaufen würden –« Der Deutsche lächelt, als ob er Nicole bei seiner Werbung nähergekommen wäre.
»Ich bin kein Spitzel«, erwidert die Französin süffisant. »Und was heißt im Falle eines Falles?« Sie bleibt während des Tanzes stehen. »Rechnen Sie damit, Monsieur Melzer«, fragt sie halblaut, »daß die Anglo-Amerikaner bei uns landen werden?«
»Ich rechne nicht damit«, versetzt der Deutsche, »aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen. Aber«, fährt er fort, »kann ich mit Ihnen rechnen?« und beginnt zu drohen: »Andernfalls –«
Die Französin schüttelt den Kopf.
»Morgen?« drängt Melzer.
»So bald wie möglich«, entgegnet Nicole.
Melzer reicht Nicole den Arm und führt sie an die Bar. Er hilft ihr auf den langen, schmalen Hocker neben Hauptmann Prenelle, bestellt etwas zu trinken, macht Nicole Komplimente und entschuldigt sich, weil er telefonieren muß.
Auch US-Vizekonsul Miller telefoniert. Von einem anderen Apparat aus. Er heißt so wenig Miller von Geburt an wie Melzer etwa Melzer. Im Grunde haben sie beiden den gleichen Auftraggeber: den Untergrund.
Nur auf verschiedenen Seiten.
Dieses Algier – oder besser ganz Französisch-Nordafrika – ist ein offenes Benzinfaß.
Ein Funke genügt, um es hochzujagen.
Und jeder spielt mit dem Feuer. Vizekonsul Miller feiert Erfolge als Salonlöwe, doch nur so nebenbei. Sein Chef ist Generalkonsul Robert Murphy, Spitzenagent des Office of Strategic Services (OSS), der US-Spionageorganisation, vor kurzem noch US-Statthalter in Vichy.
Zu diesem Zeitpunkt hat Frankreich als einziges von Hitler überfallenes Land eine Sonderbehandlung: Nur ein Teil seines Gebietes ist besetzt; der andere wird von Vichy aus regiert.
Vichy ist ein berühmter Leberkurort, aber den meisten Franzosen kommt die Galle hoch, wenn man diesen Namen nennt. Hier sitzt General Philippe Pétain, der französische Hindenburg; hier sind Männer wie Laval und Admiral Darlan, Halbfaschisten.
Die Franzosen verfügen über eine intakte Flotte. Und über eine Armee. In Nordafrika stehen 200000 Mann unter Waffen – schlecht ausgerüstet, aber hervorragend ausgebildet. Erstklassige Offiziere.
Auf welcher Seite sie stehen?
Der Gesandte Murphy und seine elf »Vizekonsuln« haben die französischen Streitkräfte durchsiebt. Sie können sich durchaus ein Bild von der Lage machen, obwohl sie mehr als verworren ist. Fast alle Franzosen – bis auf wenige Kollaborateure – hassen die Deutschen und warten auf den Tag der Befreiung. Trotzdem möchten sie sich, zumindest in Nordafrika, aus dem Krieg noch heraushalten. Sie haben in ihren Kolonien genügend Scherereien mit den Arabern. Sie sagen sich ganz richtig, daß hier ein Kampf mit Sicherheit das Ende ihrer Kolonialherrschaft mit sich brächte, daß aus einem Kriegsschauplatz in Nordwestafrika letztlich die selbständigen Staaten Algerien, Tunesien und Marokko hervorgehen könnten.
Dazu kommt die mehr als gefühlsmäßige Abneigung gegen die Briten, von denen sich die Franzosen verraten glauben. Werden diese kämpfen? Werden sie schlafen? Werden sie den Einmarsch dulden? Oder werden sie für Pétain ihre Haut zu Markte tragen? Auf zwei Seiten weiß man keine Antwort auf diese Fragen.
Hauptmann Prenelle, Ordonnanzoffizier bei General Mast, betrachtet die Französin an seiner Seite mit verzogenen Lippen. »Schade –«, sagt er.
»Was ist schade?« fragt sie.
»Daß Sie mit einem Boche reden.«
»Ich hasse sie«, versetzt die hübsche Witwe leise.
»Oh«, antwortet der Offizier. »Pardon, Madame.« Seine schlechte Laune desertiert auf der Stelle. »Allein?« fragt er dann.
»Im Moment –«
»Ich liebe Momente«, erwidert der Offizier, »vor allem, wenn sie länger andauern.«
»Das liegt an Ihnen«, entgegnet Nicole keß.
»Dann will ich tun, was ich kann«, antwortet der Hauptmann, klettert lächelnd vom Hocker und entführt die junge Frau auf das Parkett.
Ein neuer Tanz. Ein anderer Mann. Nichts Besonderes bei Nicole. Sie ist verliebt in das Leben, und sie zeigt es, sie spielt die lustige Witwe überzeugend. Vielleicht ist es nur Tarnung. Fast alle tarnen sich in Algier. Aber die junge Französin ist keine Agentin, sie ist eine Patriotin.
Hauptmann Prenelle: Das ist keine Aufgabe für Nicole oder eine, die ihr Spaß macht, denn der Offizier gefällt ihr. Er küßt ihr galant die Hand, doch seine Augen sind schon viel weiter: hübsche, dunkle Augen, groß und werbend.
Der Offizier bringt sie in einem alten Citroën nach Hause. Er macht Umwege, Nicole merkt es und lächelt. Prenelle steigt aus, geleitet sie an die Tür. »Bis morgen, Nicole?« fragt er.
»Warum bis morgen?« entgegnet die Französin kokett. »Wollen Sie nicht noch eine Tasse Kaffee –«
»Wenn ich darf«, erwidert der Offizier überrascht.
»Sie dürfen viel mehr, als Sie annehmen«, versetzt Nicole frivol. Vielleicht bin ich zu plump, überlegt sie sich, aber was soll’s. Die Zeit drängt – und Miller wartet.
Es ist keine Kunst, einen Verliebten auszufragen.
Hauptmann Prenelle steht neben ihr in der Küche, zieht die junge Frau an sich, streichelt sie.
»So kommst du nie zu deinem Kaffee«, sagt Nicole.
»Ich will keinen Kaffee«, antwortet er.
»Sondern?«
»Dich –«
»Geduld, mon chéri –«, versetzt sie.
»Geduld erfordert Zeit, und Zeit ist knapp.«
»Warum?«
»Der Dienst –«
»Ist General Mast denn so eifrig?« wagt sich Nicole vor. Sie geht zurück in den Salon, setzt sich auf eine tiefe Couch, legt die Beine übereinander. »Na, kommt schon«, fordert sie den Zögernden auf, der sich dann ein wenig zu schnell neben ihr niederläßt.
Prenelle küßt sie. Die Französin läßt es sich gefallen. Seine Hände wandern vom Nacken abwärts.
Sie schlägt ihm spielerisch auf die Finger. »Lentement, mon ami«, sagt sie, als sie der Hauptmann um die Taille faßt und an sich zieht.
Zeitweilig vergißt Nicole, was sie erfahren möchte, aber als der Offizier ein paar Stunden später direkt von ihrer Wohnung in seine Garnison geht, ist sich die junge Französin ziemlich sicher, daß ihr neuer Freund bald vor ihr keine Geheimnisse mehr haben wird, auch keine militärischen.
Die »Operation Lightfoot« war schon vorbereitet worden, als Rommels Marsch nach Ägypten unaufhaltsam schien. In der Etappenstadt Kairo hatten längst junge ägyptische Offiziere unter Anführung des Obristen Abd el Nasser den Aufstand geprobt, aber Rommel, seinem Nachschub wieder einmal davongelaufen, war gezwungen, die Offensive 100 Kilometer vor Alexandria abzubrechen. »Gäbe man mir nur drei Schiffe mit Benzin für meine Panzer – ich wäre in achtundvierzig Stunden in Kairo«, stellte der Wüstenfuchs fest.
Nunmehr lagen sich in der El-Alamein-Stellung die Deutschen und die Engländer schon fast zwei Monate scheinbar tatenlos gegenüber. Rommel nutzte die Zeit, seinen »Teufelsgarten«, das Vorgelände seiner Stellung, mit 249 849 Panzer- und 14500 Tretminen zu bestücken.
Aber auch die Briten versäumten keine Zeit. In den ägyptischen Häfen, nach meist langwieriger Umschiffung ganz Afrikas, liefen die Schiffe mit fabrikneuen Sherman- und Grant-Kampfwagen, made in USA, ein. Geschütze, Munition, Proviant wurden entladen, in Mengen, wie man sie noch nie gesehen hatte. Die »Wüstenratten« – so nannte sich das britische Expeditionskorps in Nordafrika selbst – erhielten neue Panzer, neue Flugzeuge, neue Geschütze – und einen neuen Oberbefehlshaber. Die Truppenverstärkungen aus fast allen Teilen der Welt und die modernen Waffen waren ihnen nur zu willkommen – auf den General Montgomery hätten sie am liebsten verzichtet; es eilte ihm der Ruf voraus, ein sturer Kommißkopf zu sein, der streng auf die Einhaltung des militärischen Brimboriums achtete. Auf Afrikas heißem Boden jedoch hatten sich die Soldaten mit den flachen Stahlhelmen – Schotten, Engländer, Südafrikaner, Australier, Neuseeländer, Inder und andere Kolonialtruppen – längst hitzebedingte Erleichterungen verschafft. Von Ehrenbezeigungen, auch Vorgesetzten gegenüber, war man weitgehend abgekommen; was die Uniformvorschriften anbelangte, begnügten sich die meisten damit, sich ihre Rangabzeichen mit Heftpflaster auf die nackte Haut zu kleben.
Es herrschte eine ungute, gereizte Stimmung, als der neue Oberbefehlshaber der 8. britischen Armee seine Kommandeure in Kairo in das Amaryia-Kino befohlen hatte, um ihnen sein strategisches Konzept für die »Operation Lightfoot« darzulegen. Es war umfassend, pedantisch bis in alle Einzelheiten vorbereitet. Die versammelten Offiziere zeigten sich überrascht, wie ein Neuling auf dem nordafrikanischen Kriegsschauplatz die Besonderheiten des Wüstenkrieges vom grünen Tisch aus so exakt analysieren konnte. Sonst schien Auchinlecks Nachfolger, der seit der Katastrophe von Dünkirchen vor zwei Jahren kein Frontkommando mehr erhalten hatte, die Gerüchte zu bestätigen, die ihm vorausgeeilt waren. »Bernard Montgomery ist klein, drahtig, hat ein Vogelgesicht und spricht durch die Nase, mit hoher, unangenehmer Stimme«, schildert ihn in seinem Buch »The trail of the fox« der britische Autor David Irving. »Seine Knie sind weiß, sein Gesicht ist rosig. Trotzdem haben er und Rommel vieles gemeinsam. Beide sind sie einsam und haben unter gleichgestellten Offizieren mehr Feinde als Freunde; beide sind sie anmaßend und überheblich; beide sind gehemmt und im normalen Dienst unbequeme Offiziere, entwickeln sich aber, sobald sie Handlungsfreiheit erhalten, zu großartigen, erfindungsreichen Truppenführern; beide rauchen nicht und trinken sehr mäßig Alkohol; beide teilen die Liebe zum Wintersport und legen großen Wert auf erstklassige körperliche Verfassung.«
Und beide lagen sich an der Pforte Ägyptens, in der El-Alamein-Stellung, gegenüber wie zwei Boxer im Clinch, unfähig, sich voneinander zu lösen. Beide wußten, daß sie die einzige Verteidigungslinie in der westlichen Wüste hielten, deren Südflanke nicht umgangen werden konnte. 65 Kilometer südlich der Küste zog sich die Qattara-Senke, eine unter dem Meeresspiegel liegende Salzniederung am Fuße einer Felsenlandschaft, dahin. »Panzer können Felsen nicht überwinden«, analysiert der englische Autor Mark Arnold-Forster die Situation, »und in Salzniederungen sacken sie ein. Vom Juli 1942 an standen die Gegner sich auf einem im Norden durch das Mittelmeer und im Süden durch die Qattara-Senke begrenzten Schlachtfeld gegenüber. Es war wie ein tödlicher Boxring, aus dem es kein Entrinnen gab. Die erste Julihälfte hindurch hielten Auchinlecks Streitkräfte die Linien gegen Rommels entschlossene und geschickte Angriffe. Rommel verausgabte seine Kräfte. Einmal wurden seine Mittel durch den Nachschub aufgefüllt, dann gingen sie wieder zur Neige ...«
Montgomery war entschlossen, den ersten Stoß frontal zu führen und mit Hilfe seiner stärkeren und moderneren Panzer Rommels Front zu durchbrechen. Er hatte seinem Gegner einiges abgesehen: Er ließ zum Beispiel eine falsche Ölleitung in den Südabschnitt seiner Front verlegen. Die Panzerarmee Afrika sollte annehmen, der Hauptstoß der Großoffensive werde am Rande der Qattara-Senke geführt. Die britischen Panzer, die deutsche Vorposten sichteten, waren Attrappen, die tatsächlichen Kampfwagen wurden im Nordteil der Front als Lastwagen getarnt.
Der Wüstenkrieg war ein Abnützungskrieg; wer am meisten Nachschub hatte, würde ihn gewinnen, ein wenig heldisches, dafür aber logisches Kalkül. Während Montgomery noch abwartete, bis seine Besatzungen mit den neuen Sherman-Panzern zurechtkamen, bis Munition in unübersehbarer Menge herangeschafft war, verstärkte er – als Vorbereitung zur Offensive – die geheimdienstliche Tätigkeit im Rücken Rommels, der in ständiger Nachschubsorge lebte. Während die Briten – zwar umständlich, doch risikolos – ihren Bedarf meistens um das Kap der Guten Hoffnung heranschafften, blieb dem Wüstenfuchs kaum die Hoffnung, durch italienische Konvois über das Mittelmeer versorgt zu werden.
Am dringendsten benötigte er Sprit für seine Panzer, aber immer seltener kamen Tanker durch, und in letzter Zeit wurden ‒ es war die Handschrift der unter dem englischen Major Chapman im Hintergrund operierenden Long Range Desert Group – mit und ohne Erfolg Anschläge auf Tanker, die U-Boot- und Luftsperren durchbrachen und sich an Malta vorbeigemogelt hatten, verübt. Deshalb begann der Morgenappell der Soldaten an den Nachschubsträngen in der Etappe jeweils mit Warnungen und Belehrungen über die Tätigkeit feindlicher Agenten.
Der Fahnenjunker-Unteroffizier Gerwegh, der in der Bomba-Bucht bei Benghasi – die bereits in der Antike ein klassisches Erholungszentrum gewesen war – eine leichtere Verwundung ausheilte, stand unter den Genesenden, die sich den Sermon des Hauptfeldwebels anhören mußten. Immer der gleiche Seich: »Achtung! Feind hört mit!«
Gleich vorbei, tröstete sich der Rekonvaleszent, bald beginnt die Freizeit wieder, und das hieß für die meisten Besuch im zweistöckigen Nachtbums »Oasis«. Das wuchtige Steinhaus, fernab vom Schuß, gehörte dem Ägypter Ali Husseini, und seine Attraktion bildeten zwölf tanzende Künstlerinnen, deren Begabung vorwiegend darin bestand, ihren Körper meistbietend an den Mann beziehungsweise an die Männer zu bringen.
Jedenfalls war die Bomba-Bucht das riesige Erholungsheim der Panzerarmee Afrika, und man zahlte mit Beutezigaretten, mit Corned beef und was sich sonst noch organisieren ließ, denn der pfiffige Ägypter nahm keine müde Mark in Zahlung, solange sie aus Papier bestand.
Doch seit einiger Zeit mied Fahnenjunker-Unteroffizier Gerwegh den fetten Ägypter nebst seiner hüpfenden Dutzendware. Er hatte die rassige Italienerin Manuela, Tochter eines Siedlers aus Tripolis, kennengelernt, die sich nicht früh genug in ihr Heimatland zurückgezogen hatte und von der italienischen Armee als Stabshelferin verpflichtet worden war, ein Mädchen mit langen schwarzen Haaren und braunen Glutaugen.
Zuerst lachten seine Kumpels, dann begannen sie, ihn zu beneiden, und jetzt war der Junge so verliebt, daß er schon fast auf sich selbst eifersüchtig wurde. Wenn er ergriffen in Manuelas große Iris starrte, sah er nur sich darin gespiegelt – wenigstens solange er da war.
»Wie lange wirst du noch im Lazarett bleiben?« fragte die Italienerin. »Quanto tempo? Quanti giorni?«
»Mindestens eine Woche«, antwortete Gerwegh mit großartiger Geste und sah in Manuelas bekümmertes Gesicht. »Vielleicht sogar noch zehn Tage«, setzte er tröstend hinzu. »Mir pressiert es wirklich nicht!«
»E poi?« fragte Manuela. Wie es dann weitergehen würde?
»– muß ich wieder zu meinem Haufen zurück. Aber denk dir nichts, Unkraut vergeht nicht.« Er zündete zwei Zigaretten an und schob Manuela eine in den Mund. »Aber was wird aus dir?«
»Ich hör’ hier auf«, entgegnete das Mädchen, »verlaß dich drauf. Ich will versuchen, nach Italien zu kommen.«
»Wirklich?« rief der Junge begeistert.
»He, Professor«, sprach ihn ein anderer Verwundeter vom Nebentisch aus mit seinem Spitznamen an. »Hältst du wieder Vorträge? Halt lieber Händchen, das ist vernünftiger.«
»Schnauze«, versetzte Gerwegh.
»Genießt den Krieg«, rief ein Betrunkener albern, »der Friede wird furchtbar.« Sie ließen den Kumpel und Manuela sitzen und suchten die »Oasis« auf.
So behütet, wie sich die uniformierten Gäste des Hauses vorkamen, waren sie nicht, denn sie wurden von spionierenden Arabern umlauert. Sie betrachteten die Italiener, die ihnen die guten Landstücke weggenommen hatten, als ihre natürlichen Feinde, und zudem handelten die Tommies nach der Devise: Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft.
Sie kauften die Araber mit Baumwolle, Zucker, Schokolade, Zigaretten und Kosmetika.
Sozusagen mit Blumen für den Harem.
Besonders die Dursas, ein Stamm der Senussis, half den englischen Agenten dabei. Die Kommandounternehmen der Long Range Desert Group starteten von den Stammesverstecken aus. Straßen und Brücken flogen in die Luft; das ohnedies knappe Benzin ging in Flammen auf, und nächtens brannten abgestellte Flugzeuge lichterloh.
In der Höhle des Commando Group Headquarter im Wadi Gherna hockte ein Funker hinter seinem Gerät und rief das versteckte Headquarter der Commando Group in der Oase Siwa.
»Hier Jack five«, tastete der Funker durch. »22 Panzer 3, 15 Panzer 4, in den Werkstätten in Tobruk instand gesetzt, auf dem Weg zur Front ... Eintrifft morgen Benzindampfer für Afrika-Armee ... E-Hafen Derna Konzentration von Stukas und Ju 88. Luftangriff auf Alexandria zu erwarten ...«
Solche und ähnliche Meldungen gingen täglich von den deutschen Linien auf die andere Seite.
Der britische Nachrichtendienst funktionierte ausgezeichnet.
Auf dem Djebel Akhdar – den Grünen Hügeln, die sich von Derna bis Bengasi parallel zur Küste hinziehen –, hockten als Araber getarnte Tommies und lauerten auf ihre Chance; wenn es nach Major Chapman ginge, würden sie eine solche nunmehr in der Bomba-Bucht nutzen.
»Caldo, Rolando?« fragte Manuela ihren neuen Freund. »Ist dir heiß?«
Gerwegh nickte und zog die Italienerin in den Garten nach draußen. Sie tanzten sich zum Hinterausgang durch und verschwanden dann zwischen Palmen, Oleanderbüschen und Agaven.
Gleich neben dem Pavillon war ihr Lieblingsplatz.
Es war frisch geworden, aber die beiden konnten eine Abkühlung brauchen.
Schritte.
Manuela wollte hochspringen, aber der Unteroffizier hielt sie fest, legte ihr warnend die Hand auf den Mund.
Ganz in der Nähe, im Schatten des Pavillons, trafen sich zwei Männer.
Einer von ihnen war Ali Husseini, der Liebeswirt.
Der andere trug die Tracht eines Arabers, aber er sprach Englisch. Kein Pidgin, kein Radebrechen. Es mußte sich um einen echten Engländer handeln.
»Wir müssen den Spritdampfer in die Luft jagen«, sagte der Verkleidete.
»Das wird schwer sein«, antwortete Ali Husseini, »aber wenn Sie Selbstmord verüben wollen ...«
»Wir kommen übermorgen. Sechs Mann. Eine Stunde vor Mitternacht. Du läßt uns ein.«
»Und das U-Boot?« fragte der Ägypter.
»– landet um die gleiche Zeit und setzt Schlauchboote aus.«
»Aber da ist doch die deutsche Wache.«
»Darum sollst du uns ja hinführen«, entgegnete der angebliche Beduine. »Hast du die deutschen Uniformen bekommen?«
»– in Zahlung genommen«, sagte der »Oasis«-Wirt, und Gerwegh glaubte noch im Dunkeln sein schmieriges Lächeln zu sehen.
»Okay«, erwiderte der Engländer. Er war Fachmann; er verschwand geräuschlos. Nicht einmal sein Schatten war zu sehen.
»Che cosa?« fragte die Italienerin. »Was ist los?«
»Niente«, erwiderte der Freund. »Io ti amo.« Er zog Manuela an sich, streichelte ihre Haare, küßte sie
Dann betraten sie durch den Hintereingang wieder den Raum.
»Vor der Kaserne«, tönte wieder einmal Lili Marleen, »vor dem großen Tor.« Gerwegh stürzte sich in das Gewühl der Tanzenden, trank und lachte. Ein Genesender des Panzergrenadierregiments 115, erneut verwundet, doch diesmal von der Liebe.
Am Morgen erwachte er mit Kopfschmerzen und versuchte den Abend aus den Nebeln des Alkohols zu schälen.
Das Gespräch im Garten?
Der Fahnenjunker-Unteroffizier fragte sich, ob er den Zwischenfall geträumt hatte, oder ob er besoffen gewesen war.
Gerwegh fürchtete, sich lächerlich zu machen.
Aber dann hörte er, daß tatsächlich ein Spritdampfer erwartet wurde – und auf einmal sah ein kleiner Statist des Krieges eine Chance, vorübergehend als Star aufzutreten.
Major Chapman ging an der Spitze seiner Leute. Sie waren bewaffnet bis an die Zähne und gewöhnt, leise aufzutreten. Sie pirschten sich querbeet durch das sandige Gelände hinter der Ansiedlung in Richtung Bucht.
Kurz vor dem Ziel stießen sie auf Ali Husseini.
»Wie sieht’s aus?« fragte der Major hastig.
»Everything allright«, entgegnete der Ägypter. »Die Germans kümmern sich mehr ums Bett als um den Sprit.« Er schob einen Packen Geld ein. »Muß zurück«, sagte er dann und hatte es eilig.
Die sechs Tommies erreichten den Pfad, der zum Strand führte.
Die Konturen des Tankers waren auch in der Nacht zu sehen. Auch das kleine Wachgebäude in der Nähe der Pier.
Die Engländer wußten, daß sich hier zwei Posten aufhielten und zwei weitere die Runde machten.
Das erleichterte ihren Plan.
Zwei Tommies arbeiteten sich von rückwärts an das Wachhaus heran und drangen in den kleinen, mit Schilfmatten abgedeckten Hof ein.
Die anderen warteten draußen auf die zurückkehrende Streife.
Als sie sich auf die beiden Posten stürzen wollten, ging schlagartig das Licht an, die überrumpelten Eindringlinge starrten in die Läufe deutscher Maschinenpistolen.
Ihre Arme hoben sich wie von selbst.
In der Nähe fielen Schüsse.
Die restlichen vier Tommies versuchten zu entkommen.
Fahnenjunker-Unteroffizier Gerwegh schoß den vorderen der Gruppe nieder, sprang hoch, wollte sich auf den nächsten stürzen und lief dabei direkt in den Feuerstoß; er überschlug sich wie ein Kartoffelsack.
Er bekam nicht mehr mit, wie seine Kumpels die Engländer schnappten.
Bis auf einen, den Wichtigsten: Major Chapman. Er konnte entkommen.
Die zweite Falle war im Hafen aufgestellt: Flak und Feldgendarmerie erwarteten den zweiten Kommandotrupp, der vom U-Boot aus mit den Schlauchbooten anlanden sollte.
Drei Schnellboote sollten sich auf das U-Boot stürzen.
Schon hoben sich die Schlauchboote ab, man hörte die Schläge der mit Lumpen umwickelten Ruder.
200 Meter noch.
Der Mann am MG verlor die Nerven und schoß zu früh.
Gleichzeitig preschten die drei Schnellboote heran.
Das englische U-Boot ging im Alarmtauchen auf Tiefe, schlug sich mit äußerster Kraft nach Nordosten durch.
Die Feuerstöße des MGs hatten die Schlauchboote durchlöchert.
Einige der Engländer versuchten, auf See zurückzuschwimmen.
Die meisten von ihnen ertranken und wurden von da an in den Mannschaftslisten der Long Range Desert Group als vermißt geführt.
Nur vier von ihnen erreichten ein paar Stunden später, völlig erschöpft, die Küste 2 Kilometer weiter westlich.
Später gelang es ihnen, sich zu ihrem Versteck in den »Grünen Bergen« durchzuschlagen.
Die anderen wurden am Strand von den Deutschen in Empfang genommen.
»Mensch, Mann, dufte, Gerwegh«, sagte Oberst Baade am nächsten Morgen zu dem von drei Schüssen verletzten Fahnenjunker-Unteroffizier. »Sie werden mit einer Ju nach Italien geflogen und können dort bei vino und amore ihre Wunden pflegen.« Der Offizier lachte trocken. »Aber das nächste Mal sind Sie besser nicht so voreilig.« Er wollte weitergehen, blieb aber, gutgelaunt wegen des Scheiterns des britischen Commando Raid, stehen. »Kann ich sonst noch etwas für Sie tun?« fragte er Gerwegh.
»Jawohl, Herr Oberst«, antwortete der Verwundete. »Kann ich Manuela nicht mitnehmen?«
»Wer ist das?« fragte der Offizier, mehr abweisend als interessiert.
»Meine Verlobte«, erwiderte Gerwegh stolz. »Eine Italienerin.«
»Mann, das ist doch gegen die Vorschriften«, versetzte Oberst Baade. »Mal sehen, ob sich ein Ausweg finden läßt.«
Ein paar Tage später ernannte man die Italienerin einfach zur Hilfskrankenschwester, die in der Ju die Verwundeten betreute: einen davon natürlich ganz besonders. So kam Manuela nach Hause – auf der Flucht vor dem Wüstenkrieg und in Gesellschaft ihres deutschen Freundes, der für ein paar Monate aus der Schußlinie war, statt an der El-Alamein-Linie zu liegen, wo in der Vollmondnacht vom 24. auf den 25. Oktober die Feuerhölle ausbrach wie nie zuvor, zwei Tage, nachdem Erwin Rommel zur Kur in die Heimat geflogen war und das Kommando dem General Georg Stumme übergeben hatte, einem hochgewachsenen Panzeroffizier, der Afrika nur aus dem Schulunterricht kannte.
Er hatte keine andere Möglichkeit, als sich auf die Analyse von »Fremde Heere West« zu verlassen, in der vorhergesagt wurde, daß der Feind frühestens im November angreifen könnte, und auf den Nachschub zu warten.
Montgomery hielt sich nicht an diese Prognose, und der Nachschub blieb aus. Einmal mehr rächte sich, daß man versäumt hatte, die Insel Malta zu erobern, als sie noch schwach gewesen war. In rollenden Einsätzen hatten deutsche und italienische Verbände den Flugplatz von La Valetta von 9 Uhr morgens bis Sonnenuntergang bombardiert; der Aufwand war riesig gewesen, die Wirkung bescheiden.
»Nach diesem Fehlschlag bestand für den deutsch-italienischen Nachschub wenig Aussicht auf Besserung«, berichtet Hellmuth Günther Dahms. »Das britische U-Boot ›Umbra‹ (Maydon) versenkte zwei Schnelltransporter, die bisher jedem Angreifer entkommen waren. Aus einem anderen italienischen Konvoi wurden drei Frachter in den Grund gebohrt und zwei andere dermaßen zugerichtet, daß sie umkehren mußten. Von 353000 Tonnen Versorgungsgütern, die allein das Deutsche Afrikakorps (Thoma) benötigte, erreichten im Oktober nur 18300 Tonnen libysche Häfen, darunter lediglich 4000 Tonnen Benzin.
So war die Schlacht bei El Alamein schon entschieden, ehe sie begann. Die zwischen Mittelmeer und Qattarasenke eingegrabene Panzerarmee (Rommel) zählte 62 Bataillone, 90 leichte und 28 schwere Batterien, dazu 252 deutsche und 323 italienische Panzer, insgesamt fast 90000 Mann mit 500 Gramm Tagesbrotration ohne genügend Zukost, I,5 bis 2 Ausstattungen Pakmunition, 3,1 bis 3,5 für die übrige Artillerie und 5,5 Versorgungssätze (3900 cbm) Treibstoff. Etwa 30 Prozent der Kraftfahrzeuge waren in Reparatur. Die Zahl der einsatzbereiten Flugzeuge betrug 372 Maschinen.
Demgegenüber hatte das britische Mittelostkommando (Alexander) die 8. Armee (Montgomery) mit amerkanischer Hilfe aufgefüllt und neu ausgestattet. Sie zählte rund 150000 Mann, zur Hälfte Engländer und Schotten, im übrigen Australier und Neuseeländer, Inder und Südafrikaner, Gaullisten und Griechen. Ihrer Infanterie halfen 1582 Geschütze und 1114 Kampfwagen (darunter etwa 500 38-Tonner ›Churchill‹ und 31-Tonner ›Sherman‹). Zur taktischen Unterstützung startete die Western Desert Air Force (Coningham) 605 Jagdmaschinen und 315 Bombenflugzeuge.
Trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit stand Montgomery vor einer schwierigen Aufgabe. Er konnte die deutsch-italienischen Stellungen nicht im Süden umgehen, sondern mußte durch eine tiefgegliederte Hinderniszone (Teufelsgärten) frontal angreifen. Auf diese Sperren und vier schnelle, zur Hälfte gepanzerte Divisionen, mit denen man aus der Nachhand schlagen konnte, setzten Feldmarschall Rommel und sein Stellvertreter, General Stumme, ihre Hoffnungen ...«
Das Trommelfeuer kam plötzlich, und es blieb einseitig, denn die deutsche Artillerie, schon knapp an Munition, konnte nicht zurückfeuern. Die englischen Soldaten hatten eben ein kaltes Essen zu sich genommen, und als Nachtisch wurde ihnen der Tagesbefehl ihres neuen Oberbefehlshabers verlesen. »Jetzt ist es nur noch notwendig, daß jeder von uns, jeder Offizier und Mann, in diese Schlacht geht mit der unerschütterlichen Entschlossenheit, sie durchzustehen, zu kämpfen und zu töten und schließlich zu gewinnen«, benutzte Montgomery die großen Worte, wie sie der Krieg braucht. »Wir werden den Feind schlagen und aus Nordafrika hinauswerfen.«
Um 21 Uhr 40 hatten auf einer Frontbreite von 60 Kilometern 1500 Geschütze den Tod in die Nacht gespuckt. Schwere Werfer waren herangeschafft worden, die neuen 10,5-cm-Kanonen hatten auf diesem Kriegsschauplatz eine schaurige Premiere. Das Feuer wurde alle 500 Sekunden 100 Meter tiefer in die deutschen Linien verlegt, und im Schutz der Feuerwalze starteten Infanteristen unter großen Verlusten den Angriff, aber 150000 britische Soldaten trieben die Offensive voran.
»Im Norden, wo Montgomery seinen Hauptangriff vorzutragen gedachte, lagen zwei Minenfelder: eines vor den vordersten Linien der Deutschen, eines dahinter«, schreibt Mark Arnold-Forster. »Die ersten Angriffe, die von der neuseeländischen Division vorgetragen wurden, schlugen Breschen durch das erste Minenfeld ...«
An der Spitze marschierten Dudelsackpfeifer, und in kurzen Feuerpausen konnte man ihre grelle Musik hören. General Stumme wurde als verschollen gemeldet, und Hitler rief Rommel an und beorderte ihn nach Nordafrika zurück.
Sein Eintreffen und die Auffindung seines toten Stellvertreters fielen zeitlich zusammen: In der Nähe der Höhe 28 war Stumme in seinem Kübelwagen in einen Überfall geraten. Sein Begleiter fiel; der korpulente General, der an Bluthochdruck laborierte, erlitt, vom Trittbrett fallend, einen tödlichen Herzanfall, während sein Fahrer, ohne es zu bemerken, weiterrollte.
Zwei Tage lang hatte man nach dem General gesucht, und zwei Tage lang war der englische Einbruch weiter vorangekommen. Die 15. Panzerdivision verfügte nur noch über 31 einsatzfähige Kampfwagen, von 119. Rommel sah sofort, daß ihm nur die Chance blieb, sich in die Fuka-Stellung zurückzuziehen und dort auf Nachschub zu warten. Aber der Tanker »Proserpina« wurde mit 7000 Tonnen beim Einlaufen in Tobruk versenkt, und auch das Ersatzschiff »Louisiano« landete auf dem Meeresgrund. Der Wüstenfuchs verfügte mittlerweile nur noch über 32 Panzer – 32 gegen 1100 gegnerische.
Beim sogenannten Heiligen Grab von Sidi Omar schlug er seinen neuen Gefechtsstand auf, und hier erreichte ihn, wie befürchtet, Hitlers Durchhaltebefehl. »Es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte, daß der stärkere Wille über die stärkeren Bataillone des Feindes triumphiert«, hatte ihm der Führer telegrafiert. »Ihrer Truppe aber können Sie keinen anderen Weg zeigen als den zum Sieg oder zum Tod.«
Rommel gehorchte zunächst und brach den Rückzug ab. Die italienische Elitedivision »Ariete« schlug sich bravourös, wurde aber von Montgomerys Truppen restlos aufgerieben. Das gleiche Schicksal erlitt die Division »Littorio«. Auf dem rechten Flügel wartete die italienische Division »Trieste« die Katastrophe nicht erst ab, sondern ging befehlswidrig in den Rückzug.
An der deutschen Front gelangen den Engländern weitere Einbrüche. Sie überrannten den Gefechtsstand der 15. Panzerdivision, fanden Kisten mit Eisernen Kreuzen und schmückten sich damit, bevor sie weiterstürmten. Das Afrikakorps verfügte jetzt noch über 12 Panzer. Schon in der ersten Etappe der britischen Offensive hatten die Achsenmächte 25000 Tote und Verwundete zu beklagten: 30000 Soldaten – mehr als jeder dritte davon ein deutscher – hatten sich ergeben. Rommel war kein Paulus; in dieser aussichtslosen Lage befahl der Wüstenfuchs – entgegen ausdrücklichem Hitler-Befehl – den Rückzug auf die Fuka-Linie. »Ich werde vors Kriegsgericht kommen«, sagte er zu seinen Offizieren, »aber bei den gegenwärtigen Umständen ist es meine Pflicht, nicht zu gehorchen.«
Am nächsten Tag hatte Hitler begriffen, daß mit Phrasen ein mindestens zehnfach überlegener Feind nicht zu schlagen war. Er billigte nachträglich Rommels Rückzugsbefehl, aber es war klar, daß die Briten auch in der Fuka-Linie nicht aufgehalten werden konnten. Obwohl Montgomery ein fast übervorsichtiger Verfolger war und den Deutschen ein schwerer Sandsturm zu Hilfe kam, näherten sich die englischen Angriffsspitzen bereits Tobruk und Benghasi: Es drohte der Verlust der ganzen Cyrenaika, und schon vor Anlaufen der »Operation Torch« hielt der Wüstenfuchs den Krieg in Nordafrika für verloren.
Wie an jedem anderen Tag lacht, tanzt, trinkt und flirtet Algier an diesem 7. November 1942. Die Gesellschaft benimmt sich, als wollte sie den Krieg gewaltsam ignorieren, und niemand scheint zu ahnen, daß die Kriegsfurie in wenigen Stunden auch in dieses Reservat des Friedens und der Neutralität einbrechen wird. Die Nachrichten, die von der Montgomery-Front kommen, lassen die meisten Franzosen aufhorchen, aber sie bleiben zurückhaltend, wissend, daß im Krieg noch mehr gelogen wird als auf der Jagd und in der Liebe.
Algiers Straßenbild wirkt friedlich, aber unter einer oberflächlichen Tarnung wird gehaßt und gehofft, geheuchelt und gedroht, angedeutet und verwischt. Es scheint Nicole Lemaire, die immer tiefer in die Maschen dieses Verwirrspiels verstrickt wird, als wollten alle Franzosen das gleiche und kämpfte doch jeder gegen jeden. Vielleicht hätte sich eine schöne Frau aus diesen politischen Zeitläuften heraushalten sollen, noch dazu, wenn ihr Bruder auf der anderen Seite kämpft, aber vielleicht ist gerade das der Grund, warum die junge Witwe im Lager des Hauptmanns Prenelle und seiner Hintermänner steht. Sie weiß nicht genau, ob es Liebe ist oder Patriotismus, vielleicht von beidem die Hälfte.
Schon sammeln sich die alliierten Verbände an den vorbestimmten Positionen, aber die Landung steht Spitz auf Knopf: Englische U-Boote haben vor der marokkanischen Küste eine meterhohe Brandung gemeldet, ein gefährliches Hindernis für die flachen Landungsboote.
In seinem Hauptquartier auf dem Felsennest Gibraltar überlegt General Eisenhower – zu diesem Zeitpunkt des Krieges als wenig erfahrener Offizier noch ein unbeschriebenes Blatt –, ob er die »Operation Torch« verschieben soll.
Aber wohin mit den vielen Schiffseinheiten in dem allzu engen Hafen?
Mit unguten Gefühlen entschließt sich der US-Oberkommandierende zur Flucht nach vorne – die Landung soll anlaufen. Torch heißt zu deutsch »Fackel«, aber niemand kann zur Stunde sagen, ob sie leuchten oder verglühen wird. Gelingt die Landung, wird sie eine Wende des Krieges einleiten.
Aber zunächst wissen nur wenige Menschen in Frankreichs nordwestafrikanischen Kolonien um das Landeunternehmen, und diese sind nervös wie Debütantinnen vor der Polonaise – denn diese Polonaise kann blutig sein.
Den ganzen Tag ist US-Vizekonsul Miller – gleich seinen zehn Kollegen – auf den Beinen. Eine Verabredung jagt die andere, aber nicht jede ist so reizvoll wie das Rendezvous mit Nicole, die er in einem kleinen Tagescafé – wie zufällig – trifft.
»Noch immer verliebt in Hauptmann Prenelle?« fragt er belustigt.
»Ein wenig«, antwortet Nicole.
»Ich bin richtig eifersüchtig«, behauptet der angebliche Diplomat, »aber der Mann ist der Richtige für Sie.« Miller lächelt anzüglich. »Und sicher auch für uns.« Der angebliche Diplomat spricht halben Klartext. Er muß sich auf diese Französin verlassen, vor allem, weil er etwas von ihr will. Sie wirkt adrett und gepflegt wie immer, aber sie zeigt Spuren von Nervosität.
»Was ist los, Nicole?« fragt der Untergrundmann.
»Der deutsche Attaché, dieser Melzer, will Namen französischer Offiziere haben, die mit den Alliierten sympathisieren«, erwidert sie. »Heute noch – ich hab’ ihn schon eine Weile hingehalten.«
»Diesen Wunsch können wir ihm gerne erfüllen«, versetzt der OSS-Agent, nennt aus dem Kopf eine lange Reihe von Namen, ausnahmslos Offiziere des französischen 200000-Mann-Heeres, die er für Vichy-treu hält. »Wenn Sie die Hälfte behalten«, sagt Miller, »haben Sie Freund Melzer bereits bestens bedient.«
»Schon gut.« Nicole trägt ein hübsches Pariser Kostüm, zitronengelb, wie auf die Haut geschneidert. Dazu meergrüne Augen, blauschwarze Haare und ein Paar wohlgeformte Beine, die den Vizekonsul seine Sorgen vergessen lassen könnten, so er Zeit dazu hätte.
»Noch eine Bitte, Nicole«, schließt der Amerikaner das Gespräch. »Sie müssen heute abend eine kleine Party arrangieren.«
»Morgen«, erwidert sie. »Oder übermorgen.«
»Es muß heute sein«, entgegnet der OSS-Agent. »Mehr kann ich Ihnen nicht sagen, aber morgen werden Sie es begreifen.«
»Dann haben Sie sicher auch schon die Gästeliste parat?« antwortet die Französin.
»Sure«, versetzt der Yankee. »Die meisten der Herren kennen Sie ohnedies. Bitte rufen Sie sie sofort der Reihe nach an und bitten Sie sie heute abend in Ihre Villa. Entlassen Sie keinen aus der Obligo.« Er lächelt süffisant. »Ein paar hübsche Damen habe ich schon dazu gebeten.« Miller steht auf und nickt Nicole zu. »Sie sind ja konkurrenzlos.«
Der Amerikaner entfernt sich so unauffällig, wie er gekommen ist. Nach dem Treffen mit dem deutschen Attaché geht Nicole daran, überstürzt ihre Gäste einzuladen. Als sie die Namensliste noch einmal durchgeht, erschrickt sie; es sind ausnahmslos Offiziere und Zivilisten, die sich verschworen haben, jede Gelegenheit wahrzunehmen, um gegen die Deutschen zu kämpfen. US-Vizekonsul Miller hatte ihnen bisher eingetrichtert, sich so wenig wie möglich miteinander sehen zu lassen.
Wenn der OSS-Agent so plötzlich sein eigenes Verbot übertritt, muß etwas los sein.
Als Nicole am Abend in ihrer Villa in der Nähe des Flugplatzes Maison Blanche ihre Gäste empfängt, versucht sie, ihre Erregung zu überspielen.
»Was hast du heute?« fragt Hauptmann Prenelle.
»Migräne«, antwortet Nicole, »halb so schlimm –«
»Sonst nichts?« fragt der Offizier mißtrauisch.
»Nichts«, versetzt Nicole. »Nicht das Geringste.«
»Mit uns hat es nichts zu tun –?«
»Aber nein –«, entgegnet die junge Französin.
»Liebst du mich noch?«
»Aber ja –«
»Das könnte begeisterter klingen«, erwidert Prenelle.
»– wenn die Migräne nicht wäre«, sagt Nicole lachend.
Sie hat alle Mühe, daß ihre Party, auf der jetzt auch Vizekonsul Miller erscheint, nicht verunglückt.
»Ich habe eine Nachricht für Sie«, raunt ihm Nicole zu, »Admiral Darlan ist heimlich in Algier eingetroffen.«
»Darlan?« erwidert der Amerikaner erschrocken. »Sind Sie sicher?«
»Absolut.«
»Auch das noch«, brummt Miller. Sosehr er sonst sein Gesicht beherrscht, jetzt gerät es aus den Fugen. Seine Hand streicht fahrig über den schmalen Pferdeschädel mit den weißen, sorgfältig geschnittenen Haaren.
Der Admiral gilt als der starke Mann von Vichy, als Halbfaschist, der mit den Deutschen willig zusammenarbeitet. Der Chef der französischen Marine hat lauthals und wiederholt erklärt, daß er seine Verbände im Falle eines Angriffs rücksichtslos auch gegen englische und amerikanische Verbände einsetzen werde.
Wenn dieser dubiose Mann nunmehr überraschend und heimlich nach Algier gekommen ist, dann muß das ganze »Unternehmen Torch« verraten sein.
Dann sind die Deutschen gewarnt.
Und die Franzosen in ihrem Schlepptau wach und bewaffnet bis an die Zähne.
Dann fährt das englisch-amerikanische Expeditionskorps direkt in feurige Kanonenschlünde.
»Darlans Sohn ist erkrankt«, sagte Nicole. »Kinderlähmung. Lebensgefährlich«, fährt sie fort. »Er will ihn nach Frankreich überführen, in eine Spezialklinik.«
»Wann?« fragt Vizekonsul Miller hart.
»Morgen.«
»Bluff«, erwidert der Amerikaner düster.
Nicole Lemaire wehrt sich verzweifelt dagegen, daß ihre Party heute danebengeht. Sowie ein Gast das Haus verlassen will, wird er von Vizekonsul Miller beinahe gewaltsam daran gehindert. Der Amerikaner ergeht sich in wirren Andeutungen, schaut zwischendurch immer wieder auf die Uhr.
Während die Gastgeberin versucht, die flaue Stimmung zu beleben, hebt sich an der marokkanischen Küste der Vorhang über einem blutigen Drama.
Bei der im Schutze der Nacht heranschwimmenden »Western Task Force 34« wird das Signal »Play ball!« gegeben.
Mündungsblitze zerreißen die Nacht. Granaten platzen in den Quartieren schlafender Soldaten. Während die Landetruppen sich an den Strand von Casablanca heranarbeiten, feuern die französischen Küstenbatterien gegen einen Feind, den sie nicht kennen.
Die Deutschen? Die Engländer? Oder die Bewohner des Mars?
Die Zerstörer »Cole« und »Bernadou« schießen die Verteidiger in Klumpen. Das Schlachtschiff »New York«, der Kreuzer »Philadelphia«, die Zerstörer »Mervine« und »Beatty« rotzen Breitseite auf Breitseite aus allen Rohren.
In diesem Moment sagt Vizekonsul Miller zu den versammelten Offizieren und Zivilisten in Nicoles Villa: »Meine Herren, ich habe Ihnen eine wichtige Mitteilung zu machen.« Er spricht rasch, als störe ihn ein unguter Geschmack im Mund. »Ein englisch-amerikanisches Invasionskorps landet zur Stunde an mehreren Positionen der nordafrikanischen Küste.«
Die Nachricht schlägt wie eine Bombe ein, und im ersten Moment löst die Explosion mehr Zorn als Freude aus.
»Und warum sagt man uns das erst jetzt?« ruft Prenelle erregt.
»Jetzt ist keine Zeit zum Reden«, erwidert der OSS-Agent und zieht den Kopf zwischen die Schultern. »Wir müssen jetzt handeln, Monsieur le Capitaine. Ich denke, wir sitzen alle im gleichen Boot. Sehen Sie zu, daß Franzosen nicht auf Engländer und Amerikaner schießen.« Dann erklärt Miller den Versammelten, daß gleichzeitig auch in Algier und Marokko alliierte Landungen stattfinden werden. Er wendet sich wieder an die Gastgeberin. »The party is over!« sagt er. »Und Sie müssen mir noch einmal helfen, Nicole. Ich brauche Sie. Jetzt, sofort.«
»Sie können mit mir rechnen«, erwidert die Französin, erleichtert, daß sie nunmehr offen reden kann.
»Wir müssen sofort nach Tunis fliegen«, erklärt der Amerikaner.
»Tunis?« fragt die Französin verständnislos.
»Ja – Sie sind doch eine gute Bekannte von General Estéva. Wir müssen versuchen, ihn zum Abfall von Vichy zu bewegen.«
»Da beißen Sie auf Granit«, entgegnet Nicole.
»Probieren wir es«, drängt der Agent. »Wenn er Blut sparen will, bleibt ihm keine andere Wahl.«
Seit Wochen war etwas los gewesen im Mittelmeer. Die deutschen Beobachter von Algeciras hatten es gemeldet: Seit Tagen besonders starke Schiffsbewegungen, Material- und Truppentransporte. Man hielt es für Verstärkungen für die von deutschen und italienischen Flugzeugen beinahe täglich angegriffene Insel Malta. Jedenfalls liefen beim Oberbefehlshaber Süd, bei Generalfeldmarschall Albert Kesselring, in Rom von allen Seiten Meldungen ein, deren Bedeutung von den Auswertern verkannt worden war.
»Die Achsenmächte hatten die Landung in Nordafrika nicht erwartet, obgleich sie seit dem Waffenstillstand mit Frankreich 1940 ein solches Unternehmen der Alliierten immer befürchteten«, schreibt Herbert Michaelis, »und wurden daher völlig überrascht, obwohl Warnungsmeldungen eingegangen waren. Da die deutschen U-Boote die zahlreichen alliierten Invasionskonvois nicht bemerkt hatten beziehungsweise die Schiffsansammlung in Gibraltar für die Vorbereitung eines Geleitzuges nach Malta hielten, den sie im westlichen Mittelmeer abzufangen hofften, konnten diese ungehindert die afrikanischen Häfen erreichen.«
Am Anfang der ersten gemeinsamen Landeoperation hatte bei den Alliierten die Zwietracht gestanden. Stalin drängte immer mehr auf die Errichtung einer zweiten Front. Er ging so weit, über Mittelsmänner in Stockholm Hitler einen Sonderfrieden anzubieten. Noch heute steht nicht fest, ob der rote Diktator die Offerte ernst gemeint hat oder nur seine ungleichen Bundesbrüder erpressen wollte.
Wie immer war Roosevelt nur zu geneigt, »Uncle Joe« entgegenzukommen. Er wollte deshalb die Invasion auf dem europäischen Kontinent bereits im Jahre 1943 riskieren. Churchill war dagegen: Er hielt diesen Zeitpunkt für verfrüht. Er plädierte dafür, in Nordafrika zu landen, um von hier aus Schläge gegen den »weichen Unterleib Europas« zu führen. Erst als der britische Premier ausdrücklich garantierte, daß die Landung in den französischen Kolonien kein Ersatz für die »Operation Round up« – die später unter dem Decknamen »Overlord« gestartet wurde – wäre, stimmten der US-Präsident und sein Berater unter der Maßgabe zu, daß nicht mehr als 250 000 Soldaten benötigt würden.
Es gab eine Reihe von Bedenken, die man nicht von der Hand weisen konnte. Völkerrechtlich gesehen beging Amerika einen glatten Bruch der Neutralität, und viele Politiker und Militärs in Washington waren der Meinung, man solle – Hitler bekämpfend – nicht Hitlers Beispiel in Dänemark, Norwegen, Holland, Belgien und Luxemburg folgen.
Ein Fragezeichen war auch das Verhalten der Spanier. Sie hatten sich bislang aus dem Krieg herausgehalten – obwohl General Franco nur mit Hitlers und Mussolinis Hilfe aus dem Bürgerkrieg als Sieger hervorgegangen war –, aber wie würden sie reagieren, wenn vor ihrer Haustür die Anglo-Amerikaner überfallartig – ohne Erklärung oder wenigstens Entschuldigung – die nordafrikanischen Besitzungen Frankreichs erobern würden?
Auch vom rein strategischen Standpunkt aus war das erste alliierte Landemanöver umstritten. General Montgomery war dabei, ganz Nordafrika von Osten nach Westen aufzurollen. Wenn er erst Rommel bis an die tunesische Grenze zurückgedrängt hatte – womit man mit Sicherheit rechnen konnte ‒, würden den Alliierten ohne Blutvergießen Tunesien, Algerien und Marokko zufallen.
Das Verhalten der Franzosen blieb ein großes Risiko, das nicht genau eingeschätzt werden konnte. In Souveränitätsfragen galten sie von jeher als besonders empfindlich. Man brauchte einen französischen Repräsentanten an der Spitze des Unternehmens, der faszinierend und einflußreich genug war, um seine Landsleute – trotz aller Bedenken, die sie haben mochten – bereits in der ersten Stunde mitzureißen und auf die Seite der Anglo-Amerikaner zu ziehen. Da General de Gaulle bei den meisten Militärs – zu dieser Zeit – noch als umstritten galt, wurde er an der »Operation Torch« nicht beteiligt, ja nicht einmal über sie informiert. Daß die erste Stimme des Freien Frankreichs bei diesem entscheidenden Manöver abgeschaltet worden war, würden die Gaullisten den Anglo-Amerikanern noch lange Zeit verübeln. Es gab beständig Reibereien mit dem aus Lothringen stammenden französischen General, der sich als erster gegen die Vichy-Regierung aufgelehnt hatte, die Churchill nach dem Krieg zu der Bemerkung veranlaßten: »Das schlimmste Kreuz, das ich zu tragen hatte, war das Lothringer Kreuz.«
In dieser Situation erinnerte man sich an den General Henri Giraud, der vor kurzem eine spektakuläre Flucht aus der sächsischen Festung Königstein und damit aus der deutschen Kriegsgefangenschaft geschafft hatte. Heimlich und offen feierten die Franzosen diese Tat, die Vichy offensichtlich ungelegen kam, denn sie verschlechterte die Beziehungen zur deutschen Besatzungsmacht ganz erheblich. Ausliefern an die Deutschen konnte man Giraud nicht: Marschall Pétain versuchte den General zu überreden, freiwillig zurückzukehren. Giraud schwankte tatsächlich einen Moment. Dann gab er Vichys Staatschef sein Wort, künftig auf jede subversive Tätigkeit gegen die Deutschen zu verzichten; so konnte er ein argwöhnisch beobachteter Gast im eigenen Land bleiben.
Giraud schien der rechte Mann zu sein, aber er stellte die Bedingung, die »Operation Torch« – an der nicht ein einziger Franzose teilnahm – zu leiten. Entweder war es ein Mißverständnis, oder die Unterhändler – OSS-Agenten im unbesetzten Frankreich – gingen zunächst auf jede Bedingung ein, um den Umworbenen mit Hilfe eines U-Boots aus Frankreich herauszuschleusen. Es gab die erste Überraschung: Vichy hatte nach der Tragödie von Mers el Kébir den Engländern den Krieg erklärt, und der ehrsüchtige General wollte nicht an Bord eines englischen Schiffes gehen.
Das U-Boot mußte vorübergehend in amerikanische Dienste gestellt werden. Bei der Landung war der Seegang so hoch, daß Giraud ins Wasser fiel und aufgefischt werden mußte. Als man ihn zu Eisenhower in den unterirdischen Befehlsstand Gibraltars brachte, meldete sich der Franzose mit den Worten: »General Giraud ist bereit, die Landeoperation zu leiten.«
Man machte dem Franzosen höflich klar, daß davon keine Rede sein könne. Einer der Offiziere schlug dem US-Oberkommandierenden vor, Giraud nominell zum »Torch«-Leiter zu ernennen, aber das lehnte Eisenhower ab. »Dann wird Giraud nur Zuschauer sein«, entgegnete der Franzose und zog sich in den Schmollwinkel zurück.
»Seine Flucht war eine sportliche Glanzleistung gewesen«, urteilt Raymond Cartier über den General, »aber was seine sonstigen Leistungen während des Zweiten Weltkriegs betraf, mußte er als ein General gelten, der am zweiten Tag schon besiegt und am siebten gefangengenommen worden war.«
Eisenhowers Haltung gegenüber Girauds Selbstüberschätzung und Eitelkeit wurde in Washington – wo man verärgert über die Zeitverschwendung war – gebilligt. Es blieb ohnedies keine Zeit mehr für Eingriffe oder Änderungen: Die Operation war bereits angelaufen, und die »Western Task Force«, ein amerikanischer Mammutkonvoi von 102 Schiffseinheiten, am Morgen des 23. Oktober aus der Casco Bay, Maine, ausgelaufen, begleitet von dem Flugzeugträger »Ranger«, gefolgt von den Trägern »Suwannee«, »Sangamon«, »Santee« und »Chenango« unter General George C. Patton, und die englische »Eastern Task Force« unter Admiral Ryder dampften auf ihre Ziele zu und eröffneten das Feuer auf die überrumpelten Verteidiger. Die französischen Küstenbatterien schossen bereits zurück, bevor sie überhaupt wußten, wer sie im Schlaf überfallen hatte. Der Himmel trug keine Sterne. Die Nacht war wie ein dunkler Vorhang, als die Lichtarme der Scheinwerfer nach den Landungsbooten griffen. Sirenen heulten. Poilus hasteten durcheinander. Verstörte Zivilisten rannten auf die Straßen, mitten in die Einschläge krepierender Granaten.
Nach der ersten Überrumpelung wehrte sich die französische Armee energisch. Blutiger Kampf bei Safi. Wildes Duell im Hafen von Méhadia, 65 Meilen nördlich von Casablanca. Bei Fédala versuchten 200 00 US-Soldaten, auf 15 Transporter verteilt, das Land zu stürmen.
Doch die französische Küstenartillerie hielt sie in Schach. Ihre Granaten detonierten an Bord des Zerstörers »Murphy«, bis die Batterie im konzentrierten Feuer der Invasoren zum Schweigen gebracht wurde.
7 französische Zerstörer griffen die Invasionsflotte an, zerschossen den US-Zerstörer »Ludlow« und drehten erst bei, als die überlegenen US-Kreuzer »Augusta« und »Brooklyn« sie dazu zwangen. In Casablanca wehrten sich die französischen Batterien bis zur letzten Granate; sie hielten dem Feuer der in der Bucht kreuzenden US-Sicherungsgruppe – 1 Schlachtschiff, 2 Kreuzer und 4 Zerstörer – stand.
Das am Cap Hank liegende französische Schlachtschiff »Jean Bart« wehrte sich noch als Wrack.
Französische Jagdflieger schossen US-Aufklärer ab. Vom Flugzeugträger »Ranger« hoben sich die Maschinen, um 6 französische Zerstörer anzugreifen. Schiff um Schiff wurde zu Schrott geschossen. Blut floß über die rauchgeschwärzten Deckplatten. In einem Tornado aus Feuer und Stahl ging Frankreichs nordafrikanische Flotte unter.
Obwohl der französische Admiral Michellier bald nur noch einige U-Boote haben sollte, lehnte er noch drei Tage nach dem Überfall einen Waffenstillstand ab, den ihm die Amerikaner anboten.
Die übertriebene Geheimhaltung rächte sich blutig: Natürliche Bundesgenossen, die Seite an Seite gegen den gemeinsamen Feind kämpfen sollten, die sich unter normalen Umständen freudig in die Arme gefallen wären, mordeten einander im nächtlichen Durcheinander. Tausende ereilte an diesem 8. November 1942 ein selbst noch für den Krieg sinnloser Tod.
Die Landung in Marokko war kein Spaziergang, auch wenn es dem ungestümen US-General Patton gelungen war, nach Brechung des französischen Widerstandes 37000 Soldaten und 200 Panzer an Land zu bringen.
Der Kavallerist, der nunmehr seine Attacken mit Panzern ritt, sollte sich schon bald den Ruf verdienen, Amerikas schillerndster Heerführer zu sein, geliebt von seinen Soldaten, die ihm den Ehrennamen »Lucky Forward« verliehen, doch eine ständige Provokation für die Politiker, die sich weit vom Schuß befanden. Patton wollte nicht auf die Franzosen feuern, sondern auf Hitlers Soldaten, aber kein einziger von ihnen war in Französisch-Nordafrika stationiert. Das Fiasko, das man bei der Planung der »Operation Torch« befürchtet hatte, schien sich nunmehr zur Katastrophe auszuweiten.
Die Verschwörer um General Mast im Salon der Madame Nicole Lemaire, im letzten Moment in die Landung eingeweiht, schüttelten die Verärgerung ab und begannen ihre Offizierskameraden zu überzeugen, daß sie künftig gegen einen andern Gegner zu kämpfen hätten. So war Algier die einzige Stadt, in der die amerkanischen Angreifer und der französische Untergrund von vornherein Hand in Hand arbeiteten.
Robert Murphy, der Sonderbeauftragte des US-Präsidenten, besuchte General Juin in seiner Villa Les Oliviers in El Bair und forderte ihn auf, den Kampf einstellen zu lassen. Der General, vor Zorn so rot wie sein Pyjama, berief sich auf Admiral Darlan, der sich in Algier aufhalte und formell der Oberbefehlshaber über alle Vichy-Truppen sei. Das Gerücht stimmte also. Tatsächlich war der Admiral inkognito nach Nordafrika gekommen, um seinen an Kinderlähmung erkrankten Sohn nach Frankreich zu holen.
Von General Juin begleitet, suchte Robert Murphy den Admiral, der in der Villa eines französischen Marineoffiziers abgestiegen war, auf, um ihm die Situation zu eröffnen. François Darlan – über den Churchill gesagt hatte: »So sehr ich Darlan auch hasse, ich würde vor ihm eine Meile auf dem Brauch kriechen, wenn er uns nur die Flotte von Toulon brächte« – erwiderte mit den Worten: »Ich weiß schon lange, daß die Engländer ein stupides Volk sind. Die Amerikaner hätte ich für klüger gehalten, aber jetzt sehe ich ein, daß die einen so gut sind wie die anderen. Wenn Sie nur ein paar Wochen Geduld gehabt hätten, wären wir zum gemeinsamen Handeln gekommen ... Jetzt muß ich mich fragen, was aus meinem Land werden soll.«
Zornig verließ Darlan die Wohnhalle. Der Amerikaner folgte ihm, redete auf ihn ein und sprach – die tatsächliche Zahl verdoppelnd – von einem 500000 Mann starken Invasionsheer. Er kannte offensichtlich den Ausspruch des Admirals: »Wenn die Anglo-Amerikaner mit 50000 Mann landen sollten, lasse ich auf sie schießen. Kommen sie aber mit 500000, dann heiße ich sie willkommen.«
Als Roosevelts Botschafter behauptete, General Giraud hätte um die Aktion gewußt und sich mit ihr einverstanden erklärt, war es, als hielte der Yankee dem Franzosen ein rotes Tuch vor.
»Giraud«, tobte Darlan, »der taugt allenfalls zum Divisionsgeneral! Er ist ein Kind. Er hat von nichts eine Ahnung. Er wird auch für Sie zu nichts gut sein.«
Beim Spaziergang im Garten beruhigte sich der Admiral allmählich wieder, aber er ließ sich auf keine Vereinbarung ein; er arbeitete auf Zeitgewinn und wollte sich vor seiner Entscheidung erst mit Marschall Pétain in Verbindung setzen. Auch General Juin war im Aufbruch zu seiner Truppe; Murphy konnte es nicht verhindern. Er war gezwungen, auf die Empfindlichkeit der beiden Franzosen Rücksicht zu nehmen, aber er stand unter extremem Termindruck.
Solcherlei Rücksicht nahm eine Gruppe junger Männer aus dem Kreis um General Mast, die plötzlich auftauchte und die Villa umstellte, nicht. Mit vorgehaltenen Maschinenpistolen verstellten sie Admiral und General den Weg.
»Was soll das heißen?« fuhr sie Juin an. »Sind wir nun Gefangene?«
»Es sieht so aus«, erwiderte Murphy trocken.
Kurze Zeit später nahmen die Wirren der Nacht eine weitere überraschende Wende: Mitglieder der Mobilgarde, einer Einheit der Polizei, erschienen, nahmen die Rebellen fest und befreiten ihre prominenten Landsleute, auf die es in dieser Stunde ankam. Als sich die verspäteten US-Fahrzeugkolonnen endlich Algier näherten, entschloß sich Darlan, den Franzosen Befehl zur Feuereinstellung zu geben. Die Amerikaner zählten 700 Gefallene, sie hatten bis jetzt 29 Schiffe verloren, darunter 3 Zerstörer und 7 Transporter, aber »dem Waffenstillstand in Algier war die Partnerschaft der französischen Streitkräfte in Nordafrika mit den Alliierten gefolgt«, stellte Raymond Cartier fest. »Giraud, der schriftlich sein Wort gegeben hatte, der Deutschlandpolitik Pétains kein Hindernis in den Weg zu legen, hatte am 13. November den Oberbefehl übernommen und den französischen Truppen Order erteilt, den Vorstoß der Alliierten nach Tunesien zu decken. Juin, der unterzeichnet hatte, was früher beim Militär ein ›Revers‹ genannt wurde, hatte sich unter Girauds Kommando gestellt und bis dahin unschlüssige Generale wie Mendigal und Koeltz mitgezogen. Darlan war mit Feuer in seine Rolle eines Rächers des Vaterlandes geschlüpft, wobei übrigens die Deutschen – nach dem Zeugnis von Goebbels’ Tagebuch – sein geheimes Einverständnis mit Pétain voraussetzten.«
Die Gaullisten, die eigentlichen Rebellen von Vichy, standen vergrämt noch immer im Abseits. Ihre Zeitungen schlugen einen harten antiamerikanischen Ton an. In »La Marseillaise« hieß es wörtlich: »Die Tatsache, daß unsere amerikanischen Verbündeten Gebiete besetzen, die uns so viel Blut gekostet haben, trifft unser Land viel mehr als die Besetzung einiger unserer Départements durch die Nazis, denn es trifft unsere Ehre.«
Ein leidenschaftlicher Anhänger de Gaulles beendete auch Darlans Auftreten als Freiheitskämpfer. Er verschaffte sich am Weihnachtsmorgen Zutritt zu dem Haus des Admirals und erschoß ihn. Er wurde dafür zum Tode verurteilt. Die halbe Welt bat um Gnade für den Attentäter. Vergeblich. Zwei Tage später wurde das Urteil – unangekündigt – vollstreckt. Die Hintergründe konnten niemals genau geklärt werden.
Jene Männer, die nun ihre Haltung änderten oder sich früherer Bindungen entledigten, hatten dafür sehr überzeugende Gründe, doch mußte man zugeben, daß sie Hitler keine schlechten Vorwände lieferten, sich durch entsprechende Maßnahmen vor weiterem Schaden zu schützen.
Pétain wurde von seiner Umgebung bestürmt, mit einem bereitstehenden Flugzeug nach Nordafrika zu flüchten und sich den Putschisten anzuschließen. Er lehnte ab, obwohl ihn Roosevelts Botschafter erst verständigt hatte, als die »Operation Torch« schon gelaufen war.
Wenige Stunden später erklärte der deutsche Botschafter dem Marschall, daß der Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu den USA nicht als ausreichende Antwort angesehen würde: Deutschland verlange die Kriegserklärung. Nunmehr ging es Schlag auf Schlag: Die französischen Truppen wurden entwaffnet, der bisher unbesetzte Teil Frankreichs besetzt. Gleichzeitig wurde Frankreich aufgefordert, Tunesien den deutsch-italienischen Streitkräften zu öffnen.
Inzwischen hatten die Alliierten die tunesische Grenze bereits erreicht und überschritten; bis zur Hauptstadt hatten sie nur noch 25 Kilometer vor sich. Der Generalresident Jean-Pierre Estéva wurde von zwei Seiten in die Zange genommen. Der bärtige Admiral war ein strenggläubiger Katholik, der täglich die 6-Uhr-Messe besuchte; es ging ihm der Ruf großer Rechtschaffenheit voraus, und niemand, der seine Sittenstrenge hinter seinem Rücken belächelte, wagte ihn für einen schlechten Franzosen zu halten. Estéva weigerte sich, von Pétain abzufallen und sich Darlan zu unterstellen.
»Die entnervenden Umstände, unter denen man auf französischer Seite handeln mußte, überforderten seinen schlichten Verstand«, urteilte Raymond Cartier. »Er weigerte sich, Darlan zu gehorchen, in dem er einen in die Politik verstrickten Militär sah, und vermochte hinter Pétains unwilligen Protesten gegen die Vergewaltigung Nordafrikas nicht dessen heimliche Zustimmung zu erkennen. Da er Befehl hatte, Tunesien den Achsenmächten zu öffnen, tat er es auch. Tunis wurde besetzt. Bizerta kapitulierte, und die deutsch-italienischen Streitkräfte hätten sich noch schneller des Landes bemächtigt, wenn nicht General Barré eine kleine Streitmacht aus Chausseurs d’Afrique und Mobilgarden zusammengestellt hätte, um mit ihr bei Medjez-el-Bab an der Straße nach Algerien Widerstand zu leisten.«
Inzwischen hatten deutsche Truppen die Grenze zum unbesetzten Frankreich überschritten und in den Kasernen die Vichy-Truppen entwaffnet. SS-Einheiten näherten sich dem Hafen von Toulon, wo die französische Kriegsflotte lag. Von Nordafrika aus gab Darlan den Befehl, die Schiffe zu versenken; er wurde befolgt.
Über den staubigen E-Hafen in Süditalien schallen Pfiffe. Alarm, der dritte schon in vier Tagen. So lange sind die Fallschirmjäger des Regiments 5 nicht aus der Sprungkombination, dem Knochensack, gekommen. So lange warten sie darauf, endlich das Nest, in dem sie sich aus Langeweile mit Marsala die Füße waschen, verlassen zu können.
»Ob es diesmal Ernst ist?« fragt Oberjäger Staller den jungen Leutnant Molitor.
»Was weiß ich«, knurrt der Offizier. »Lieber hol’ ich mir im heißen Afrika einen kalten Arsch, als daß ich mir hier noch länger Plattfüße in den Leib stehe –«
»Ich glaube, da unten ist nicht viel mehr zu erben«, unkt Oberjäger Stallerweise, »als Malaria, Heldentod oder Gefangenschaft.«
Leutnant Molitor tippt sich an die Stirn und klettert in die Maschine.
Ihre Schnauze steht nach Süden – nach Nordafrika, wo Nicole lebt. Aber an die Schwester will er nicht denken. Am besten ist es überhaupt, vor dem Einsatz abzuschalten.
Der gebürtige Straßburger wurde zwangsweise zur deutschen Wehrmacht eingezogen. Später meldete sich Peter Molitor freiwillig zu dieser Einheit. Wenn er schon Krieg spielen mußte, dann wollte er wenigstens bei einem interessanten Sauhaufen sein und nicht bei einem langweiligen Verein.
Deutsch ist Molitors Muttersprache, obwohl er in der Schule Französisch lernte. Sein Großvater hat im Siebziger Krieg gegen die Deutschen gekämpft, sein Vater im Ersten Weltkrieg für Kaiser Wilhelm. Sein Schwager ist im Kampf gegen Hitler gefallen, und er, der Beutedeutsche, trägt heute im Knochensack seine Haut zu Markte, ohne dabei zu überlegen, für wen.
Er klettert in den dicken Bauch der Ju, hängt den Karabinerhaken ein.
Daß da unten in Nordafrika die Hölle los ist, wissen die Grünen Teufel, trotz der optimistischen Sprachregelung der Wehrmachtsberichte, die die alliierte Landung wie einen Sieg feiern – dabei kam die »Operation Torch« zum denkbar ungelegensten Zeitpunkt: Alle deutschen Kriegsanstrengungen sind zwangsläufig auf Rußland fixiert. Was man jetzt an Truppen nach Afrika abgeben muß, wird der Ostfront abgehen.
Feldmarschall Kesselring, der Oberbefehlshaber Süd, erbittet und erhält Handlungsfreiheit für seine Gegenmaßnahmen. Als erste Einheiten landen Staffeln des Jagdgeschwaders 53, einer Stuka- und einer Transportgruppe, in Tunesien und nehmen überfallartig den Flugplatz Al Aqueila in Besitz. Bei der ersten Kompanie des Fallschirmjägerregiments 5, unter Hauptmann Sauer, die mit Ju 52 und »Giganten« eingeflogen werden, um Stadt und Hafen von Tunis zu sichern, ist auch der Zug des Leutnants Molitor.
Daß die Männer im Knochensack dazu nicht einmal einen Sprungeinsatz benötigen, verdanken sie dem französischen Generalresidenten von Tunesien: Admiral Estéva hat sich deutschem Druck gebeugt, bleibt Vichy treu und setzt den deutschen Truppen keinen Widerstand entgegen. Auch der Besuch des US-Vizekonsuls Miller und seiner charmanten Begleitung Nicole Lemaire kann daran nichts mehr ändern.
Melzer, Ribbentrops Mann, triumphiert und zeigt es deutlich. »Falls Sie etwas für Großdeutschland tun wollten, wären Sie zu spät nach Tunis gekommen, Madame«, tropft der Hohn von seinen Lippen. »Hier sind wir, und hier werden wir auch bleiben«, setzt er hinzu, »wenn’s sein muß, bis zum Jüngsten Tag.« Im ersten Moment merkt der Zyniker gar nicht, daß sich Vizekonsul Miller davonmacht. »Unsere Fallschirmjäger sind schon unterwegs«, behauptet Melzer. »Vielleicht ist Ihr Bruder unter ihnen, Madame, und es kommt bald zu einem glücklichen Familientreffen – und vielleicht wird Leutnant Molitor dann seinen Einfluß geltend machen, Sie zu einer besseren Deutschen zu erziehen.« Er wirft Nicole die Zigarettenkippe vor die Füße. »Sie verdanken es ausschließlich ihm, Madame, daß ich Sie jetzt nicht verhaften lasse!«
Melzer hat nicht übertrieben. Die ersten Fallschirmjäger sind auf dem Flughafen gelandet und schwärmen aus. Zunächst wirkt der Einsatz wie ein Stadtbummel. »Und wo sind die Ehrenjungfrauen?« fragt Oberjäger Staller. »Die Damen. Die Weiber. Die Mädchen. Die Nutten.«
»Da kannste lange warten«, entgegnet der Gefreite Holzmüller. »Die Hälfte seines Lebens wartet der Soldat vergebens.« Seine Mundecken wandern bis zu den Ohren. »Vor allem auf das schöne Geschlecht.«
Die Zivilbevölkerung ist nicht unfreundlich. Schuhputzer stürzen sich auf die Soldaten und polieren ihre Sprungstiefel vor den pittoresken Häusern mit den maurischen Fassaden auf Hochglanz. Laufend werden Verstärkungen angelandet: Die gesamte 5. Panzerarmee muß ebenso wie die italienische Division »Superga« nach Tunesien geworfen werden. Noch starten und landen pausenlos die 400 Jus, die man vom Osten nach Sizilien verlegt hat, aber bald werden sie wieder nach Stalingrad abgezogen, und die Anglo-Amerikaner stehen schon auf der Halbinsel Bône; ihr linker Flügel erreicht auf der Straße von Bizerta Mateur, und auf dem rechten Flügel stoßen die Invasoren bereits auf Djedeida vor. Nur die Feuerwehr kann sie noch aufhalten – und das sind die Fallschirmjäger im Sprungeinsatz.
Molitor und seine Männer lungern schon seit Stunden, Sturmgewehr bei Fuß, um die vollbetankten Jus herum. Die Planen werden weggerissen, die Motoren angeworfen. Viel ist es nicht, was man den Alliierten zunächst entgegenwerfen kann am II. November – eigentlich nur die beiden Fallschirmjägerbataillone und die Stabskompanie des Feldmarschalls.
»Der elfte Elfte – Karnevalsbeginn«, sagt Leutnant Molitor lachend.
»Alaaf!« brüllt Oberjäger Staller. »Auf zum fröhlichen Mummenschanz!«
Sie steigen über die Bodentreppe wie über eine Hühnerleiter des Schicksals. Einer hinter dem anderen. Sprungkombination. Fallschirm am Rücken.
Die Jus heben sich ächzend von der Piste, gewinnen an Höhe, nehmen Kurs: Wohin die Reise geht, weiß keiner, aber stets führt sie an einen Abgrund.
»Wenn ich zu langsam bin«, sagt Leutnant Molitor grinsend zum Absetzer, »dann befördere mich mit einem ordentlichen Tritt hinunter.«
»Vorläufig ist es noch nicht so weit«, brummelt der Mann am Luk. »Und Sie sind sonst eher zu schnell, Herr Leutnant.«
Aber die Soldaten, deren Metier es ist, vom Himmel zur Hölle zu stürzen, wissen auch so, daß sie kein Sprungbein auf die Erde bringen werden, wenn die langsamen Jus beim Anflug »Lightnings« oder »Mustangs« begegnen, aber der Anflugweg ist zum Glück kurz.
Über ihnen wölbt sich der Himmel wie ein blaues Zelt. Ab und zu sieht man einen deutschen Jäger des Geleitschutzes.
Scheint ein glatter Flug zu werden.
Der Fallschirmjägerleutnant Molitor gehört zu der Vorausabteilung, die sich bei der Aufklärung bis Tebourba durchschlägt. Sie verhandeln mit störrischen Franzosen, die sich schließlich zurückziehen, drängen die Alliierten bis Souk es Arba ab und dringen in Béja ein. Sie nehmen Qued Zarga und sind damit auf dem halben Weg nach Medjez el Bab, von dem Hannibal einst gesagt hatte: »Wer es besitzt, ist der Herr von Tunis.«
Leutnant Molitor hat sich mit seiner Kompanie am Djebel Abiod eingenistet. Er erwartet den Angriff der 78. Infanteriedivision der Engländer. Die Position ist günstig gewählt, aber er ist hoffnungslos unterlegen und kämpft mehr mit Mut als mit Taktik.
Im Feuer der MGs bricht der erste englische Ansturm zusammen. Während die Alliierten Verstärkungen sammeln, stellt der Leutnant fest, daß er sich um Oberjäger Staller nicht mehr zu kümmern braucht. Granatwerfer. Volltreffer.
Molitor schafft die Nacht, und am nächsten Morgen wagt er sogar einen Gegenstoß. Wenigstens ist das Wetter günstig, die Alliierten können ihre Luftüberlegenheit nicht ausnutzen. Die Grünen Teufel sammeln Beutewaffen ein, rauchen eine Zigarette, halten ihre Stellung weiterhin – wie General Nehring den Brückenkopf Tunesien.
Dreimal in 48 Stunden greift die 78. Infanteriedivision die Stellung des Leutnants Molitor am Djebel Abiod an, dicht aneinandergedrängt, nach flüchtiger Artillerievorbereitung, ohne Panzerunterstützung.
»Dann machen wir sie halt noch einmal fertig«, sagt der Leutnant. »Laßt sie rankommen!«
Der Kampf ist kurz und mörderisch. Schon rücken deutsche Einheiten heran, die die Grünen Teufel entsetzen werden. Die Nacht wird sie retten. Wieder ziehen sich die Engländer zurück.
Die Fallschirmjäger stehen auf verlorenem Posten, aber sie werden ihn bis zuletzt halten. Die deutsch-italienischen Alarmeinheiten haben in Tunesien gerade noch rechtzeitig alle Schlüsselpositionen erobert. Die Achsenmächte bauen den Brückenkopf mit dem Armeekorps des Generals Walther Nehring, den man in Italien aus dem Zug geholt und schleunigst nach Nordafrika befördert hatte, weiter aus. Dem Panzergeneral, vormaligen Kommandeur des Afrikakorps, kamen seine Erfahrungen mit dem Wüstenkrieg zugute. »Es kommt darauf an«, hatte ihm Generalfeldmarschall Kesselring vor dem Abflug in Rom erläutert, »weit nach Westen vorzustoßen, um Bewegungsfreiheit zu haben. Erwünscht ist etwa die Linie der tunesisch-algerischen Grenze. Das OKW und ich hoffen, daß es Ihnen gelingen wird, die Aufgabe Tunesien zu meistern.«
Mit minimalsten Kräften, doch großem Einsatz kam Nehring dem Befehl nach. »Indem die deutsch-italienischen Truppen den Gegner bei Bab el Aroussa, Tebourba, Einfidaville, Tebessa und Djedeida schlugen«, schreibt Hellmuth Günther Dahms, »behaupten sie sich nicht nur im Besitze von Tunis. Zugleich blieb der wichtige Verkehrsweg nach Süden offen, die Straße Sousse–Sfax–Gabès–Tripolis, auf der sich Rommels Panzerarmee langsam zurückzog. Montgomery wollte sie bei Marsa el Brega, Buerat und Tauia überholen und abschneiden, doch konnte die deutsche Horchaufklärung rechtzeitig vor jedem dieser Versuche warnen.«
Immer mehr nähern sich die Reste der Panzerarmee Afrika der tunesischen Grenze. Es sieht aus, als würden die deutschen Truppen in Tunesien und die aus der Cyrenaika zurückflutenden bald Rücken an Rücken kämpfen. Rommel führt 190 Panzer – deren Hälfte schrottreif ist – an die tunesische Grenze zurück. Die Reste der 15. und der 21. Panzerdivision, die 90. leichte und die 164. Division sowie italienische Verbände unter dem Oberkommandierenden Giovanni Messe bilden den Brückenkopf Tunesien.
Die Zeichen stehen auf Untergang: Am 9. März wird Rommel aus Afrika abberufen und ins Führerhauptquartier befohlen, wo er – um die Niederlagen zu überspielen – als erster Heeresoffizier die Brillanten zum Ritterkreuz erhält und durch Generaloberst Hans-Jürgen von Arnim ersetzt wird.
Drei Tage später streiken in Turin 100 000 Arbeiter und legen die italienische Rüstung lahm. Die Streikwelle greift auf die ganze Lombardei über. Die faschistischen Behörden wagen nur zögernd zu reagieren.
Am 21. März greifen Montgomerys Truppen die Mareth-Linie an und überrennen sie teilweise. Am 7. April schließen die Amerikaner unter Patton und die Briten unter Montgomery den Ring um die deutsche Heeresgruppe Afrika im Norden Tunesiens.
Am gleichen Tag treffen sich Hitler und Mussolini in Salzburg. »Duce«, erklärt der Diktator in dieser hoffnungslosen Lage, »ich bürge dafür, daß Afrika verteidigt wird. Verdun hat mit Erfolg den Attacken der besten deutschen Regimenter standgehalten. Ich sehe nicht ein, warum wir uns in Afrika nicht gegen die alliierten Truppen halten sollten. Mit Ihrer Hilfe, Duce, werden meine Truppen aus Tunis das Verdun des Mittelmeeres machen.«
Aber das Finale in Afrika ist nicht mehr aufzuhalten. Die 8. britische Armee und das II. amerikanische Armeekorps vereinigen sich bei Graiba am Golf von Gabès. Gleichzeitig greifen Bomber die Häfen von Bizerta, Tunis, Sfax und Sousse an. Im Laufe des Monats April schießen anglo-amerikanische Jäger zwischen Sizilien und Tunesien 200 Transportflugzeuge ab.
Der Brückenkopf Tunis hat sich in eine Falle verwandelt. Arnim zieht sich auf die Höhenzüge zurück, entschlossen, sie nach Hitlers Befehl »bis zur letzten Patrone« zu halten. Am 13. Mai ist sie verschossen, und damit hält der neue Oberbefehlshaber – er hatte, von Rußland kommend, Afrika zunächst für ein Kinderspiel gehalten – den Befehl für erfüllt und kapituliert. Auf Schnellbooten und Flugzeugen entkommen noch 638 deutsche und italienische Experten sowie arabische und französische Kollaborateure.
Die Feuereinstellung brauchte der Generaloberst nicht zu befehlen, seine Soldaten haben keine Munition mehr, keinen Sprit und keine Verpflegung. Nebeneinandersitzend, apathisch, abgekämpft, erwarten sie das Eintreffen der Alliierten, unter ihnen Leutnant Molitor, der auf einer Treppe kauert und seine letzte Zigarette raucht.
Irgendwo schiebt sich ein Gewehrlauf aus einem Hinterhalt und richtet sich auf ihn. Der Leutnant sackt zusammen. Er ist sofort tot – einer von einer Million Gefallenen, Verwundeten und Gefangenen, die das afrikanische Abenteuer die deutsche Wehrmacht kostet. Drei Monate nach Stalingrad hatte der »größte Feldherr aller Zeiten« die nächste komplette Armee geopfert, statt ihr nach Rommels Ratschlag den Rückzug auf den europäischen Kontinent zu erlauben.
In Tunesien sind 8503 Deutsche und 13476 Italiener gefallen. Die Franzosen beklagen den Tod von 3000 Soldaten, 12000 Verwundeten und 4500 Vermißten. Briten und Amerikaner zusammen hatten etwas über 12000 Tote, 38 688 Verwundete und 21 363 Vermißte, aber nunmehr gab es zwischen Gibraltar und der Ägäis kein Hindernis mehr für den Angriff auf die »Festung Europa«. Zwischen Großbritannien und Asien hatte sich der Seeweg um 16000 Kilometer verkürzt. Das bedeutete eine Ersparnis von 45 Tagen und einen dadurch frei werdenden Schiffsraum von einer Million Tonnen.
»Mag dieses Ende der Armeen Arnims und Messes für die Betroffenen auch weniger schrecklich gewesen sein als für die Opfer der verbrecherischen Kriegführung in und bei Stalingrad«, schreibt in seinem Sachbuch »Verrat auf deutsch« Erich Kuby, »für den Gesamtverlauf des Krieges ist die tunesische Niederlage von noch weit größerer Bedeutung als jene an der Wolga. Nun können die Alliierten an jeder Stelle, die ihnen passend erscheint, vom Süden her in den ›weichen Leib‹ Europas hineinstoßen und das Mittelmeer benützen, als sei es die Irische See. Die Hilfslieferungen an die Sowjetunion werden ab sofort durchs Mittelmeer nach Persien, von dort per Bahn in die Sowjetunion geleitet, was eine Einsparung von mehreren tausend Seemeilen Transportweg und die Sicherheit bedeutet, daß unterwegs nahezu keine Verluste mehr entstehen ...«
Engländer, Amerikaner und Franzosen sind nunmehr – trotz aller blutigen Mißverständnisse – Waffenbrüder, die künftig Schulter an Schulter gegen Hitler kämpfen werden.
Sie hatten einen Sieg errungen, und sie feierten ihn ausgiebig.
Eine junge Frau, Nicole Lemaire, stand abseits, obwohl sie viel zu dem Siegeslauf der Alliierten beigetragen hatte. Sie kämpfte – schließlich mit Erfolg – bei den französischen Behörden darum, daß ihr als deutscher Leutnant gefallener Bruder Peter Molitor auf einen französischen Soldatenfriedhof umgebettet wurde.