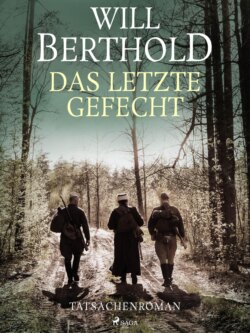Читать книгу Das letzte Gefecht - Tatsachenroman - Will Berthold - Страница 5
Kalter Frühling – heißer Sommer
ОглавлениеWegen Hitlers verspäteten Befehls zum Rückzug aus dem Kaukasus hatte der Ostfront ein zweites, noch vernichtenderes Stalingrad gedroht. Nur wenn Rostow gehalten werden konnte, war der Fluchtweg offen, aber die Heeresgruppe A stand noch weit davon entfernt: die 17. Armee 400 Kilometer, die 1. Panzerarmee 700 Kilometer. Hoth war mit seiner 4. – nach ihrem vergeblichen Versuch, Stalingrad zu entsetzen – südlich des Don, 400 Kilometer östlich von Rostow, in schwere Abwehrkämpfe geraten. Die Sowjets standen sechsmal näher an Rostow als ihre deutschen Gegner. Die T-34-Panzerspitzen waren nur noch 70 Kilometer entfernt. Nicht nur hier drohte höchste Gefahr, auch weiter westlich, am Dnjepr bei Dnjepropetrowsk und Saporoschje, war ein weiterer deutscher Flaschenhals in Bedrängnis geraten.
Es ging Schlag auf Schlag. Am 8. und 9. Februar 1943 hatten die Russen Kursk und Bjelgorod überrannt. Die 2. Gardearmee und die 5. Panzerarmee der Sowjets stürmten nunmehr gegen den Korridor von Rostow und näherten sich ihm bis auf 40 Kilometer. Es wäre für sie ein leichtes gewesen, den Generalfeldmarschall von Manstein und sein Hauptquartier bei Nowotscherkask aufzuheben, aber die Verfolgung des geschlagenen Feindes war nicht – noch nicht – ihre Stärke. »Hoth begegnete dieser Situation mit jener lächelnden Kaltblütigkeit, die seinem Ansehen unter den deutschen Generalen etwas Ungewöhnliches verlieh«, stellt Raymond Cartier fest. »Langsam zog er sich in das Tal des Manytsch zurück, die Grenze zwischen Europa und Asien, deren Überschreitung im Sommer des vergangenen Jahres von der deutschen Propaganda ausgiebig gefeiert worden war.«
Die Ostfront bebte in ihrer ganzen Breite unter den Hammerschlägen sowjetischer Angriffe. Im Norden tobten schwere Kämpfe an der Leningrad-Front. Demjansk mußte geräumt werden, Woronesch war schon von drei Seiten eingeschlossen. Hitler wollte das unhaltbare Trümmerfeld zur Festung erklären, verzichtete aber dann darauf, mit drei Divisionen ein »kleines Stalingrad« herbeizuführen. Dafür bestand er – nach dem Fall Rostows und Woroschilowgrads am 14. Februar – darauf, daß Charkow bedingungslos verteidigt werden müsse.
Die Reste der Heeresgruppe Süd hatten sich auf die Halbinsel Taman auf der Ostseite der Straße von Kertsch zurückgezogen. Auf dem Kuban-Brückenkopf drängten sich 400 000 deutsche Soldaten zusammen und behinderten einander bei der Verteidigung. Hitler, der mehr an die Rückeroberung des Kaukasus dachte als an die Rettung seiner Truppen, hatte den sinnlosen Befehl gegeben, einen 200 Kilometer langen Korridor offen zu halten.
Die Heerführer im Osten waren längst in einen Zweifrontenkrieg verwickelt. Sie erwehrten sich, schrittweise zurückgehend, mit größter Mühe der ungestümen russischen Angriffe – ihr zweiter Gegner war das Führerhauptquartier, das ihnen durch seine starre Festklammern-um-jeden-Preis-Taktik das strategische Konzept verdarb. Statt einer durchgehenden, übersichtlichen Verteidigungslinie entstand nunmehr ein Gewirr von Einbuchtungen, Überhängen und Vorsprüngen, die einen weit größeren Verteidigungsaufwand erforderten und im Falle eines konzentrischen russischen Angriffs nicht gehalten werden konnten.
So entstand der weit nach Westen vorgezogene russische Frontvorsprung bei Kursk. Die Deutschen mußten den 180 Kilometer tiefen und 250 Kilometer breiten Bogen als Pfahl im Fleisch empfinden. Es war beiden Seiten klar, daß sich hier ein Brennpunkt neuer Kämpfe anbahnte. Hitler, nach der Bekundung seines Wehrmachtsadjutanten Rudolf Schmundt »der göttliche Führer, der gegen die Unfähigkeit seiner Feldmarschälle des neunmalklugen Generalstabes alle Schlachten gewinnen mußte«, ließ einen Plan für die letzte deutsche Großoffensive im Osten, die »Operation Zitadelle«, ausarbeiten.
Die Nachricht vom Fall Charkows schlug am 15. Februar wie eine Bombe in der Wolfsschanze ein. Ausgerechnet der SS-Obergruppenführer Paul Hausser, dem man weder Ungehorsam noch Feigheit nachsagen konnte, hatte mit seinem III. SS-Panzerkorps die mit 900 000 Einwohnern zweitgrößte Stadt der Ukraine – entgegen einem ausdrücklichen Führerbefehl – geräumt, um seine Soldaten zu retten.
Hitler tobte und entschloß sich zu einem Blitzbesuch bei seinen Oberbefehlshabern im Osten. Auch diesmal rang er sich nicht zu einem Abstecher zu seinen Frontsoldaten – mit denen er, wie er sagte, litt und die er rücksichtslos verheizte – durch. Er hatte sich zu einem Besuch in der Etappe entschlossen, um die Rückeroberung Charkows mit allen Mitteln voranzutreiben und seinen »Zitadelle«-Plan durchzusprechen, aber er sollte nun doch aus erster Hand einen Anschauungsunterricht erhalten, wie sehr sich die Kriegführung – seit seiner Zeit als Gefreiter im Ersten Weltkrieg – gewandelt hatte, vor allem in Rußland, wo Front und Etappe oft ineinander übergingen.
Eingehüllt in starken Jagdschutz, flog der Diktator am 17. Februar mit seinem auf zwei FW 200 Condor verteilten Gefolge und Sicherheitspersonal in das Hauptquartier der Heeresgruppe Don nach Saporoschje ab. Aus Geheimhaltungsgründen erfuhr Manstein erst im letzten Moment, daß Hitler zu ihm unterwegs war. Der Generalfeldmarschall, dessen Verdienste um die Stabilisierung der Front nicht bezweifelt werden konnten, hatte mehr Einfluß auf den Diktator als andere Heerführer. Er redete ihm zunächst einmal aus, Charkow überstürzt zurückzuerobern, und stellte für die »Operation Zitadelle« Bedingungen für eine Neuauffrischung der Truppen und ihre neue Bewaffnung. Hitler verstieg sich zu der Feststellung: »Unbekannte, einzigartig dastehende Waffen befinden sich auf dem Weg zu euren Fronten.«
Während er Versprechungen abgab, die ihm – wenn auch keiner widersprach – kaum einer der zuhörenden Offiziere glaubte, wurde Panzeralarm gegeben. Eine Brigade T 34 hatte überraschend die Hauptkampflinie durchbrochen, und zwischen ihr und dem Hauptquartier standen nur zwei Stunden Fahrt und eine einzige Wachkompanie.
Flugkapitän Hans Baur wollte die Führer-Condor sofort auf einen weiter westlich gelegenen Flugplatz verlegen, aber Hitler zögerte, und schließlich wurde gemeldet, daß die Sowjetpanzer ihren Angriff abgebrochen hätten. Später stellte sich heraus, daß ihnen der Treibstoff ausgegangen war.
Hitler schloß seine Besprechung mit Manstein ab und flog nach Rastenburg zurück. Später wollte er das Hauptquartier der Heeresgruppe Mitte besuchen, wo ihn bei Smolensk eine noch weit tödlichere Gefahr erwartete als russische Panzer: Angeführt vom Ersten Generalstabsoffizier der Heeresgruppe, dem Obersten und späteren Generalmajor Henning von Tresckow, hatte eine Gruppe von Frondeuren seit langem eine Falle für ihn aufgestellt, Offiziere, die nicht mehr im Halbdunkel des Salons flüsternd über Wert und Unwert des Fahneneids debattierten, sondern entschlossen waren, Adolf Hitler zu töten. »Insgesamt war im Stab der Heeresgruppe Mitte«, so stellt der Historiker Peter Hoffmann fest, »die stärkste Oppositionsgruppe konzentriert, die je bestanden hatte.«
Die beiden Offiziere gingen spazieren. Unvermittelt blieb Oberst von Tresckow stehen. »Fragen Sie mich bitte jetzt nichts, Gersdorff«, sagte er zum IC, »aber ich brauche einmal einen besonders wirksamen Sprengstoff, der wenig Raum beansprucht, und zum anderen einen absolut zuverlässigen Zeitzünder, der keinerlei Geräusche verursacht. Können Sie mir beides besorgen?«
Der Oberst und spätere Generalmajor Rudolph Christoph Freiherr von Gersdorff – auf dem weiten Weg vom preußischen Junker zum handelnden Rebellen – ahnte, daß er das Rohmaterial für eine Bombe gegen Hitler liefern sollte; er hatte nichts dagegen, und er verstand auch, warum ihm Tresckow keine näheren Erklärungen gab. Der alte Kavallerieoffizier wandte sich an die Sabotageabteilung der militärischen Abwehr und erklärte, an neuartigen Sprengmitteln für den Einsatz hinter den russischen Linien interessiert zu sein.
Dem Oberstleutnant Wilhelm Hotzel schmeichelte das Interesse des Besuchers, der von der Front kam. Bereitwillig zeigte er Gersdorff das in Frage kommende Arsenal: Sprengmunition, Zündkapseln und andere brisante Geräte.
»Das deutsche Material machte einen soliden, aber meist sehr aufwendigen Eindruck«, stellt in seinem Buch »Soldat im Untergang« Gersdorff fest. »Vor allem waren die deutschen Zünder mit einem tickenden Uhrwerk versehen. Dann wurde mir Material gezeigt, das die Briten zur Versorgung französischer und holländischer Widerstandskämpfer über den besetzten Gebieten abgeworfen hatten. Durch gefaßte und umgedrehte feindliche Funkagenten hatte die deutsche Abwehr unverfängliche Verbindungen mit den Absendestellen in Großbritannien herstellen können. In sogenannten Funkspielen wurde das Material angefordert. Es brauchte dann nur eingesammelt zu werden. Auch bei fehlgeschlagenen britischen Kommandounternehmen an der Kanalküste waren größere Mengen des britischen Materials erbeutet worden.
Der englische Sprengstoff bestand aus einer Plastikmasse, die sich in jede beliebige Form kneten ließ. Die dazugehörigen Zünder wirkten auf chemischem Weg und verursachten daher keinerlei Geräusch. Sie hatten die Form eines dicken Bleistiftes. Am oberen Ende befand sich unter der Metallhülse eine Säurekapsel über einem Draht, der eine Schraubfeder zusammendrückte und unter Spannung hielt. Der Draht war von Baumwolle umgeben. Zerdrückte man die Säureampulle, so entwich die Säure in die Watte und zerfraß in einer bestimmten Zeit den Draht, der dann die Feder freigab, welche einen Bolzen auf die Zündkapsel schnellen ließ und so die Explosion auslöste. Je nach Stärke des Drahtes gab es Zünder mit einer Zünddauer von zehn, dreißig, sechzig und mehr Minuten. Die jeweilige Zünddauer war durch farbige Ringe auf den Zündern gekennzeichnet. So hatte zum Beispiel der Zehn-Minuten-Zünder einen schwarzen Ring.«
Freiherr von Gersdorff bat um eine Demonstration. »Die Wirkung des Sprengstoffes war erstaunlich. Wenige Gramm zerfetzten Eisenbahnschienen. Dann ließ ich an einem russischen Beutepanzer eine Ladung von zirka 250 Gramm anbringen: die Panzerkuppel wurde abgesprengt und meterweit durch die Luft geschleudert. Dieses Material mußte Tresckows Wünsche in idealer Weise erfüllen. Ich bat Oberstleutnant Hotzel, mir ein Sortiment der verschiedenen Geräte zur Verfügung zu stellen, da ich dem Feldmarschall die neuartigen Sabotagemittel zeigen wollte. Hotzel ließ mir alle möglichen Geräte, darunter auch Proben der britischen Sprengmittel, einpacken. Korrekterweise verlangte der das Lager verwaltende Feldwebel, daß ich den Empfang des im einzelnen aufgeführten Materials in einem Quittungsbuch durch meine Unterschrift bescheinige. Beim Unterschreiben fragte ich mich, ob ich mein eigenes Todesurteil unterzeichne.«
Der englische Sprengstoff kam mit unfreiwilliger Hilfe der französischen Résistance in deutsche Hände und wurde doch dem Ursprungszweck wieder zugeführt. Es handelte sich um die gleiche brisante Mischung, die bei der Bombe gegen den stellvertretenden Reichsprotektor von Böhmen und Mähren und RSHA-Chef Reinhard Heydrich ihren Zweck erfüllt hatte. Bald probten Tresckow und seine Freunde auf den Dnjepr-Wiesen den Tyrannenmord. Der willige I C mußte noch mehrmals bei der Abwehr vorsprechen und um Nachlieferung bitten, dann verliefen die Experimente erfolgreich.
Der Diktator brauchte nur noch im Hauptquartier der Heeresgruppe Mitte, in Krasny Bor bei Smolensk, zu erscheinen.
Tresckow, der Motor der Rebellen, hatte eine hohe Stirn, kühle Augen, einen geraden Mund und ein energisches Kinn. Er war ein höchst begabter, doch auch höchst ungewöhnlicher Generalstabsoffizier. Er entstammte einer Familie, in der es Dogma war, Offizier zu werden. Der Hochgebildete folgte dem Familienwunsch, und sein erster Kommandeur sagte zu ihm vor versammelter Mannschaft: »Sie, Tresckow, werden einmal Chef des Generalstabs werden oder als Revoluzzer auf dem Schafott enden.«
Aus dem Ersten Weltkrieg war er mit einer Reihe von Auszeichnungen, doch berufslos zurückgekehrt. Vorübergehend hatte er sich einem Freikorps angeschlossen, sich dann aber entschieden, einen bürgerlichen Beruf zu ergreifen. Er absolvierte in Potsdam eine Banklehre, fiel auf und wurde gefördert, arbeitete dann in der Reichshauptstadt als Börsenmakler und verdiente dabei so viel Geld, daß er sich eine einjährige Weltreise leisten konnte. Tresckows Horizont hatte sich beträchtlich erweitert, als er sich 1926 von der Reichswehr reaktivieren ließ.
Einer seiner Offizierskameraden war Rudolph Schmundt, ein glühender Nationalsozialist, der später zu Hitlers persönlichem Adjutanten aufrücken sollte. Tresckow stand der braunen Bewegung zunächst freundlich bis gleichgültig gegenüber. Erst als er begriff, daß ihre Politik zum Krieg führen mußte, wurde er zu ihrem Feind und, als er in Rußland das Mordgeschäft der Vernichtungskommandos kennenlernte, zu ihrem Todfeind.
Im Gegensatz zu anderen Offizieren redete er wenig darüber. Er war ein geradliniger Offizier, aber auch ein Realist, der wußte, daß er sich seinem Ziel, dem Tyrannenmord, nur nähern konnte, wenn es ihm gelang, sich zu verstellen. Der scharfsinnige und scharflippige Generalstabsoffizier schaffte es, gegenüber seinen Freunden offen zu sein und doch bei Schmundt im Führerhauptquartier den Eindruck eines zuverlässigen Gefolgsmannes Hitlers zu erwecken.
List und Verschlagenheit waren Eigenschaften, die man gemeinhin bei einem preußischen Offizier nicht vermutete; überhaupt liegen sie wenig im deutschen Nationalcharakter – falls es so etwas gibt. »Die Deutschen sind keine Verschwörer«, hatte der italienische Botschafter in Berlin, Bernardo Attolico, gespöttelt. »Zum Verschwörer gehört alles, was sie nicht haben: Geduld, Menschenkenntnis, Psychologie, Takt. Nein, sie werden alle abgeschossen werden und in Lagern verschwinden: Gegen Gewaltregierungen, welche zur vollen Anwendung ihrer Gewaltmittel jederzeit bereit sind, gibt es keine Aufstände. Um gegen solche Verhältnisse anzukämpfen wie die hiesigen, braucht es eine Ausdauer, eine Verstellungsgabe, ein Geschick, wie es Talleyrand und Fouché besaßen. Wo finden Sie zwischen Rosenheim und Eydtkuhnen einen Talleyrand?«
Oberst von Tresckow stand die Tarnung durch. Es war die Voraussetzung seines Vorhabens, denn er brauchte das Vertrauen Schmundts, um seine Personalwünsche durchzusetzen, und der Adjutant tat ihm gerne den Gefallen, viele Gefallen. Und so wurden mit der Zeit die Nazis unter den Offizieren im Hauptquartier der Heeresgruppe Mitte weggelobt und durch Tresckows Gesinnungsfreunde ersetzt. Es entstand ein harter Kern von Hitler-Gegnern. Der I A mauerte den Oberbefehlshaber Fedor von Bock, seinen Vetter, mit oppositionellen Offizieren förmlich zu, nötigte ihm die Grafen Hardenberg und Lehndorff als Adjutanten auf und holte sich selbst den Rechtsanwalt und Oberleutnant Fabian von Schlabrendorff als Verbindungsmann zu dem Abwehr-Obersten Hans Oster, dem heimlichen »Geschäftsführer des Widerstandes.«
Der »helle Sachse« – so nannten seine Freunde die rechte Hand des Admirals Canaris – leitete die Zentralabteilung am Tirpitzufer: Nach außen hin »anscheinend immer auf der Jagd nach attraktiven Frauen und neuen Pferden« (Heinz Höhne), war er tatsächlich ein Drahtzieher der Subversion, der alles wußte und vieles bewerkstelligen konnte.
Tresckow konnte nur zweigleisig fahren: Was er bei Schmundt nicht erreichte, schaffte er über die militärische Abwehr. Der I A der Heeresgruppe Mitte war nicht der erste Offizier – freilich auf langen Umwegen –, der erkannt hatte, daß nur ein toter Hitler dem Widerstand zum Durchbruch verhelfen konnte. Die Pläne der anderen Verschwörer, den Führer gefangenzusetzen und vor Gericht aburteilen zu lassen, waren für Tresckow nur Phantastereien. Hitlers Beseitigung hielt er für die Grundvoraussetzung bei der Liquidierung des Nationalsozialismus. Da er wußte, daß es nicht leicht war, an den Diktator heranzukommen, und daß ihn bislang eine Reihe von Zufällen gerettet hatte, arbeitete er verschiedene Attentatspläne aus.
Henning von Tresckow war nicht der erste deutsche Offizier, der versuchte, Hitler zu töten. 1938, während der Sudetenkrise, hatte sich der frühere Freikorpskämpfer und Major Friedrich Wilhelm Heinz mit einem Stoßtrupp von 40 Mann in Berlins Eisenachstraße 118 bereitgestellt, um auf ein Stichwort der Canaris-Organisation die Reichskanzlei zu stürmen und Hitler zu erschießen. Die Waffen hatte ihnen die Abwehr geliefert. Die Teilnehmer der Fronde stammten aus dem »Jungen Stahlhelm« und dem »Studentenring Langemarck«.
Tagelang warteten die Männer, daß der Diplomat Erich Kordt, der zu ihnen gehörte, die Flügeltüren der Reichskanzlei für sie öffne. Sie waren verwegene Draufgänger, wie der Oberleutnant Dr. Hans Albrecht Herzner oder Oberleutnant Wolfgang Knaak oder der Kapitänleutnant Franz Ledig. Sie rauchten Zigaretten, hörten Nachrichten und warteten auf das Stichwort. Sie warteten und warteten – und dann schlug ihnen die Nachricht vom Münchener Abkommen, dem die Engländer und Franzosen zugestimmt hatten, die Waffen aus der Hand. Ein Putsch hätte keinen Sinn mehr gehabt, die Rebellen liefen auseinander.
Der nächste Offizier, der Hitler erschießen wollte, war sein eigener Generalstabschef Franz Halder. Der Generaloberst steckte sich, wenn er zum Führer gerufen wurde, eine Pistole ein und haderte hinterher mit sich, daß er wiederum nicht gewagt hatte, sie zu ziehen. »Bringt doch endlich den Hund um!« forderte er seine Vertrauten auf.
Später wollte ein Offizierskreis um den Generalfeldmarschall Erwin von Witzleben den Diktator bei der Siegesparade in Paris erschießen. Drei Offiziere aus dem Stab des Oberbefehlshabers, der Rittmeister Graf von Waldersee sowie Major Alexander von Voß und der Hauptmann Graf Schwerin von Schwanenfeld, erklärten sich bereit, ein Pistolenattentat auf der Tribüne in der Nähe der Place de la Concorde zu inszenieren. Sollten die Offiziere nicht durch die Abschirmung kommen, wollte Graf Schwerin auf Hitlers Hotelflur einen Handgranatenanschlag riskieren.
Die Verschwörer hatten ihren Umsturzversuch mit ihren Freunden beim Ersatzheer in Berlin abgesprochen. Sowie die Nachricht aus Paris einginge, wollten diese in der Reichshauptstadt nach Osters Besetzungsplan losschlagen.
Und wieder entging Hitler der Falle. Am 28. Juni 1940 um 5 Uhr morgens landete er – erst im letzten Moment angemeldet – auf dem Flughafen Le Bourget, stieg sofort in seinen gepanzerten Mercedes-Wagen und fegte mit seiner Kolonne durch das noch schlafende Paris. Er fuhr durch den Arc de Triomphe die Champs-Élysées hinunter, besichtigte kurz die Oper, den Louvre und den Eiffelturm, ließ sich dann zum Invalidendom bringen, wo er am Grab Napoleons für die Kamera posierte. Drei Stunden später war er schon wieder in Le Bourget und flog in sein Hauptquartier »Tannenburg« bei Freudenstadt zurück. Viel schlimmer war, daß er sich während seines Blitzbesuches entschlossen hatte, die Siegesparade in Paris ausfallen zu lassen.
1941 sollte sie nachgeholt werden. Wieder stellten sich die verschwörerischen Offiziere bereit, aber der Balkanfeldzug verhinderte »Emils« – so lautete Hitlers Tarnname bei den Frondeuren – Paris-Besuch. Kurze Zeit später erkrankte Witzleben und mußte sich einer Operation unterziehen. Hitler nutzte die Gelegenheit, seinen unbequemen und undurchschaubaren Oberbefehlshaber im Westen loszuwerden.
Im Zeitalter der Blitzsiege fand Hitler einen solchen Rückhalt bei der Bevölkerung, daß die Verschwörer Anschläge für sinnlos hielten. Erst nach dem Rückschlag vor Moskau 1941 hatten ihre Umsturzpläne wieder eine Chance.
Die Offiziere im Hauptquartier der Heeresgruppe Mitte waren vom Fach, und spätestens seit Stalingrad erkannten die meisten von ihnen, daß der Krieg unausweichlich verloren war und Millionen von Opfern fordern würde, falls er sich noch Jahre dahinzöge. Darüber konnte man offen sprechen, denn nahezu alle Offiziere um den Generalfeldmarschall Fedor von Bock kamen aus dem Infanterieregiment 9, einer Adelsdomäne, die von Spöttern »von 9« genannt wurde. Der exklusive Kreis schloß es aus, daß einer den anderen denunzierte, selbst wenn er anderer politischer Meinung war. Bezeichnend dafür war ein Zwischenfall, der sich vor mehreren Zeugen ereignet hatte.
Die Sowjets waren wieder einmal durchgebrochen. »Was schlägst du vor?« fragte der Oberbefehlshaber seinen ersten Generalstabsoffizier.
»Es gibt nur einen Weg«, erwiderte Tresckow salopp. »Wir müssen Hitler beseitigen.«
Der Generalfeldmarschall fuhr hoch, brüllte Tresckow nieder. »So was lasse ich mir nicht sagen! Das hör’ ich mir unter keinen Umständen an.« Er stürmte aus dem Raum, lief im Freien herum, bis sich sein Zorn gelegt hatte.
Die Kontroverse blieb ohne Folgen. Bock wurde kurze Zeit später abgelöst und durch den zugänglicheren Generalfeldmarschall Günther von Kluge ersetzt, den Tresckow sofort in seine Attentatspläne einzuspannen versuchte. Der I A war der Meinung, daß ein Attentat bei der deutschen Bevölkerung einen ganz anderen Rückhalt fände, wenn ein Generalfeldmarschall, der sich im Krieg einen Namen gemacht hatte, an der Spitze des Aufstandes stünde.
Es kam zu einem harten, zähen Ringen zwischen Tresckow und Kluge, zwischen einem Pragmatiker, der den kürzesten Weg zur Tat suchte, und einem Zauderer, der ihre Notwendigkeit erkannt hatte, doch nicht seine Haut riskieren wollte.
Ein ungewöhnlicher Umstand kam dem Verschwörer zu Hilfe. Der Führer, der die meisten seiner Generäle verachtete und selbst den bevorzugten noch mißtraute, hatte einen Weg gefunden, sie fester an sich zu binden: Er versuchte sie zu korrumpieren und überschüttete sie mit steuerfreiem Zusatzsold, mit wertvollen Gemälden, schenkte ihnen Rittergüter und dazu noch einen Scheck in Höhe von einer Viertelmillion Reichsmark.
»Sehen Sie, Herr Feldmarschall«, schrieb er als stehende Floskel in den jeweiligen Begleitbrief, »es daher nur als ein kleines Zeichen meiner persönlichen und der Dankbarkeit des deutschen Volkes an, wenn ich in seinem Namen versuche, Ihnen dafür bei der Gestaltung Ihres privaten Lebens etwas behilflich zu sein. Mit herzlichen Grüßen, Ihr ergebener Adolf Hitler.«
Nun war es zwar auch schon früher üblich gewesen, daß ein siegreicher Feldherr – nach dem Krieg – mit Dotationen wie Latifundien beschenkt wurde, aber zuerst mußte er ihn einmal gewonnen haben. Es galt als undenkbar und mit dem soldatischen Ehrbegriff unvereinbar, wenn ein General schon den Lohn des Sieges einheimste, während seine Soldaten noch um ihn kämpften und für ihn starben.
»Was macht man eigentlich«, überraschte Generalfeldmarschall von Kluge seine Tischrunde mit der Frage, »wenn man ein Trinkgeld von zweihundertfünfzigtausend Mark erhält?« Er berichtete den Offizieren, daß er »zur Gestaltung seines privaten Lebens« einen Scheck in dieser Höhe von Hitler erhalten habe.
Seine Offiziere machten dem Oberbefehlshaber rasch klar, daß sich die Annahme des Geldes mit dem Ehrbegriff eines deutschen Offiziers nicht vereinbaren lasse. Kluge wußte es selbst: Er hatte durch die Überweisung an das Rote Kreuz die Summe wieder loswerden wollen, fürchtete aber, sich den Unwillen des Obersten Feldherrn zuzuziehen, wenn er ihn brüskierte. Der Generalfeldmarschall hatte offensichtlich Gewissensbisse, obwohl er sich damit hätte verteidigen können, daß eine ganze Reihe von Offizieren zu ihrem – ohnedies steuerfreien – Sold von 4000 Mark monatlich (Generaloberste 2000 Mark) den Viertelmillion-Scheck angenommen hatte, Männer wie Großadmiral Raeder, Generalfeldmarschall Ritter von Leeb, Generalfeldmarschall von Rundstedt, Generalfeldmarschall Milch, Generalfeldmarschall Keitel – dazu noch ein Rittergut im Wert von 480000 Mark (Generalfeldmarschall von Kleist), von 739000 Mark (Generalfeldmarschall Keitel), von 123000 Mark (Generaloberst Guderian), von 1100000 Mark (Familie des Generalfeldmarschalls von Reichenau).
Es war Günther von Kluge offensichtlich peinlich, zu diesen neureichen Privilegierten zu gehören, deren Schatulle Hitler so reichlich aufgefüllt hatte. Hier setzte seine konspirative Umgebung den Hebel an, zerschlug Einwände, ließ keine Ausreden gelten, bis Kluge eines Tages sagte: »Ihr habt mich, Freunde, ich bin euer Spießgeselle.«
Der I A wußte sehr wohl, daß er zunächst nur eine verbale Rückendeckung hatte, aber sie war immer noch besser als überhaupt keine. Nachdem man sich nunmehr einig war, daß Hitler getötet werden müsse, ergab sich die Frage, wie es geschehen könne. Freiherr Philipp von Boeselager – gleich seinem Bruder Georg ein hochdekorierter Offizier und dazu noch einer der bekanntesten Fünfkämpfer – bot sich an, mit seinem Reiterverband von 450 Kosaken Hitler bei seinem Besuch in einer klassischen Attackte über den Haufen zu reiten und dabei umkommen zu lassen. Wiewohl man dem Freiherrn – der mit seinen ihm blind ergebenen Soldaten häufig hinter den russischen Linien operierte – den tollkühnen Ritt zutraute, kam man davon ab, weil Erkundungen ergeben hatten, daß der Diktator schwer bewacht war und meistens in einem gepanzerten Fahrzeug saß.
Nach dem Prager Attentat auf Heydrich, den gefürchtetsten Mann Deutschlands, waren alle Sicherheitsvorschriften noch einmal verschärft worden. Sie wurden von Hitler – im Gegensatz zu früher – jetzt auch weitgehend eingehalten. Er zeigte sich kaum mehr in der Öffentlichkeit. Zivilisten hatten keine Möglichkeit mehr, an ihn heranzukommen. Selbst für die Militärs war es schwieriger geworden – wenngleich in der Ecke des Speiseraums im Führerhauptquartier, wie Henry Picker in »Hitlers Tischgespräche« berichtet, »an einem kleinen Abstelltisch, Tag und Nacht unbewacht, die Flasche mit Hitlers Magenelixier herumstand, ein deutliches Dokument seiner während meiner Führerhauptquartierszeit noch auffallend geringen Vorsicht vor Attentaten. Jeder Führerhauptquartier-Angehörige oder jeder FHQ-Gast hätte Hitler damals ohne Schwierigkeiten umbringen können, wenn er es gewollt hätte.«
Hitlers Hofschranzen wollten das natürlich nicht. Das Attentat konnte nur bei Smolensk über die Bühne gehen, aber dazu mußte Hitler erst einmal kommen. Er hatte seinen Besuch wiederholt angesagt und immer wieder verschoben. Tresckow beschwor seinen alten Regimentskameraden Schmundt – der ihn immer wieder vertrösten mußte. Der I A drängte, behauptend, daß es unerläßlich sei und der Führer sich persönlich ein eigenes Bild von der Frontlage machen müsse. Der Adjutant stimmte ihm zu und versprach zu tun, was nur möglich sei.
Inzwischen hatten sich die aufrührerischen Offiziere im Hauptquartier entschlossen, »Emil« durch ein gemeinsames Attentat im Kasino zu erledigen. Rittmeister Schmidt-Salzmann, Oberst von Kleist und der Schwadronschef König waren bereit, ein zehnköpfiges Offizierskommando anzuführen. Auf ein Zeichen von ihnen wollten alle gleichzeitig die Pistolen ziehen und ohne Vorwarnung den Diktator und seine Bewachung zusammenschießen.
Da ihr Oberbefehlshaber als Gastgeber neben Hitler sitzen würde, mußte er aus der Schußlinie gehalten werden. Als die Verschwörer Kluge einweihten, erschrak der hohe Militär über ihren Plan und wandte ein, daß außer ihm auch noch andere Tafelgäste gefährdet wären. Schließlich stellte er fest, daß es ihm gegen den Strich gehe, einen Mann bei Tisch zu töten.
»Der einzige Mensch, der die Verschwörer im Stich ließ, war Kluge selbst«, stellen in ihrem »Canaris«-Buch die Autoren Heinrich Fraenkel und Roger Manvell fest. »Er brachte jedes nur mögliche Argument vor, um den Anschlag zu verschieben. Daraufhin beschloß Tresckow, auf eigene Faust, wenn auch in enger Zusammenarbeit mit den Verschwörern in Berlin, vorzugehen. Sie griffen auf den Alternativplan zurück, der nur Tresckows und Schlabrendorffs direkte Mitwirkung erforderte und der Kluge im Falle des Gelingens zwingen würde, sich auf ihre Seite zu stellen. Es schienen kaum Zweifel daran zu bestehen, daß Kluge – sobald Hitler tot war – den Putsch unterstützen würde.«
Die Verschwörer bastelten eine Höllenmaschine mit Zeitzündung. Wiederholte Versuche hatten bewiesen, daß das Mordgerät einwandfrei funktionierte. Schlabrendorff war bereit, den lautlosen Tod an Bord der Führermaschine zu schmuggeln.
Hitler brauchte nur noch zu kommen.
Endlich war es soweit. Am 12. März 1943 herrschte in Kluges Hauptquartier auf einmal hektische Geschäftigkeit. Hitlers vorausgefahrene Autokolonne war, begleitet von SS-Männern mit umgehängten Maschinenpistolen, aus Rastenburg eingetroffen. Männer vom Führerbegleitkommando besichtigten die Sicherheitseinrichtungen. Kurze Zeit später teilte Generalfeldmarschall von Kluge seinen Vertrauten mit, daß der Führer seinen Besuch angesagt habe, um die Frühjahrsoffensive von Kursk zu besprechen.
Es war ein kalter, schöner Wintertag. Die Toten lagen noch aufgestapelt an den Sammelplätzen. Sie konnten erst beigesetzt werden, wenn der frostklamme Boden aufgeweicht war. Sie boten keinen schlimmen Anblick, eine dicke Schneeschicht bedeckte sie wie ein Leichentuch.
Hans Rattenhuber, der Führer der SS-Sicherungsgruppe, hatte befohlen, daß Soldaten vom E-Hafen bis zur Blockhütte des Feldmarschalls als Postenkette Spalier zu stehen hätten. Der Oberbefehlshaber witterte die Spannung unter seinen Offizieren. Unmittelbar vor Hitlers Eintreffen sagte er zu seinem I A: »Sie werden doch um Gottes willen am heutigen Tag nichts unternehmen, Tresckow. Es ist noch viel zu früh dazu.«
Der Oberst schwieg; er fürchtete, daß es schon zu spät sei. Gleich danach fragte er seinen Adjutanten: »Was ist, Schlabrendorff, wollen wir’s wagen?« Es war eine theoretische Frage – die beiden Offiziere waren längst entschlossen zu handeln.
»Wir müssen es tun«, erwiderte der Kurier und Rechtsanwalt.
Kluge war schon unterwegs zum Feldflughafen, um Hitler bei der Landung zu begrüßen.
Die beiden Condor-Maschinen setzten am 13. März in kurzem Abstand hintereinander auf. Nach einem Händedruck lud der Genralfeldmarschall seinen Gast in seinen Wagen ein, aber der Diktator lehnte ab; er legte die kurze Strecke in seiner eigenen, gepanzerten Kolonne zurück; sie näherte sich langsam der Blockhütte des Generalfeldmarschalls. Über das Gelände fegte ein eisiger Wind, während die Sonne die Schneekristalle funkeln ließ. Hitler, Kluge und einige Offiziere zogen sich für ein paar Stunden in das Innere zurück.
Mittags fand im größeren Kreis ein Essen statt. Obwohl Hitler nur auf einen Blitzbesuch gekommen war, hatte er seine Diätköchin und seinen Leibarzt Professor Theo Morell – den Göring als »Reichsspritzenmeister« zu verspotten pflegte – mitgebracht. In der Tischrunde saßen die Offiziere, die sich bereit erklärt hatten, den Diktator zu erschießen. Sie waren ihm, soweit er sie noch nicht kannte, vorgestellt worden. Obwohl sie sich zusammennahmen, gingen ihre Blicke immer wieder zu Oberst von Tresckow, der ihren Anschlag – ohne weitere Erklärung – abgesagt hatte. Sie kannten den I A gut genug, um zu wissen, daß er – wie auch immer – die Gelegenheit wahrnehmen würde.
Sonst war Tresckow ein blendender Unterhalter. Heute wirkte er verschlossen, in sich gekehrt, als machte ihm Hitlers Anwesenheit zu schaffen.
»Was ist denn mit dem Oberst heute los?« fragte einer der jüngeren Offiziere einen Vertrauten des Ersten Generalstabsoffiziers.
»Sie wissen doch, daß der Herr Oberst zur Zeit ständig an Zahnschmerzen leidet«, erhielt er zur Antwort.
Alle Speisen, die Hitler zu sich nahm, wurden von Professor Morell zuvor abgeschmeckt. Hitler wirkte auf die Offiziere wie ein orientalischer Satrap, der sich gegen ein Giftattentat absichert. Tatsächlich fand die Prozedur nicht aus Angst vor einem Anschlag statt, sondern weil sein schwacher Magen Gewürze nicht vertrug. Der Diktator aß hastig, fast unappetitlich. Der Mann, der sich selbst zum Obersten Feldherrn erhoben hatte, war stark gealtert. Er litt in dieser Zeit bereits an Schwächeanfällen, Schüttelfrost, Unwohlsein; an seinen Unterschenkeln hatten sich Ödeme gebildet. Morell spritzte Sulfonamide, Drüsenstoffe, Traubenzucker und Hormone. Sein Patient nahm 28 verschiedene Medikamente, bis zu 150 Pillen pro Woche.
Die Stimmung der Tischrunde war gedämpft. Hitler sprach gelegentlich vom Durchhalten und von Wunderwaffen, aber es war nicht die Tageszeit für seine endlosen Monologe, und irgendwie schien er – wie jeder andere – darauf zu warten, daß die Tafel endlich aufgehoben würde.
Die Frondeure hatten sich die Baupläne der Führer-Condor verschafft. In geduldiger Arbeit waren von ihnen zwei Bomben englischer Herkunft gebastelt und mit einem Zeitzünder versehen worden. Mit Geschenkpapier umkleidet, lag das brisante Päckchen in einer Kiste, in der sonst das Kriegstagebuch der Heeresgruppe aufbewahrt wurde. Unmittelbar vor dem Abflug sollte das Danaergeschenk scharf gemacht und an Bord geschmuggelt werden. Tresckow fragte den neben ihm sitzenden Oberstleutnant i. G. Heinz Brandt von der Operationsabteilung des OKH, ob er in der Führermaschine mitfliegen werde.
»Und ob«, antwortete der Offizier. »Der Führer hat ja nie Zeit, und so muß ich ihm im Flugzeug meinen Vortrag halten.«
Tresckow bat den Oberstleutnant um einen Gefallen: »Ich hab’ eine Wette gegen Oberst Stieff vom Führerhauptquartier verloren. Zwei Flaschen Cointreau. Ich habe sie zu einem Päckchen verschnüren lassen – es dürfte keine große Mühe machen, sie zu transportieren. Würden Sie es bitte mitnehmen und dem Obersten mit meinen besten Grüßen überreichen?«
»Selbstverständlich, Herr Oberst«, erwiderte Brandt. Er würde in unmittelbarer Nähe des Führers sitzen, und so mußte die Explosion ihn gleichzeitig mit dem Führer zerfetzen, aber es würde ohnedies keine Überlebenden geben. Es war ein bitterer Gedanke für Tresckow, aber er selbst hatte sich und seinen Freunden beständig die Maxime eingeschärft, daß man die Waffen nicht selbst bestimmen könne, sondern daß diese von dem skrupellosen Gegner bestimmt würden. »Wer einen Tyrannen stürzen will, darf sich in der Wahl der Mittel keine Scheu auferlegen«, hatte er seinen Mitverschwörern eingetrichtert.
Unter riesigem Aufwand an Sicherheitsmaßnahmen fuhr Hitler nach Tisch zum Flughafen zurück. Wiederum bewachte ihn eine Postenkette im Schulterschluß. In einem Wagen folgten Tresckow und Schlabrendorff. Ohne Zwischenaufenthalt erreichte die Kolonne das Rollfeld, wo Flugkapitän Baur die Condor aufgetankt und startklar gemeldet hatte. Eine Jägerstaffel stand bereit, obwohl an diesem Frontabschnitt mit russischen Angriffen kaum zu rechnen war.
»Während Hitler noch auf der Piste stand und sich mit den höheren Offizieren der Heeresgruppe unterhielt«, beschreiben Heinrich Fraenkel und Roger Manvell die Szene, »bevor er sein kugelsicheres Flugzeug bestieg, wechselte Schlabrendorff mit Tresckow einen Blick und zerdrückte mit einem Schlüssel den Säurebehälter der Zündung. Dann überreichte er das harmlos aussehende Paket beim Einsteigen dem Oberstleutnant Brandt.«
Unter den Augen der SS-Bewacher verstaute der Offizier das Päckchen in seiner Aktentasche und folgte den anderen über die Gangway, ein lächelnder Todesbote, der sich noch einmal umdrehte und den Offizieren der Heeresgruppe Mitte zuwinkte. Der Säurezünder war auf eine halbe Stunde eingestellt. Nach den Berechnungen der Rebellen mußte Hitlers Maschine etwa auf der Höhe von Minsk zerplatzen. Die Höllenmaschine hatte so viel Kraft, daß sie ein riesiges Leck in den Rumpf der Viermotorigen reißen und sie dadurch zum Absturz bringen mußte.
Die Attentäter fuhren zurück. Sie durchlebten die längste halbe Stunde ihres Lebens, darauf wartend, daß einer der Begleitjäger per Sprechfunk der Bodenstation melden würde, daß die Führermaschine abgestürzt sei. 32 Minuten. 35.40. Noch immer keine Meldung. Noch waren die beiden Offiziere nicht über Gebühr beunruhigt. Säurezünder lassen sich nicht so auf die Minute und Sekunde berechnen wie ein Uhrwerk oder eine elektronische Einstellung.
50 Minuten. Noch immer blieb es still im Äther. Vielleicht hielt man den Tod Hitlers zunächst geheim. Man konnte sich auf die Clam-Haftminen, made in Great Britain, verlassen. Bei keinem einzigen Experiment hatten sie bislang versagt.
Die beiden Offiziere hofften und verzweifelten. Sie gingen alle Möglichkeiten durch – bis auf die einzige, bis auf die Nachricht, die nach zwei Stunden eintraf: Führermaschine in Rastenburg gelandet.
Tresckow und Schlabrendorff behielten die Nerven. Sie mußten sofort etwas unternehmen. Jetzt ging es nicht mehr um Hitlers Leben, sondern um ihren eigenen Kopf. Zunächst verständigten sie die Abwehr in Berlin, daß der Anschlag – warum auch immer – gescheitert sei, um dort voreiliges Handeln zu verhindern. Als nächstes mußten sie versuchen, das Danaergeschenk an Stieff – der erst am 20. Juli 1944 zu den eingeweihten Verschwörern gehören würde – wieder in ihren Besitz zu bringen.
Tresckow ließ sich mit dem Führerhauptquartier verbinden.
»Dumme Sache, Brandt«, sagte er. »Mir ist ein Mißgeschick passiert. Ich habe Ihnen versehentlich ein falsches Paket für Stieff mitgegeben. Bitte tun Sie mir einen Gefallen und behalten Sie es bei sich. Morgen kommt ein Ordonnanzoffizier und tauscht es aus.«
Oberstleutnant Brandt tat Oberst von Tresckow auch diesen Gefallen. Am nächsten Tag flog Schlabrendorff mit der üblichen Kuriermaschine nach Ostpreußen, um das explosive Päckchen auszutauschen. »Es stand noch auf seinem Tisch«, berichtet er. »Ich nahm das Paket an mich und fuhr noch zu Stieff, um den echten Cointreau zu überbringen. Stieff war von ungewöhnlich kleiner Statur, ein fröhlicher, drahtiger Mann, der über den Formen stand und allem Feierlichen abhold war. Früher war er Erster Generalstabsoffizier der 4. Armee unter Kluge gewesen. Er wußte längst, was die Glocke geschlagen hatte, und machte auch mir gegenüber aus seinem Herzen keine Mördergrube. Für Hitler hatte er nur Ausdrücke der Feindseligkeit. Nach Abschluß des Gespräches mit Stieff fuhr ich nach dem Bahnhof Rastenburg. Dort hielt ein nur für die Wehrmacht bestimmter Schlafwagenzug, der abends Ostpreußen verließ und am Morgen Berlin erreichte. Sofort schloß ich mich in das für mich reservierte Schlafwagenabteil ein und öffnete vorsichtig mit einer Rasierklinge das Paket. Ich entfernte den Zünder aus dem Sprengstoff und stellte zu meinem Erstaunen folgendes fest: Der Zünder war ganz schwarz. Die in der zusammengedrückten Flasche enthaltene Flüssigkeit hatte den Draht zerfressen. Der Schlagbolzen war nach vorne geschnellt, aber der Sprengstoff hatte nicht gezündet. Worauf das zurückzuführen war, konnte ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber ich ahnte, daß wohl die russische Kälte der wirkliche Grund war. Hatte doch auch in vielen Fällen der Krieg gezeigt, daß die deutsche Artillerie zu kurz schoß, weil unsere Geschosse auf das europäische Klima geeicht waren, aber durch die russische Kälte nicht ihre volle Wirkung entfalteten. Selbst die wieder und wieder geölten Maschinengewehre versagten in Rußland, wenn es Winter war. Rußland war eben nicht nur ein anderes Land, es war auch ein anderer Erdteil mit einem anderen Klima. Der Zug brachte mich pünktlich nach Berlin. Dort begab ich mich in das Haus von Professor Lauter. Er wohnte damals auf dem Kurfürstendamm und hatte eine Wohnung inne, die aus einer Flucht von Zimmern bestand. Zunächst einmal brachten wir die Bombe in einer großen, alten und wunderschönen Kommode unter. Aber schon bald darauf erhielt ich einen Anruf von Tresckow ...«
Der hatte seine Attentatspläne nicht aufgegeben. Bald verfügte der I A über einen neuen Termin und über einen neuen Akteur. Im Berliner Zeughaus fand in Anwesenheit Hitlers eine Heldengedenkfeier statt. Bei der Veranstaltung am 21. März 1943 sollte die Heeresgruppe Mitte russische Beutewaffen ausstellen, die Hitler in Gegenwart des Generalfeldmarschalls von Kluge und seiner Frau besichtigen wollte. Zuständig für die Präsentation der Beutewaffen war der I C der Heeresgruppe Mitte, Oberst von Gersdorff, der Offizier, der, nur halb eingeweiht, den Sprengstoff für die Führermaschine beschafft hatte. Tresckow war entschlossen, den Freiherrn jetzt voll in sein Vertrauen zu ziehen und ihn aufzufordern, die Blutarbeit zu erledigen, weil sich ihm als einzigem die Chance dafür bot.
Die beiden Offiziere vertraten sich in den riesigen Wiesengründen am Dnjepr – wo nun schon seit zwei Jahren das Hauptquartier der Heeresgruppe Mitte lag – die Beine. »Ist es nicht etwas Ungeheuerliches, daß hier zwei deutsche Generalstabsoffiziere zusammen überlegen, wie sie am sichersten ihren Obersten Befehlshaber umbringen können, Gersdorff?« fragte der I A den I C. »Aber es muß getan werden. Es ist die einzige Möglichkeit, Deutschland vor dem Untergang zu retten. Die Welt muß von dem größten Verbrecher aller Zeiten befreit werden. Man muß ihn totschlagen wie einen tollwütigen Hund ...«
Freiherr von Gersdorff, ein drahtiger Reiteroffizier, der bei Turnieren geglänzt hatte, war bereit, sich in die Pflicht nehmen zu lassen und dafür in den Sattel zu steigen.
Dann redete Tresckow seinem Oberbefehlshaber – um ihn aus der Schußlinie zu halten – den Besuch in Berlin aus; an seiner Stelle würde der Oberbefehlshaber der 9. Armee, Generaloberst Walter Model, an der Zeughaus-Veranstaltung teilnehmen.
Am 15. März flog der Militär, anstelle Kluges, in Begleitung Gersdorffs nach Berlin. Beide Offiziere meldeten sich bei Schmundt. Hier erhielt der I C eine Mitteilung, deren Weitergabe Hitlers persönlichem Adjutanten offensichtlich schwerfiel: Gersdorff sollte zwar die Ausstellung vorbereiten, sich danach aber im Hintergrund halten, da der Führer nur Generäle in seiner Umgebung haben wolle. Generaloberst Model – der als strammer Nationalsozialist galt – protestierte; er erklärte sich außerstande, Hitler die nötigen Erklärungen zu den Beutestücken zu geben, und bestand darauf, daß Gersdorff dies an seiner Stelle besorge. Schmundt war nach kurzem Zögern bereit, Gersdorffs Rolle in eigener Verantwortung zu genehmigen.
Am 20. März suchte der potentielle Attentäter den Schauplatz des Anschlags erstmals auf. Er besichtigte den Lichthof des Zeughauses, die Arbeiten an der Tribüne, die Proben des Philharmonischen Orchesters. Die Sicherungsbeamten aus dem Führerhauptquartier beobachteten den Obersten argwöhnisch; schließlich gewöhnten sie sich an seinen Anblick.
Als der Lotse des Führers am nächsten Tag, an dem er die Tat hinter sich bringen mußte, das Zeughaus betrat, wurde er schon freundlicher gegrüßt, aber doch kontrolliert. Nicht gründlich genug. In den Taschen seines Uniformmantels steckten die Clam-Minen, deren Zünder in der Condor-Maschine wegen der Kälte versagt hatte. Aber diesmal herrschten günstigere Temperaturen.
Gersdorff hatte die Höllenmaschine halbiert: Wenn eine Mine explodierte, würde sie die andere automatisch mitzünden. Der Oberst mußte nur ganz in der Nähe Hitlers stehen, um sich gleichzeitig mit ihm in die Luft zu sprengen. Tresckow hatte vorausgesehen, daß die Tat schwerer fallen müßte als der Entschluß, sie hinter sich zu bringen. Er hatte seinem Vertrauten vorsorglich Pervitin-Tabletten als Aufputschmittel mitgegeben.
Kurz vor 11 Uhr trafen die ersten Würdenträger des Dritten Reiches ein, zu einem Zeitpunkt, als der genaue Beginn der Veranstaltung aus Sicherheitsgründen noch nicht festlag; unter ihnen befanden sich Bekannte, Freunde, Untergebene und Vorgesetzte des Obersten von Gersdorff. Sie wunderten sich, wie fahrig der Freiherr, der kaum ein Wort mit ihnen wechselte, heute wirkte. Als sie erfuhren, daß er bei der Besichtigung der Beutewaffen Hitlers Lotse sein würde, nahmen sie fälschlich an, der I C leide an Lampenfieber.
Die Heldengedenkfeier im Zeughaus war eine der ganz wenigen Anlässe, bei denen sich der Führer noch in einer abgestimmten, sorgfältig ausgewählten Öffentlichkeit sehen ließ. Für die Betriebe, Schulen, Kasernen war Gemeinschaftsempfang angeordnet. Alle Reichssender würden die Feierstunde übertragen, und so könnte man in Smolensk bei der Heeresgruppe in Direktübertragung die Detonation der Höllenmaschine erleben.
Als der Dirigent den Taktstock hob, schluckte Freiherr von Gersdorff das Pervitin. Schon Minuten später spürte er die Wirkung. Sie war so stark, daß die Führerrede an ihm vorüberrauschte, ohne daß er ihren Sinn erfassen konnte. Alles wirkte verschwommen, als der Attentäter – das letzte Orchesterstück nicht mehr abwartend – zu den Ausstellungsräumen ging.
»Ich stand zwischen Model und dem uniformierten Direktor«, berichtete Gersdorff. »Es dauerte jedoch noch eine ganze Weile, bis Hitler erschien. Neben ihm ging Göring, der in seiner weißen, mit Orden und Schmuck überladenen Uniform und in roten Saffianstiefeln den Eindruck eines Operettenfürsten machte; zudem war er auf grotesk auffallende Weise geschminkt. Hitler wurde von Himmler, Keitel, Dönitz, Schmundt sowie zwei oder drei Ordonnanzoffizieren begleitet. In der Tür wandte Hitler sich plötzlich um und sagte: ›Herr Feldmarschall von Bock, ich bitte Sie, als ehemaligen Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte, sich mir anzuschließen.‹ Bock quittierte mit einer etwas übertriebenen Verbeugung ...«
Diesen Augenblick, in dem die Anwesenden ein wenig abgelenkt waren, nutzte Gersdorff, um den Zündmechanismus der in seiner linken Manteltasche steckenden Clam-Haftmine einzuschalten. Es war eine groteske Doppelbewegung, denn wie alle Anwesenden hatte er beim Auftauchen des Diktators den rechten Arm zum Hitlergruß hochgerissen, als er mit der linken Hand unbemerkt im Gedränge den programmierten Tod einschaltete: Artistik auf Leben und Tod. Zehn Minuten noch. Allenfalls zwölf. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre würde sich der Diktator mindestens eine halbe Stunde mit den Ausstellungsstücken befassen, vielleicht sogar länger.
»Hitler begrüßte nur Model mit Handschlag«, erinnert sich Gersdorff. »Dann begann der Rundgang, wobei ich mich dicht an Hitlers linke Seite drängte. Als ich Erklärungen zu verschiedenen Ausstellungsstücken abgeben wollte, hörte Hitler offensichtlich gar nicht zu. Auch als ich ihn auf einen napoleonischen Adler aufmerksam machte, den deutsche Pioniere beim Brükkenbau über die Beresina im Flußbett gefunden hatten, erhielt ich keine Antwort. Statt dessen ging, oder besser gesagt, lief Hitler auf kürzestem Weg in die Richtung des seitlichen Ausgangs. Auch Göring, der inzwischen einen Blick in eine Vitrine mit Schriftstücken geworfen hatte und Hitler auf einen patriotischen Aufruf des Metropoliten von Moskau aufmerksam machen wollte, wurde keiner Antwort gewürdigt. Am Ausgang an der Zeughausstelle, in deren Nachbarschaft das Ehrenmal steht, verabschiedete sich Hitler von Model und mir mit dem üblichen rechtwinkeligen Erheben des rechten Unterarms. Hitler hatte während des kurzen Ganges durch die Ausstellung kein Wort gesprochen und sich kaum etwas angesehen. Nach dem Krieg stellte sich heraus, daß die BBC die ganze Feier mitgeschnitten hatte: die Zeit von seinem Eintreffen bis zum Verlassen des Zeughauses hatte nur zwei Minuten gedauert. Mir war sie in der Erinnerung einige Minuten länger erschienen. In jedem Fall wäre das selbst für eine normale Zünddauer von zehn Minuten zu kurz gewesen.«
Hitler verließ das Gebäude, und mit ihm entschwand dem Attentäter die Möglichkeit, ihn zu töten. Wie ferngelenkt kletterte der Diktator vor dem Haus auf einen russischen Beutepanzer, der zwischen dem Zeughaus und dem Ehrenmal aufgestellt war. Nur das gepanzerte Ungetüm schien ihn an diesem Tag zu interessieren. Und Gersdorff hastete in die Toilette, um schleunigst den Zünder aus der Höllenmaschine herauszuschrauben.
Auch der zweite Versuch der Heeresgruppe Mitte war an einer Zufälligkeit gescheitert. Der Krieg ging weiter, Millionen von Menschen hatten noch vor Hitler, der das Anlaufen der »Operation Zitadelle«, seiner letzten Offensive im Osten, forderte, zu sterben.
Über Nacht wechselte das Wetter. Dem strengen russischen Frost folgte – wie erwartet – die Schlammperiode. Im Morast erstickten alle Bewegungen der ineinander verbissenen Gegner. Zuvor war es dem unbestreitbaren Geschick des Generalfeldmarschalls von Manstein in äußerster Bedrängnis gelungen – die sowjetischen Panzerspitzen, nur noch 200 Kilometer von der Stadt Dnjepropetrowsk entfernt, hatten zwei Drittel dieser Distanz in einer Woche geschafft –, in einer Gegenoffensive die katastrophale Lage noch einmal zu meistern und im Kampf die Oberhand zu gewinnen: 866 Panzer und 1198 Geschütze wurden erbeutet; 23000 russische Soldaten waren gefallen, doch nur 9000 in Gefangenschaft geraten. »Die Russen starben, aber sie ergaben sich nicht mehr.« (Raymond Cartier)
Die aufgerissene deutsche Ostfront war wieder geschlossen, und Hitler trieb mit den Operationsbefehlen Nr. 5 und Nr. 6 vom 13. März und 15. April seine vorgezogene Sommeroffensive voran. Sie sollte bereits am 3. Mai anlaufen. Aber dieser Termin war utopisch und das ganze Unternehmen mehr als fraglich. »Der Kursker Keil verleitete Hitler dazu, eine weitere Schlappe zu riskieren und zu erleiden, die genauso schwerwiegend war wie seine Niederlage bei Stalingrad«, kommentiert Mark Arnold-Forster. »Es war nicht so, daß die Russen ihn bewußt in die Falle gelockt hätten: sie besetzten den Landkeil bei Kursk einfach, weil sie dieses Gebiet erobert hatten. Doch wie die Sowjets wußten, stellte ein Gebietsvorsprung für einen deutschen General eine große Versuchung dar. Zumindest war das damals so. Die klassische Reaktion des deutschen Generalstabs auf einen vorspringenden Keil in den feindlichen Linien, einen vom Feind gehaltenen Vorposten, der über den allgemeinen Frontverlauf herausragte, hatte von jeher darin bestanden, diesen Vorsprung durch einen gleichzeitigen Angriff auf beide Flanken abzuknipsen. Eben dies beschloß Hitler im Fall von Kursk denn auch zu tun, genau wie die Sowjets es erwartet hatten.«
Ziel der Operation war es, die Straße von Orel an der Nordostecke des Keils nach Moskau frei zu machen; es war örtlich begrenzt, aber: »Der Sieg bei Kursk muß für die Welt wie ein Fanal wirken«, hieß es in Hitlers Angriffsbefehl.
Beide Seiten rüsteten zur größten Schlacht des Rußlandfeldzuges; beide Seiten wollten – nach Beendigung der Schlammperiode – wieder offensiv werden. Die Russen waren – was ihre deutschen Gegenspieler nicht wußten – durch den Schweizer Agentenring »Lucy« über alle Pläne und Vorbereitungen ihrer Feinde informiert. Hinwiederum blieb den Sowjets unbekannt, daß die Deutschen durch das neue Freya-Gerät die Möglichkeit hatten, ihre Bomberanflüge schon aus großer Distanz zu orten und dann im Alarmstart ihre Jäger loszuschicken.
Manstein schlug vor, die russische Offensive »federnd aufzufangen« und mit bereitgestellten Kräften massiv zurückzuschlagen, wenn ihr erster Schwung sich totgelaufen hätte. Hitler jedoch befahl – wie immer – die offensive Lösung, und auch sein fähigster Generalfeldmarschall hielt eine solche für machbar, falls es gelang, dem Sowjetangriff zuvorzukommen.
So freilich sah es nicht aus.
Zwar hatte der neue Rüstungsminister Albert Speer die Anstrengungen ins Gigantische gesteigert und schon im Winter 1942/43 eine Produktionssteigerung von 56 Prozent erzielt – bis zum Sommer 1944 sollte sie, ungeachtet der Schäden des Luftkriegs, auf das Dreifache anwachsen ‒ aber davon merkte man im Osten wenig.
Die Wunderwaffen, die Hitler versprochen hatte, waren ohnedies ausgeblieben, aber selbst mit den konventionellen Waffen klappte es nicht so, wie es die massierten Rüstungsanstrengungen erhoffen ließen: Henschel konnte bis zum 25. März nur 330 Tiger und 25 Panther liefern, Porsche schaffte bis Mitte März 90 Tiger. Zwar wurden die 556 B-3- und B-4-Kampfwagen mit zusätzlichen Stahlplatten ausgerüstet, aber die »Schürzen« behinderten ihre Beweglichkeit noch mehr. Die Panther, von denen bis zum Juli insgesamt 200 geliefert wurden, wiesen oft schadhafte Getriebe auf, ihre Optik war mangelhaft. Der Typ war noch lange nicht frontreif, ging aber in Serie. Der Panzerjäger »Ferdinand« hatte zwar stabile Stahlplatten auf der Frontseite, aber er war untermotorisiert und wirkte im Nahkampf, für den er geschaffen war, wie ein hilfloser Riese, 70 Tonnen schwer.
Neue Panzer kamen nur selten an die Front, sie wurden zur Ausrüstung neu aufgestellter Einheiten benötigt. »Die Kommandeure gaben daher nur unwillig beschädigte Panzer zur Hauptinstandsetzung in die Heimat ab, sondern zogen es vor«, berichtet Geoffrey Jukes, »sie mit feldmäßigen Mitteln wieder einsatzbereit zu machen. Diese Art der Flickschusterei lief unter dem Motto: Der kaputte Panzer in der eigenen Instandsetzungskompanie ist mir nützlicher als der neue aus der Heimat, der niemals ankommt ...«
Kaum besser sah es mit dem Ersatz der Soldaten aus, der dem Ostheer garantiert worden war. Die Front erreichten kaum ausgebildete Pimpfe oder viel zu alte Landsturmsoldaten, die durch die totale Kriegführung in der Heimat freigestellt worden waren. Ihr Durchschnittsalter lag bereits über 40, aber selbst die Zahl der neuen Wehrpflichtigen – das war jetzt praktisch jeder männliche Deutsche zwischen 16 und 60 – blieb weit hinter den Erwartungen zurück.
Der Bergbau konnte nur 200000, die Reichsbahn nur 33000 Mann abgeben. Aus den Geburtsjahrgängen 1906–1922 sollten noch einmal 100000 Soldaten rekrutiert werden, aber die Sollstärke der Wehrmacht wies im ersten Halbjahr 1943 noch immer ein Defizit von 616000 Mann auf; um es auszugleichen, mußte Hitler, was ihm schwerfiel, seinen Rassedünkel einschränken und die Anwerbung von Ausländern in die deutsche Wehrmacht genehmigen.
Die Luftwaffe griff sofort zu und stellte für ihr Bodenpersonal 100000 Hilfswillige ein. Das Ersatzheer nahm sogar Kriegsgefangene. Das Feldheer kam auf 320000 Freiwillige, die man verächtlich »Hiwis« nannte. Die Hilfstruppen im Osten, auf 176 Bataillone sowie 38 Kompanien und Schwadronen verteilt, erreichten eine Stärke von 150000 Soldaten.
Heinrich Himmler verzichtete auf die Exklusivität der Waffen-SS und warb in Lettland, Estland, Holland, Belgien, Luxemburg und Norwegen um Runenanwärter. Sogar 100000 Galizier meldeten sich freiwillig zur Himmler-Garde, 30000 von ihnen wurden genommen. Eine muselmanische Bosniaken-Division mit 21000 Mann komplettierte das nunmehrige Arsenal der Himmler-Hilfswilligen. Probleme, die sich aus diesem Völkergemisch ergaben, wollte der Generalgouverneur in Polen, Hans Frank, so lösen: »Versagen sie, schießen wir sie tot. Eine einfache Sache.«
Zu den Vorbereitungen des »Unternehmens Zitadelle« gehörte auch die Wiedereinsetzung des Panzergenerals Guderian – er war nach dem Debakel vor Moskau 1941 von Hitler entlassen worden – als Generalinspekteur der Panzerwaffe. »Es hat zwischen uns eine Reihe von Mißverständnissen gegeben«, sagte Hitler. Der »schnelle Heinz« bestand auf seiner Forderung, nur dem OKW direkt unterstellt zu sein.
»General Guderian war nach einer ersten Bestandsaufnahme in seinem neuen Kampfbereich erschüttert über den Zustand der Panzerverbände«, schreibt in seinem Buch »Die Schlacht der 6000 Panzer« der US-Autor Geoffrey Jukes. »Die von ihm entwickelte Gliederung einer Panzerdivision basierte auf 4 Regimentern mit je 100 Panzern. In der Zeit seiner Zwangspensionierung war die Zahl der Panzer durch Änderung der Gliederung auf 200 Panzer und ein Bataillon Sturmgeschütze reduziert worden. Da bei den niedrigen Produktionsziffern im Jahre 1942 die hohen Verluste in Rußland jedoch nicht annähernd ersetzt werden konnten, war die Zahl der einsatzbereiten Panzer aller 18 Panzerdivisionen an der Ostfront auf insgesamt 495 Panzer abgesunken. Durchschnittlich verfügte eine Division damit über nur 27 einsatzfähige Panzer. Guderian setzte sich daher dafür ein, das Jahr 1943 zur Wiederauffrischung der Panzerverbände zu nutzen und deshalb auf eine Offensive zu verzichten.«
Daran war nicht zu denken, aber immerhin hatte Guderians Vorschlag die zweite Verschiebung des Angriffstermins bewirkt; es sollte noch die neue Panzergeneration abgewartet werden, insbesondere die 250 »Panther«, die der Front für Ende Mai versprochen worden waren. Zu diesem Zeitpunkt stieg die Zahl der Zwangsarbeiter in Deutschland bereits auf 5,25 Millionen Ausländer an. 11 Millionen schufteten in den besetzten Ostgebieten für die Rüstung, 20 Millionen im besetzten Frankreich, vorwiegend für Konsumgüter.
Tagtäglich berichtete »Fremde Heere Ost« über das Anwachsen der sowjetischen Kampfstärke. »Nach dem zweiten Kriegsjahr hatten die Sowjets ihr Lehrgeld bezahlt«, resümiert Geoffrey Jukes. »Unfähige Führer waren ausgemustert worden und jüngere, tatkräftige nachgewachsen. Viele von ihnen waren Schüler des von Stalin hingerichteten Marschalls Tuchatschewski. Diese neuen Führer wie Konjew, Rokossowski, Watutin, Golikow, Jeremenko, Meretskow, Malinowski und viele andere waren gleichwertige Gegner für die deutschen Kommandeure. Der bekannteste von ihnen, Marschall Schukow, war an jeder Schlacht des Krieges beteiligt und hat keine verloren ...«
Zwei Mammutheere lagen einander gegenüber, den Blick auf Kursk fixiert. Nicht einmal die Ruhe vor dem Sturm brachte eine Verschnaufpause. In Warschau hatte sich das Getto erhoben. Nach monatelangem erbarmungslosen Kampf schlug am 19. Mai der SS-Brigadeführer Jürgen Stroop den Aufstand endgültig nieder. 6000 Rebellen wurden erschossen; 50000 Überlebende kamen nach Auschwitz, Treblinka und Majdanek.
Das andere totalitäre System, das der Sowjets, war kaum menschlicher: Im Wald von Katyn wurden die Leichen von 4243 polnischen Offizieren ausgegraben, die Stalin mit Genickschuß hatte beseitigen lassen. Das Nationalkomitee der Polen in London war der gleichen Meinung, aber die Weltöffentlichkeit nahm das Verbrechen gelassen auf – braun oder rot, jedes System hatte seine eigenen Massengräber.
Im deutschbesetzten Hinterland verstärkte sich am Vorabend der Schlacht von Kursk der Partisanenkrieg noch. 80000 Soldaten standen ständig im Einsatz gegen die Rebellen aus dem Hinterhalt. Auf den Reichsleiter Wilhelm Kube, einen von Hitlers übel beleumdeten Ostsatrapen, wurden vier Anschläge hintereinander verübt; der letzte, eine unter seinem Bett verborgene Bombe, hatte Erfolg. Die 330 Meter lange Eisenbahnbrücke über die Desna flog in die Luft. Bei einem Luftangriff am 4. Mai auf Orscha wurden 300 Eisenbahnwaggons in Brand geschossen. Laufend erfolgten Angriffe und Anschläge auf die Bahnhöfe von Gomel, Brjansk und Lokhot. Der Nachschub, den die Russen vernichteten, mußte der »Operation Zitadelle« entzogen werden.
Einen anderen Aderlaß nahm Hitler selbst vor: Schon vor der Schlacht ließ er Manstein wissen, daß er auf sechs Elitedivisionen verzichten müsse, da sie, in Erwartung des Badoglio-Putsches, für Italien bereitzustehen hätten.
Auf beiden Seiten lauerten Tausende von Panzern auf riesigen Weizen- und Zuckerrübenfeldern in Bereitstellung. Kursk liegt in der Ebene Zentralrußlands, 530 Kilometer südlich von Moskau, eine alte Stadt aus dem 11.Jahrhundert, in der bei Ausbruch des Krieges 120000 Einwohner gelebt hatten. Sie war das Herzstück des Kursker Bogens, der in einem Angriff mit einer von Orel (Kluge) bis Charkow (Manstein) reichenden Front überrannt werden sollte.
5. Juli, 3 Uhr 30. Unmittelbar vor Beginn des deutschen Trommelfeuers kam ihm die russische Artillerie mit dem Beschuß der deutschen Ausgangsstellen zuvor. Auf die Minute pünktlich jagten 1700 deutsche Bomber, Stukas und Schlachtflugzeuge während des Artillerieduells über die Pisten der E-Häfen, um in die Offensive einzugreifen. Der Massenstart klappte, trotz der überfüllten Flugplätze.
Das Wetter war hervorragend, aber nicht nur für die deutschen, sondern auch für die russischen Flugzeuge. Auf einmal griffen die Sowjets mit starken Verbänden an, die sie angeblich nicht mehr hatten. Die Freya-Funkmeßgeräte bei Charkow orteten mehrere hundert Flugzeuge. Die Warnung kam gerade noch rechtzeitig, um ihnen die Abfangjäger im Alarmstart entgegenzuwerfen.
Nach dem Gemetzel auf der Erde kam es zum Massaker in der Luft.
Brennende Flugzeuge fielen vom Himmel. Vorrückende Kampfwagen explodierten in den Minenfeldern. Um 5 Uhr 30 waren die ersten Panzer zum Angriff auf die Stellungen der 13., 48. und 70. Armee der Russen angetreten. Auf einer Frontbreite von 45 Kilometern standen 3 Panzerdivisionen und 5 Infanteriedivisionen der Deutschen im Gefecht.
Um 7 Uhr 30 erfolgte nach einstündiger Artillerievorbereitung ein weiterer Angriff im südlichen Abschnitt der 13. Armee. Tiger-Panzer rollten an der Spitze. Hunderte anderer Kampfwagen und Schützenpanzer folgten ihnen. Die Sowjets setzten ihre Luftstreitkräfte gegen sie ein. »Ich habe während des ganzen Ostfeldzugs noch nicht so viele russische Flugzeuge am Himmel gesehen wie bei diesem Luftangriff«, stellte General Grossmann, der Kommandeur der 6. deutschen Infanteriedivision, fest.
Im letzten Moment hatten sowjetische Pioniere noch einmal 6000 Minen verlegt, die bereits am ersten Angriffstag 100 deutsche Panzer zerfetzten. Die anderen, durch die Sperren in ihrer Manövrierfähigkeit behindert, rollten direkt auf die Mündungen der russischen Panzerabwehrkanonen zu.
Besser erging es auf dem Südflügel der Panzerarmee Hoth; sie kam schneller voran und brach südlich Obojan 18 Kilometer tief in die sowjetischen Stellungen ein. Models 9. Armee gewann, trotz Unterstützung durch Stuka- und Jabo-Angriffe, nur 10 Kilometer Raum. Die Verluste stiegen ungeheuerlich. An das operative Ziel, die Schließung der Zange nach sechs Kampftagen hinter Kursk, war nicht zu denken – das Operationsziel blieb unerreichbar.
Die gestaffelte Verteidigung, die von russischen Generälen unter Mitwirkung der Zivilbevölkerung in wochenlanger Arbeit aufgebaut worden war, bewährte sich. Wenn auch die einzelnen Auffanglinien dem massierten Angriff nicht immer standhalten konnten, so wurden Einbrüche doch sofort abgeriegelt und bereitgestellte Reserven nach vorne gebracht.
Der deutsche Vormarsch, für den Verstärkungen von allen Fronten abgezogen worden waren, kam nur langsam voran. Die Zeit der raschen Flügelbewegungen mit motorisierten Verbänden und den von den Geschwadern der Luftwaffe freigebombten Wegstrecken, die Zeit der tödlichen Umklammerung des Feindes, war schon Legende. Beide Seiten hatten jetzt gleichwertige Waffen und gleichwertige Heerführer, ihre Soldaten dieselbe Kampfmoral, nicht zuletzt weil sie meistens auf diesem barbarischen Kriegsschauplatz den Tod der Gefangenschaft vorzogen.
Die Rotarmisten fürchteten die Überlegenheit des Gegners längst nicht mehr; die Soldaten der Wehrmacht wußten, daß sie nicht mehr für ein fernes Fähnchen auf der Generalstabskarte kämpften, sondern dafür, daß der Feind nicht schon in Monaten vor Breslau, Königsberg, Stettin und Berlin stand. Es ging für sie nicht mehr darum, ob sie sich für oder gegen Hitler schlugen; die militärische Lage forderte ihnen die letzte Tapferkeit ab, fern der Heimat hatten sie bereits das Bewußtsein, daß sie jetzt ihre Frauen, Kinder und Mütter vor einem Feind schützen mußten, der wenig Gründe hatte, sich fair oder menschlich zu benehmen.
Die 4. Panzerarmee (Hoth) hatte nach drei Tagen 40 Kilometer geschafft. Gemessen an den Geländegewinnen früherer Schlachten war es wenig, doch fast doppelt so viel, wie auf der Nordseite Models 11. Armee erreicht hatte. Es kam zu einem Wettlauf zwischen den sowjetischen Reserven, die aus den Bereitstellungen in die Hauptkampflinie geführt wurden, und den deutschen Schlacht- und Kampfflugzeugen, die sie aus der Luft aufhalten sollten.
Hoth galt als ein hervorragender Panzerführer, und auf mittlere und lange Entfernung waren die neuen Tiger den sowjetischen T 34 tatsächlich weit überlegen. Sorge machte dem Generalobersten jedoch, daß seine rechte Flanke weitgehend ungedeckt war. Den dafür aufgebotenen Divisionen war es nicht gelungen, ein riesiges Waldstück nördlich Bjelgorod von den Russen zu säubern. Ständig hingen deutsche Aufklärer in der Luft, um die Gefahrenzone zu überwachen. Prompt trat ein, was zu befürchten war: Aus den Wäldern heraus rückten über eine offene Ebene 30,40 und noch mehr Sowjetpanzer, mindestens eine Brigade, heran, begleitet von Infanteristen in geschlossenen Formationen, wie in Exerzierplatzordnung.
Alarm bei der in Mikojanowka in Bereitschaft liegenden Panzerschlachtgruppe: In 4 Staffeln mit je 16 HS 129, speziell ausgerüsteten Panzerjägern, die erst vor wenigen Tagen eigens für die »Operation Zitadelle« aus Deutschland nach Osten verlegt worden waren, bestückt mit 9 3,7-Zentimeter-Kanonen, gingen die niedrigfliegenden Todesvögel in eine schaurige Premiere. Sie griffen die Panzerkolonne, deren Besatzungen zunächst nicht durchdrehten, weil bislang ihre Panzerplatten immer die Treffer aus den Bordkanonen der Schlachtflugzeuge aufgehalten hatten, an.
Die ersten HS 129 stürzten sich wie die Habichte nach unten. In Erwartung ihrer Splitterbomben flitzten die russischen Infanteristen auseinander, suchten auf dem übersichtlichen Gelände irgendwo Deckung zu finden. Als die ersten T 34 mit einer Stichflamme in die Luft flogen und die Fahrer der anderen versuchten, in wilder Zickzackfahrt den Luftangriffen zu entkommen, begriffen sie, daß die Angriffe diesmal weniger ihnen als den Panzerbesatzungen galten. In wenigen Minuten waren die ersten T 34 vernichtet und wurden die Flüchtenden weiter von scharfkralligen Raubvögeln gejagt.
An allen Abschnitten der erbitterten Schlacht bot sich das gleiche Bild: Die eigentlich schon ausgemusterten Stukas waren als Lückenbüßer jetzt oft die einzigen Nothelfer. Beim Anlaufen der Offensive auf den Kursker Bogen hatte die Luftwaffe im Süden 1000 Flugzeuge, im Norden bei Orel 700 an den Start gebracht, was ziemlich genau der Kampfstärke beim Überfall 1941 auf Rußland entsprach. Trotzdem gab es keine deutsche Überlegenheit mehr, auch in der Luft war der Russe ein gleichwertiger Gegner geworden.
Örtliche Erfolge, teuer erkaufte Einbrüche konnten den ungünstigen Gesamtverlauf der Offensive nicht verdecken. Im Führerhauptquartier jagten sich die Hiobsbotschaften. In der Führungsspitze der Wehrmacht mehrten sich die Stimmen, die für einen sofortigen Abbruch der Offensive eintraten. Hitler befahl, sie fortzusetzen und alle verfügbaren Reserven in die Schlacht zu werfen. Aber fünf Tage nach der deutschen X-Zeit traten die Sowjets in Richtung Orel und Charkow zu ihrer Gegenoffensive an und rissen endgültig das Gesetz des Handelns an sich.
Am 12. Juli kam es zur größten Panzerschlacht des Zweiten Weltkriegs. Freund und Feind bewegten sich in zwei endlosen Kolonnen aufeinander zu, 850 Kampfwagen des sowjetischen Generals Rotmistrow, vorwiegend T 34, und 700 der Panzerarmee Hoth, deren Gros aus dem SS-Panzerkorps Hausser bestand. Beide Generäle hatten sich bei dem gescheiterten Entlastungsangriff auf Stalingrad schon einmal gegenübergestanden; beide führten die Schlacht persönlich, der Russe von einem Hügel aus, der einen ausgezeichneten Blick auf die unübersehbare Zahl von Kampffahrzeugen ermöglichte, die am Psel-Fluß auf einem überfüllten Schlachtfeld in den Angriff rollten, vorbei an Waldparzellen und Obstplantagen. Generaloberst Hoth war von seinem Gefechtsstand auf den Führungspanzer umgestiegen; er wußte bereits, daß bei der mit furchtbarer Wucht losgebrochenen Gegenoffensive bei Orel Models Truppen direkt in das russische Messer gelaufen waren und daß die anglo-amerikanische Invasion auf Sizilien vor zwei Tagen begonnen und Fuß gefaßt hatte.
Die T 34 waren auf Schußentfernung herangekommen. Die Tiger eröffneten das Feuer, schossen die vorderen Sowjetpanzer in Fetzen. Aber im Schutz des Rauchvorhangs und unter Ausnutzung ihrer größeren Beweglichkeit rollten weitere Rudel der Panzer mit dem roten Stern heran und durchbrachen unter schweren Verlusten die vordere Reihe der deutschen Kampfwagen. Sie waren auf kurze Entfernung den 60-Tonnen-Ungetümen auf einmal überlegen. Die ersten Tiger, deren verblüffte Besatzungen von den T 34 unterlaufen worden waren, wurden abgeschossen.
Die Gegner verkeilten sich ineinander. Im blutigen Durcheinander verloren sich Angriff und Verteidigung, Freund wie Feind. Die Konturen der feuerspuckenden Kampfwagen verschwanden im Qualm. Gelegentlich landete ein Volltreffer in der mitgeführten Munition, dann zerriß eine hohe Stichflamme den Rauchvorhang. In diesem kurzen Aufleuchten konnte keiner mit Sicherheit sagen, ob es einen T 34 oder einen Tiger erwischt hatte. Bald bedeckten Hunderte ausgebrannter Wracks das Schlachtfeld, über dem russische und deutsche Flugzeuge kreisten, versuchend, aus Flammen und Rauch ein Angriffsziel zu erspähen.
Erst am Abend flaute der Gefechtslärm ab, verzogen sich die Qualmwolken. Bilanz des grausamen Geschehens: Die Panzerschlacht hatte unentschieden geendet. Jede Seite mußte etwa 300 Panzer von der Kampfstärke abbuchen, aber die Russen waren die eigentlichen Sieger, weil ihre Gegner das Angriffsziel nicht erreicht hatten. Die Sowjets verfügten jetzt noch über 500 Panzer, der SS-Gruppenführer Hausser noch über etwa 350. Die Sowjets wußten nun auch, daß sie dem neuen deutschen Wunderpanzer beikommen konnten und im Nahkampf seine Tigerkrallen weniger tödlich waren als befürchtet.
»Für die Deutschen zählten die tatsächlichen Ausfälle weniger als der Verlust an Stolz und Selbstvertrauen«, stellt Geoffrey Jukes fest. »An einem Tag hatte das SS-Panzerkorps fast die Hälfte seiner Kampfwagen verloren ... Die Elite des nationalsozialistischen Deutschlands, ausgerüstet mit modernstem Gerät und in dem Glauben rassischer Überlegenheit, hatte sich eine Schlacht mit dem ›Untermenschen‹ geliefert und dabei erkannt, daß er ihr gleichwertig war.« Auf dem Schlachtfeld, das auf der einen Seite durch den Psel und auf der anderen durch einen Bahndamm begrenzt wurde, hatte – wie der Sowjetmarschall Koniew später feststellte – der »Schwanengesang der deutschen Panzertruppe« stattgefunden.
Einen Tag später ließ Hitler die »Operation Zitadelle« abbrechen. Fast alle Truppen mußten Verstärkungen für die Orel-Front abtreten, wo mittlerweile um das schiere Überleben gekämpft wurde. Der Orel-Bogen mußte geräumt werden. Die Russen stürmten weiter vor. Gleichzeitig lähmte eine Partisanen-Aktion größten Stils für 28 Stunden jeglichen Nachschubverkehr auf den Eisenbahnstrecken.
Zum zweiten Mal mußte Charkow aufgegeben werden. Brjansk und Stalino wurden vom Feind freigekämpft und genommen. Noch immer widersetzte sich – unter Androhung von Kriegsgericht und standrechtlicher Erschießung – Hitler jeder Rückzugsbewegung, doch jeden Tag verlor das Ostheer Gelände, das es befehlsgemäß in »verbrannte Erde« verwandelte. Die Erkenntnis der Entlastungsoffensive vor Stalingrad bestätigte sich immer wieder: Im Osten konnte die Wehrmacht bei geschickten Gegenvorstößen zwar noch Geländegewinne erzielen, zu einer großangelegten Offensive aber reichten ihre Kräfte nicht mehr aus. Nur widerwillig stimmte Hitler dem vorsorglichen Ausbau fester Stellungen zu, die als Ostwall in erster Linie eine Rolle für die Propaganda spielten.
»Deutschland hat das Westufer des Dnjepr in Stahl und Beton gegossen«, hieß es auf Flugblättern, die von deutschen Flugzeugen zu Hunderttausenden über den russischen Linien abgeworfen wurden. »Wir haben hier einen Ostwall gebaut, der genauso undurchdringlich ist wie der Westwall. Ihr, die ihr dort angreifen müßt, werdet in den Tod geschickt. Tod und Verderben erwarten euch am Dnjepr.«
Mit Flugblättern ließen sich die Sowjets nicht mehr aufhalten. Die verlustreiche Schlacht von Kursk trug entscheidend dazu bei, daß der Russensturm schon erschreckend bald gegen die deutschen Grenzen vordringen sollte.