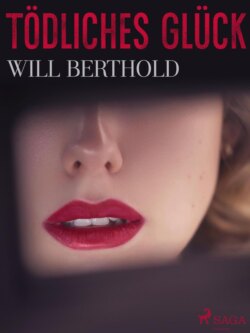Читать книгу Tödliches Glück - Will Berthold - Страница 5
ОглавлениеDer Sommertag wirkte wie ein fauler Wechsel, der jeden Moment zu platzen drohte. Zur Zeit lag Deutschland von der Nordseeküste bis zur Donau unter dichtem Regen, aber von den Bergen her war in die oberbayerische Landschaft eine Art Föhn eingefallen. Die Wälder schimmerten blau, der Himmel trug orangefarbene Flecke, und die Luft wirkte verbraucht wie Spülwasser. Die am späten Vormittag im Chefbüro in Pullachs „Weißem Haus“ zusammengetrommelten Teilnehmer einer improvisierten Besprechung wirkten abgeschlafft.
Den Spitzenleuten des bundesdeutschen Geheimdienstes war natürlich bekannt, daß – meteorologisch gesehen – im Hochsommer keine Föhnlage entsteht, aber als Experten der unsichtbaren Front wußten sie nur zu gut, daß auf dieser Erde vieles existiert, das es gar nicht geben darf, und so litten sie sichtbar, und nicht nur unter der Wetterunbill.
Der Hausherr des 60 000 Quadratmeter großen und durch eine eineinhalb Kilometer lange Mauer abgeschirmten geheimen Hauptquartiers – im Isartal, zehn Kilometer südlich von München – saß an seinem Schreibtisch, ein schlanker, mittelgroßer Mann mit einem schmalen Kopf, kalten Augen, mit hohem Stirnansatz und schütteren Haaren. Auf den ersten Blick fielen seine übergroßen Ohren auf, überdimensionierten Horchgeräten gleich, wie sie einem Untergrundchef anstehen. Pullachs Chef nannte sich Dr. Schneider, aber jeder im Camp wußte, daß er in Wirklichkeit General Gehlen war, der frühere Chef der geheimen Nachrichtenabteilung „Fremde-Heere-Ost“. Hier, im engsten Mitarbeiterkreis, kannte jeder die wahre Identität des anderen, aber Pullachs legendärer und autoritärer Hausherr bestand darauf, daß sich seine Crew auch im internen Verkehr mit den falschen Namen anredete, und so kam es seinen Männern mitunter vor, als trügen sie ihre Pappnasen auch außerhalb des Karnevals.
Die Vertrauten des Chefs, von den Fernerstehenden mißgünstig „Pullachs Mafia“ genannt, waren fast vollständig zur Stelle: Dr. Grosse, der scharfsinnige Analytiker von der „Auswertung“, der kleine Karsunke, der schlaksige Söldner, der schieflippige, krummnasige Schluckesaft von der „Zentralen Abteilung“, Kleemann, der Schweigsame und der aggressiv intrigante Dennert mit dem Verschwörer-Gehabe.
Nur Bailauf fehlte, hatte die Aufforderung, bei Gehlen zu erscheinen, mit den rüden Worten: „Konferenzen sind der Sieg der Ärsche über die Köpfe“, quittiert, Ballauf, der mit seinen spektakulären Erfolgen an die großen ORG-Zeiten anknüpfte, konnte sich das Fernbleiben erlauben, obwohl er nicht mit dem General im gleichen Artillerieregiment gedient und weder der Canaris-Abwehr noch dem Generalstab angehört hatte, was sonst für Pullachs Spitzengarnitur eine kaum umgehbare Voraussetzung war.
Die Herren, die der Günstlings-Crew zugerechnet wurden, hatten ihre Stühle zwanglos im Halbkreis um den Schreibtisch des Chefs gestellt. Keiner von ihnen fühlte sich wohl an diesem Tag; übereinstimmend deuteten die Akteure des Untergrunds ein flaues Gefühl nach Eintritt des Debakels als Vorahnung. Die Besprechung war zunächst wie alle anderen verlaufen; es ging um Berlin, wie fast immer in letzter Zeit. Seitdem der rote Zar, Nikita Chruschtschow, und sein sächsischer Lautsprecher und Statthalter Walter Ulbricht der früheren Reichshauptstadt – zunächst verbal – die Daumenschrauben angelegt hatten, glich die Vier-Zonen-Stadt einem Pulverfaß. Mit sowjetischem Segen hatte der Spitzbart den Sowjet-Sektor, unter Bruch des Viermächte-Abkommens, zur DDR-Hauptstadt erklärt, mit Anspruch auf die westlichen Sektoren. Der neue US-Präsident Kennedy sprach offen aus, daß eine Abschnürung des alliierten Zugangs nach Westberlin den Dritten Weltkrieg bedeuten könne, und die Franzosen erörterten bereits die verhängnisvolle Frage: Mourir pour Berlin – Sterben für Berlin?
Es war ein heißer Sommer, und es herrschten viel Kraftmeierei und Defätismus auf beiden Seiten. Pankow hatte 8000 Soldaten um Berlin zusammengezogen, um für die Bürger des „Arbeiter- und Bauernstaates“ den Zugang in ihre eigene Metropole abzuriegeln. Viele Verkehrswege waren umgeleitet worden. Trotzdem ging ununterbrochen, Tag wie Nacht, ein Einbahnstrom von Flüchtlingen nach Westen. Die Ostdeutschen beteiligten sich zu Hunderten, zu Tausenden, zu Hunderttausenden, zu Millionen an der Volksabstimmung mit den Füßen.
Der Chef kam vom Thema ab. Ohne Übergang wandte er sich an Dr. Grosse von der Gegenspionage. „Noch immer keine Verbindung mit Metzler?“ fragte er. Obwohl er vor seinem Braintrust keine Geheimnisse hatte, bedeutete die Frage in Gegenwart von vier weiteren Mitarbeitern einen Verstoß gegen die selbst aufgestellte Regel einer lückenlosen Geheimhaltung.
„Sorry“, erwiderte der Referent; seine Stimme klang schläfrig, aber sein Adamsapfel bewegte sich aufgeregt.
„Seit drei Tagen keine Nachricht. Nach seiner letzten Meldung ist Metzler nach Gottbus gefahren, und seitdem –“
Grosse brach mitten im Satz ab, es bedurfte auch keiner weiteren Erklärung. Die unterbrochene Nachrichtenverbindung konnte ein normaler Vorgang sein. Tatsächlich hatten alle „im Feind operierenden Agenten“ den Befehl, die Funkstille nur bei außerordentlichen Vorfällen zu unterbrechen.
Es brauchte nichts zu bedeuten, aber so hatte es immer begonnen: im Fall Auer im Januar; bei der Grainer-Affäre im März und bei der Panetzky-Sache im Juli. Januar, März, Juli. Schlag auf Schlag auf Schlag. Bis Ende Juli dieses Jahres waren 29 hochkarätige Agenten dem ostzonalen Staatssicherheitsdienst (Stasi) in die Falle gegangen. Im Vorjahr waren es 92 gewesen. Selbst wenn man einige Doppelagenten und Überläufer abzog, die aus propagandistischen Gründen im Osten hochgespielt worden waren, drohte der Aderlaß die bewährte „Firma“ zu ruinieren, denn drei in kurzen Abständen aus unerklärlichen Gründen hintereinander aufgeflogene Agentenringe konnte auch sie nicht verkraften. Das wußte jeder in dieser Runde, aber nur einer sprach es aus: Dennert, ein großer, knochiger Mann, erschreckend hager. „Dann werden wir also auch Metzler abschreiben müssen“, sagte er. „Und womöglich auch noch Megede und Deschler.“
Der General schwieg verbissen. Karsunke und Schlukkesaft nickten zustimmend. Ausgerechnet der sonst so schweigsame Kleemann erwiderte gereizt: „Sie sollten wirklich keinen beerdigen, Herr Dennert, bevor er gestorben ist.“
„Meinen Sie?“ entgegnete der Vize der Sonderabteilung „Strategischer Dienst“. Als stellvertretender Sicherheitschef war er der zweithöchste Hauspolizist und zudem ein Intimus des Generals. „Wenn ein Agentenring auffliegt, ist es eine Panne.“
Dennert sprach in einem süffisanten, überheblichen Ton. Sein Plisseegesicht wirkte blaß und hautig. „Wenn zwei – oder gar drei – hochgehen und die Fehlerquelle noch immer nicht entdeckt ist, dann gibt es wohl nur eine Erklärung.“ Sein linkes Auge flackerte wie in einem Wackelkontakt. Jedenfalls litt er, mit seinem Drittel-Magen ohnedies kein Gesundheitsathlet, am sichtbarsten unter dem Wetter. Im übrigen geisterte über den Unbeliebten durch das Camp das vergiftete Bonmot: „Hoffentlich wird der Dennert so alt, wie er aussieht.“
„Was wollen Sie damit sagen?“
„Es liegt auf der Hand“, erwiderte Dennert. „Eine undichte Stelle. Hier in Pullach – im Camp Nikolaus, macht uns allmählich zu Weihnachtsmännern.“
„Das ist doch purer Unsinn“, warf Kleemann ein. „Wir hatten früher einen leichten Gegner gehabt und haben nunmehr einen schweren. Mit anderen Worten“, er lotete das Gesicht des Generals aus und registrierte stumme Zustimmung, „diese Stasti-Leute haben einfach dazugelernt – und wir müssen uns neue Wege einfallen lassen.“
„Und ich sage, daß es in Pullach einen Maulwurf gibt“, entgegnete Dennert unbeirrt. „Einen Verräter, der das ostzonale Ministerium für Staatssicherheit, wenn nicht sogar das KGB direkt bedient – eine Laus in unserem Pelz.“
„Hier im Camp?“ fragte Grosse verärgert.
„Womöglich sogar unter uns Pfarrerstöchtern“, erwiderte der stellvertretende Sicherheitsbeauftragte zynisch; er hatte nichts zu verlieren. Er war die rechte Hand des Generals und schon aufgrund seiner Position bei den anderen Vertrauten unbeliebt. Dazu galt er als ein erstklassiger Fachmann, auch wenn die anderen heimlich darüber witzelten, daß er sich in seinem Büro einschloß und nur auf ein bestimmtes Klopfzeichen öffnete, jede Woche den Namen wechselte und die Überprüfung neu angeworbener Sekretärinnen so konspirativ betrieb, daß die Kripo München in einem Fall gegen ihn wegen Verdachts des Mädchenhandels ermittelt hatte.
„Ich weiß, daß Sie unter dem Föhn leiden, Dennert“, griff der General ein. „Aber selbst wenn Sie rot sehen, sollten Sie nicht schwarz malen.“
„Und Metzler ist einer unserer fähigsten und zuverlässigsten Leute“, konstatierte der kleine Karsunke.
„Metzler schon“, erwiderte Dennert höhnisch. „Auer auch, um von Grainer und Panetzky gar nicht zu reden.“
„Wenn Sie einen konkreten Verdacht haben“, versetzte der General pikiert, „dann kommen Sie zu mir, teilen Sie es mir unter vier Augen mit, und wir werden sofort handeln.“ Während er seinen Intimus tadelte, betrachtete er ihn irritiert. „Andernfalls muß ich Sie wirklich bitten, künftig pauschale Verdächtigungen zu unterlassen. Sie kennen mein Motto, Dennert? Ich bin bei unserer diffizilen und diskreten Tätigkeit für waches Vertrauen. Vergessen Sie bitte nicht, wir haben einen Ruf zu verlieren.“
Pullach war ein Markenartikel des Untergrunds. Seit vielen Jahren schon. General Gehlen hatte mit seinem Startkapital, mit fünfzig Stahlkoffern, gefüllt mit Geheiminformationen über die Sowjetunion, gewuchert, seitdem er – kurz vor dem Zusammenbruch von Hitler noch abgesetzt – auf der Elendsalm in der Nähe des Schliersees aufgetaucht war. Erst zwölf Tage nach Kriegsende durch eine Denunziation in die Hände von Militärpolizisten gefallen, war er in Miesbach an den örtlichen Chef des Counter-Intelligence-Corps (CIC) gekommen.
„Ich bin Generalmajor Gehlen“, hatte er sich dem Captain Marian E. Porter vorgestellt. „Der Chef der ,Abteilung Fremde-Heere-Ost‘ im deutschen Oberkommando des Heeres.“
„Sie waren es, General“, hatte der CIC-Offizier erwidert und den Untergrundchef wie einen gewöhnlichen „Prisoner of war“ wegschaffen lassen.
Aber Gehlen kam wieder nach oben. Er ließ später seine versteckten Stahlkoffer ausgraben und überzeugte die olivgrünen Besatzer von seiner Wichtigkeit. Bald nannte ihn der greise Bundeskanzler „seinen lieben General“. Nach den Gründerjahren bezeichneten nicht nur die bezahlten Hofschreiber des Ex-Generals die Gehlen-Organisation als besten Geheimdienst der Welt, wenn es um Informationen hinter dem Eisernen Vorhang ging.
Der amerikanische Geheimdienst (CIA) gab unumwunden zu, daß 70 Prozent aller Informationen über die Sowjetunion und ihren ostdeutschen Satelliten, die in Washingtons Pentagon eingingen, aus Pullach stammten. Der Secret-Intelligence-Service der Engländer (SIS), der französische SDECE und sogar Israels MOSSAD sahen im Bundesnachrichtendienst eine Monopoleinrichtung für Ost-Informationen. Und auf seine Weise zollte sogar das sowjetische KGB Gehlens Männern Respekt.
Von Pullach aus gingen über General, Bezirks- und Untervertretungen, über Residenturen und Filialen subversive Fäden in alle Welt, von hier wurden Tausende von Menschen und Millionen-Summen dirigiert. Mit dreieinhalb Millionen Dollar war die ORG als Erfüllungsgehilfin der Amerikaner gestartet, gestützt auf ein Abkommen, daß die Dienstherren nichts von ihren Nescafé- und Chesterfield-Spionen erwarteten, was gegen die deutschen Belange verstieße, wobei freilich ausschließlich General Gehlen definierte, was deutsche Belange seien: Deutsch war, in dieser Zeit, was Pullach nutzte und den Sowjets schadete.
Aus den Carepaket-Stipendiaten waren vierzehn Jahre später Bundesbeamte geworden, im Range von Inspektoren, Regierungsräten, Oberregierungsräten, Regierungsdirektoren, Ministerialräten und noch höher; aus einem Zehn-Millionen-Etat ein Hundert-Millionen-Bedarf, der wuchs und wuchs und wuchs. Aus ein paar hundert Idealisten und Desperados, arbeitslosen Generalstabsoffizieren und Verlegenheitszivilisten Tausende von Mitarbeitern, unter ihnen jetzt auch erstklassige Wissenschaftler und Techniker. Die erste elektronische Datenbank, die je bei einer deutschen Behörde installiert wurde, registrierte in Pullach Freund und Feind und half mit Lichtgeschwindigkeit den Spionen mit Pensionsberechtigung.
Pullach saß mit an Moskaus rundem Tisch, wenn das sowjetische Politbüro seine geheime Langzeitpolitik festlegte. Als Chefsekretärin des DDR-Ministerpräsidenten hatte eine Agentin Pullachs jahrelang streng vertrauliche Anweisungen mitstenografiert und jeweils noch am selben Tag in den Westen weitergeleitet. Zu den Gehlen-Agenten war ein stellvertretender DDR-Ministerpräsident ebenso gestoßen wie die rechte Hand des Sabotage-Spezialisten Wollweber und der auf einer Agentenschule in Moskau ausgebildete Oberstleutnant der Nationalen Volksarmee Dombrowski, der um die Weihnachtszeit vorletzten Jahres mit zwei Koffern Geheimmaterial in den Westen geflüchtet war. Ein immenser Erfolg: Der Überläufer machte es möglich, Dutzende von in Westdeutschland operierenden Stasi-Agenten zu verhaften.
Seitdem freilich war der Teufel von der Kette. Untergrund-Operationen auf dem Staatsgebiet der DDR waren von SSD-Männern meist schon im Ansatz zerschlagen worden. Topagenten der zum Bundesnachrichtendienst (BND) avancierten ORG, die seit Kriegsende erfolgreich hinter dem Eisernen Vorhang gearbeitet hatten, wurden enttarnt oder mußten zurückgezogen werden.
Pullachs Sendboten waren im roten deutschen Osten bei der Verhaftung erschossen, bei der Vernehmung umgedreht worden, hatten sich nach verschärften Verhören in Haft selbst getötet oder saßen zu lebenslänglichen Strafen verurteilt in der Strafanstalt Bautzen. Jedenfalls wies Pullach zur Zeit mehr Versorgungsfälle auf als Erfolge vor. Jedem der Anwesenden im Chefbüro hatte sich der Verdacht schon einmal aufgedrängt, der von Dennert heute erstmals laut und pöbelhaft ausgesprochen worden war.
Der General kam nach der unerfreulichen Abschweifung wieder zur Sache. Er warf einen Blick auf die Unterlage, die ihm der tüchtige Grosse übergeben hatte. „Die Zahlen sind überprüft?“ fragte er.
„Mehrfach“, erwiderte der Referent. „Zur Zeit hat sich die Zahl der Republikflüchtlinge von täglich vierhundert auf fünfzehnhundert erhöht. Hier handelt es sich um offizielle Angaben ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer. Nach unseren Erfahrungen kommt zunächst jeder dritte von drüben bei westlichen Verwandten unter und läßt sich erst später registrieren.“
„Oder nie, falls er auf Kosten des zonalen Staatssicherheitsdienstes reist“, warf Dennert ein, als wüßte man es nicht in dieser Runde; er war heute rabiat und bewies dadurch eigentlich nur seine Ohnmacht. Natürlich hatte der zweitoberste Hauspolizist längst unter der Hand den Maulwurf gesucht und verfehlt. Männer, die in Pullach arbeiteten, waren so transigent wie ihr Gewerbe undurchsichtig. Sie lebten auf viel zu kleinem Raum zusammen, um nicht voneinander alles – oder fast alles – zu wissen. Keiner von ihnen bedeutete ein Sicherheitsrisiko, obwohl fast jeder einige Minuspunkte aufwies. Aber Dennert wußte aus Erfahrung, daß die Unverdächtigsten oft die Gesuchten sind.
Wo sollte er mit der Wertung beginnen in einer Dienststelle, die auf einen einzigen Mann fixiert war, der selbst aus Erfurt stammte, der west-thüringischen Stadt innerhalb des sowjetischen Machtbereichs. Der General hatte in der DDR Verwandte, Freunde, Bekannte – aber er stand natürlich und logisch außerhalb jeden Verdachts. Es nutzte Dennert wenig, zu wissen, daß Schlukkesafts Ehe kaputt war, daß Söldner ein Verhältnis mit einer verheirateten Frau hatte, daß Karsunkes Kinder ziemlich zwecklos von einem Internat ins andere zogen, daß Ballauf aus Sachsen kam und Grosse schon zweimal beim Roulett in Bad Wiessee gesehen worden war.
Manche tranken zuviel, lebten auf zu großem Fuß oder bewiesen durch ihren Geiz ihre besondere Geldgier. Es waren menschliche, allzu menschliche Eigenschaften. Familiäre oder freundschaftliche Bande hatte fast jeder in den anderen Teil Deutschlands. Hier mußte Dennert sich selbst miteinschließen.
Was konnte er noch tun?
Der General hatte Familiensinn und sechzehn Verwandte bei seiner zur Behörde gewordenen Spionageorganisation in recht gute Pfründe gehievt. Lag hier das faule Ei im Nest? Zur Pullacher Mafia gehörte fraglos auch Lilo, die einflußreiche Sekretärin des Generals, die alles wußte und ohne die im Camp einfach nichts ging. Natürlich war Lilo zuverlässig, aber „Gänseblümchen“, die Spionin im Vorzimmer Grotewohls, war es auch gewesen, bis man nach ihrer Enttarnung das eingemottete Nazi-Fallbeil wieder ausgegraben und sie geköpft hatte.
Sicherheit: Das war ein Kampf mit Windmühlenflügeln, geführt von Kontrolleuren, bei denen sich die Frage stellte, wer sie kontrollierte. Noch immer wurde Pullach mit der CIA wie mit einer Nabelschnur verbunden. Jahrelang waren allmorgendlich an die fünfzig US-Kontroll-Offiziere in Pullachs Heilmannsstraße gezogen, die nicht zufällig von GIs bewacht wurde. Die westlichen Geheimdienste lebten in einer Art Verbundsystem, tauschten wenigstens zum Teil ihre Nachrichten aus.
War einer der Amerikaner faul, oder mußte man die undichte Stelle bei den Franzosen vermuten, in deren Reihen es aus Resistance-Zeiten noch Kommunisten gab? Wer garantierte, daß bei den Engländern alles intakt war, daß sie die Katastrophenfälle wie zum Beispiel Fuchs und Burges hinter sich hatten? Oder bei der NATO in Brüssel, die sich ein paarmal unangenehm über die Durchstechereien beim Bundesnachrichtendienst beschwert hatten, die angeblich ihre Schlagkraft in Frage stellten.
Dennert war verzweifelt, auch wenn er es nicht zugab. Es ging ihm wie einem Toningenieur, der durch den Umgang mit Lautstärke das Gehör zu verlieren drohte. Bedeutete die Hellsichtigkeit des Vizechefs vom Strategischen Dienst nicht letztlich eine Art Betriebsblindheit? Ein Bankier neigt dazu, in seinen Klienten Defraudanten zu sehen, ein Pfarrer in seiner Gemeinde Sünder, ein Arzt überall Patienten, ein Finanzbeamter in jedem einen Steuerhinterzieher. Und so war es nicht verwunderlich, daß ein Sicherheitsbeauftragter, dessen Handwerkszeug das Mißtrauen sein muß, nach Verdächtigen Ausschau hält wie ein Regenwurm nach Wasserpfützen.
Dennert folgte wieder der Besprechung und stellte fest, daß selbst Pullachs Nummer eins heute unkonzentriert wirkte und eigentlich unnötige Fragen zweimal stellte: Das Pulverfaß Berlin, in das Pankow ständig Funken warf, machte ihn besorgt, die BND-Rückschläge nervös.
„Sie nehmen an“, wiederholte er, „daß dieser Run in den Westen mit den Straßenumleitungen, Transportbewegungen und den achtzigtausend DDR-Soldaten rings um Berlin zusammenhängt?“
„Fraglos“, erwiderte Schluckesaft und führte seine Tüchtigkeit vor, wie man einen Wasserhahn aufdreht. „Wir erwarten in den nächsten Tagen den zweihunderttausendsten Flüchtling“, schloß er, „und das Jahr 1961 ist noch nicht zu Ende, und das heißt, daß dreieinhalb Millionen Ostdeutsche, bald jeder fünfte der Gesamtbevölkerung, diesen Hau-ab-Staat verlassen hat. Selbst diese Zahl verfremdet noch das Bild, denn fast jeder zweite ist unter fünfundzwanzig, und fast zwei von drei unter vierzig Jahre alt, und von diesen wiederum waren die meisten Wissenschaftler, Lehrer, Professoren, Ingenieure und Ärzte –“
„– und Polisten“, warf Dennert ein. „Fünfzehntausend Vopos. Mit anderen Worten: eine ganze Division.“
Die Anwesenden lachten befreit; wenn es auch nicht neu war, blieb es doch ein durchschlagbarer Witz, daß junge, politisch geschulte Soldaten, die die Flucht der Bevölkerung verhindern sollten, in solcher Zahl selbst an ihr teilnahmen.
„Was nennen Sie Abriegelung, Schluckesaft?“ fragte der General.
„Eine totale Abschnürung. Eine Grenzsperre, durch die keiner mehr kommt.“
Der General wirkte skeptisch. „Wie wollen Sie eine 1381 Kilometer lange Grenze abriegeln?“ fragte er. „Wie können Sie ein Gebiet hermetisch absperren, das so groß wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen ist?“
„Wenn die wollen, schaffen sie es“, antwortete der Spezialist von der Auswertungs-Abteilung. „Die haben keine parlamentarische Kontrolle. Keine Opposition, keine langwierige Flurbereinigung und schon gar keine Presse, die ihnen auf die Finger sieht.“ Einen Moment lang hatten die Zuhörer den Eindruck, von Schluckesafts Stimme hinge Mißgunst über so viel unkontrollierte Staatsmacht. „Das einzige Problem ist, woher sie das Material nehmen.“
„Sie haben Bonn verständigt, Grosse?“ vergewisserte sich der General.
„Laufend.“
„Mit Nachdruck?“
„Zusätzliche Blitzmeldung an das Bundeskanzleramt unter dem Datum des 10. August 1961“, wiederholte Grosse pedantisch. „Headline: Mit hermetischer Abriegelung der sowjetischen Besatzungszone ist umgehend zu rechnen.“
„Was heißt umgehend?“ fragte Dennert.
„Die X-Zeit ist vielleicht morgen, übermorgen, nächste Woche – noch in diesem Monat, möchte ich sagen.“
Grosse schob dem General die Blitzmeldung an das Bundeskanzleramt zu. Dr. Schneider las sie pedantisch.
„In Ordnung“, sagte er. „Mehr als wir wissen, können wir der Bundesregierung nicht melden. Ich versteh’ nur nicht, warum Bonn bei diesen Alarmnachrichten sich so schlafmützig gibt.“
„Wird Zeit, daß dieser dämliche Wahlkampf zu Ende geht“, erwiderte Dr. Grosse. „Die haben ja zur Zeit nichts anderes im Kopf als die vierte Wiederwahl des Bundeskanzlers am 17. September.“
In diesem Moment ging der faule Wechsel zu Protest.
Auch als Überbringer einer Hiobsbotschaft strotzte Ballauf noch vor Tüchtigkeit: Er trat ein, ein unauffälliger, unaufdringlicher Mann mittleren Alters, der typische Herr im grauen Flanell, von der Stange. Das As der Gegenspionage sah aus wie ein ordentlicher Buchhalter, der ein wenig darum bangte, vom Computer verdrängt zu werden – aber seine enormen Erfolge, die ihn von der Generalvertretung einer westdeutschen Großstadt in die Zentrale nach Pullach gehievt hatten, verliehen ihm im Camp einen Rang, der ihn weit über seine Dienststellung hinaushob.
„Ich bitte um Verzeihung“, sagte Ballauf mit einer schnellen Verbeugung vor dem Hausherrn. „Ich bin leider aufgehalten worden, und ich fürchte, daß ich nunmehr auch Sie aufhalten muß, meine Herren.“ Er turnte um die auf den Stühlen Sitzenden herum, ein Stubenhokker und zugleich ein Draufgänger in der Frontlinie.
Der General las die Notiz, die ihm Ballauf überreichte, und starrte einen Moment wie blind auf seine Unterlagen am Schreibtisch. Fast mühsam hob er den Kopf und betrachtete seinen Sicherheitsmann. „Ich fürchte, Sie haben recht behalten, Dennert“, sagte er mit belegter Stimme. „Zumindest, was Metzler angeht.“ Seine Lippen bewegten sich ein paar Worte lang stumm: „Er ist tot“, setzte er dann leise hinzu.
Der General stand auf, trat an das Fenster, sah einen Moment lang hinaus, zu dem Springbrunnen im Garten, der wie in Atemnot gurgelte, zu den ranken Jünglingen auf den massiven Sockeln, die mit versteinerten Gebärden ins Leere griffen, dem Hoheitsadler gleich, der in diesem Moment mehr denn je einem Pleitegeier ähnelte.
Langsam drehte er sich wieder um. „Ich danke Ihnen, meine Herren“, sagte er und gab – als sich die anderen entfernten – Dennert einen Wink, noch zu bleiben.
Bailauf brauchte er dazu nicht aufzufordern, er blieb auch so: Der Regierungsrat wußte, daß der General nähere Einzelheiten über das jüngste Fiasko in der Zone von ihm hören wollte, natürlich hatte der Günstling sie parat.
„Heinrich“, begann der Hausherr – nur im allerengsten Kreise redete er einige vertraute Mitarbeiter mit dem Vornamen an –, „Sie haben mit Ihrer Schelte völlig recht gehabt – wenn auch vielleicht am falschen Platz. Ich stimme Ihnen zu. Ich habe mit dem Bundeskanzler bereits Maßnahmen besprochen, diesen unterschleifigen Dingen – diesen Durchstechereien – auf den Grund zu gehen. Ich kann darüber nicht reden, noch nicht, aber glauben Sie nicht, daß ich die Entwicklung einfach treiben ließe.“ Dann wandte er sich an Ballauf: „Wie weit ist Ihre Hiobsnachricht bestätigt?“
„Radio DDR hat sie vor ein paar Minuten über alle
Sender ausgestrahlt, und die Nachrichtenagentur ADN gibt sie als offizielle Regierungsverlautbarung weiter. Natürlich kochen die ihre Giftsuppe – aber ich fürchte, es steckt mehr dahinter als Propagandarummel. Es scheint sich um eine großangelegte Aktion zu handeln. Jedenfalls sind diese Stasi-Leute verdammt sicher.“
„Was weiß man über Deschler und Megede?“
„Noch nichts Genaues“, antwortete Ballauf dumpf. „Aber ich fürchte –“
„Haben Sie die CIA schon kontaktiert?“
„Ich wollte niemandem vorgreifen, Herr Dr. Schneider“, gab er sich bescheiden.
Obwohl Megede niemals auf dem Dienstweg gemeldet hatte, daß er auch die konkurrierende Schwesterfirma CIA bediente, wußte man es natürlich in Pullachs Spitze und benutzte den Mann, den Amerikanern bestimmte Nachrichten zuzuspielen, die nicht offiziell über den Schreibtisch gehen sollten, oder die Bundesgenossen – in dem einen oder anderen Fall – sogar eine Weile zu desinformieren.
„Also, Heinrich“, wandte sich der General wieder an Dennert, „stellen Sie ohne Rücksicht auf die Person und auch auf die Nation fest, wer von dem Auftrag Metzlers gewußt haben kann. Setzen Sie mich als Verdächtigen Nummer eins auf Ihre Liste.“ Er lächelte kläglich; Humor war nicht seine Stärke, Menschenkenntnis auch nicht, „und reihen Sie sich selbst als den zweiten und Herrn Ballauf als Nummer drei in die Kartei der Verdächtigen ein. Alle weiteren Namen, einschließlich meiner Sekretärin. Jeder wird überprüft, und wenn es zum hundertsten Male ist. Sie haben jede Rückendeckung von mir.“
„Besten Dank“, erwiderte Dennert. „Nur möchte ich darum bitten“, warf er gallig ein, „daß ich mich nicht selbst zu checken brauche, sondern ein anderer –“
„Seien Sie doch nicht so humorlos, Heinrich“, faßte sich der General gewissermaßen an die eigene Nase. Er lief mit kurzen abgezirkelten Schritten auf und ab. „Wenn die Normannenstraße jetzt schon die Verhaftung bekanntgibt, dann wird sie nach bewährtem Muster in Ostberlin eine Pressekonferenz inszenieren, und wir haben wieder mal die Bescherung.“
„Das ist zu befürchten“, bestätigte Dennert.
„Die Ostpropaganda macht jetzt schon aus ihren Fahndungsdurchsagen Trompetenstöße“, konstatierte Bailauf. „Sie können sich das anhören. Ich habe die ersten Meldungen mitschneiden lassen. Der übliche Schmus – aber zwei Dinge geben mir zu denken“, setzte er nach kurzem Zögern hinzu, wartend, bis ihn der General durch ein Kopfnicken aufforderte, weiterzusprechen: „Verhaftungen spielt man doch erst hoch, wenn der Fall restlos aufgeklärt ist.“
„Vielleicht wollen sie von ihrem faulen Zauber an der Grenze ablenken“, versetzte Dennert. „Oder sie hatten den Fall schon geklärt, bevor wir unser Kleeblatt in die Zone eingeschleust haben.“
„Und der zweite Punkt?“ überging der Hausherr logischen Pessimismus.
„Ich habe inzwischen das Unternehmen Metzler-Megede-Deschler noch einmal rekonstruiert. Vermutlich war die Falle, in die unsere Freunde gelaufen sind, tatsächlich von langer Hand vorbereitet – aber von einem vierten Teilnehmer dieses Unternehmens weiß ich absolut nichts.“
„Wieso viertem Teilnehmer?“ fragte Dennert.
„In der ganzen Zone wird ein Mann gesucht, der unter dem Namen Fritz Stenglein auftritt: fünfunddreißig Jahre alt, einen Meter achtzig groß, blaue Augen, glattes Gesicht, gescheiteltes Haar, braune Lederjacke usw., usw.“ zitierte Bailauf. „Jagen die Gespenster? Oder hat man uns einen Kuckuck ins Nest gelegt? Von einem Fritz Stenglein ist mir jedenfalls überhaupt nichts bekannt.“
„Ach“, spöttelte Dennert in mokantem Ton, „und sonst ist Ihnen alles bekannt?“
„Wenn ich mit einer Sache befaßt bin, sehr wohl“, konterte das As der Gegenspionage. „Haben hier vielleicht unsere amerikanischen Freunde ohne unser Wissen mitgemischt?“
„Fragen Sie sie doch“, versetzte Dennert noch einmal hämisch.
Der General beendete die Kontroverse. „Ich habe eine Frage an Sie beide, meine Herren“, sagte er. „Wie weit sind Sie mit Jabionski?“
„Jabionski?“ entgegnete Dennert, der im ersten Moment nicht begriff, daß der Chef eine Schlappe durch eine Bombe wegsprengen wollte.
„Ich bin so gut wie fertig mit den Ermittlungen“, antwortete Bailauf, dem seine Neider nachsagten, er stelle immer fest, was der Chef hören wolle.
„Was heißt so gut wie?“
„Soweit die Vorgänge in mein Ressort fallen, hätte ich keine Bedenken zuzuschlagen“, warf sich Ballauf in die Brust; Serge Jabionski, der KGB-Resident in Hamburg, war schon vor mehreren Wochen erkannt, enttarnt und seitdem rund um die Uhr beschattet worden. Die Berichte, die täglich über ihn in Pullach eingingen, füllten ein dickes Dossier.
„Die Ermittlungen sind praktisch abgeschlossen“, setzte Ballauf behende hinzu.
„Und was heißt praktisch?“
„Ich hätte – wie gesagt – keine Bedenken, Jabionski zu verhaften.“
„Und was meinen Sie dazu, Heinrich?“ fragte der General.
„Blendende Idee“, erwiderte der Sicherheitsbeauftragte. „Das ist genau die richtige Masche, diesen Schreihälsen und drei weiteren Mitarbeitern da drüben das Maul zu stopfen.“
Der General holte sich noch bei Karsunke und Kleemann Zustimmung, dann beorderte er Dennert und Bailauf nach Hamburg, wo sie morgen früh, in Zusammenarbeit mit Kriminalpolizei und Verfassungsschutz, schlagartig die Residentur des sowjetischen Geheimdienstes ausheben sollten.
„Es könnte nicht schaden, wenn Sie auch einige unserer Pressefreunde verständigen würden“, hatte der General bei der Verabschiedung noch festgestellt.