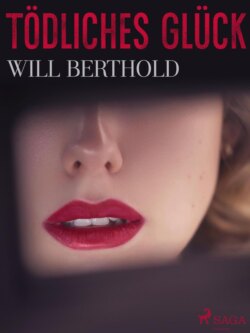Читать книгу Tödliches Glück - Will Berthold - Страница 6
ОглавлениеAls ich – fünf Minuten nach der ersten Fahndungsdurchsage nach dem Mann, der ich heute noch gewesen war – die HO-Raststätte verlassen wollte, war ich direkt der Vopo-Streife in die Arme gelaufen. Es waren zwei Uniformierte. Sie standen links und rechts vom Eingang, groß der eine, untersetzt der andere. Sie hatten mich längst bemerkt und sahen mir entgegen wie dem linken Schächer am Kreuz.
Umkehren war sinnlos, und so schob ich mich betont langsam und lässig auf die Vopos zu und memorierte: Du bist Martin Lange aus der Friedrichstraße in Berlin-Ost, seit drei Jahren Witwer, seitdem deine Frau Irene im Wochenbett gestorben ist. Du arbeitest als Angestellter in Adlerhorst. Du hast noch acht Tage Urlaub, du warst beim Angeln an der Müritz, und du hast alte Freunde in Magdeburg besucht, obwohl du ein richtiger Eigenbrötler und Alleingänger bist. Martin Lange, evangelisch, fast 82 Kilo schwer, nicht ohne Grund, denn du bist gewöhnt, alles in dich hineinzufressen, den Kummer im Büro genauso wie den Erbseneintopf.
Ich war noch einen Meter von ihnen entfernt.
Sie wichen nicht beiseite.
Ich griff in die Tasche, nach meinem Ausweis, aber sie trafen keine Anstalten, meine Papiere zu kontrollieren oder mich zu filzen.
Ich ging langsam weiter, schritt durch die beiden hindurch.
Sie sahen mir mit diesem unbeschreiblichen Blick nach, sagten kein Wort und rührten keine Hand, als lohne es sich nicht für die Diener eines atheistischen Staates, einen biblischen Sünder zu stellen.
Ich tadelte mich selbst ob der Erleichterung, die ich verspürte, und zwang mich, meine Schritte nicht zu beschleunigen. Ich stellte aus den Augenwinkeln fest, daß sie mir nicht folgten, sondern den nächsten Verdächtigen in Augenschein nahmen mit Mienen, die man wohl am besten mit „wachem, proletarischem Mißtrauen“ übersetzt.
Ich zündete mir eine Zigarette an, keine „Stuyvesant“ mehr – die hatte ich weggeworfen –, aber doch eine westliche. Im großen Halbkreis ging ich um meinen Wagen herum, versuchte, jede Einzelheit zu erfassen. Es waren zu viele Menschen am Parkplatz, ich konnte nicht sicher sein, daß der „Trabant“ nicht kontrolliert wurde. Dann sah ich auf das Leipziger Nummernschild und wußte, daß ich meine Flucht zu Fuß fortsetzen mußte. Wenn auch meine Personenbeschreibung sehr allgemein gehalten war und vermutlich auf ein paar hunderttausend DDR-Bürger zutraf – die Insassen von Autos, die aus der Messestadt kamen, würde man sich heute besonders genau ansehen.
Vielen Dank, Martin Lange, dachte ich.
Natürlich gab es ihn. Er hatte sich auch Urlaub genommen und war zum Angeln gefahren. Nur in Magdeburg, da war er nicht aufgetaucht. Dafür aber hatte er sich vor ein paar Tagen im Westberliner Auffanglager Marienfelde registrieren lassen. Einem unserer Leute war sofort bei der Vernehmung der Gedanke gekommen, daß seine Identität für uns recht brauchbar werden könnte, und er hatte den DDR-Ausweis unauffällig einbehalten und dem Mann zu seiner großen Freude eine vorläufige westliche Kennkarte ausgestellt.
Der Boden brannte mir unter den Füßen, aber ich mußte nach der Devise handeln: Eile mit Weile, und das bedeutete: kurze Strecken. Ständiger Wechsel der Verkehrsmittel. Umwege, um das Ziel zu verschleiern. Gelegentlicher Krebsgang.
Die ersten fünf Kilometer ging ich zu Fuß.
Dann stieg ich in die Eisenbahn und rollte drei Stationen weit nach Westen, statt nach Nordost. Ich starrte zum Fenster hinaus und zählte die Bäume, die der Wind rüttelte. Dabei purzelte mir der Gedanke vor die Füße, daß Metzler seinem amourösen Abenteuer mit der Rotgrünen vielleicht einen Tag länger Leben verdankte.
Ab einem bestimmten Tempo wird Geschwindigkeit zu Hexerei. Ich traute den Stasi-Leuten vieles zu, jedoch nichts Übersinnliches. Sie mußten die beiden Co-Agenten schon früher verhaftet und zum Reden gebracht haben. Das erklärte auch, warum mich der Joker heute morgen über Kurzwelle zurückpfeifen wollte.
Am Bahnhof einer Kleinstadt, deren Namen ich vergessen habe, stieg ich aus. Gegenüber war ein Gemüsestand. Es gab endlich Frischobst.
„Um was stehen die denn Schlange?“ fragte ich.
„Mensch, das ist doch keine Schlange“, erwiderte der Fahrer eines Viehtransportes so laut, daß es auch die anderen hören mußten. „Das ist eine sozialistische Wartebrigade.“
Sie lachten, sie lachten gerne. Und sie schimpften gerne. Aber sie waren doch auf der Hut, nach beiden Seiten. Sie wollten nicht an den Unrechten kommen, aber auch nicht durch laute Sprüche in den Verdacht geraten, demnächst schwarz über die grüne Grenze den roten Machtbereich zu verlassen.
„Wo fährst du denn hin, Kumpel?“ fragte ich den Witzbold.
„Geht’s dich was an?“ erwiderte er. „Zur LPG nach Ludwigsfelde“, lenkte er dann ein.
„Mensch, ich muß nach Potsdam“, entgegnete ich. „Kannst du mich ein Stück mitnehmen, Sportsfreund?“
„Können schon“, versetzte er anzüglich. „Aber umsonst ist der Tod, und der kostet das Leben.“
Wir wurden rasch handelseinig, und ich stieg zu. Der Fahrer hatte lebende Schweine geladen. Sie grunzten laut und stanken abscheulich. Ich leistete als Fuhrlohn fünf Ostmark Anzahlung und versprach ihm zusätzlich drei Ami-Zigaretten. Ich hätte spendabler sein können, aber dadurch wäre ich nur aufgefallen.
Wir fuhren los, und nach der zweiten Zigarette wurden wir richtige Freunde. „Bin heute schon sechsmal kontrolliert worden“, sagte der Fahrer. „Scheißpolizei.“
„Die suchen einen Spion“, erwiderte ich.
„Die suchen immer einen“, versetzte der Mann am Steuer. „Schließlich ist ja auch alles besser als arbeiten.“ Er lachte. „Dir geht’s gut, wa? Haste Verwandte im Westen?“
„’ne verheiratete Schwester in Hamburg“, behauptete ich.
„Verwandte im Westen hab’ ick ooch“, versetzte er. „Aber die sind stinkgeizig. Die kennen uns ja nich mehr, so größenwahnsinnig sin’ se jeworden.“
„Da ist was dran“, räumte ich ein. „Aber meine sind nicht knickrig.“
Nach vier Kilometer näherten wir uns der ersten Straßensperre. Mit aufdringlicher Korrektheit gingen die Beamten um den schäbigen Viehtranspörter herum, rümpften die Nase und ließen uns weiterfahren.
„Das kommt auch nicht oft vor“, meinte der Fahrer. „Vielleicht war ihnen der Gestank zu säuisch.“
„Die reinsten Glücksschweinchen“, erwiderte ich lachend.
„Solange sie nicht meinen Führerschein anschauen, haben wir keine Scherereien“, sagte der Mann am Steuer. „Ich hab’ schon zwei rote Stempel. Du weißt ja, Kumpel, bei fünfen ist es Sense.“
Der Viehtransporter war für mich wie maßgeschneidert. Der Fahrer hatte seine drei Zigaretten weg. Um ihn bei Laune zu halten, bot ich ihm eine vierte an.
„Wieviel haste denn noch, Kumpel?“ fragte er lauernd.
Ich zählte nach. „Acht“, antwortete ich.
„Wenn’ste mir die Hälfte abgibst, mach’ ich ’nen Umweg und fahr’ dich nach Potsdam.“
„Das is’n Wort“, erwiderte ich.
Der Schweinetransporteur wählte eine Abkürzung, aber kurz nach dem Schild „Potsdam fünf Kilometer“, nach einer übersichtlichen Kurve, fuhren wir in die nächste Polizeisperre.
Mitten in der Straße stand ein Vopo mit der Kelle.
„Ausweis, Führerschein“, sagte er im barschen Ton.
Zum Glück präsentierte der Fahrer zuerst den Führerschein, und die roten Stempel stachen den Hütern des Gesetzes so in die Augen, daß sie Auspuff, Scheinwerfer, zulässiges Ladegewicht, Hupe und Winker gründlicher kontrollierten als meine Ausweispapiere.
Es war gut gegangen – aber die letzte Meile ist die längste, vor allem auf dem Weg nach Berlin.
Eine Viertelstunde später hatte mich mein ahnungsloser Fluchthelfer nach Potsdam geschafft. Er hielt an, um mich abzusetzen, übrigens in der Nähe von Schloß Sanssouci, zu deutsch: ohne Sorgen, und das war wohl die Untertreibung des Tages. Obwohl es von Potsdam aus nur noch ein Katzensprung nach Berlin war, freilich zu den Westsektoren – und sie waren momentan sorgfältiger bewacht als der Kronschatz in Londons Tower. Ich konnte nur über den östlichen Teil die ehemalige Reichshauptstadt erreichen, und das bedeutete, daß ich sie auf der Südseite umfahren mußte.
„Sag mal“, fragte ich im plötzlichen Entschluß den Fahrer der LPG-Ludwigsfelde. „Dir pressiert’s wohl nicht so?“
„Nee. Eijentlich gar nich. Kann doch alles auf die Vopos schieben, die mir ständig uffjehalten haben.“
„Dann kommen wir vielleicht noch einmal ins Geschäft“, erwiderte ich lockend.
Der Fahrer ließ sich leicht überreden; er stellte seinen Wagen ab und ging in das Café im „Haus des Handwerks“ an der Wilhelm-Pieck-Straße, ganz in der Nähe des sowjetischen Ehrenmals, das die Einheimischen „die unbekannten Plünderer“ nennen. Ich erwarb im HO-Warenhaus einige Requisiten für meine Rolle als Urlauber Martin Lange, kaufte ein knallbuntes Hemd, einen grünen Regenmantel, eine Schlägermütze. Ein Stockwerk tiefer erwarb ich einen kleinen Koffer und ein paar Angel-Utensilien. In der Parfümerieabteilung kaufte ich noch Rasier- und Waschzeug.
Dann ging ich auf die Toilette, wechselte das Hemd und verstaute den speckigen Pullover im neuen guten Stück aus Kunstleder. Staub gab es genug; ich machte meinen Finger feucht und verlieh dem Handköfferchen Patina. Rasier- und Zahncreme drückte ich halb aus der Tube; die Zahnbürste machte ich naß.
Es gab für mich nunmehr zwei Möglichkeiten: den Versuch, mich querfeldein nach Berlin durchzuschlagen, oder legal durch die Vopo-Kontrolle zu gehen. Schnappten sie mich beim illegalen Versuch, wäre ich erledigt. Wenn ich mich freiwillig der Kontrolle stellte, hatte ich eine weit größere Chance durchzukommen, denn im Vorgelände der Reichshauptstadt hielten die Uniformierten weniger nach Fritz Stenglein als nach Republikflüchtlingen Ausschau, wiesen jeden zweiten zurück und sahen vor lauter Bäumen keinen Wald mehr. Ich machte mir die Regel Mao Tsetungs zu eigen, „im Strom der Fische“ zu schwimmen.
Ich ging in das Haus des Handwerks zurück. Die Kellner machten einen großen Bogen um meinen Freund, es lag wohl am schweinischen Geruch, der ihm anhaftete, aber dann merkte ich, daß sie auch bei mir die Nase rümpften, und ich sagte mir befriedigt: Gestank isoliert. Es konnte mir nur lieb sein, wenn mir heute keiner zu nahe käme.
„Mensch, hast du dir ausstaffiert“, begrüßte mich der Schweinekutscher anerkennend. „Haste immer noch Pinke-Pinke?“
Er saß unter einem riesigen Gemälde von Adolf Hennecke, der sich 1948 durch ein vielfaches Soll zum „Helden der Arbeit“ empormalocht hatte.
Ich deutete auf den Zonen-Stachanow:
„Paß bloß auf, daß er dich nicht ansteckt“, sagte ich.
„Der“, erwiderte der Fahrer, „der trägt jetzt weiße Hemden und hat saubere Hände und guckt nur noch zu, wie die anderen sich mit der hochjeschraubten Arbeitsnorm abrackern.“ Er grinste und betrachtete skeptisch die Ostzigaretten, die ich für ihn erworben hatte, nahm sie aber doch: „Det Janze nennt sich dann sozialistischer Wettbewerb.“
„Ich würde meinen Lautsprecher etwas dämpfen“, riet ich ihm.
„Vor dir brauch’ ich doch keene Angst zu haben.“
„Besser wär’s, du würdest niemanden trauen“, antwortete ich, machte eine hohle Hand und setzte hinzu: „Quasi –“
Mehr brauchte ich nicht zu sagen; es war die volkstümliche Umschreibung für Stasi. Ich zahlte, und wir gingen. Der LPG-Fahrer war sichtbar stiller geworden. Vielleicht hielt er mich jetzt für einen Spitzel. Jedenfalls setzte er mich sichtbar erleichtert an einer Omnibushaltestelle ab.
Ich erreichte Königswusterhausen, fuhr eine kurze Wegstrecke per Anhalter und stieg in den Vorortzug um. Er war überfüllt, er würde viermal halten.
Dann käme die Entscheidung.
Es war ein Rechenfehler.
Der Personenzug hielt auf freier Strecke. Was sich hier kurz vor Einbruch der Dämmerung abspielte, konnte sich nur ein totalitärer Staat erlauben: Alle Reisenden mußten das Abteil verlassen. Mitten auf der Wiese waren ein paar Tische aufgestellt. Vopos nahmen die Kontrollen vor. Wer ohne Gepäck reiste, hatte es etwas leichter. Wer zum Beispiel Tafelsilber bei sich hatte, wie zwei unglückliche Frauen von Dresden, wurde gleich zu einem Omnibus abgeführt, der sicher zur nächsten Polizeidienststelle rollte. Laute wurden leise, bisher Stille randalierten. Bereits die Absicht, heimlich die Republik zu verlassen, war mit zwei Jahren Haftstrafe bedroht.
Ich hielt mich in der Mitte, und das in jeder Hinsicht, sowohl im Gedränge wie mit dem Protest. Wer als einwandfrei befunden wurde, durfte wieder in die vorderen Waggons einsteigen. Es ging ziemlich rasch. Die Kontrolleure waren ein eingespieltes Team.
Ich präsentierte meinen aufgeschlagenen Ausweis.
„Und das ist Ihr Gepäck?“ fragte ein Unteroffizier und deutete auf meinen Handkoffer.
Ich legte ihn auf den Tisch.
„Sperren Sie ihn bitte auf.“ Er warf einen Blick in meinen Ausweis: „Herr Lange.“
„Er ist offen“, antwortete ich.
Das Schnappschloß ging auf. Der Unteroffizier wühlte in den getragenen Klamotten, betrachtete die anderen Utensilien: „Ein sehr ordentlicher Mensch sind Sie ja nicht gerade“, stellte er angewidert fest – aber schließlich war ich weder bei der Volkspolizei noch bei den nationalen Streitkräften als Rekrut eingezogen worden, und außerdem haftete an mir ein ziemlich volksnaher Geruch.
Neben dem Tisch stand ein Funkstreifenwagen, der über Radiotelefon Verbindung zum Einwohnermeldeamt und sicher auch zur Fahndungsstelle der Kriminalpolizei herstellte. Es war wirklich erstaunlich, daß trotz dieser Absperrungspraktiken an diesem Tag an die zweitausend Menschen nach drüben entkommen konnten.
„Personenfeststellung“, rief der Unteroffizier seinem Funker zu. „Ein Martin Lange, Angestellter, geboren am 17. 3. 26, beschäftigt beim Fernsehen in Adlerhorst. Ist der Mann in Berlin, Friedrichstraße polizeilich gemeldet?“
Der Vopo von der Funkstreife gab die Daten durch. Der Unteroffizier schloß zögernd den Koffer und sah mich streng an. Die nächsten Sekunden vergingen tranig und träge. Ich hoffte mit der Inbrunst eines Gebets, daß die Republikflucht meines Namensgebers noch nicht entdeckt worden war.
„Woher kommen Sie?“ fragte mich der Unteroffizier.
„Aus Magdeburg. Ich hab’ Urlaub. Ich war zum Fischen in –“
„Allein?“
„Ich bin Witwer“, antwortete ich. „Seit dem Tod meiner Frau lebe ich sehr zurückgezogen.“
Sein Mißtrauen war größer als sein Mitleid.
Man hörte nur einen unverständlichen Wortbrei, aber der Funker nickte dem Unteroffizier zu.
„Hier, nehmen Sie Ihren Koffer wieder“, sagte der Uniformierte und quälte sich tatsächlich noch ein: „Gute Reise“ ab.
Ich kam in den zweiten Waggon. Jetzt hatte ich einen Sitzplatz. Jeder dritte war diesmal zur weiteren Überprüfung festgehalten worden, keiner brauchte mehr im Abteil zu stehen.
Endlich war ich in Berlin und damit zunächst aus dem Schneider.
Ich fuhr noch zwei Stationen weiter und stieg in die S-Bahn um. Am liebsten wäre ich in einem Stück nach West-Berlin durchgerollt, aber da hätte ich mich gleich in der Normannenstraße stellen können. Jetzt brauchte ich die Hilfe der Agency. Sie hatte eine Anlaufstelle in Berlin-Ost. Ich mußte nur meinen Code-Namen „Solist“ nennen und von einer öffentlichen Fernsprechstelle aus eine bestimmte Telefonnummer wählen.
Es war mein Fallschirm; ich war sicher, daß er sich öffnen würde.
Das Ortsgespräch kam auf Anhieb zustande.
Die Verbindung war deutlich. „Sie sind in Berlin?“ fragte eine undefinierbare Stimme.
„Gerade angekommen. Ich möchte Ihnen eigentlich nur guten Tag sagen.“
Wir verabredeten uns am Eingang der Treptower Parks in der Köpenicker Landstraße. Es regnete. Ich trat unter die Überdachung des HO-Ladens auf der verabredeten Straßenseite. Ich war noch immer sicher, daß es klappen würde.
Aber wenn es zu glatt verliefe, würde mir auch mulmig.
In langsamer Fahrt zog ein Wagen der Volkspolizei an mir vorbei. Alle vier Insassen betrachteten mich mißtrauisch, aber mit sechsunddreißig war ich noch nicht aus dem Alter, in dem man sich auch bei Regen mit einer Puppe verabreden kann.
Die Zeit ließ sich Zeit.
Nach neununddreißig Minuten näherte sich ein problematischer Ford in langsamer Fahrt, mit abgeblendeten Scheinwerfern.
Ich trat aus der Überdachung hervor.
Ich nahm die Schirmmütze ab und winkte – das verabredete Zeichen.
Der Wagen hielt.
Ich öffnete den Schlag und sagte: „Guten Abend.“
Mein Lotse war eine Lotsin, und sie hatte – ungleich ihrem Gefährt – ihre besseren Jahre wohl noch vor sich.
Ich stieg zu. Der Wagen rollte über die nasse Straße. Der Himmel hing tief über Berlin, nieder wie eine Affenstirn und grau wie eine Fabrikwand. Grau war schon keine Farbe mehr, sondern ein Zustand. Aber ich würde vermutlich noch heute nacht in den goldenen Westen der Stadt repatriiert werden.
Ab und zu zogen Lichtreflexe über das Gesicht meiner Chauffeuse. Ich betrachtete es gründlich – weniger mit den Augen des Mannes als aus professioneller Gewohnheit. Sie hatte sanft-rote Haare; sie waren hochgesteckt. Sie sah wie ein Pinup-girl aus, aber sie plapperte nicht. Sie schwieg und fuhr sehr konzentriert.
„Wohin bringen Sie mich?“ fragte ich.
„Ich führe nur Aufträge aus“, erwiderte sie betont professionell. „Ich beantworte keine Fragen.“
„Fallen Sie um Gottes willen nicht aus Ihrer Rolle“, spöttelte ich.
„Haben Sie die letzten Nachrichten nicht gehört?“ fragte sie.
„Am späten Vormittag.“
„Sie werden in der ganzen DDR gesucht wie ein bunter Hund.“
„Hauptsache, Sie haben mich gefunden“, entgegnete ich.
„Soweit ich es bei dieser schlechten Beleuchtung sehen kann, ist die Personenbeschreibung im Radio gar nicht so abwegig.“
„Sicher eine Verwechslung“, wurde ich jetzt professionell.
„Heute nacht ist nicht daran zu denken, Sie legal nach drüben zu schaffen“, sagte sie. „Sie können sich nicht vorstellen, was da heute los ist.“
„Und illegal?“ fragte ich.
„Ich habe keine Weisung“, entgegnete sie.
Sie hatte eine dunkle Stimme mit einem heiseren Timbre. Ich schätzte sie auf etwa dreißig und stellte fest, daß sie hübsche Beine hatte. Diese Beobachtung war noch immer sachlich. In diesen Dingen hatte ich gelernt, die Männlichkeit auszuknipsen wie das elektrische Licht.
„Wo sind wir eigentlich?“ fragte ich.
„Das wissen Sie doch“, antwortete die Fahrerin. „Oder haben Sie geschlafen, als wir die Janowitzbrücke passierten?“
Ich schwieg. Ich dachte an eine andere Dreißigjährige, die die gleichen Haare hatte, wenn auch in einem viel ordinäreren Rot. Wenn die „Ford“-Chauffeuse das an der Tigerfalle angepflockte Schaf wäre?
Unsinn, rügte ich meine Nerven.
Die Falle wäre längst zugeschnappt, so lange warten die nicht. Das sind ungeduldige, ungehobelte Burschen. Und die drei Gehlen-Leute hatten sie ja längst kassiert.
„Sie sehen das Hochhaus da vorn?“ fragte sie. „Auf der rechten Seite, Nummer 189.“ Sie überreichte mir einen Schlüssel.
„Sie nehmen den zweiten Eingang. Der Lift liegt genau gegenüber. Sie fahren zum Apartment 811 hoch. Der Schlüssel sperrt oben wie unten.“
Ich nickte.
„Im Kühlschrank sind Wurst, Butter, Wodka und Bier. Außerdem finden Sie Brot, Whisky und Zigaretten. Ein Notbett ist für Sie im Wohnzimmer aufgeschlagen. Wenn Sie noch etwas brauchen, bitte bedienen Sie sich.“ Sie warf mir einen Seitenblick zu. „Es handelt sich um meine Wohnung.“
„Besten Dank, Altruistin“, entgegnete ich.
„Sie werden nicht lange allein bleiben“, versprach sie. „Ich hab’ noch einige Dinge zu erledigen, dann leiste ich Ihnen Gesellschaft.“ Sie nickte mir zu. „Wir sehen uns spätestens beim Frühstück.“
„Fein“, erwiderte ich. „Ich laß’ das Kaffeewasser schon nicht anbrennen.“
Sie machte es gut; sie hielt an der dunkelsten Stelle der Straße, fuhr sofort weiter, ohne sich nach mir umzudrehen. Die Beleuchtung war schlecht. Neonschein glänzte vorwiegend auf der anderen Seite der Stadt, und die Republikflüchtlinge umschwärmten ihn wie Motten das Licht.
Ich ging zuerst am Eingang des Neubaus vorbei, ganz langsam. Niemand zu sehen. Wenn es eine Falle war, hatte man sie perfekt installiert. Ich kehrte um. Die Haustür stand offen. In den Lift brauchte ich nur einzusteigen, wie auf Kommando stand er im Erdgeschoß. Ich drückte den Knopf. Kein Aufenthalt.
Niemand stieg zu.
Fünfter Stock, sechster, siebter.
Es ging weiter nach oben.
Achte Etage.
Ich verließ den Aufzug.
Kein Mensch im Treppenhaus.
Dr. Liane Lipp stand an der Wohnungstüre.
Der Nachbar hatte seinen Fernsehapparat nicht auf Zimmerlautstärke gestellt: Schreie, Schüsse, quietschende Reifen, ein Krimi, made in USA – nicht nur in Ostberlin waren viele Antennen auf das Westfernsehen ausgerichtet.
Ich betrat die Wohnug, ohne Licht zu machen.
Ich war sicher, daß mich niemand gesehen hatte.
Die Rolladen waren heruntergelassen.
Ich machte Licht.
Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad, Balkon; für eine Ostwohnung ein erstaunlicher Komfort in einem Haus, das vermutlich vor DDR-Prominenz nur so wimmelte. Wohnungen kann man in der DDR nicht kaufen, sie werden zugeteilt.
Wer auch immer diese Zweieinhalb-Zimmer-Pracht vergeben hatte, wußte nicht, daß die CIA als Mieter eingezogen war.