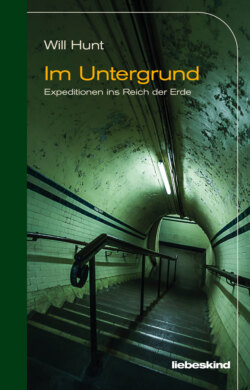Читать книгу Im Untergrund - Will Hunt - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Kapitel DER ABSTIEG
ОглавлениеEs gibt eine andere Welt, aber sie ist in dieser.
PAUL ÉLUARD
Hinweise auf den Untergrund findet man überall. Man tritt aus der Haustür und spürt unter den Füßen das Dröhnen aus U-Bahn-Tunneln, Stromkabeln, Wasserleitungen und Rohrpoströhren, alle in Schichten übereinanderliegend und miteinander verwoben wie Fäden auf einem riesigen Webstuhl. Am Ende einer ruhigen Nebenstraße sieht man Dampf aus einem Entlüftungsschacht steigen, vielleicht aus einem versteckten Tunnel, wo Obdachlose in einem selbst gebauten Unterschlupf hausen, oder aus einem geheimen Bunker mit bombensicheren Betonwänden, in den sich die Elite beim Weltuntergang flüchten wird. Bei einem ausgedehnten Spaziergang durch friedliches Weideland fährt man mit der Hand über einen grasbewachsenen Hügel, unter dem vielleicht das uralte Grab einer Stammesfürstin verborgen liegt oder die Fossilien eines urzeitlichen Riesentiers mit langem Zackenschwanz. Man wandert einen schattigen Waldweg entlang, legt das Ohr an den Boden und hört das Krabbeln von Ameisen, die eine unterirdische Miniaturstadt mit zahllosen gewundenen Gängen bauen. Auf einer Bergtour riecht man ein erdiges Aroma, das aus einem schmalen Spalt aufsteigt – Hinweis auf einen großen Hohlraum, dessen Wände vielleicht mit prähistorischen Kohlemalereien verziert sind. Auf Schritt und Tritt spürt man ein Beben aus großer Tiefe, wo gigantische Felsmassen sich aneinander reiben, sich verschieben und die Erde zum Wanken und Schaudern bringen.
Wäre die Erdoberfläche durchsichtig, verbrächten wir ganze Tage auf dem Bauch liegend, um hinunter in die vielen Schichten des unterirdischen Terrains zu starren. Aber für uns Oberflächenbewohner, die in der sonnenhellen Welt ihrem Leben nachgehen, ist und war der Untergrund unsichtbar. Unser Wort für die Unterwelt, Hölle, ist hergeleitet von der protoindoeuropäischen Wurzel kel-, die »verhüllen« bedeutet. Das altgriechische Wort Hades heißt »der Unsichtbare«. Wir verfügen heutzutage über moderne technische Hilfsmittel wie Georadar und Magnetometer, um die Welt zu unseren Füßen anschaulich zu machen, aber selbst die besten Bilder wirken neblig und unscharf, und immer noch spähen wir wie Dante mühsam in die Tiefen: »Ob ich den Blick auch schickte tief zum Grunde, so schwarz blieb der, so neblig allerseiten, dass ich nichts unterschied in weiter Runde.« Der Untergrund ist die abstrakteste Landschaft des Planeten, und immer mehr Metapher als konkreter Ort. Wenn wir von »Untergrund« sprechen – ein illegaler Rave, eine unentdeckte Künstlerin, eine Untergrundbewegung –, dann beschreiben wir im Allgemeinen keinen Ort, sondern einen Zustand: etwas Verbotenes, Unausgesprochenes, in jedem Fall etwas, das sich jenseits des Bekannten und Gewöhnlichen befindet.
Als Augenkreaturen – unsere Augen, schrieb Diane Ackerman, sind »die großen Monopolisten unserer Sinne« – vergessen wir den Untergrund. Wir sind komplett oberflächenfixiert. Wir feiern die Pioniere, die immer weiter hinaus und höher hinauf streben: Wir sind über die Mondoberfläche gehüpft, haben Messfahrzeuge in Marsvulkane gesteuert und elektromagnetische Stürme im fernsten Weltall aufgezeichnet. Das Weltinnere ist im Vergleich dazu viel leichter zu erreichen – aber weniger erforscht. Die Geologen glauben, dass weltweit über die Hälfte aller Höhlen noch unentdeckt tief in der Erdkruste versteckt liegen. Die Entfernung von unseren Füßen bis zum Mittelpunkt der Erde ist nicht weiter als eine Reise von New York nach Paris, und trotzdem ist der Erdkern eine Black Box, eine Gegend unseres Planeten, deren Existenz wir in blindem Glauben akzeptieren. Wir sind noch nicht weiter unter die Erde vorgedrungen als die 12.262 Meter der Kola-Bohrung in der russischen Arktis – das ist weniger als ein halbes Prozent des Wegs bis zum Erdmittelpunkt. Der Untergrund ist eine Geisterlandschaft, die sich überall unter unseren Füßen ausbreitet und sich doch stets dem Blick entzieht.
Aber ich wusste schon als Kind, dass die Unterwelt nicht immer und nicht für alle unsichtbar war – für bestimmte Menschen hatte sie sich geöffnet. Im alten D’Aulaires Book of Greek Myths meiner Eltern – der amerikanischen Variante von Schwabs Sagen des klassischen Altertums – las ich, dass Odysseus, Herakles, Orpheus und andere Helden durch schroffe Spalten in die Erde hinabgestiegen waren, den Styx mithilfe des Fährmanns Charon überquert, den dreiköpfigen Höllenhund Cerberus abgeschüttelt und das Schattenreich des Hades betreten hatten. Von all diesen Helden begeisterte mich Hermes am meisten, der Götterbote mit Flügeln an Helm und Sandalen. (Hermes trug den wunderbaren Beinamen Psychopomp, was so viel wie »Seelenbegleiter« bedeutet.) Während andere Götter und Sterbliche den kosmischen Gesetzen gehorchen mussten, bewegte er sich mühelos zwischen Licht und Dunkel, unten und oben. Hermes – den ich zum Schutzheiligen meiner eigenen Exkursionen in den Untergrund ernannte – war für mich der Inbegriff des unterirdischen Entdeckungsreisenden, der die Dunkelheit mit Klarheit und Anmut durchmaß, die Unterwelt erkannte und den vergrabenen Schatz ihrer Weisheit zu heben wusste.
In dem Sommer, in dem ich sechzehn wurde und meine Welt klein und vertraut wie meine Fingerkuppe war, entdeckte ich einen verlassenen Eisenbahntunnel, der unter unserem Viertel in Providence, Rhode Island, hindurchführte. Mein Erdkundelehrer erwähnte den Tunnel zum ersten Mal, ein kleiner, bärtiger Mann, Otter hieß er, der jede versteckte Furche in der neuenglischen Landschaft kannte. Der Tunnel war für eine kleine Güterverkehrslinie gebaut worden, erzählte er mir, aber die gab es schon lange nicht mehr. Jetzt verfiel er, war voll mit Schlamm und stinkendem Müll und Gott weiß was sonst noch allem.
Eines Nachmittags fand ich den von einem dichten Gebüsch hinter einer Zahnarztpraxis verborgenen Eingang. Er war mit Schlingpflanzen überwuchert, und das Datum der Erbauung – 1908 – war im Beton über der Einfahrt verewigt. Der Zugang war von der Stadt mit einem Metalltor verschlossen worden, aber jemand hatte eine kleine Öffnung hineingeschnitten: Zusammen mit ein paar Freunden kroch ich in die Tiefe. Die Strahlen unserer Taschenlampen durchkreuzten das Dunkel. Mit den Füßen blieben wir im Schlamm stecken, die Luft war feuchtwarm. Von der Decke hingen perlweiße, warzenartige Stalaktiten, an denen Wasser herunter- und uns auf die Köpfe tropfte. In der Mitte des Tunnels machten wir eine Mutprobe und schalteten die Taschenlampen aus. Als alles um uns herum in Finsternis versank, stießen meine Freunde Freudenschreie aus, um den Hall ihres Echos zu hören, aber ich hielt den Atem an und stand wie angewurzelt da – als könnte ich bei der kleinsten Bewegung abheben und davonschweben. An diesem Abend kramte ich zu Hause einen alten Stadtplan von Providence hervor. Ich verfolgte mit dem Finger, wo wir den Tunnel betreten hatten und wo er auf der anderen Seite wieder herauskam. Ich blinzelte: Der Tunnel führte fast genau unter meinem Elternhaus hindurch.
In jenem Sommer stieg ich, wenn alle anderen unterwegs waren, immer wieder in die Gummistiefel und ging den Tunnel erforschen. Was mich dort unten so anzog, hätte ich nicht erklären können, ich ging nie mit einer konkreten Absicht in die Dunkelheit. Ich schaute mir die Graffiti an oder kickte leere Bierflaschen herum. Manchmal stellte ich meine Lampe aus, nur um zu sehen, wie lang ich es im Dunkeln aushielt, bevor meine Nerven mit mir durchgingen. Als Sechzehnjähriger machte ich mir nicht besonders viele Gedanken über mein Wesen, hatte aber trotzdem das vage Gefühl, dass diese Unternehmungen nicht direkt zu meinem Charakter passten: Ich war ein unsicherer, dünner Teenager mit Bücherwurmbrille und Zahnlücke. Als meine Freunde längst mit Mädchen herummachten, hatte ich immer noch ein Terrarium mit Baumfröschen im Zimmer stehen. Etwas über die Abenteuer anderer Leute in Büchern zu lesen, fand ich gut, aber ich war nicht scharf darauf, selbst welche zu erleben. Aber irgendetwas an dem Tunnel ging mir unter die Haut: Ich lag nachts im Bett und dachte daran, dass er unter unserer Straße verlief.
Gegen Ende dieses Sommers betrat ich den Tunnel nach einem starken Regenguss, und mir schallte aus dem Dunkel unerwarteter Lärm entgegen. Erschreckt wollte ich umdrehen, beschloss dann aber doch weiterzugehen, obwohl das Getöse immer lauter wurde. Tief im Tunnel sah ich, woher es stammte: Aus einem Spalt in der Decke – einem geplatzten Rohr vielleicht – strömte das Wasser in Kaskaden zu Boden. Direkt unter dem Wasserfall stand ein umgedrehtes Kindereimerchen. Daneben ein Farbeimer. Ich sah eine Riesenkollektion umgedrehter Behälter – Ölfässer, Bierbüchsen, Tupperdosen, Benzinkanister, Kaffeedosen –, alle unter mysteriösen Umständen von einem Unbekannten zu einem Orchester angeordnet. Das Wasser trommelte auf die hohlen Gefäße und ließ Harmonien und Echos erklingen, und ich stand wie angewurzelt im Dunkeln.
Jahre vergingen, und ich vergaß meine Spaziergänge unter der Erde. Ich zog weg aus Providence, ging aufs College, wurde erwachsen. Aber meine alte Liebe zum Untergrund verschwand nie vollständig. So wie ein Samenkorn unbemerkt Wurzeln schlägt und verborgen in der Erde keimt, bevor es nach oben austreibt, so reiften auch die Erinnerungen an den Tunnel irgendwo tief in meinem Hinterkopf. Erst viel später, nach einer Reihe überraschender Begegnungen im unterirdischen New York, kehrten meine Erinnerungen an den Tunnel und den rätselhaften Altar aus Eimern wieder zurück. Doch dann packten mich die Erinnerungen mit einer Wucht, die mein gesamtes Denken und Leben auf den Kopf stellte.
Ich verliebte mich in die Stille und den Widerhall der unterirdischen Welt. Selbst der kürzeste Ausflug unter die Erde war wie eine Flucht in eine parallele Realität – so wie Figuren in Kinderbüchern eine geheime Welt betreten. Ich liebte die Möglichkeiten zu wilden, unterirdischen Tom-Sawyer-Abenteuern – wo immer auch eine Konfrontation mit den ältesten, tiefsten Grundängsten der Menschheit auf mich wartete. Meinen Freundinnen und Freunden erzählte ich für mein Leben gern Geschichten aus dem Untergrund – von unter Großstadtstraßen gefundenen Reliquien und Ritualen in tiefen Höhlen – und liebte es, das Staunen in ihren Augen zu sehen. Am stärksten fühlte ich mich zu den Träumern, Visionären und Exzentrikern hingezogen, die sich im Untergrund zu Hause fühlten: den Menschen, die den Sirenengesang der unterirdischen Welt gehört hatten und in der Unterwelt auf Forschungsreisen gingen, Kunst machten oder beteten. Menschen, die sich ihrer Leidenschaft auf eine Art hingaben, die ich zu verstehen meinte oder zumindest verstehen wollte. Paradoxerweise hoffte ich, tief unten im Dunkeln vielleicht so etwas wie Erleuchtung zu finden.
Im Lauf der Jahre überzeugte ich eine Forschungseinrichtung, mehrere Zeitschriften und dann einen Buchverlag davon, mich finanziell zu fördern; dieses Geld und noch viel mehr gab ich für die Erforschung unterirdischer Räume in den verschiedensten Teilen der Welt aus. Mehr als zehn Jahre lang kroch ich durch Katakomben und unbenutzte U-Bahn-Stationen, heilige Höhlen und Atombunker. Anfangs wollte ich nur meine eigene Faszination für die Tiefe verstehen, wurde aber mit jedem Abstieg empfänglicher für die Resonanzen der unterirdischen Landschaft. Eine universellere Geschichte trat zutage. Ich verstand, dass wir – wir alle, die Gattung Mensch – immer den leisen Sog der Welt unter unseren Füßen spüren und mit ihr so verbunden sind wie mit unserem eigenen Schatten. Seit unsere Vorfahren sich zum ersten Mal Geschichten erzählten über die Landschaften, die sie bewohnten, erfüllen uns Höhlen und andere Abgründe immer mit Angst und Begeisterung zugleich, prägen unsere Albträume und Fantasien. Wie ich herausfand, ziehen sich unterirdische Welten wie ein unsichtbarer Faden durch die Menschheitsgeschichte: Auf fast unmerkliche, aber tief greifende Art und Weise haben sie unser Denken und unser Menschsein geformt.
Für mich öffnete sich der Untergrund zunächst ganz langsam, ein kleiner, splitteriger Spalt nach dem anderen – und dann mit einem Ruck, als ginge eine Falltür unter meinen Füßen auf. Es fing in meinem ersten Sommer in New York an, als ich bei einer Zeitschrift in Manhattan arbeitete und bei meinen Verwandten in Brooklyn wohnte: bei Tante, Onkel und meinen Cousins Russell und Gus. Als Teenager hatte ich jahrelang von New York geträumt und mir vorgestellt, wie ich lange, ekstatische Spaziergänge durch das nächtliche Manhattan unternehmen und das Licht aus den Fenstern der unzähligen Hochhauswohnungen gierig in mich aufsaugen würde, und nun war ich da und fand keinen Zugang zur Stadt. In Menschenmassen wurde ich ganz klein, stammelte, wenn ich im Eckladen etwas kaufen wollte, stieg am falschen U-Bahnhof aus, irrte wie ein ahnungsloses Landei in Brooklyn umher und traute mich nicht, jemanden nach dem Weg zu fragen.
Eines Nachts, sehr spät, als ich mich besonders von der Stadt eingeschüchtert fühlte, wartete ich in Downtown Manhattan auf die U-Bahn, an einem der tiefen Gleise, auf denen man in einer Sommernacht den Granituntergrund der Stadt fast riechen kann, als ich etwas Verblüffendes sah. Aus der Dunkelheit des Tunnels tauchten zwei junge Männer auf: Sie trugen Stirnlampen, und ihre Gesichter und Hände waren schwarz vor Ruß, als wären sie tagelang in einer tiefen Höhle herumgeklettert. Sie gingen im Geschwindschritt über das Gleis, kletterten direkt vor meinen Füßen auf den Bahnsteig und verschwanden die Treppe hinauf. An diesem Abend drückte ich mir die Nase am U-Bahn-Fenster platt, bis das Glas beschlug, und stellte mir vor, dass unter den Straßen alles von geheimen Hohlräumen durchzogen war wie in einer Bienenwabe.
Die jungen Männer mit den Stirnlampen waren Urban Explorer oder Urbexer, Teil eines losen Zusammenschlusses von New Yorkern, die in ihrer Freizeit die verbotenen und versteckten Räume unterhalb der Stadt aufsuchten. Es war ein bunt gemischtes Völkchen: Manche waren Historiker, die den Glanz der vergessenen Orte der Stadt dokumentieren wollten; andere waren Aktivisten, die durch dieses verbotene Eindringen das von Unternehmen beanspruchte Privatgelände zurückeroberten; wieder andere waren Künstler, die Installationen und Performances in den verborgenen Schichten der Stadt schufen. In jenen ersten Wochen, in denen ich einfach nicht mit New York warm wurde, war ich oft bis spätabends wach und betrachtete Fotos geheimer Orte – seit Jahrzehnten stillgelegte Geisterbahnhöfe, tiefe Ventilkammern der Wasserversorgung, staubbedeckte, lang vergessene Luftschutzbunker – und all das kam mir so exotisch und mysteriös vor wie durch die Tiefsee schwimmende Meeresungeheuer.
Es war Abend, ich surfte durch das Onlinearchiv eines Urban Explorers, und mit einem Mal sah ich mich verblüfft einem Bild des Tunnels gegenüber, den ich als Junge in Providence erforscht hatte: Seit Jahren hatte ich nicht mehr an die ins Dunkel führende Gleisspur oder die Jahreszahl »1908« über dem Tunneleingang gedacht. Dieses zufällige Wiedersehen wirkte beunruhigend intim auf mich, als hätte jemand in meinen Kopf gefasst, eine Luke geöffnet, und ein ganzes Floß untergegangener Erinnerungen wäre zurück an die Oberfläche getrieben. Ich fand heraus, dass der Fotograf Steve Duncan hieß: ein beeindruckender, brillanter, eventuell komplett durchgeknallter Mann, der mein erster Führer durch die Unterwelt werden sollte.
Wir trafen uns an einem Nachmittag zu einer Erkundungstour durch die Bronx; Steve plante eine Exkursion durch ein altes Abwasserrohr. Er war sechs oder sieben Jahre älter als ich, mit hellen Haaren, blauen Augen und dem langgliedrigen Körperbau eines Kletterers. In seinem ersten Studienjahr hatte er angefangen, New York illegal zu erforschen; an seiner Uni, der Columbia University, schlängelte er sich durch ein Netzwerk von Dampftunneln unterhalb des Campus. Eines Nachts zwängte er sich durch einen Entlüftungsschlitz und fand sich in einer Kammer voll eingestaubter wissenschaftlicher Instrumente wieder. Es war der Geräteraum des ersten Vorläufers des späteren Manhattan-Projekts – die Entwicklung der Atombombe. Die bauchige grüne Maschine in der Mitte des Raums war der Original-Teilchenbeschleuniger: ein seltsames Juwel der Geschichte, knapp außerhalb unserer Sichtweite.
Die Sache ließ ihn nicht mehr los, und Steve wechselte kurzerhand das Studienfach, von Ingenieurswissenschaften zu urbaner Geografie und Geschichte. Wenn er nicht studierte, erforschte er erst die Eisenbahntunnel, später zog er Anglerstiefel über und stapfte durch Abwasserkanäle, bald danach kletterte er auf die Pfeiler von Hängebrücken, wo er beeindruckende Bilder der Stadt aus der Vogelperspektive schoss. Im Lauf der Jahre kultivierte er sein Image als Guerillahistoriker und Underground-Fotograf, der mit einer beunruhigend detaillierten Kenntnis der städtischen Infrastruktur aufwarten konnte. (Die New Yorker Umweltschutzbehörde, die für die Überwachung der Kanalisation zuständig ist, hat immer mal wieder versucht, Steve anzuheuern, trotz seiner illegalen Forschungsmethoden.) Steve bewegte sich irgendwo zwischen Nerd und Outlaw: Er war dünn, hatte letzte Überbleibsel eines kindlichen Sprachfehlers, trank wie ein Seemann, wickelte mit seinem verwegenen Lächeln die Frauen um den Finger und hatte ein Auftreten wie ein Superheld. Als junger Mann war er an einer seltenen Form von Knochenkrebs im Bein erkrankt und wäre beinahe daran gestorben. Diese Erfahrung schien allem, was er tat, eine besondere Dringlichkeit zu verleihen. Er konnte den Abend mit einem Vortrag über die Bedeutung der verschiedenen Abkürzungen auf den New Yorker Gullydeckeln oder über die Veränderungen der Durchflussrate in europäischen Abwassersystemen des neunzehnten Jahrhunderts verbringen, und dann in der nächsten Bar in eine Schlägerei geraten.
An jenem Nachmittag bewegten wir uns im Zickzack von einem Gullygitter zum nächsten, leuchteten mit den Taschenlampen nach unten und folgten dem Verlauf eines Abwasserrohrs. Im Gehen schwärmte Steve mit der Begeisterung eines Frischverliebten von den Puzzleteilen, aus denen sich die unsichtbaren Systeme der Stadt zusammensetzten. Für ihn war New York ein riesiger, sich ständig verändernder Organismus mit vielen Tentakeln, von dem Oberflächenbewohner nur einen winzigen Ausschnitt wahrnahmen. Er sah es als seine Aufgabe, die Verbindung der Menschen zu den verborgenen Aspekten der Welt herzustellen: Er wünschte sich, jeder Kanaldeckel wäre aus Glas gemacht, damit die Stadtbewohner überall in die Tiefe schauen konnten.
»Die meisten Leute bewegen sich in zwei Dimensionen durch die Welt«, sagte er. »Sie haben keine Ahnung, was unter ihnen los ist. Wenn man weiß, was unter der Erde passiert, versteht man, wie eine Stadt funktioniert. Aber es ist mehr als das. Man versteht, wie man selbst in die Geschichte der Stadt passt und welchen Platz man in der Welt einnimmt.«
Steve war für mich eine Verkörperung des Hermes – er war in der Lage, eine parallele Topografie wahrzunehmen. »Ich glaube, auch viel Unsichtbares ist hier«, schrieb Walt Whitman in Grasblätter. Steve sah das Unsichtbare – und ich wollte es auch sehen.
Mein erster Abstieg führte mich nicht sehr tief: eine Wanderung durch den West Side Tunnel – bei Urbexern und Graffitikünstlern als Freedom Tunnel bekannt –, der vier Kilometer lang unter dem Riverside Park an der Upper West Side in Manhattan verläuft.
An einem Sommermorgen schlüpfte ich durch einen Schlitz im Maschendrahtzaun nahe der 125th Street und betrat die große, an die sieben Meter hohe und doppelt so breite Tunneleinfahrt. In diesem Tunnel war es nicht richtig dunkel, eher dämmrig: Alle dreißig Meter öffnete sich in der Decke ein viereckiges Belüftungsgitter, durch das gedämpft Lichtstrahlen einfielen wie durch die Fenster einer Kathedrale. Es fühlte sich an wie ein Traum, als ich so still mitten durch Manhattan wanderte, ohne einen einzigen Menschen zu sehen.
Ungefähr auf halbem Weg fand ich ein riesiges, über dreißig Meter langes Mural, Produkt eines Künstlers, der sich Freedom nannte und dem Tunnel seinen Namen verlieh. Ich lehnte an der gegenüberliegenden Wand und bewunderte das Gemälde, das im Licht zu zittern schien. Eine leichte Brise wehte durch den Tunnel, und aus der Ferne hörte ich das Brausen des Verkehrs auf dem West Side Highway, das sich mit dem Vogelgesang im Park vermischte.
Und dann sah ich auf einmal, wie aus der Tiefe des Tunnels die riesigen Scheinwerfer eines Zugs auf mich zukamen. Ich drückte mich mit dem Rücken an die Wand, spürte einen tiefen, rumpelnden Bass unter den Füßen, dann eine Lichtexplosion, die Druckwelle eines starken Windes und ein enormes Tosen, das meine Rippen vibrieren ließ. Ich schwebte nicht in Lebensgefahr – zwischen mir und den Gleisen war knapp fünf Meter Platz. Aber dicht an die Wand gedrängt schlotterte ich am ganzen Körper, und in meinem Kopf brannte es lichterloh.
Als ich an jenem ersten Nachmittag aus dem Tunnel auftauchte und am Hudson River über einen Zaun kletterte, hatte sich mein Verhältnis zu New York radikal verändert. Überirdisch bewegte ich mich auf immer derselben Route zwischen Arbeit und Zuhause, entlang eines Weges mit sehr eingeschränkten Sinneserfahrungen; unten im Tunnel hatte ich diese begrenzten Wege verlassen und spürte tief in mir eine neue Verbindung mit der Stadt. Es war ein Gefühl, als wäre ich wachgerüttelt worden und hätte es zum ersten Mal gewagt, New York auf Augenhöhe zu begegnen.
In den Untergrund zu gehen, in den Leib der Stadt hineinzukriechen, das war für mich der Beweis, dass auch ich nach New York gehörte und mit der Stadt vertraut war. Es bereitete mir große Genugtuung, meinen Freundinnen und Freunden, die echte, gebürtige New Yorker waren, von alten Gewölben unter ihrem Viertel zu erzählen, von denen sie nichts ahnten. Ich liebte es, in unterirdischen Gängen Strukturen der Stadt zu sehen, die für Menschen an der Oberfläche unsichtbar waren – uralte Graffiti und Tags, Risse in den Fundamenten von Wolkenkratzern, exotische Schimmelwucherungen an Wänden, jahrzehntealte Zeitungsseiten, die zusammengeknüllt in versteckten Nischen lagen. Die Stadt und ich hatten jetzt gemeinsame Geheimnisse: Ich durchsuchte ihre geheimen Schubladen und las ihre privaten Briefe.
Steve und ich waren eines Nachts in der Nähe des Brooklyn Navy Yard unterwegs; er stellte orangefarbene Kegel rund um einen Gully auf und zog mit einem Eisenhaken den Deckel hoch. Ein Dampfwölkchen kam heraus. Wir stiegen die Leiter hinunter, Hand für Hand an den schleimigen Sprossen, und landeten spritzend in der Kanalisation. Das Abwasserrohr war um die vier Meter hoch, in der Mitte gurgelte grünliches Wasser. In der warmen Luft beschlug meine Brille sofort. Beim Anblick der langen, zähflüssigen Bakterienstränge, die von der Decke hingen – in der Szene unter dem zärtlichen Spitznamen »Snotsicles« bekannt, weil sie wie gefrorene Rotzfäden aussehen –, zögerte ich ein wenig, aber die Kanalisation war weit weniger eklig, als ich erwartet hatte. Es roch nicht so sehr nach Fäkalien, sondern eher erdig, wie in einer alten Scheune voller Düngersäcke. Wir ließen das Licht unserer Stirnlampen über das Lehmufer wandern; wie Sandbänke in einem Fluss sah der Schlamm aus und war besiedelt von Kolonien winziger Albinopilze. Während der Laichsaison schwimmen in diesem Wasser Aale.
Vermischt mit dem grünlichen Abwasser floss hier der Wallabout Creek, erklärte mir Steve, ein natürlicher Bach, der früher in die Wallabout Bay entwässert hatte, wo sich heute der Navy Yard befand. Auf einer Karte von 1766 war der Fluss noch eingezeichnet, aber als die Stadt immer weiter wuchs, wurde er unter die Erde verlegt und verschwand aus den Augen der Welt.
An der Oberfläche war New York ein wildes, ungestümes Tier: grummelnd und knurrend stieß es Dampf aus und spuckte Menschenmassen aus seinen Öffnungen. Aber hier unten, wo einer der ursprünglichen Flüsse friedlich um meine Füße plätscherte, fühlte sich die Stadt ruhig und gelassen an, sogar verletzlich. Die Begegnung war so intim, dass sie mir fast unangenehm war: ein Gefühl, als ob man jemanden beim Schlafen beobachten würde.
Als wir die Leiter wieder hochkletterten und durch den offenen Gully zurück an die schneidend kalte Luft kamen, war drei Uhr morgens vorbei. Ich streckte den Kopf aus dem Loch und ein junger Mann auf dem Fahrrad musste einen Bogen um mich machen. Quietschend kam er zum Stehen, drehte sich um und fragte atemlos: »Wer seid ihr?«
Steve richtete sich auf, streckte die Brust heraus, als stünde er auf der Bühne, warf den Kopf in den Nacken und zitierte Robert Frosts »Ein Bach in der Stadt«:
In einen tiefen Kerker unter Stein
wurde der Bach verbannt
in stinkendes Abwasserdunkel,
dort zu leben und zu fließen –
dabei hatte er gar nichts verbrochen,
nur vielleicht die Angst zu vergessen.
Mit jedem Ausflug unter die Erde brach die harte Schale der Stadt ein bisschen mehr auf und gab ein neues Geheimnis preis, immer gerade so viel, dass ich noch ein Stück tiefer gelockt wurde. Bei jeder U-Bahn-Fahrt hatte ich ein Notizbuch dabei, schaute aus dem Fenster und vermerkte die Stellen, an denen Lücken in den Wänden zu sehen waren, die möglicherweise zu verlassenen Gleisen führten, zu »Geisterbahnhöfen«, wie sie von den Graffitisprayern genannt wurden. Ich folgte dem Verlauf von unterirdischen Bächen und suchte nach Stellen, an denen ich mein Ohr an einen Rost halten und darunter Wasser gluckern hören konnte. In meinem Wandschrank hingen Anglerstiefel und schlammige Klamotten, und ich trug jederzeit eine Stirnlampe im Rucksack bei mir. Ich begann mich immer langsamer durch die Stadt zu bewegen, blieb bei Lüftungsschächten der U-Bahn, bei Gullys und Baustellen stehen und versuchte, ein Bild von den Eingeweiden der Stadt zusammenzusetzen. Meine innere Landkarte New Yorks ähnelte immer stärker einem von verborgenen Faltungen, geheimen Durchgängen und unsichtbaren Nischen durchzogenen Korallenriff.
Eine Weile bewegte ich mich wie in Trance durch die Stadt und stellte mir vor, dass jedes Gullyloch, jeder dunkle Treppenschacht und jede Bodenluke im Bürgersteig in eine andere Dimension führten. Ich entdeckte ein Backsteingebäude in Brooklyn Heights, das von außen genau wie die anderen Häuser der Straße aussah – außer, dass die Tür aus schwerem Industriestahl bestand und die Fenster verdunkelt waren: Es war ein getarnter Entlüftungsschacht, der hinunter in die U-Bahn führte. Auf der Jersey Street in SoHo fand ich einen alten Gully, der in den unterirdischen Croton Aqueduct führte, den 1842 vier Männer mit einem kleinen Holzfloß, das sie Croton Maid getauft hatten, auf einer sechzig Kilometer langen Odyssee durchs stockdunkle Gewässer von den Catskills bis nach Manhattan befahren hatten. Unterhalb der Atlantic Avenue in Brooklyn fand ich einen 1862 verlassenen Eisenbahntunnel, der bis 1980 vergessen war, als der neunzehnjährige Bob Diamond in einen Gully einstieg und die riesige Echokammer darunter entdeckte. (Diese Entdeckung versetzte die Stadt in einen kurzen Faszinationstaumel, und Fotografen eilten herbei, um Bilder des jungen Bob zu schießen, wie er durch den mysteriösen Tunnel kroch.) Auf einer Insel in der Bronx schloss ich mich einer Schatzsuche an, bei der nach einem verlorenen Dollarbündel des verschwundenen Erpressungsgelds gesucht wurde, das der Entführer von Charles Lindberghs Baby angeblich dort vergraben hatte. Ich folgte den Gerüchten von düsteren, im U-Bahn-Netz verborgenen Kammern, deren Wände mit hundert Jahre alten Graffiti bedeckt waren: Räume, die so unberührt und vergessen waren, dass der Sand in Kaskaden von der Decke rieselte, wenn man zu laut sprach. Ich suchte nach einem alten Gebäude in Midtown Manhattan, in dem es im tiefsten Kellergeschoss ein Loch im Boden geben sollte, das sich auf einen schnell fließenden Fluss öffnete; tagsüber, hieß es, saßen alte Männer um das Loch und angelten Forellen. Diese Storys erzählte ich so oft, bis meine Freunde sie nicht mehr hören konnten; sie stöhnten, wenn ich sie bei Spaziergängen durch die Stadt ständig darauf hinweisen wollte, was sich gerade unter unseren Füßen befand. Aber zu dieser Zeit konnte ich schon nicht mehr anders.
Ich kletterte hinunter und begab mich in Gefahren, die sogar mich selbst erstaunten. Spätabends stieg ich über das Schild am Bahnsteigende, auf dem DO NOT ENTER OR CROSS TRACKS (Betreten der Gleisanlage verboten) stand, schlich mich auf den Steg und sprang von dort hinunter auf die Gleise, wo es finster wie in einem Schornstein und an Sommerabenden heiß wie in einem Hochofen war. Anfangs war ich da unten mit meinem Cousin Russell unterwegs: Wir rannten im Dauerlauf durchs Dunkel, spürten erst einen Lufthauch und dann ein tiefes Beben an den Füßen. »Zug kommt«, flüsterten wir. Wir hörten, wie die Weichen einrasteten, dann kam das Licht eines riesigen Scheinwerfers um die Kurve und erleuchtete die Tunnelwand: Blitzschnell kletterten wir hoch auf den Steg und drückten uns in die Vertiefung von Notausgängen, während die Bahn an uns vorbeidonnerte und dabei einen Wind erzeugte, der uns leicht hätte mit sich reißen können. Bald fing ich an, mich auch allein dort unten herumzutreiben, spontan, wenn ich Lust dazu hatte. Spätabends nach einer Party oder einem langen Tag in der Bibliothek wartete ich am Gleis, sah die U-Bahn kommen und entschied mich in letzter Sekunde, sie vorbeifahren zu lassen und ihr in den finsteren Tunnel zu folgen. Mehrere Male ging es beinahe schief, ich sah die blauen Funken der vorbeifahrenden Räder fliegen und war kurzzeitig taub vom Donnern des Zuges. Mitten in der Nacht ging ich dann wie betäubt nach Hause, das Gesicht vom Stahlstaub verschmiert, fühlte mich neben mir und doch hellwach, als sei ich gerade aus einem intensiven Traum erwacht.
Eines Nachts bemerkte mich ein U-Bahn-Fahrer im Tunnel, und als ich zurück auf den Bahnsteig kletterte, warteten schon zwei Polizisten auf mich: der eine klein und dick, der andere groß und dünn, beide jung und aus der Karibik stammend. Sie bogen mir die Arme auf den Rücken, drückten mich gegen die Wand und leerten meinen Rucksack auf dem Boden aus – sie hatten zwar guten Grund, mich festzunehmen, ließen mich am Ende aber doch gehen. Völlig fertig saß ich hinterher auf einer Bank und wusste haargenau, dass man mich, wenn ich nicht weiß wäre, in Handschellen abgeführt hätte. Aber als ich in derselben Nacht zu Fuß nach Hause ging, ertappte ich mich, wie ich schon wieder auf der Straße stehen blieb und in Ablaufgitter und Gullys spähte.
In den dunkelsten Schichten traf ich auf die Mole People – obdachlose Männer und Frauen, die in den unsichtbaren Nischen und Gewölben der Stadt hausten. In einer Nacht war ich mit Steve, Russell und ein paar anderen Urban Explorern unterwegs und lernte eine Frau kennen, die sich Brooklyn nannte und seit dreißig Jahren unter der Erde lebte. Sie hatte ein vernarbtes Gesicht und auf dem Kopf aufgetürmte Dreadlocks. Ihr Zuhause, das sie als »ihren Iglu« bezeichnete, war ein in einem Vorsprung des Tunnels versteckter Alkoven, den sie mit einer Matratze und ein paar schiefen Möbelstücken ausgestattet hatte. Brooklyn hatte Geburtstag, und wir ließen eine Flasche Whiskey herumgehen, sie sang ein Medley aus Tina-Turner- und Michael-Jackson-Songs, und eine Weile lachten alle. Aber dann legte sich bei Brooklyn irgendein Schalter um, aus dem Gesang wurde unverständliches Lallen, und sie sah Dinge, die nicht da waren. Ihr Partner kehrte zurück – der irgendwie auch Brooklyn hieß –, und die beiden fingen an, sich zu streiten, wüste Beschimpfungen hallten durchs Dunkel.
Irgendwann hörte ich auf, mit meinen Freunden, Freundinnen und Verwandten über meine Ausflüge in den Untergrund zu reden, weil ich es zunehmend schwierig fand, ihre Fragen zu beantworten: Was suchte ich dort unten eigentlich genau?
»Ich zeige dir was«, sagte Steve eines Abends, »aber du musst versprechen, dass du niemandem etwas davon verrätst.«
Es war gegen zwei, wir kamen von einer Party irgendwo in Brooklyn. Steve führte mich in einen U-Bahnhof und auf den Steg hinter der Absperrung. Ich ging direkt hinter ihm, aber auf einmal war er im Dunkeln verschwunden. Erst als er nach mir rief, wurde mir klar, dass er durch eine in der Wand verborgene Öffnung geschlüpft war. Ich trat hindurch und stand im finsteren Nichts. Es war eine der heiligen Hallen des New Yorker Untergrunds, ein riesiger Hohlraum, der nur durch eine hauchdünne Membran vom normalen Leben getrennt und dennoch vollständig unsichtbar ist.
Steve führte mich in die Mitte des Raums und beleuchtete den Boden, auf dem sich ein Gitter aus rechteckigen Fliesen befand, ungefähr 2 x 1,30 m groß. Wir bliesen auf die Fliesen und eine Staubwolke hob sich. Ich blickte auf eine Karte. Es war der Plan der New Yorker U-Bahn, wie er in jedem U-Bahnhof der Stadt hängt, auf dem die Umrisse von Brooklyn und Manhattan als unförmige, beigefarbene Klöße dargestellt sind, die von den bunten Fäden der U-Bahn-Linien über dem blassblauen East River miteinander verbunden werden. Aber statt der vertrauten Landmarken zeigte die Karte nur die unsichtbaren Orte. Die Veteranen unter den Urban Explorern, die über viele Jahre hinweg immer tiefer unter die Stadt vorgedrungen waren, hatten Fotos auf dem Plan befestigt, die zeigten, wo sich ein Abwasserkanal, ein Aquädukt, ein Geisterbahnhof oder andere, vor dem Auge der Öffentlichkeit verborgene Orte befanden. Begeisterung überfiel mich, als ich dort im Dunkeln hockte und diesen Atlas der unsichtbaren Stadt betrachtete, der sich selbst ebenfalls an einem unsichtbaren Ort befand: Es war eine Art Schrein für all das, was ich in den Jahren als Explorer unter New York gesucht hatte. Zugleich fühlte ich mich seltsam entfremdet von dieser Begeisterung, als stamme sie aus einem Teil meines Gehirns, zu dem ich keinen wirklichen Zugang hatte.
In diesem Augenblick, in dem ich im Staub tief unter der Stadt hockte, wurde mir klar, wie wenig ich über mein Verhältnis zum Untergrund wusste. Und wie wenig ich über das Verhältnis der Menschheit zur unterirdischen Landschaft im Allgemeinen wusste, das zurückreicht bis zum ersten schwachen Aufflackern der Menschengeschichte.
Bei einer Wanderung durch die Toskana stieg Leonardo da Vinci über ein paar Felsen und gelangte zum Eingang einer Höhle. Er stand dort im Schatten, spürte die kühle Brise auf seinem Gesicht, starrte ins Dunkel und wusste nicht mehr weiter: »Als ich aber geraume Zeit verharrt hatte, erwachten plötzlich in mir zwei Gefühle: Furcht und Verlangen. Furcht vor der drohenden Dunkelheit der Grotte, Verlangen aber, mit eigenen Augen zu sehen, was darin an Wunderbarem sein mochte.«
Seit Anbeginn der Menschheit haben wir in Höhlen und unterirdischen Öffnungen gelebt; seitdem verursachen diese Orte bei uns starke, widerstreitende Gefühle. Evolutionspsychologen vermuten, dass die archaischsten Beziehungen zu unserer Umwelt nie völlig verschwinden, dass sie tief in unserem Nervensystem verankert sind und in unbewussten Instinkten zum Ausdruck kommen, die unser Verhalten immer noch bestimmen. Der Ökologe Gordon Orians nennt diese übrig gebliebenen Urtriebe »die evolutionären Geister längst vergangener Umwelten«. Bei meinen Ausflügen unter New York liefen bei mir jedes Mal, wenn ich in den dunklen Schlund eines Tunnels oder in die Tiefen eines Kanalisationsschachts spähte, unbewusst die verschütteten Impulse ab, die ich von meinen Vorfahren geerbt hatte, die vor langer, langer Zeit am Eingang dunkler Höhlen gehockt und überlegt hatten, ob sie hineingehen sollten oder nicht.
Unter der Erde sind wir Fremde. Die Evolution hat uns in jeder nur vorstellbaren Weise – von den Bedürfnissen des Metabolismus über den Aufbau unserer Augen aus Stäbchenzellen bis hin zur geleeartigen Tiefenstruktur unseres Gehirns – darauf eingestellt, an der Oberfläche zu bleiben und nicht in den Untergrund zu gehen. Der aphotische Bereich einer Höhle – Fachausdruck für den Teil der Höhle, in dem es keinerlei Zwielicht mehr gibt, keine letzten Lichtreste, die lichtlose Zone – ist die Geisterbahn der Natur, der Inbegriff unserer tiefsten Ängste. Dort wohnen Schlangen, die zuckend von der Höhlendecke herunterhängen, Spinnen so groß wie Chihuahuas und Skorpione mit Stachelschwänzen – Tiere, vor denen wir uns aufgrund unserer Evolutionsgeschichte fürchten, weil so viele unserer Vorfahren von ihnen umgebracht wurden. Bis vor ungefähr fünfzehntausend Jahren waren Felsgrotten in aller Welt Wohnort von Höhlenbären, Höhlenlöwen und Säbelzahntigern. Was heißt, dass sich unsere Spezies seit ihrem Bestehen (abgesehen vom letzten kurzen Blinzeln) darauf gefasst machen musste, beim Anblick einer Höhle von einem menschenfressenden Untier aus dem Dunkeln angefallen zu werden. Und so flackert auch heute noch die Angst vor gefährlichen Tieren in uns auf, sobald wir im Finstern stehen.
Angepasst an das Leben in der afrikanischen Savanne, wo wir bei Tageslicht als Jäger und Sammler unterwegs waren, aber im Dunkeln nachtaktive Raubkatzen fürchten mussten, hat uns die Dunkelheit immer beunruhigt. Die unterirdische Finsternis – die »blinde Welt«, wie Dante sie genannt hat – ist in der Lage, unser gesamtes Nervensystem zusammenbrechen zu lassen. Die europäischen Pioniere der Höhlenforschung gingen davon aus, dass ein längerer Aufenthalt unter der Erde ihre Psyche dauerhaft schädigen würde, wie es der Erforscher einer Höhle in Somerset, England, im siebzehnten Jahrhundert beschrieb. »Wir fingen an, uns vor einem Besuch zu fürchten, denn obgleich wir die Höhle ausgelassen und heiter betraten, kehrten wir traurig und nachdenklich daraus zurück, und wir lachten bis an unser Lebensende nie mehr.« In gewisser Weise hat sich diese Furcht als berechtigt erwiesen, da zahlreiche neurowissenschaftliche Experimente gezeigt haben, dass ein ausgedehnter Aufenthalt in vollkommener Lichtlosigkeit psychische Verwirrung auslösen kann. In den 1980er-Jahren nahm ein Mann an einer Expedition in die Sarawak-Kammer im Gunung Mulu Nationalpark auf Borneo teil. Er betrat einen riesigen Höhlenraum – so groß, dass siebzehn Fußballplätze hineingepasst hätten, einer der größten unterirdischen Hohlräume der Welt – und verlor die Höhlenwand aus den Augen: Der Mann irrte ziellos in der unendlich scheinenden Dunkelheit herum, verfiel in eine Schocklähmung und musste von seinen Begleitern an die Oberfläche gebracht werden. Solche von der Dunkelheit ausgelösten Panikattacken sind in der Szene als »The Rapture« bekannt: Angst, Rausch und Entrückung.
Das Gefühl, eingeschlossen zu sein, bringt uns aber auch zum Durchdrehen. Unter der Erde in einem Spalt festzustecken und sich nicht mehr bewegen zu können, abgeschnitten vom Licht, mit langsam weniger werdendem Sauerstoff, ist vielleicht der Inbegriff des Albtraums schlechthin. Der römische Philosoph Seneca beschrieb einmal eine Gruppe antiker Silberschürfer, die tief unter die Erde stiegen und dort Dinge sahen, die dafür sorgten, dass »manche wie toll und vom Donner gerührt herumliefen«, unter anderem ausgelöst durch den psychischen Druck der Landmasse, »die über ihren Köpfen hing«. Dieses Gefühl wurde auch von Edgar Allan Poe sehr treffend beschrieben, dem genialen Dichter der Klaustrophobie. Er schrieb über das Gefühl, lebendig begraben zu sein: »Es ist nicht zu viel gesagt mit der Behauptung, dass kein Ereignis so grauenvoll geeignet ist, Leib und Seele aufs Äußerste zu schrecken, wie das Lebendigbegrabensein. Der unerträgliche, atemraubende Druck – die erstickenden Dünste der feuchten Erde – das hemmende Leichengewand – die harte Enge des schmalen Hauses – das Dunkel vollkommener Nacht – die alles verschlingende Woge ewiger Stille –«. In einem unterirdischen Hohlraum verspüren wir vielleicht nicht unbedingt den vollen Ansturm der Panik, aber zumindest eine Ahnung davon, wenn wir uns vorstellen, dass Decken und Wände immer näher kommen und uns allmählich einschließen.
Letztendlich ist es der Tod, den wir am meisten fürchten: Alle unsere Aversionen gegen die Dunkelheit kulminieren in der Angst vor unserer eigenen Sterblichkeit. Unsere Spezies hat, den Funden in der Qafzeh-Höhle in Israel zufolge, seit mindestens hunderttausend Jahren ihre Toten in der Dunkelheit von Höhlen begraben, und lange davor haben unsere Neandertaler-Vorfahren es ähnlich gemacht. In religiösen Traditionen auf der ganzen Welt gleichen die Beschreibungen des Totenreichs lichtlosen Höhlenräumen: Körperlose Schatten treiben durch konturlose Dunkelheit. Selbst in Kulturen, die in höhlenlosen Landschaften siedeln und nie in Kontakt mit unterirdischen Räumen kommen – wie zum Beispiel die Völker der Kalahari-Wüste oder der sibirischen Steppe –, gibt es Mythen von einem vertikalen Kosmos mit einer unterirdischen Sphäre, in der es vor Geistern wimmelt. Sobald wir die Schwelle einer Höhle übertreten, spüren wir eine reflexartige Vorahnung unseres eigenen Todes, was heißen soll, dass wir mit dem einen Ding in Berührung kommen, auf dessen Vermeidung uns die natürliche Auslese konditioniert hat.
Und trotzdem zögern wir vielleicht an der Schwelle zum Untergrund, aber dann betreten wir ihn doch. An jenem Tag in der Toskana stieg Leonardo da Vinci natürlich hinunter in die Finsternis. (In einer Höhlenwand tief im lichtlosen Bereich entdeckte er die Fossilien eines Wals, was ihn bis zu seinem Lebensende beschäftigen und inspirieren sollte.) Praktisch jeder zugängliche Höhlenraum des Planeten weist Spuren unserer Vorfahren auf. Archäologinnen und Archäologen sind auf dem Bauch durch schlammige Gänge in den Höhlen Frankreichs gerobbt, haben lange unterirdische Flüsse in Belize durchschwommen und viele Meilen im Innern der Kalksteinhöhlen Kentuckys zurückgelegt: Überall haben sie die Spuren unserer Vorfahren gefunden, die durch Felsspalten in die Erde geklettert sind und sich mit Harzfackeln oder Talglichtern den Weg durchs Dunkel gesucht haben. Dort begegneten unsere Ahnen einer fremden Welt, die völlig von dem abgetrennt war, was sie auf der Erdoberfläche kannten: eine Welt, die dunkler war als jede Nacht, in der die Echos hallten und Stalagmiten wie Zähne von Drachen aus der Erde ragten. Ausflüge in die lichtlose Zone sind möglicherweise die älteste kontinuierliche Kulturpraxis der Menschheit. Die archäologischen Hinweise auf Besuche unter der Erde gehen Hunderttausende Jahre zurück, lange bevor der Homo sapiens existierte. Keine andere Tradition, schreibt der Mythologe Evans Lansing Smith, »bringt uns als Menschheit enger zusammen als der Abstieg in die Unterwelt«.
Als ich anfing, meine Faszination für den Untergrund New Yorks genauer unter die Lupe zu nehmen, merkte ich, dass sie Teil eines viel größeren, älteren und universelleren Rätsels war. Entgegen der grundlegendsten Logik der Evolution, trotz aller konkreten unterirdischen Gefahren, trotz eines Chors tief sitzender Ängste, die uns ans Licht zwingen wollen, und obwohl uns der eigene Tod konkret vor Augen steht, gibt es im tiefsten Inneren unserer Psyche einen Drang, der uns in die Finsternis lockt.
Mehrere Jahre lang pendelte ich wie ein Jo-Jo zwischen New York und weit entfernten Ecken der Welt hin und her, immer auf der Suche nach dem nächsten Faden in unserem verworrenen Verhältnis zu unterirdischen Landschaften. Nach den feuchtkalten Tunneln unterhalb moderner Großstädte bewegte ich mich durch ältere, wildere Grotten, Gruben und Kavernen und schließlich durch die ewige Finsternis echter Höhlen. Überall ließ ich mich von anderen heutigen Inkarnationen des Hermes führen, die sich allesamt hervorragend in der Unterwelt auskannten und sich regelmäßig zwischen oben und unten hin- und herbewegten.
»In den Keller hinuntersteigen heißt träumen«, schrieb der Philosoph Gaston Bachelard in Poetik des Raumes, »heißt sich verlieren in den fernen Gängen einer unsichtbaren Etymologie, heißt in den Worten unauffindbare Schätze suchen.« Ich ging unserem Verhältnis zur unterirdischen Welt in Mythologie und Geschichte nach, in Kunst und Anthropologie, Biologie und Neurowissenschaften. Ich fand ein Symbol, das verwirrend war in seiner Vielgestaltigkeit, eine Landschaft, so elementar für die Menschheitsgeschichte wie Wasser, Feuer und Luft. Wir gehen zum Sterben in die Unterwelt, aber auch, um aus dem Schoß der Erde wiedergeboren zu werden; wir fürchten uns vor allem Unterirdischen, aber wenn Gefahr droht, ist es unser erster Zufluchtsort. Unter der Erde verbergen sich unbezahlbare Schätze und giftige Mülldeponien; der Untergrund ist die Sphäre verdrängter Erinnerungen und strahlender Offenbarungen. »Die Metapher vom Untergrund«, schrieb der Forscher David L. Pike in seinem Buch Metropolis on the Styx, »lässt sich auf das gesamte Leben auf Erden ausweiten.«
Sobald man ein Bewusstsein für die Räume unter seinen Füßen entwickelt, spürt man, wie sich die Welt öffnet. Wenn wir uns in Gedanken den Tunneln und Höhlen im Untergrund der Erde zuwenden, entwickeln wir ein besseres Gespür für die vielen unsichtbaren Kräfte, die unsere Realität beeinflussen. Unsere Verbindung zum Untergrund öffnet eine Tür zu den rätselhaften Tiefen der menschlichen Fantasie. Wir steigen hinab, um das Ungesehene, das Unsichtbare zu sehen – wir sind auf der Suche nach der Erleuchtung, die nur im Dunkeln zu finden ist.