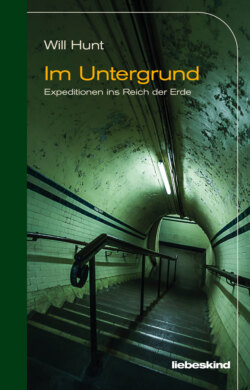Читать книгу Im Untergrund - Will Hunt - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Kapitel DIE UNTERQUERUNG
ОглавлениеIch hielt das Haupt nicht lang in solcher Lage, So glaubt ich hoher Türme viel zu schauen; Drum ich: »Wie heißt die Stadt dort, Meister, sage?«
DANTE, 31. GESANG, Die Hölle
Die ersten Fotos des Pariser Untergrunds stammten von einem Mann mit einer wilden roten Mähne, der sich Nadar nannte. Nadar sei »ein Inbild erstaunlicher Lebenskraft«, schrieb Charles Baudelaire – Mitte des neunzehnten Jahrhunderts zählte Nadar zu den auffälligsten und exzentrischsten Persönlichkeiten in der Kulturmetropole Paris. Er war ein Entertainer, ein Dandy, Freund und Fürsprecher der Bohemiens und Künstler; insbesondere aber war er der wichtigste Fotograf der Stadt. Mit seinem prunkvollen Studio im Zentrum der Stadt war Nadar Pionier und Wegbereiter des Mediums Fotografie. 1861 erfand Nadar eine batteriebetriebene Beleuchtung und setzte als einer der Ersten in der Geschichte der Fotografie Kunstlicht ein. Um die Macht seiner »Wunderlampe«, wie er sie nannte, zu demonstrieren, machte er sich daran, an den dunkelsten und verborgensten Stellen zu fotografieren, die er finden konnte: in den Abwasserkanälen und Katakomben unter der Stadt. Im Verlauf mehrerer Monate machte er Hunderte von Aufnahmen in der unterirdischen Finsternis, jeweils mit einer Belichtungszeit von achtzehn Minuten. Die so entstandenen Bilder waren eine Offenbarung. Die Pariser wussten natürlich, dass sich unter ihren Straßen ein Gewirr von Tunneln, Gräbern und Aquädukten befand, aber als Orte waren sie immer abstrakt geblieben, Gegenstand geflüsterter Gerüchte, wenig mehr. Nadar machte die unterirdische Landschaft zum ersten Mal für jedermann sichtbar, und damit begann die intensive Auseinandersetzung der Stadt Paris mit ihrer Unterwelt: eine Verbindung, die im Laufe der Zeit immer seltsamer wurde, obsessiv und wahrscheinlich enger als in jeder anderen Stadt der Welt.
Anderthalb Jahrhunderte nach Nadar traf ich zusammen mit Steve Duncan und einer Handvoll anderer Urban Explorer in Paris ein; wir wollten das Verhältnis der Stadt zu ihrem Untergrund auf eine Art erforschen, die bis dahin noch niemand versucht hatte. Wir planten eine Unterquerung – eine Wanderung von einem Stadtrand zum anderen, ausschließlich auf unterirdischen Wegen. Steve hatte diesen Katakomben-Trip daheim in New York ausgetüftelt: Monate hatten wir mit der Planung verbracht, hatten alte Stadtpläne studiert, uns mit Pariser Explorern ausgetauscht und potenzielle Routen entworfen. Vom Konzept her war es eine lupenreine Expedition. Wir wollten die Katakomben außerhalb der südlichen Stadtgrenze in der Nähe der Porte d’Orléans betreten; wenn alles nach Plan lief, würden wir jenseits der nördlichen Stadtgrenze nahe der Place de Clichy aus der Kanalisation wieder auftauchen. Luftlinie waren das nicht einmal zehn Kilometer, ein gemütlicher Spaziergang, den man vor dem Mittagessen machen konnte. Aber die unterirdische Route – der »Wurmweg« sozusagen – würde schmutzig und schwierig werden, mit vielen Umwegen, Richtungsänderungen, Haken und Schlenkern. Wir bereiteten uns auf einen zwei- bis dreitägigen Treck vor, bei dem wir die Nächte unter der Erde verbringen würden.
An einem milden Juniabend saßen wir zu sechst am südlichen Pariser Stadtrand in einem nicht mehr benutzten Eisenbahntunnel, der zur petite ceinture gehörte, dem »kleinen Gürtel«, einer seit Langem stillgelegten Ringbahn rund um Paris. Den Tag hatten wir mit letzten Besorgungen verbracht, jetzt war einundzwanzig Uhr vorbei, und die Lichtpunkte an den beiden Enden des Tunnels wurden allmählich schwächer. Alle waren schweigsam, und die Strahlen unserer Stirnlampen tanzten nervös über den Boden. Einer nach dem anderen spähten wir in ein dunkles, von Graffiti umrandetes Loch, das mit einem Presslufthammer aus der Betonwand gebrochen worden war: unser Einstieg in die Katakomben.
»Steckt euren Pass am besten in eine Reißverschlusstasche«, erinnerte uns Steve und ließ die Hosenträger seiner Anglerstiefel schnalzen. »Nur für den Fall.« Unsere Exkursion war natürlich vom ersten bis zum letzten Meter illegal; falls wir erwischt wurden, würde uns unser gezückter Ausweis hoffentlich vor der zentralen U-Haftanstalt der Stadt bewahren.
Moe Gates beugte sich über eine Karte, die uns helfen würde, einen Weg durch das ausgedehnte Labyrinth der Katakomben zu finden. Moe war klein, bärtig, mit einem roten Hawaiihemd bekleidet und Steves langjähriger Urbexing-Partner. Er hatte schon die Moskauer Kanalisation unsicher gemacht, auf den Wasserspeiern an der Spitze des Chrysler Building in New York gehockt und Sex oben auf dem Brückenpfeiler der Williamsburg Bridge in Brooklyn gehabt. Eigentlich wollte er mit dem Tunnelkriechen aufhören, solide werden und »mit einem netten jüdischen Mädchen Kinder kriegen«, aber bisher hatte er es noch nicht geschafft, die Sucht abzuschütteln.
Liz Rush – Steves Freundin, eine Frau mit scharfen Augen und kinnlangen Haaren – checkte die Batterien an einem Gasmelder für geschlossene Räume, der uns auf giftige Gase aufmerksam machen sollte, auf die wir in den ungelüfteten Tunneln stoßen könnten. Liz ging regelmäßig mit Steve unter New York auf Erkundungstouren, aber es war ihr erster Trip durch den Pariser Untergrund. Neben Liz überprüften zwei andere Neulinge ihre Ausrüstung: Jazz Meyer, eine junge Australierin mit roten Dreadlocks, die in den Regenwasserkanälen unter Melbourne und Sydney unterwegs gewesen war, und Chris Moffett, ein New Yorker Philosophiestudent, für den es der erste Vorstoß in den Untergrund werden sollte.
»Fünfzig Prozent Niederschlagswahrscheinlichkeit«, sagte Steve beim letzten Blick auf sein Handy, bevor er es ausstellte. Die größte Gefahr bei unserer Expedition war Regen: Sobald wir die Kanalisation betraten, konnte selbst ein kleiner Schauer an der Oberfläche unterirdisch eine Flutwelle bedeuten. Der Juni in Paris war nass gewesen, und wir hatten seit unserer Ankunft ständig den Wetterbericht verfolgt. Steve hatte einen anderen Explorer, Ian, oben in der Stadt dafür abgestellt, uns Wetter-Updates zu schicken. In der Gruppe legten wir ein Versprechen ab: Beim ersten Zeichen von Regen ging es nach oben, und die Expedition wäre vorbei.
Unser Grüppchen stand eng zusammen ums Einstiegsloch; Moe hatte die Rolle des Protokollanten übernommen, sah auf die Uhr und machte einen Eintrag auf dem Notizblock: »21.46 Uhr, es geht nach unten.« Steve kletterte als Erster Kopf voran hinein, schlängelte sich mit der Hüfte durchs Loch und machte Scherenschläge mit den Beinen; wir anderen folgten, einer nach dem anderen. Ich war der Letzte: Ich blickte noch einmal nach rechts und links durch den menschenleeren Eisenbahntunnel und zwängte mich dann ins Dunkel.
Der Tunnel, in dem wir landeten, war eng und niedrig, die Wände bestanden aus rauen, nassen Steinen. Ich schob den Rucksack nach vorn, krabbelte auf allen vieren durch kaltes Wasser, stieß trotzdem mit dem Rücken an die Steindecke und war sofort bis auf die Haut durchnässt. Das Gestein roch erdig, fast angenehm ländlich, nach regendurchweichter Tafelkreide. Die Strahlen unserer Stirnlampen flackerten wie Stroboskopblitze, nur die Musik fehlte. Der Abschied von der Oberwelt war so abrupt, wir hätten auch am Grund des Ozeans sein können. Das Hupen der Autos auf der Straße, das Rattern der Tram auf der Avenue du Général Leclerc, das Murmeln der unter den Brasseriemarkisen rauchenden Pariser – alles war mit einem Schlag weggewischt.
Steve führte uns Richtung Norden. In einem etwas breiteren Stollen konnten wir in die Hocke gehen und mühsam im Entengang weiterwatscheln, dann kam eine gewölbte Passage, in der wir Erdboden unter den Füßen hatten, bis wir alle aufrecht gehen konnten und etwas schneller vorankamen. Der erste Abschnitt unserer Reise hatte begonnen.
In Paris sagt man, der Untergrund der Stadt mit seinen unendlich vielen Aushöhlungen sei löchrig wie ein Schweizer Käse, und nirgendwo so sehr wie in den Katakomben. Die Katakomben sind ein enormes Labyrinth aus Stein, dreihundert Kilometer Tunnel, zum größten Teil am Rive Gauche der Seine. Manche der Stollen stehen unter Wasser, sind halb eingestürzt und voller Krater; andere sind mit ordentlich gemauerten Backsteinen, eleganten Torbögen oder sogar verzierten Wendeltreppen ausgestaltet. Die Catas, wie sie von den Eingeweihten genannt werden, sind ganz genau genommen keine Katakomben – ein aus dem Lateinischen stammendes Wort für unterirdische Beinhäuser, catacumbae waren Grabgewölbe –, die Pariser Katakomben sind Steinbrüche. Sämtliche imposanten Gebäude entlang der Seine – Notre-Dame, der Louvre, der Palais Royal – sind aus Kalkstein gebaut, der unter der Stadt gewonnen wurde. Die ältesten Gänge wurden bereits in den felsigen Untergrund gehauen, um die römische Stadt Lutetia zu errichten; Überreste davon sind heute noch im Quartier Latin zu finden. Als die Stadt im Lauf der Jahrhunderte immer weiter wuchs, wurde immer mehr Kalkstein an die Oberfläche geschafft, das unterirdische Stollensystem wucherte und breitete sich unter der Stadt aus wie die Wurzeln eines riesigen Baums.
Bevor Nadar mit seiner Kamera kam, herrschte Stille in den unterirdischen Steinbrüchen. Die einzigen regelmäßigen Besucher waren eine Handvoll städtische Angestellte, die mit dem Rechen die Knochen in den Katakomben verteilten; die Inspection générale des carrières, die im Licht von Laternen die steinernen Passagen patrouillierte und die Tunnel abstützte, damit sie nicht unter dem Gewicht der Stadt zusammenbrachen – und vereinzelt mal ein Pilzzüchter, der die trockene, dunkle Umgebung zum Anbau von Pilzen nutzte. Für den Rest der Stadt war der Steinbruch unter ihren Füßen ein großer weißer Fleck: ein sehr weit entfernter Ort mit einer eher imaginären als echten Landschaft.
Als wir den Untergrund so viele Jahre nach Nadar betraten, war es recht belebt dort. Bunte Graffiti zierten die Wände, und auf dem Erdboden waren überall Fußabdrücke. Wenn wir an Pfützen kamen, war das Wasser darin schlammig und aufgewühlt, ein deutliches Zeichen, dass erst vor Kurzem jemand hindurchgegangen war. Überall gab es Spuren der Cataphiles – Pariser und Pariserinnen, die regelmäßig in den Katakomben unterwegs sind. Im Königreich der Urban Explorer bildeten sie ihr eigenes Völkchen, das meist aus Teenies und Studierenden unter dreißig bestand; manche Kataphile sind aber auch über fünfzig oder sogar sechzig, erforschen seit Jahrzehnten das Labyrinth und haben schon wieder katakombenliebende Kinder und Enkel in die Welt gesetzt. Die Stadt beschäftigt eine eigene Polizeitruppe für die Katakomben – die Cataflics –, sie patrouilliert in den Tunneln und verteilt Fünfundsechzig-Euro-Strafzettel an alle Unbefugten. Aber sie kann die Cataphiles trotzdem nicht fernhalten, für die das Labyrinth eine Art riesiger Underground Club und Spielwiese ist.
Wir waren seit zwei Stunden unter der Erde unterwegs, und Steve führte uns durch einen Gang, der so eng und niedrig war, dass wir auf Ellbogen und Bauch vorwärtsrobbten. Als wir auf der anderen Seite wieder herausrutschten, sahen wir drei Stirnlampen in der Dunkelheit glühen. Es waren drei junge Pariser Cataphiles, angeführt von einem großen, langgliedrigen Mann Mitte zwanzig, Benoit hieß er.
»Willkommen am Plage«, sagte er mit weit ausholender Geste.
Wir waren an einem der wichtigsten Treffpunkte der Cataphiles gelandet, einem großen, höhlenartigen Raum mit Sandboden und hohen Decken, die von dicken Sandsteinpfeilern gestützt wurden. Jede Oberfläche, jeder Quadratzentimeter an den Wänden, Pfeilern und der Felsendecke war bemalt. Im Dunkeln sahen die Gemälde gedämpft und schemenhaft aus, aber im Licht einer Taschenlampe fingen sie an zu strahlen. Mittelpunkt war eine Kopie von Hokusais Die große Welle vor Kanagawa mit der sich kräuselnden Gischt in Weiß und Blau. Im ganzen Raum verteilt standen aus Stein gemeißelte Tische, Bänke und Stühle. Die Raummitte wurde von der riesigen Skulptur eines Mannes eingenommen, der mit seinen erhobenen Armen die Decke stützte, wie ein unterirdischer Atlas, die Stadt auf seinen Schultern tragend.
»Das hier ist so was wie …« Benoit zögerte, offensichtlich suchte er nach einer passenden Analogie, »der Times Square der Katakomben.«
Am Wochenende, erklärte er, füllten sich La Plage und andere große Hallen mit Partyvolk. Manchmal zapften sie eine Straßenlampe an der Oberfläche an, sodass eine Band oder ein DJ Musik machen konnte. Oder ein Cataphile band sich einen Gettoblaster auf die Brust, arbeitete sich damit durch die Tunnel und bewegte sich mit der Musik von einem Raum zum nächsten, und die Party folgte ihm, tanzte wie eine unterirdische Polonaise durchs Dunkel, während Whiskeyflaschen von einem zum nächsten wanderten. Aber dort unten fanden auch gesetztere Zusammenkünfte statt: Gut möglich, dass man in einem dunklen Saal auf eine kerzenerleuchtete Festtagsfeier traf, bei der Cataphiles zusammen Champagner tranken und galette des rois aßen.
In Paris gehen die Menschen seit langer Zeit in den Untergrund, um sich künstlerisch zu betätigen, Bilder zu malen und Skulpturen und Installationen in entlegenen Grotten zu schaffen. Nicht weit von La Plage befand sich Le Salon du Chateau, wo ein Cataphile die Nachbildung einer normannischen Burg aus dem Stein gehauen und mit Wasserspeier-Skulpturen verziert hatte. Im Salon des Miroirs waren die Wände mit Spiegelscherben bedeckt, es sah aus wie in einer großen Discokugel. Und dann war da noch La Librairie, ein Alkoven mit handgehauenen Regalen, auf denen man Bücher für andere abstellen konnte (leider verschimmelten die Bücher in der feuchten Luft relativ schnell).
Wenn man die Katakomben durchstreift, hat man das Gefühl, in einem irren Krimi voller Falltüren, falscher Wände und geheimer Rutschen gelandet zu sein, in dem jede Öffnung zu neuen, versteckten Räumen mit neuen Überraschungen führt. Am Ende einer Passage stößt man vielleicht auf ein riesiges Hieronymus-Bosch-Wandgemälde, das im Lauf der Jahrzehnte immer weiter vervollständigt worden ist, an einer anderen Stelle auf die lebensgroße Skulptur eines Mannes, der halb aus der Steinwand herauskommt, als trete er gerade aus dem Jenseits hervor; dann geht man einen anderen Gang entlang und kommt an einen Ort, der jegliches Konzept von Realität infrage stellt. 2004 brach eine Streife in den unterirdischen Steinbrüchen durch eine falsche Wand und landete in einem großen, höhlenartigen Raum. Die Cataflics trauten ihren Augen nicht: Sie standen in einem unterirdischen Kino. Cataphiles hatten Sitzplätze für zwanzig Zuschauer aus dem Stein gehauen, es gab eine Leinwand, einen Projektor und mindestens drei Telefonleitungen. Neben dem Vorführraum befanden sich eine Bar, eine Lounge, eine Werkstatt und ein kleines Esszimmer. Als die Polizei drei Tage später zurückkehrte, um das Ganze näher zu untersuchen, waren alle Installationen verschwunden, und der Raum lag leer da – mit Ausnahme einer Nachricht: »Versucht nicht, uns zu finden.«
Auch wenn die Cataphiles nichts davon ahnten – unsere Unterquerung der Stadt wäre ohne sie undenkbar gewesen. Unsere Karte war ursprünglich von den Stammesältesten angefertigt und mit dem Wissen mehrerer Generationen vervollständigt worden: Es wurde angezeigt, welche Gänge niedrig waren und auf dem Bauch durchquert werden mussten, welche unter Wasser standen und welche unsichtbare Stolperfallen hatten, die vorsichtig umgangen werden mussten. (Damit das Tunnelsystem nicht zu einfach zu finden war, hatten die Älteren die Eingänge allerdings nicht auf der Karte verzeichnet.) Im Lauf der Jahre schmuggelten die Cataphiles Bohrmaschinen und Presslufthammer in den Untergrund, um kleine Durchgänge in den Wänden zu schaffen: sogenannte chatières – Katzenklappen –, die sich auf unserem Treck als lebensnotwendige Übergänge erweisen sollten.
Benoit, der nur ein kleines Täschchen mit einer Wasserflasche und einer zweiten Lampe dabeihatte, warf einen fragenden Blick auf unsere dicken Rucksäcke. »Wie lang wollt ihr unten bleiben?«, fragte er.
»Wir durchqueren die Stadt«, antwortete Steve. »Bis an die nördliche Stadtgrenze.«
Benoit starrte Steve einen Augenblick lang an, dann lachte er, bevor er sich umdrehte und im Dunkeln verschwand; vermutlich hielt er es für einen Witz.
Wir wanden, bogen und reckten unsere Körper, als absolvierten wir ein ausgedehntes unterirdisches Stretching. Wir zwängten uns durch lange Schläuche und fielen auf der anderen Seite mit verknoteten Gliedmaßen wieder heraus wie ein neugeborenes Fohlen. Wir ließen uns hinab in Hohlräume von der Größe eines Ballsaals, in denen unsere Stimmen von der Decke hallten. Von den durch die Luftfeuchtigkeit glitschigen Wänden stieg Dampf auf: ein Gefühl, als würde man durch verschlungene Hirnwindungen kriechen. Mehr als zwanzig Meter blickten wir in Kanalschächten nach oben, doch draußen war es zu dunkel, um den Himmel zu sehen. Braune Wurzeln hingen wie kleine, runzlige Kristalllüster von den Decken. Die Hauptgänge waren mit den typischen Pariser Straßenschildern aus blauem Emaille gekennzeichnet, entsprechend der Straßennamen darüber. Das unterirdische Palimpsest wird immer wieder neu überschrieben; Graffiti aus heutigen Sprühdosen überdeckten die Rußflecken der Steinbrucharbeiter aus dem siebzehnten Jahrhundert, unter denen sich wiederum Fossilien prähistorischer, im Kalkstein eingebetteter Meereslebewesen verbergen. Alle paar Minuten kamen wir an seitlich abzweigenden Galerien vorbei, eine kleine Erinnerung daran, wie labyrinthisch unser Weg noch werden sollte.
Die Neulinge Chris, Liz und Jazz bewegten sich wie in einem Traum. »Ich kann einfach nicht glauben, dass das echt sein soll«, flüsterte Jazz.
Irgendwann leuchtete ich mit meiner Lampe nach oben und entdeckte einen großen schwarzen Spalt in der Decke. Im achtzehnten Jahrhundert waren Stollen eingestürzt: Ganze Häuser, Pferdekutschen und Passanten wurden von der Erde verschluckt, und die Steinbrucharbeiter unter ihnen wurden vom Erdreich verschüttet. Aber heutzutage waren die Tunnel gut gesichert, und wir mussten nicht fürchten, lebendig begraben zu werden – die Katakomben waren der ungefährlichste Abschnitt unserer Reise.
Nadar verfolgte schon lange vor seinen Ausflügen in den Pariser Untergrund das Ziel, die Welt aus ungewohnter Perspektive zu fotografieren. Zuerst tat er das aus der Luft. Zusammen mit seinem Freund Jules Verne gründete Nadar die Société d’encouragement de la navigation aérienne au moyen d’appareils plus lourd que l’air (Gesellschaft zur Förderung der Luftfahrt mit Apparaten, die schwerer sind als Luft) und veranstaltete überall in Europa spektakuläre Heißluftballonfahrten. 1858 bestieg er einen Ballon, flog über Paris und nahm aus der Höhe von achtundsiebzig Metern das erste Luftbild der Welt auf, eine leicht unscharfe, silbrig graue Aufnahme der Stadt. »Wir erlebten die Welt aus der Vogelperspektive, wie sie bisher vom inneren Auge nur unvollkommen wahrgenommen worden war«, schrieb er über seine Aufnahmen aus dem Heißluftballon. »Jetzt besitzen wir nichts weniger als das Abbild der Natur selbst, festgehalten auf der Nassplatte.«
Für sein nächstes Kunststück wollte Nadar die Stadt von unten fotografieren. Es begann mit der Bogenlampe, die er in seinem Atelier zusammengebaut hatte. Es war eine lichtstarke, aber unhandliche Konstruktion: Mithilfe von fünfzig Bunsenelementen entzündete ein elektrischer Funken zwei Kohlenstoffstäbe, die ein weißes Licht aufflammen ließen. Durch diese Lampe wurde es zum ersten Mal möglich, Bilder ohne Sonnenlicht aufzunehmen, ein im jungen Medium der Fotografie noch unerprobtes Konzept. Abends entzündete Nadar die Lampe auf dem Trottoir vor seinem Atelier und zog mit dem Lichtschein die Menschenmassen an. Nadar erklärte, er werde seine Lichtapparatur dazu benutzen, um Bilder mit seiner Kamera einzufangen, die sich allen anderen Fotografen bisher entzogen hatten. »Die unterirdische Welt«, schrieb er, »bot uns ein unendliches Betätigungsfeld, das nicht weniger faszinierend war als das an der Oberfläche. Wir stiegen hinab, um die Geheimnisse der tiefsten, geheimsten Kavernen zu lüften.« In den Beinhäusern – genannt Les Catacombes, in Anlehnung an die berühmten Katakomben in Rom – machte Nadar seine ersten unterirdischen Aufnahmen.
Als wir ungefähr sieben Stunden gegangen waren, führte Steve uns durch eine lange Passage in eine Kammer mit gemauerten Wänden. Wir nahmen unsere Rucksäcke ab und setzten uns auf den Boden. Die Stimmung war bestens, trotz nasser Füße und sensationell verschlammter Klamotten. Es dauerte ein paar Augenblicke, bis wir die trockenen, kupferfarbenen Gegenstände identifizierten, die rund um uns auf dem Boden lagen.
Jazz nahm einen in die Hand und musterte ihn. »Das ist ein Rippenknochen.« Sie schüttelte sich, dass die Dreadlocks flogen, und ließ den Knochen fallen.
Als wir nach unten guckten, wurde uns klar, dass wir auf menschlichen Überresten herumgelaufen waren – einem Schienbein, einem Oberschenkelknochen, einer Schädeldecke, alle trocken, glatt und pergamentfarben. Wir spähten um die Ecke und sahen, dass wir am Fuß eines riesigen Turms standen: Tausende von Menschenknochen, die von oben auf eine Rutsche gekippt worden waren und sich in einer chaotischen Kaskade nach unten ergossen hatten. Wir befanden uns inmitten eines Ossuariums unterhalb des Cimetière du Montparnasse.
Ende des achtzehnten Jahrhunderts quoll Paris über vor Leichnamen. Die Mauern des Cimetière des Saints-Innocents, des größten Friedhofs der Stadt, gaben nach, und die Leichen ergossen sich in die Keller der benachbarten Häuser. Um den Ausbruch von Seuchen zu verhindern, beschloss die Stadt, ihre Toten in die unterirdischen Steinbrüche auszulagern, die im Lauf der Jahrhunderte immer größer geworden waren. Als letzte Ruhestätte wurde ein zwölftausend Quadratmeter großes Areal mit leeren Stollen im Süden der Stadt ausgewählt, passenderweise unter einer Straße namens Tombe-Issoire. Nachdem die unterirdischen Galerien von einem Priester-Trio offiziell geweiht worden waren, wurden die Skelette auf schwarz verhängten Holzkarren durch die Stadt transportiert und dann in Schächte gekippt, die man in den Straßen geöffnet hatte. Insgesamt wurden die sterblichen Überreste von sechs Millionen Menschen in die unterirdischen Steinbrüche umgebettet. Arbeiter wurden mit der kaum zu bewältigenden Aufgabe in die Katakomben geschickt, die Knochen zu ordnen und zu ansehnlichen Arrangements aufzuschichten.
Im Dezember 1861 stieg Nadar mit einem Tross von Gehilfen und zwei mit fotografischer Ausrüstung beladenen Loren hinab in die knochengefüllten Korridore. Die unterirdischen Galerien waren 1810 kurzzeitig für Besucher geöffnet, aber wegen Vandalismus schnell wieder geschlossen worden. Als Nadar eintraf, waren sie seit Jahrzehnten für niemanden mehr zugänglich gewesen. In den »Maulwurfshügeln«, wie Nadar sie nannte, traf er auf eine Belegschaft von Arbeitern, die immer noch unter der Erde mit der Ordnung der Skelette beschäftigt waren.
Damals war es selbst unter den kontrollierten Bedingungen eines Fotoateliers schwierig, eine fotografische Aufnahme zu machen; unter der Erde in den stockdunklen Stollen war es praktisch unmöglich. Der Prozess war unendlich zeitaufwendig. Die Kollodium-Emulsion wurde im Dunkeln verschüttet, die Bogenlampe blieb in den engen Durchgängen stecken, die Batterien produzierten giftige Dämpfe, was in dem beengten Raum eine echte Gefahr darstellte. Jede Aufnahme musste achtzehn Minuten lang belichtet werden, sodass im Laufe eines ganzen Arbeitstags nur ein paar wenige Fotos entstanden; ein Assistent murrte: »Wir werden noch alt hier unten.« Aber Nadar war nicht zu bremsen. Als Fotomodell staffierte er eine Holzpuppe mit einem Bart, Hut, Stiefeln, Arbeitsoverall und Mistgabel zum Verteilen der Knochen aus.
Nadar produzierte dreiundsiebzig Fotos in den Katakomben, eine stille, surreale Bilderserie. Auf einem Bild war ein frisch aufgeschütteter, ungeordneter Haufen Knochen zu sehen, auf anderen liebevoll aufgeschichtete Knochenfriese, auf wieder anderen die Holzpuppen, die knochengefüllte Loren durch die Gänge schoben. Die Bilder waren, sobald sie in der Société française de photographie gezeigt wurden, umgehend eine Sensation. Nadar wurde zu einer mythischen Figur stilisiert, die den Kosmos der Stadt durchwanderte. Ein Artikel im Journal des débats bezeichnete ihn als »Beelzebub«, den Herrn der Unterwelt; ein anderer bezichtigte ihn, ein Totenbeschwörer zu sein, der »die sterblichen Überreste vergangener Generationen elektrisiert« habe. Eine ganze, bis dahin geheime Dimension der Stadt war mit einem Mal offenbar geworden: »Er und seine Gehilfen«, schrieb ein Journalist, »wühlen in den Eingeweiden der unschuldigen Erde und machen die Menschen mit Szenen vertraut, die nur wenige bis dahin mitangesehen haben.« Nadar wurde zur Sensation von Salons und Cafés, die unterirdischen Bilder waren in aller Munde.
Aber es wurde nicht nur geredet. Die Fotos weckten ein Verlangen in den Parisern: Kaum hatten sie einen ersten Eindruck von der Unterseite der Stadt bekommen, wollten sie die Stollen auch berühren, ihren Geruch wahrnehmen, wollten die eigenen Schritte durchs Dunkel hallen hören. Ungefähr zur selben Zeit, in der die Fotografien zum ersten Mal zu sehen waren, wurden auch die Katakomben geöffnet und entwickelten sich sehr schnell zu einer der größten Attraktionen der Stadt. Anfangs ein paar Mal im Monat, dann regelmäßiger bewegten sich Herren in Zylindern und Damen in langen Kleidern in dicht gedrängten Grüppchen durch die Beinhäuser, spähten in die leeren Augenhöhlen braun gewordener Schädel und betrachteten Wände aufgeschichteter Schienbeine im Kerzenlicht. Sie schauderten angesichts der hallenden Akustik und des beklemmenden Gefühls, tief unter der feuchten Erde zu sein; am Ende des Rundgangs ließen viele Besucher heimlich einen Schädel als Souvenir mitgehen. Die Katakomben waren bald so beliebt, dass Gustave Flaubert sich über die Menschenmassen in ihnen empörte, als er sie 1862 mit den Schriftstellern Jules und Edmond de Goncourt besuchte. »Man muss sich mit den vielen Pariser Witzbolden herumschlagen, die sich im Untergrund auf veritable Vergnügungsfahrten begeben«, schrieben die für ihren scharfen Witz berühmten Goncourt-Brüder, »und sich einen Spaß daraus machen, dem Nichts Verwünschungen ins Maul zu schleudern.«
Gleichzeitig gab es auch den ersten großen Andrang illegaler Besucher – Proto-Kataphile, die sich in den Stollen abseits des offiziellen Rundgangs umsahen. Liebespaare verabredeten sich zum unterirdischen Rendezvous, Jugendliche begaben sich auf abenteuerliche Entdeckungsreisen. Ähnlich wie viele, viele Jahre später wurden auch damals schon geheime Konzerte in den Katakomben organisiert. Einhundert geladene Gäste versammelten sich auf der Rue d’Enfer (Straße der Hölle). Ihre Kutschen hatten sie in einiger Entfernung abgestellt, um keinen Verdacht zu erregen, dann schlüpften sie in den Untergrund. Zwanzig Meter unterhalb der Stadt saß das Publikum, umgeben von auf menschlichen Schädeln brennenden Kerzen, vor einem Orchester mit fünfundvierzig Musikern. Auf dem Programm standen Chopins Trauermarsch und Saint-Saëns mit seinem Danse Macabre.
Noch eine Stunde weiter in nördlicher Richtung, dann schlugen wir unser Lager in einer viereckigen Kammer auf, die erst im neunzehnten Jahrhundert aus dem Stein gehauen worden war. Wir hängten unsere Hängematten an Eisenringe in der Wand, und Liz und ich kochten Spaghetti mit Thunfisch. Glücklich und erschöpft verzehrten wir schweigend unser Essen. Es war wie Zelten auf dem Mond: Hier unten gab es keine Geräusche, nichts Lebendiges, nur kilometerweit Dunkelheit.
Als wir uns schlafen legten, fragte Chris, welche Uhrzeit es sei. Moe meinte, wir befänden uns an einem Ort, an dem es von Anbeginn aller Zeiten bei vierzehn Grad Celsius vollkommen dunkel gewesen sei, der sich also jenseits aller natürlicher Rhythmen befand. »Es ist nie Uhr«, sagte er.
Ich wachte auf und sah eine Frau im Durchgang zu unserer Schlafkammer stehen. In einer Hand hielt sie eine antike, schmiedeeiserne Laterne mit einer zischenden Flamme darin, die ein honiggelbes Licht verströmte. Ich beobachtete, wie sie sich auf Zehenspitzen in die Mitte des Raums bewegte und etwas auf den Boden legte, das wie eine kleine Postkarte aussah.
»Bonjour«, sagte ich. Sie fuhr zusammen.
Misty war über vierzig und besuchte die unterirdischen Steinbrüche seit gut fünfundzwanzig Jahren. In dieser Nacht wanderte sie allein durch die Gänge – ohne Karte, wie mir auffiel.
»Manchmal ist es schön, zum Spazierengehen nach hier unten zu kommen«, sagte sie mit französisch singendem Tonfall. Wie sie es schaffte, dass ihre Stiefel fleckenlos und ihre graue Bluse wie frisch aus der Reinigung aussahen, war mir unklar. Misty bewegte sich in den Steinbrüchen von einem Hohlraum zum nächsten und hinterließ überall kleine Zeichnungen, gemalte Grüße an andere Cataphiles. Für uns hatte sie ein Bild von zwei Händen, die ein Dreieck bilden, hingelegt.
Es war ein Uhr morgens, als wir den Ausgang aus den Katakomben fanden: eine chatière, die so eng war, dass ich mit den Schultern nur ganz knapp hindurchpasste. Wir befanden uns in einer selten besuchten Ecke der Bergwerksstollen, in der die Decken mit jahrhundertealten, von der Inspection générale des carrières eingebauten Holzpfosten abgestützt wurden.
Wir waren jetzt seit siebenundzwanzig Stunden unter der Erde. Ich hatte getrockneten Schlamm in den Ohren und rund um die Nasenlöcher.
»Ich komme mir schon wie ein Höhlenmensch vor«, sagte Liz und machte ein paar Dehnübungen im Tunnel.
»Ich finde ständig irgendwelches Zeug in meinen Haaren«, sagte Jazz und untersuchte eine Dreadlock. »Ich glaube, das war gerade Knochenmark.«
Moe zog die Socken aus, holte ein kleines Jodfläschchen hervor und pinselte seine Zehennägel mit der orangefarbenen Flüssigkeit ein. Steve sah verwundert zu.
»Du glaubst doch nicht etwa, dass ich meinen Niednagel nicht desinfiziere, bevor ich im Abwasser herumlaufe?«
Um in die Abwasserkanäle zu gelangen, mussten wir erst einen Weg durch Technikgänge finden, die uns unter die Seine führen würden. Wenn die Katakomben das Stammhirn der Stadt waren, dann war der Gang aus Beton, in dem wir jetzt herauskamen, ein Blutgefäß, eine bescheidene Verbindungsader zwischen wichtigeren Organen. Als wir weitergingen, merkten wir, wie nah wir der Erdoberfläche auf einmal waren: Von der Straße drangen gedämpft Gesprächsfetzen herunter, das Klacken hoher Absätze, das Bellen eines Hundes. Durch einen Entlüftungsschacht in der Wand sah ich einen orangefarbenen Schein – Licht aus einer Tiefgarage. Ich ging in die Hocke und beobachtete eine dunkelhaarige Frau, die in ihr Auto stieg, rückwärts aus der Parklücke ausscherte und wegfuhr, und ich kam mir vor, als sei ich ein Gespenst, das hinausspäht in die Stadt der Lebenden.
Wir schafften es nicht, einen Zugang zum Versorgungstunnel unter der Seine zu finden, und mussten deshalb nach oben, wenn auch nur für einen Augenblick. Am Fuß eines Schachts mit einer an die Oberfläche führenden Leiter diskutierten wir die Choreografie unseres Ausstiegs in besorgtem Flüsterton.
»Ich glaube, ich habe mehr Angst davor, erwischt zu werden, als hier unten ums Leben zu kommen«, flüsterte Moe.
»Alles gut«, sagte Steve. »Wenn sie uns ins Gefängnis schmeißen, graben wir einfach einen Tunnel.«
Chris’ Augen war leichte Besorgnis anzusehen.
Wir kamen in der Nähe von Saint-Sulpice heraus, vor einem Laden mit luxuriöser Babykleidung. Weit und breit war keine Polizei zu sehen, und wir huschten durch leere Gassen in Richtung Seine. Am Ende einer menschenleeren Straße ging Steve in die Hocke und öffnete eine Klappe, und wir verschwanden alle schnell wieder unter der Erde. Als ich mich noch einmal umschaute, bemerkte ich den Blick eines Hilfskellners, der mich verständnislos anstarrte, während er die letzten Salz- und Pfefferstreuer abräumte.
Der Tunnel unter der Seine war feucht und hatte eine schreckliche Akustik, wie in einem U-Boot. Selbst hier fanden wir Spuren von Eindringlingen: ein paar Tags, eine leere Literflasche Kronenbourg-Bier. Als wir unter dem Fluss hindurchgingen, stellte ich mir einen Querschnitt der Stadt vor, auf dem alle Ebenen übereinander zu sehen waren. Über uns ragte die mächtige Silhouette von Notre-Dame auf, dann kamen die Brücken und der Fluss. Tief unter uns verliefen die Röhren der Metro, in denen es bald schon wieder von Menschen auf dem Weg zur Arbeit wimmeln würde. Wir, sechs winzige, durchs Dunkel wandernde Lichtkegel, befanden uns in der mittleren Ebene dazwischen.
Vor Nadar waren die dunklen, verschlungenen Abwasserkanäle eine Quelle unendlichen Grauens für die Pariser Bevölkerung gewesen. In Victor Hugos Die Elenden, dem Roman, der in den zwanzig Jahren vor der Veröffentlichung von Nadars Bildern entstand, versinnbildlicht die Kanalisation den Albtraum des Städters schlechthin. Victor Hugo schrieb: »Der Darm des Leviathan« ist »verschlungen, zerklüftet, das Pflaster aufgerissen, ausgehöhlt, von Schlammlöchern unterbrochen, hin und her geworfen von bizarren Krümmungen, auf- und absteigend ohne Logik, stinkend, wild, grausam, in Dunkelheit getaucht, mit Narben auf den Quadersteinen und Hiebwunden an den Mauern, entsetzlich.«
In den 1850er-Jahren wurde die Kanalisation unter der Leitung von Georges-Eugène Haussmann, dem berühmten Stadtplaner von Napoleon III., vollständig saniert. Er ließ die Straßen aufreißen und fünfhundertsechzig Kilometer neue Abwasserrohre verlegen. Die Rohrstücke wurden mit einem Gefälle von drei Zentimetern pro Meter verlegt – eine allmähliche Steigung, die zu Fuß gut zu bewältigen, aber steil genug war, dass die Abwässer ständig im Fluss blieben. In ausgiebigen Testreihen wurde festgestellt, dass ein Tierkadaver im Laufe von achtzehn Tagen durch die Stadt gespült wurde, Konfetti schafften dieselbe Strecke in sechs Stunden. Doch das Grauen der Öffentlichkeit ließ sich auch durch diese Modernisierungsmaßnahmen nicht vertreiben. Außer den Kanalisationsarbeitern – den égoutiers –, die jeden Tag den Dreck aus den Röhren putzten, betrat niemand die Abwasserkanäle freiwillig.
Wir waren gerade einmal neunzig Sekunden in der Kanalisation, da kam schon vorn der Warnruf von Steve: »Ratte!«
Grau und so groß wie ein Kaninchen huschte das Tier durch den Abwasserbach zu unseren Füßen. Wir sprangen aus dem Wasser seitlich hoch, während die Ratte mit hin- und herzuckendem Schwanz zwischen uns hindurchlief und ein v-förmiges Kielwasser hinter sich herzog.
Unsere Route in nördlicher Richtung würde uns durch den Abwasserkanal unterhalb des Boulevard de Sébastopol führen, einen großen, runden, aus Ziegeln gemauerten Kanal, durch den auch zwei dicke Wasserrohre liefen – eins für Trinkwasser, das andere für nicht trinkbares Frischwasser. Alle kleineren Zuleitungen entwässerten in diesen Kanal. In der Mitte war eine ein Meter dreißig breite Vertiefung, cunette genannt – dort floss im dampfenden Wasser alles, was irgendwie an der Oberfläche nicht mehr gewünscht war. Innerhalb einer Minute sichteten wir eine Spritze, einen toten Vogel, ein durchweichtes Metro-Ticket, eine zerstückelte Kreditkarte, ein Weinetikett, ein Kondom, einen Kaffeefilter, jede Menge Klopapier sowie schwimmende Kackhaufen. »Kanalisationsfrisch«, sagte Moe – Urbexer-Slang für »menschliche Exkremente«.
Wir bereiteten uns gerade aufs Weitergehen vor – Liz spritzte allen Desinfektionsmittel auf die Hände, Moe schaltete das Gaswarngerät ein –, da meldete sich Steve.
Er hatte eine SMS von Ian bekommen, unserem Wetterfrosch.
REGEN ANGEKÜNDIGT, EVTL GEWITTER. KÖNNTE NASS WERDEN
Steve machte die Runde und sah jedem von uns ins Gesicht, aber keiner zögerte. Wir waren seit einunddreißig Stunden unterwegs: Wir waren zu weit gekommen, um jetzt noch aufzugeben.
»Wir müssen einfach die Augen offen halten«, sagte Steve. Solange wir den Wasserspiegel in der cunette und das Wasser aus den Zuleitungen im Blick hätten, würde uns nichts passieren, sagte er.
Steve hatte wahrscheinlich mehr Ahnung von Kanalisationsschächten als sonst jemand auf der Welt, was allerdings nicht immer beruhigend, sondern auch nervenzerfetzend war, weil er uns haarklein schildern konnte, was im Fall eines Regenschauers mit uns passieren würde. Mit dem Finger ritzte er eine kleine Grafik an die schleimige Wand der Kanalisation, damit wir uns den exponentiellen Anstieg des Wassers vorstellen konnten. »Ich war schon in der Kanalisation von New York, London und Moskau«, sagte er. »Aber nirgendwo ist die Strömung so kräftig wie in Paris. Erst geht einem die Suppe bis über die Knöchel, dann an die Knie, und bevor man merkt, was los ist, steht’s einem schon bis zur Taille. In dem Augenblick, in dem wir sehen, dass der Wasserspiegel steigt, rasen wir sofort los zur nächsten Leiter.«
Keiner sprach, während wir durch den Abwasserkanal gingen. Ich setzte sehr vorsichtig einen Fuß vor den anderen: Der Steg war glitschig, und meine Schuhe hatten wenig Profil. Die Luft war dick wie im Urwald, überall um uns gurgelte, rülpste und gluckerte es – so klang Paris, wenn es verdaute. Der Gestank war bei Weitem nicht so schlimm, wie man sich das vorstellen würde – es roch wie ein Kühlschrank, der mal geputzt werden müsste –, nistete sich aber trotzdem in jeder Faser ein. An den dunklen Kreuzungspunkten herrschte ein labyrinthisches Gewirr schleimiger Röhren und Ventile, wie es Piranesi nicht besser hätte darstellen können. Als ich unter einem Rohrgewirr sicher fünf Meter über mir hindurchging, sah ich dort oben zerfetztes Klopapier baumeln – Beweis, dass in jüngster Zeit eine Flutwelle durch genau diesen Kanal gerauscht war.
Irgendwann donnerte ein Wasserfall aus einer Zuleitung und hallte schockierend laut durch den Kanal. Wir erstarrten mit aufgerissenen Augen und machten uns bereit, zur nächsten Leiter zu rennen.
»Nichts Bedenkliches«, sagte Steve. Nur ein Frühaufsteher, der in einer der Wohnungen über uns die Toilettenspülung betätigt hatte. »Die Geräusche werden hier unten ziemlich verstärkt«, meinte er. »Da klingt das kleinste Tröpfeln wie die Niagarafälle.«
Kurz nach seinen Besuchen in den Katakomben begann Nadar mit der Erforschung der Kanalisation. Mehrere Wochen lang war er im Verdauungstrakt der Stadt unterwegs, wobei seine Assistenten ihm die Ausrüstung über die Stege schleppen mussten. Im Vergleich zu den Katakomben stellten die Abwasserkanäle eine weit größere Herausforderung dar. Hier war er allen von der Erdoberfläche stammenden Widrigkeiten ausgesetzt, jedem Regenschauer und jeder Toilettenspülung, was es wesentlich schwieriger machte, die ungestörten achtzehn Minuten zu finden, die für die Aufnahme notwendig waren. Jedes Mal, wenn Nadar auf den Auslöser drückte, betete die gesamte Mannschaft, dass nichts dazwischenkommen würde. »In dem Augenblick, in dem alle Vorbereitungen getroffen und alle Hindernisse beiseitegeräumt worden waren«, schrieb Nadar später, »dem Augenblick, in dem die entscheidenden Handgriffe stattfinden sollten, legte sich urplötzlich, in den letzten Sekunden der Belichtung, ein aus dem Abwasser aufsteigender Nebelschleier auf die Platte – welche Verwünschungen wurden da laut gegen la belle dame oder le bon monsieur über uns, die unwissentlich gerade diesen Moment gewählt hatten, um ihr Badewasser abzulassen.«
Nadars Fotos aus der Kanalisation verliehen den düsteren Röhren einen eher romantischen Schimmer. Auf einigen war wieder die bärtige Holzpuppe zu sehen, jetzt im Overall des égoutier (Kanalarbeiters) in verschiedenen Arbeitshaltungen. Andere Bilder konzentrierten sich auf abstrakte geometrische Muster: ein Rohr, das sich in zwei Kanäle teilt, in geisterhafter Bewegungsunschärfe fließendes Abwasser. Wegen des vielen Dampfs in den Kanälen ist auf allen Bildern ein leichter Dunst zu sehen, als seien sie durch einen Schleier aufgenommen worden.
Journalisten und Kritiker waren auch diesmal wieder außer sich vor Begeisterung. In einer Zeitung wurde Nadar als Pionier porträtiert, der den Tücken und Gefahren des lang verschmähten Untergrunds die Stirn bot und diese Fotografien »halb erstickt von den giftigen Dämpfen der elektrischen Batterie in den bedrückenden Gewölben« aufnahm. Der Philosoph Walter Benjamin schrieb: »Damit werden dem Objektiv zum ersten Mal Entdeckungen zugemutet.«
Mit einem Mal rissen Menschen in ganz Paris die Gullydeckel auf. Spät in der Nacht kletterten sie die Abflussschächte hinab, zündeten eine Kerze an und gingen flanieren. 1865 beschrieb La Vie Parisienne einen mitternächtlichen Spaziergang in der Kanalisation als neue promenade. »Reizende Begegnungen sind dort möglich. Mir begegnete die hübsche Comtesse de T______, praktisch allein, und ich sah auch die Marquise D____ und plauderte mit Mlle N______, bekannt aus dem Varieté-Theater.«
Der Tag würde kommen, so die Vorhersage des Journalisten, an dem die Kanalisation eine größere Anziehungskraft ausüben würde als die grünen Parkflächen der Stadt. »Wenn es erst möglich ist, die Kanalisation auf Pferderücken zu besuchen«, schrieb er, »wird der Bois de Boulogne mit Sicherheit verlassen daliegen.«
Während der Weltausstellung 1867 öffnete die Stadt die Kanalisation für offizielle Touren, und Besucher aus ganz Europa drängten heran. Würdenträger und Royals, Diplomaten und Abgesandte stiegen eine eiserne Wendeltreppe nahe der Place de la Concorde hinab und setzten sich in einen Kahn, der ansonsten von Arbeitern zur Reinigung der Röhren benutzt wurde. »Eine Barke mit gepolsterten Sitzen, an den Ecken von Öllampen erleuchtet«, erinnerte sich ein Besucher. Damen mit eleganten Kopfbedeckungen und hochhackigen Schuhen, Spitzenschirme in der Hand, glitten durch die Ausscheidungen der Stadt. Die Kanalarbeiter spielten Gondoliere und manövrierten das Boot durch den Abwasserkanal. In einem Reiseführer der damaligen Zeit war zu lesen: »Wie allgemein bekannt, will kein Besucher, der etwas auf sich hält, aus der Stadt abreisen, ohne diese Unternehmung gemacht zu haben.«
In der Zwischenzeit genoss Nadar seine Rolle als Hermes von Paris, als Pariser Psychopomp und Vermittler zwischen allem Ober- und Unterirdischen. In den Jahren nach der Veröffentlichung seiner Fotografien veranstaltete er private Führungen durch die Kanalisation und die Katakomben und ging kichernden Grüppchen voran ins Dunkel. In einem begleitenden Essay zu seinen Bildern schrieb er: »Madame, gestatten Sie mir, Ihr Führer zu sein. Ich bitte Sie, meinen Arm zu nehmen – suivons le monde.«
Vor dem letzten großen Stück unseres Trecks kampierten wir am Ufer des unterirdischen Canal Saint-Martin: Es war ein breiter, gewölbter Tunnel, in dem grünes Wasser friedlich plätscherte; von sehr weit weg drang schwach das Morgenlicht ein. Es war gegen acht Uhr morgens – oben würden die Brasserien bald aufmachen und die Kellner das Besteck auf den Tischen verteilen. Wir hängten unsere Hängematten am Geländer entlang des Kanals auf, ein bisschen wie Bergsteiger, die im nackten Fels biwakieren. Steve meldete sich freiwillig, um aufzubleiben und Wache zu halten.
Ich lag in der Hängematte und dachte an Nadars Fotos. Die Sage von Phaeton fiel mir ein, in der er als junger Mann seinen Vater, den Sonnengott Helios, darum bittet, einmal mit dem Sonnenwagen über den Himmel fahren zu dürfen. Das Vierergespann rast los, und der Jüngling verliert schon bald die Kontrolle über die Pferde: Das Gefährt stürzt der Erde entgegen, die Hitze lässt die Flüsse austrocknen und Wüsten entstehen, auf Bergkuppen bricht Feuer aus, und schließlich fliegt Phaeton so niedrig, dass der Sonnenwagen ein Loch in die Erdoberfläche brennt. Licht strömt in die Unterwelt. Die Menschen drängen an den Rand des Lochs, wo sie zum ersten Mal direkt bis ins Reich des Hades blicken können, vom alles verbrennenden Flammenmeer und dem düsteren Asphodeliengrund bis zum tiefsten Schwarz des Tartaros. Sie sehen sogar König Hades und Königin Persephone auf dem Thron sitzen und zu ihnen hochblinzeln. Die Menschen sind zu Tode erschreckt über diese infernalische Landschaft, die sie immer gefürchtet haben; und trotzdem weichen sie nicht vom Rand des Lochs zurück. Sie spähen weiter hinab in die Düsternis und können den Blick nicht abwenden.
Wir hatten vielleicht zweieinhalb Stunden geschlafen, als Steve ein Ausflugsboot bemerkte, das den Kanal heruntergeglitten kam. Steve schüttelte uns schnell wach, bevor der Kapitän uns entdecken und die Polizei rufen konnte, und wir verkrümelten uns wieder in der Dunkelheit.
Der letzte Abschnitt unserer Reise war der Abwasserkanal unter der Avenue Jean-Jaurès – ein langer, viereckiger, gesichtsloser Korridor, durch dessen Mitte ein Fäkalienstrom von der Breite einer einspurigen Straße floss. Steve zufolge gingen wir am Hauptkanal entlang: Das Abwasser von praktisch ganz Paris floss zu unseren Füßen.
Wir waren jetzt seit achtunddreißig Stunden unterwegs und spürten die Nähe zu unserem Ziel. Eigentlich hätten wir triumphierend, erleichtert oder stolz sein müssen, aber wir schlurften nur noch mit rot geränderten Augen dahin, abgespannt und ein wenig benommen, vielleicht von dem unterirdischen Miasma, das wir auf den vielen Kilometern eingeatmet hatten.
»Und, weiter nach Nordfrankreich, was meint ihr?«, sagte Steve.
Ich merkte, wie mir auf dem glitschigen Steg die Augen zufielen: Ich hielt mich so nah wie möglich an der Wand und konzentrierte mich darauf, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Alle paar Hundert Meter kamen wir an einem kleinen Zuleitungsrohr mit einem Schild vorbei, auf dem der Name der darüberliegenden Straße stand. Moe ging mit der Karte voran, rief laut die Straßennamen und machte einen Countdown für die letzten Meter bis zu unserem Ziel.
»Fünfhundert Meter!«
Mit jedem Schritt nahm die Strömung des Kanals zu, das Abwasser schwappte über den Rand des Stegs, schließlich schlug es über unseren Schuhen zusammen – der Untergrund spuckte uns aus.
Wir kamen direkt jenseits der Stadtgrenze unter einer hellen Mittagssonne an die Oberfläche. Alle sechs stiegen wir die Leiter hoch und durch ein Gullyloch vor einem türkischen Restaurant. Unsere Gesichter waren verschmiert, unsere Haare mit Schlamm und Schleim verklebt, unsere Kleider nass und stinkend. Als wir die Köpfe herausstreckten, sprangen die Fußgänger auf dem Bürgersteig zurück, ein Kellner ließ das Besteck fallen. Eine ältere Frau im rosa Pullover lehnte sich auf ihrem Rollator vor und starrte zu uns herunter, Augen und Mund weit aufgerissen. Einen kurzen Augenblick – bevor Steve den Gullydeckel wieder zuschob und wir in den nächsten Park stolperten, eine Flasche Sekt köpften und feierten – beugten sich alle auf der Straße vor und wollten einen Blick in das offene Loch nach unten werfen.