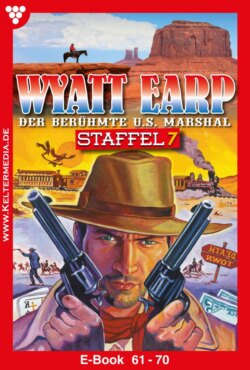Читать книгу Wyatt Earp Staffel 7 – Western - William Mark D. - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDer leichte vierrädrige Wagen rollte über den Overlandway nach Süden. Rechts und links von dem stark überwachsenen Weg, der eigentlich nur durch die Zwillingsspur der Räder zu sehen war, breitete sich das endlos scheinende Hügelland der Apache-Prärie.
Zwei Männer saßen auf dem Kutschbock des Wagens.
Der Ältere hielt die Zügel der beiden Braunen. Es war ein untersetzter Mann in den Vierzigern, wuchtig, breit und mit einem braunen Ledergesicht, das von zwei wachen grauen Augen beherrscht wurde. Er trug einen hellbraunen Melbahut, einen braunen Anzug und ein weißes Hemd, das von einer schwarzen Samtschleife am Hals zusammengehalten wurde.
John Saunders war der Besitzer der großen S-Ranch. Fünfundvierzig Jahre hatte der Ire gebraucht, um die gewaltige Viehfarm oben in der Nord-ostecke Arizonas aufzubauen. Er hatte das Schicksal all jener Menschen teilen müssen, die Mitte der fünfziger Jahre nach Arizona gekommen waren, um sich dort eine Existenz zu schaffen: Indianerüberfälle, Bürgerkrieg, und dann waren die weißen Banden gekommen, die sich aus ehemaligen Soldaten zusammensetzten, als Menschen, die den Weg zurück ins zivile Leben nicht finden konnten. Aber auch jetzt noch gab es gefährliche Banden im Land. Immer noch gab es Ärger und Sorgen genug, die dem Rancher das Leben ziemlich schwer machten.
Der junge Mann neben ihm war sein Sohn Jonny, zweiundzwanzig Jahre alt, groß, kräftig, mit wasserhellen Augen und frischem Gesicht. Der Bursche trug ebenfalls seinen guten Anzug, hatte aber im Gegensatz zu seinem Vater einen Waffengurt umgeschnallt.
Der Rancher hatte eine Winchester zwischen den Knien; mit dem Revolver konnte er nicht umgehen. Als er damals in die Staaten kam, hatte man ihm gesagt, daß ein Mann hier ohne den Colt nicht lange leben könne. Saunders lebte noch – er hatte schnell gelernt, mit dem Gewehr umzugehen.
Die Fahrt währte schon mehrere Stunden. Da unterbrach der Junge das Schweigen.
»Man kann sich gar nicht vorstellen, daß man hier mal ohne Waffe fahren oder reiten kann.«
Der Rancher nickte. »Yeah – das ist ziemlich schwer. Aber eines Tages wird es doch soweit sein, Jonny.«
»Glaubst du das wirklich? Um mit Leuten wie den Clantons und den McLowerys fertigzuwerden, braucht man Männer, die ihr eigenes Leben nicht schonen.«
Damit endete das kurze Gespräch auf dem Kutschbock.
Dann tauchten in der Ferne die Dächer der Station auf. Der Rancher trieb die Pferde zu größerer Eile an.
Da lachte Jonny.
»Glaubst du etwa, daß du ihn verpaßt, Vater?«
Ein kleines Lächeln huschte auch um das Gesicht John Saunders.
»Nein, Jonny, wir kommen noch zeitig an die Bahn.«
Die kleine Station Harpersville rückte näher.
»Wie lange habt ihr euch eigentlich nicht gesehen, Vater?« wollte der Bursche plötzlich wissen. »Du und Onkel Greg?«
»Da muß ich nachdenken, Jonny. Ich glaube, daß es fast zwanzig Jahre sein werden.«
Der Rancher war, nachdem er fünf Jahre in den Staaten lebte, nach Hause gefahren, um den Bruder zu besuchen.
Und jetzt, fast zwanzig Jahre später, war auch Greg Saunders, sein Bruder, ausgewandert. Als der Vater dies ankündigte, war John sofort bereit gewesen, den Bruder zu sich auf die Ranch zu nehmen. Er hatte ja am eigenen Leib erfahren müssen, wie schwer es ein Neuling in den Staaten hatte.
Die ersten Dächer von Harpersville flogen vorüber.
Es war die kleine goldbraune Kistenholzstadt in der Nordoststrecke Arizonas. Eine breite Mainstreet und zwei Querstraßen, ein Store, ein Sa-loon und das Stationsgebäude der Bahn neben dem Post Office, das war Harpersville.
Der Rancher brachte die beiden Braunen vor der Station zum Stehen und stieg mit seinem Sohn zum Kutschbock.
Es gab hier keine Schranken und Barrieren – man konnte ungehindert auf den »Bahnsteig« gehen. Sie sahen den Stationshalter im Schatten sitzen und über den blitzenden Schienenstrang nach Osten blicken.
»He, Hutkins«, rief ihn der Rancher mit seiner Bärenstimme an.
Der kleine Mann wandte den Kopf. Wasserhelle Äuglein sahen zwinkernd aus einem verschrumpelten Gesicht hervor.
»John Saunders! By gosh, wir haben uns doch ganz sicher ein paar Jahre nicht mehr gesehen.«
»Nun, ganz so lange ist es nicht her, Hutkins.«
Das gichtige Männchen erhob sich und kam auf die beiden zu.
»Donnerwetter, das ist Jonny, nicht wahr? Aus dem ist ja ein richtiger Mann geworden.«
Der Bursche wurde rot und sah angelegentlich den Schienenstrang hinunter.
Hutkins stopfte sich seine halb zernagelte Maiskolbenpfeife zwischen die Zähne und krächzte an ihrem Mundstück vorbei:
»Sie warten doch hier nicht etwa auf jemanden?«
»Doch«, entgegnete der Rancher. »Ich warte auf meinen Bruder.«
»Sie haben einen Bruder?«
»Ja, er war bis jetzt drüben im alten Europa bei den Eltern.«
»Kommt er nur zu Besuch oder bleibt er immer?« wollte der Alte wissen, ohne zu bemerken, daß seine Frage schon reichlich neugierig war.
»Hm, er wird wohl bleiben. Kommt natürlich darauf an, ob’s ihm hier gefällt.«
»Wie kann es einem Menschen hier überhaupt gefallen?« knurrte der Stationsvorsteher. »Etwas Scheußlicheres als den Westen gibt’s doch wohl nicht auf der Welt.«
Während sich der Rancher eine lange Virginia anzündete, wandte sich der Bursche an den Alten. »Weshalb sind Sie denn hier, wenn es Ihnen nicht im Westen gefällt? Die Welt ist doch groß genug. Ziehen Sie nach Persien oder Arabien oder nach China. Auch in Germany soll es ganz schön sein.«
Der Alte sah den Rancher an. »Ihr Junge hat ja schon Haare auf den Zähnen, Saunders. Damned, der ist richtig. Solche Leute können wir hier gebrauchen. Überhaupt jetzt! Das Bandenunwesen hat durch den Knall in Tombstone zwar einen gewaltigen Schock bekommen, aber aussterben wird es so schnell nicht.«
»Den Knall in Tombstone?« fragte Jonny interessiert.
»Yeah! Haben Sie nichts von dem Fight im O.K.-Corral gehört?«
»Nein.«
»Da sind doch drei große Banditen ausgelöscht worden.«
»Banditen?« Jonnys Wangen glühten. »Aber in Tombstone herrschen doch die Clantons und die McLowerys.«
»Die McLowerys sind tot!«
Man hörte deutlich, daß der Alte stolz darauf war, seine Neuigkeit weitergegeben zu haben.
Jonny warf seinem Vater einen raschen Blick zu.
»Hast du’s gehört, Dad?«
Der Rancher hatte am Schienenstrang gestanden und nach Osten gesehen.
»Was war los in Tombstone?«
»Haben Sie tatsächlich nichts von dem Fight gehört? Außer den McLowerys ist einer von den Clantons ausgelöscht worden.«
»Ein Clanton und die beiden McLowerys?« meinte der Rancher ungläubig. »He, wer hat denn das geschafft? Da muß ja eine ganze Armee nach Tombstone marschiert sein.«
»Gar nicht mal. Es waren Wyatt Earp, seine Brüder und Doc Holliday.«
Das Rot in dem Gesicht des Burschen verstärkte sich noch.
»Wyatt Earp und Doc Holliday?«
Der Stationshalter wandte sich um und nahm eine Zeitung von seinem Stuhl. »Hier steht es, auf der ersten Seite.« Er las vor: »Die Clanton Gang zerschlagen. Im offenen Straßenkampf schlugen die Earps zusammen mit Doc Holliday die Anführer der berüchtigten Clantonbande. Drei Tote im O.K.-Corral.«
So begierig Jonny auch darauf war, die Zeitung selbst zu lesen, so reichte er sie als wohlerzogener Bursche doch zuerst seinem Vater.
Der Rancher rieb sich das Kinn.
»Zounds! Das hat der Marshal also geschafft. Er kämpft doch schon seit Jahren gegen Ike Clanton. Hell and devils, wie mich das freut!«
»Das schönste ist die jämmerliche Rolle, die Ike selbst bei dieser Auseinandersetzung spielte«, meinte der Stationshalter.
Der Rancher reichte die Zeitung seinem Sohn. »Da, lies, Jonny! Wir hatten ja unterwegs noch von den Clantons gesprochen. Jetzt haben sie einen gewaltigen Stoß bekommen.«
»Meinst du, daß sie noch nicht ganz fertig sind?«
»Ganz sicher nicht, Junge. Ike lebt ja noch, und Curly Bill ist auch davongekommen. Es war doch eine große Bande. Aber vielleicht hat Ike einen so gewaltigen Schock bekommen, daß er genug hat.«
Der Stationshalter meinte ziemlich wütend:
»Die größte Gemeinheit haben wieder mal die Bürger von Tombstone geliefert. Obgleich sie jahrelang unter den Clantons gelitten haben, sind sie jetzt keineswegs einstimmig für die Earps. Fast die halbe Stadt ist gegen sie.«
Ein fernes Singen drang durch den Schienenstrang.
Die drei Männer blickten auf.
»Der Zug!« rief Jonny.
»Yeah«, brummte der Alte.
Es dauerte fast noch eine Viertelstunde, bis die Bahn stampfend, ratternd und polternd vor dem Stationsgebäude vorfuhr.
Die beiden Saunders überflogen die drei Wagen mit erwartungsvollen Blicken.
Aus dem zweiten Wagen stieg eine rothaarige Frau in der Aufmachung einer Primaballerina. Sie trug einen gewaltigen Federhut, ein kanariengelbes Kleid und einen schreiendroten Seidenschal. Ihre Knopfschuhe waren mit rotem Samt verziert, und der schwarze Schirm, den sie jetzt sofort gegen die Sonne aufspannte, war mit roten Rosen bestickt.
Der Mann, der hinter ihr ausstieg, war mittelgroß, hatte ein blasses, eingefallenes Gesicht und schiefergraue Augen. Er war stutzerhaft gekleidet, mit einem hellen englischen Hut, einem Gehrock von der gleichen Farbe und einer gestreiften Hose. Seine schwarzen Lackstiefeletten glänzten. Lang wuchsen die Koteletten vor den Ohren hinunter und verliehen dem ohnehin harten, eingefallenen blassen Gesicht noch ein wenig angenehmes Aussehen. Zu seinem weißen Rüschenhemd trug er eine geckenhaft wirkende papageiengrüne Seidenschleife. Ein Tüchlein von der gleichen Farbe blickte aus seiner Reverstasche.
So wenig schön die Erscheinung der Frau in diesem Land paßte – der Mann wirkte wie ein Pfau in der Schweine-pferch.
Der Rancher hatte die beiden kurz gemustert und sah dann suchend die beiden anderen Wagen ab. Jonny hatte die beiden nicht einmal angesehen.
Aus dem letzten Wagen kam ein langer, breitschultriger Mann, braungebrannt in einfacher grauer Reisekleidung. Er zerrte etwas aus dem Wagen heraus und schwang es sich auf den Rücken. Einen schweren Sattel mit pendelnden Steigbügeln.
Jonny Saunders bekam weite Augen und warf dem Vater einen raschen Blick zu.
»Dad, Onkel Greg!«
Aber der Rancher hatte die Augen zu schmalen Schlitzen zusammengezogen und musterte den herkulisch gebauten Fremden kopfschüttelnd.
Das aufgeputzte Paar war neben dem Wagen stehengeblieben. Immer mehr Körbe und Kartons lud der Dandy aus und stellte sie neben die Frau, die gebieterisch mit dem Sonnenschirm winkte und so den Stutzer dirigierte.
Der Riese aus dem letzten Wagen mußte wie ein Storch im Salat über das Koffergewirr steigen, sah sich um, und als er wieder nach vorn blickte, sah Jonny in ein lachendes Männergesicht. Er sah in dunkelgrün schimmernde Augen, sah die tiefbraune Haut des Fremden und zwei Zahnreihen, die ebenmäßig und blendend weiß waren.
Der Mann maß wenigstens sieben Fuß. Je näher er kam, desto größer wurde er.
Jonny fühlte, daß er heiße Hände bekam. Sein junges Herz schlug hämmernd.
»Damned, Onkel Greg…!«
Aber die Freude verflog aus seinem Gesicht, als er einen Blick hinüber auf den Vater warf.
»Dad, was hast du? Ich finde ihn großartig!«
Der Rancher hörte gar nicht hin. Er suchte noch einmal die Wagen ab und hatte dann eine steile Falte zwischen den Brauen.
»Dad, was hast du denn? Er sieht doch prächtig aus! Die Boys auf der Ranch werden begeistert von ihm sein. By Gosh, der hebt Hal Baker mit der linken Hand von den Füßen.«
Jonny wollte auf den vermeintlichen Onkel Greg zugehen, als er von dem Vater zur Seite gezogen wurde.
Der hünenhafte Fremde ging vorbei.
Jonny sah den Vater bekümmert an.
»War… er das nicht?«
»Nein!«
Jonny wandte sich noch einmal um und sah dem Fremden nach.
Schade! Er hätte eine Menge darum gegeben, wenn das sein Onkel Greg gewesen wäre.
Dann sah er, wie der Vater noch einmal an den Wagen entlangging.
»Vielleicht hat er viel Gepäck und kann nicht so rasch aussteigen. Ich werde mal nachsehen.«
Obgleich der Rancher ihn daran hindern wollte, lief der Bursche an den Wagen vorbei und blickte in die Fenster.
Nichts.
Enttäuscht kam er zurück.
»Er ist nicht gekommen.«
Schweigend stand der Rancher da und starrte vor sich hin.
»Doch, Jonny, er ist gekommen«, sagte er dann mit heiserer Stimme.
»Aber – ich habe sonst niemanden aussteigen sehen, Vater!«
Der Rancher bewegte sich nicht. Steif stand er da und sah auf das Stationshaus.
Die Frau und der stutzerhafte Mann kamen jetzt an ihnen vorbei. Schnatternd und girrend die Frau – keuchend und schwitzend, gepäckbeladend wie ein Lakai, der Mann.
Als sie vorbei waren, wandte der Rancher sich um.
»Greg!«
Der Stutzer blieb stehen.
Drei Hutschachteln fielen auf den Bahnsteig, sprangen auf, und ihr blumenbesetzter, mit violetten, gelben und schwarzen Federn dekorierter Inhalt ergoß sich in den Staub des aufgeschütteten »Perrons«.
Langsam wandte der Dandy sich um. In seinem bleichen Gesicht brannten dunkelrote Flecken. Aus weiten Augen sah er den Rancher an.
»Jonny…?«
Der Bursche starrte den Fremden fassungslos an. Nein! Das konnte doch wirklich nicht wahr sein, daß diese Spielbudenfigur, dieser lächerliche Stutzer, dieser Tanzgirl-Gepäckträger sein Onkel Greg war!
Dunkle Schamröte überzog das Gesicht Jonnys. Der Rancher stand wie eine Steinfigur da, mit harten marmornen Gesichtszügen. Unverwandt ruhten seine Augen auf dem Bruder.
Da flötete die Frau:
»Was ist mit Ihnen, Greggy? Soll ich meine Koffer vielleicht selbst aufheben und weitertragen?«
»Ja!« stieß John Saundes heiser und mit unmißverständlicher Grobheit hervor. »Ja, Miß Mary, schleppen Sie Ihren Tand gefälligst selbst weiter. Mein Bruder ist kein Gepäckträger!«
»Ihr Bruder? Um Himmels willen, Greggy, dieser ungehobelte Klotz, dieser Kuhbauer ist Ihr Bruder? Nicht möglich. Jetzt dachte ich, daß mal ein Kavalier in dieses elende Nest gekommen wäre, und schon erweist sich das als fürchterlicher Irrtum.«
»Sie brauchen keinen Kavalier, sondern einen Knecht, Miß Mary«, fauchte der Viehzüchter. »Und das mit dem Kuhbauern will ich noch einmal überhört haben!«
»Greggy! Heben Sie sofort die Hüte auf, die Sie hingeworfen haben!« kreischte die Frau hysterisch. Und hatte sie bis zu diesem Augenblick noch halbwegs hübsch ausgesehen, so wirkte sie jetzt geradezu abstoßend häßlich durch ihr vor Zorn völlig entstelltes Gesicht.
Greg Saunders hatte sich schon halb abgewandt und machte Anstalten, der Aufforderung der »Lady« nachzukommen, als ihm die Stimme des Ranchers in den Ohren donnerte:
»Greg! Komm her!«
Entsetzt hatte der junge Saunders dieser Szene zugesehen.
Der Stutzer wandte sich wieder um; ganz langsam kam er auf den Rancher zu.
Der sah ihn aus scharfen Augen an und reichte ihm dann die Hand.
»Willkommen in der neuen Heimat, Greg!«
Langsam hob Greg seine Hand und nahm die Hand des Bruders.
»John.«
Der Rancher wies auf seinen Sohn.
»Das ist Jonny, mein Junge. – Und das ist dein Onkel Greg, Boy. Gib ihm die Hand und begrüße ihn!«
Der Bursche trat heran, nahm seinen Hut ab und reichte dem Stutzer nicht eben freudig begeistert die Hand.
Der Stutzer nahm ein blütenweißes Taschentuch aus der Tasche und rieb sich damit durch das völlig verschwitzte Gesicht.
»Woher wußtest du denn, daß ich mit diesem Zug kommen würde?«
Der Rancher rieb sich das Kinn.
Er hatte den Eltern das Reisegeld für Greg geschickt. Er hatte genau beschrieben, wann sie ihn zur Bahn bringen sollten. Er hatte sich nach allem genauestens erkundigt – und wußte, daß der Vater für alles sorgen würde.
So hatte er auch gewußt, daß dies der Zug war, der den Bruder herbringen würde. Allenfalls hätte er noch mit dem nächsten kommen können. In diesem Fall wäre der Rancher mit seinem Jungen über Nacht hier im »Hotel« geblieben.
»Ich wußte es, Greg. Nun komm. Wo ist dein Gepäck?«
»Gepäck? Oh, die Tasche. Sie steht sicher noch im Wagen…«
Sein eigenes Gepäck hatte er also über den Hutschachteln des Tanzgirls vergessen.
Jonny lief auf einen Wink des Vaters los und kam gleich darauf mit der Reisetasche des Onkels zurück.
Der Rancher blickte darauf nieder.
»Vaters Tasche«, kam es heiser von seinen Lippen.
Greg nickte.
»Ja, er dachte, sie wäre noch gut genug. Allzu kauffreudig war er ja nie, der alte Herr.«
»Wozu auch, die Tasche tut’s doch wirklich noch. Außerdem bin ich direkt froh, daß ich sie noch einmal sehen kann. Vater ist früher damit über Land gefahren, wenn er den Leuten seine Sachen anbot. Ich werde es nie vergessen, wie er abends nach Hause kam und die Tasche auf den Tisch stellte. Ich stand dann immer davor und glaubte, er müsse gleich etwas Besonderes auspacken.«
Greg Saunders nahm die Tasche und hielt sie dem Bruder hin.
»Hier, wenn du willst, schenke ich sie dir.«
Der Rancher schüttelte den Kopf.
»No, Greg, behalte sie nur – und vor allem: halte sie in Ehren. Vergiß nie, daß sie deinem Vater gehört hat, der sie viele Jahre durch Nordirland geschleppt hat, um Geld für uns zu verdienen.«
Sie gingen an dem gaffenden Stationsvorsteher vorbei zum Wagen.
Georg Saunders sah an dem Gefährt vorbei in die Mainstreet.
»Um Himmels willen, ist das hier etwa ganz Harpersville?«
»Yeah«, versetzte der Rancher trocken. »Komm, steig auf, wir haben zu dritt auf dem Kutschbock Platz.«
Der Ankömmling vermochte jedoch den Blick von der Straße nicht loszureißen.
»Hell and all devils! Das ist also Harpersville! Aber das kann doch nicht sein. Das wird das Ende der Stadt sein, die Bahnhofsecke… Überhaupt: Bahnhof! Dieser elende Schuppen hier soll ein Bahnhof sein? Miß Queen hat mir…«
»Queen?« lachte der Viehzüchter, während er die Zügel aufnahm. »Wenn du diese Vogelscheuche meinen solltest, Greg, sie heißt Frosch, ganz einfach Frosch, und stammt aus Austria. Maria Frosch. Sie läßt sich hier also Mary Queen nennen.«
»Ist sie denn nicht im Golden Pa-lace die Attraktion der Cowboys aus ganz Arizona?«
Nun lachte John Saunders laut auf.
»Sie hat wirklich Phantasie, die Dame. Erstens ist sie nicht im goldenen Palace, sondern im Wimmerts ›Blech-Hütte‹, und dann ist sie nicht die Attraktion aller Cowboys von Arizona, sondern eine ganz verrufene Person, nach der sich kein anständiger Cowpuncher mehr umdrehen wird. Im Silver Saloon hat man sie hinausgeworfen. Joe Wimmert ist anspruchslos – und seine Gäste auch. Anscheinend hat sie gerade wieder eine ihrer ominösen kleinen Reisen gemacht, von denen sie nach ein paar Wochen aufgeputzt wie ein Pfingstochse zurückkehrt.«
Greg, der immer noch unten neben dem Wagen stand, fragte:
»Ominöse Reisen? Wie meinst du das?«
Der Rancher sah sich nach seinem Sohn um und meinte dann leise feixend:
»Hm, wenn ihr einer der Gäste wohlhabend und gleichzeitig dumm erscheint, spielt sie sich als seine Braut auf und reist so lange mit ihm durch die Gegend, bis er eben nur noch dumm ist.«
»Und sie ist nicht die Tochter eines Silberminenbesitzers?«
»Nein, so wenig wie sie eine Lady ist.«
Man sah es dem Ankömmling an, daß ihn das Gehörte sehr enttäuschte; vielleicht hatte er sich von der Zugbekanntschaft mit der hübschen Mary Queen doch schon bereits sehr viel versprochen. Hatte sie ihm doch Gott weiß was vorgegaukelt, als sie erfuhr, daß er hier in der Nähe eine Ranch aufbauen wolle.
So unaufrichtig die Frau gewesen war – Greg Saunders hatte auch so prahlerisch von seinen Zukunftsplänen gesprochen, daß das etwas abgeblühte Dancing Girl sich von dem Fremden sehr angezogen fühlte.
Jetzt erst wurde ihm klar, daß er sich von dem Gedanken, John aufzusuchen, während dieser Reise vollständig gelöst hatte.
»Komm, steig auf!« rief ihn der Rancher aus seinen düsteren Gedanken.
Mit ungeschickten Bewegungen zog sich Greg Saunders auf den Wagen.
*
Die Fahrt verlief ziemlich schweigsam.
Jonny war so fürchterlich von dem Onkel enttäuscht, daß er nichts sagen konnte. Auch der Rancher, der vielerlei Fragen nach Vater, Mutter, dem Haus und dem Garten, der kleinen Stadt und den Menschen in der alten Heimat auf dem Herzen gehabt hatte, schwieg. Der Anblick des Bruders hatte all diese Fragen in ihm erstickt.
Welch eine unwürdige Ankunft!
Welch ein Auftreten! Wie ein Schürzenjäger, wie eine lächerliche Figur war Greg Saunders in Harperswille angekommen. Er hatte sich zum Gespött der Leute gemacht!
Als schließlich am Horizont auf einem Hügel die Bauten der Ranch auftauchten, wies John Saunders mit der ausgestreckten Rechten nach vorn.
»Da vorn liegt die Ranch, Greg!«
Der Ire Gregory Alfred Saunders sah mit zusammengekniffenen Augen zu den Häusern hinüber, die nun seine neue Heimat sein sollten.
»Die drei Buden?« fragte er zum Entsetzen seines Neffen und zum Unwillen des Bruders.
»Drei Buden? Es sind sieben Bauten. Ein großes Wohnhaus mit neun Räumen, ein Cowboyhaus mit drei großen Sälen, ein langes Stallhaus und zwei Scheunen, von denen die eine größer ist als die City Hall mancher Stadt. Dann ist da noch ein Geräteschuppen und eine Schmiede. Der Pferdecorral ist größer als alles Land, was unserem Vater daheim gehört, und das Wagendach, das sich daran anschließt, könnte die Wagen von ganz Greenwest beherbergen.«
»Greenwest!« stieß Greg gallig hervor. »Ich wäre dir wirklich dankbar, John, wenn du diesen Namen in meiner Gegenwart nicht mehr erwähnen würdest. Ich kann ihn nicht mehr hören.«
»Es ist der Name meiner Heimatstadt, Greg. Aber wenn du willst, kann ich das ja für mich behalten. Daß du auch dort geboren bist, spielt ja vielleicht keine Rolle. Außerdem« – der Rancher sog die frische Luft, die von den Gräsern aufstieg, in seinen mächtigen Brustkasten – »hast du vielleicht recht, Bruder. Da oben liegt meine Heimat und jetzt auch deine.«
Greg nahm den Kopf herum und fuhr sich unbehaglich durch den Kragen.
»Ich weiß noch nicht, ob ich bleiben werde, John«, druckste er hervor.
»Was denn? Wo willst du denn hin? Und was willst du tun? Du bist drüben in einer Branche tätig gewesen, die es hier überhaupt nicht gibt. Ich finde, es wäre das beste, wenn du dich gleich an den Gedanken gewöhnst, daß du hier daheim bist. Bei uns. Wir sind deine Verwandten. Du bist nicht allein, hast dich nicht durch den verdammten Holzkuchen durchzubeißen, durch den ich mich beißen mußte, kannst dich an den gedeckten Tisch setzen und froh sein, daß dein älterer Bruder bereits ein Vierteljahrhundert hier hinter sich hat.«
Aber der Ankömmling schien von diesen Gedanken nicht eben begeistert zu sein.
»Ich werde es mir überlegen, John.«
»Tu das. Ich bin sicher, daß es dir hier gefallen wird!«
»Aber das alles hier ringsum ist doch Prärie!«
»Die Prärie?« Der Rancher sah ihn verblüfft an. Dann machte er eine weitausholende Handbewegung.
»Das… das habe ich mir ganz anders vorgestellt.«
»Wie denn?«
»Wilder. Romantischer. Voller Bären mit zottigem grauen Fell, voller Pumas, und vor allem voll schleichender und buntbemalter Rothäute. Banditen müßten zu sehen sein, mit rauchenden Revolvern und schnellen Pferden.«
Das Gesicht des Viehzüchters verdichtete sich.
»Sei froh, daß du dies alles nicht siehst. Denn es ist da! Ohne daß du es siehst. Das ist das Schlimme daran.«
»Verstehe ich nicht.«
»Nicht nötig, das kommt von selbst. Wenn dich unterwegs mal ein Indianer angefallen hat, wenn du nachts einmal von Banditenkugeln aus dem Bett gejagt wirst, wenn ein paar Strolche dir das Dach über dem Kopf angezündet haben, oder wenn du auf einem einsamen Ritt auf einer Waldlichtung oben in den Bergen plötzlich einem Grisly gegenüberstehst. Sei nur nicht ungeduldig.«
Die beiden Braunen hatten den Wagen zum Ranchtor gebracht.
Jonny sprang vom Kutschbock und öffnete das Tor.
»He! Weshalb habt ihr hier überhaupt ein Tor?« meinte Greg. »Ich sehe ja nirgends einen Zaun. Wozu braucht man ein Tor, wenn kein Zaun da ist?«
»Das ist so üblich in diesem Land«, erklärte der Rancher. »Einen Zaun braucht man nicht. Hauptsache, man weiß, daß man vor einer Ranch und auf fremder Weide ist. Durch solch ein Tor weiß man das genau.«
Greg lachte auf.
»Ein Tor und kein Zaun – das ist doch idiotisch.«
»Wenn du so denkst, Greg, wirst du noch manches in diesem Land idiotisch finden.«
Der Wagen rollte dem Ranchhof entgegen.
Vorn rechts neben den beiden Holzbauten, die die Einfahrt bildeten, stand ein alter Mann und spaltete Holz.
Als er den Wagen hörte, blickte er kurz auf und tippte an den Hutrand.
»Was war denn das für eine verkrüppelte Figur?« meinte Greg.
»Das ist der alte Sam Barney, Greg. Er ist mein ältester Cowboy. Sieben-undsiebzig. Aber er ist fleißiger als mancher Bursche von zwanzig oder dreißig.«
»Cowboy?« schnarrte Greg und sah sich feixend um. »So eine Jammergestalt ist bei dir Cowboy?«
Der Rancher mußte sich den Ärger gewaltsam von der Stirn wischen und mühte ein Lachen um seine Mundwinkel.
»Du hast noch keinen rechten Blick für das Land und für die Leute hier, Greg. Barney ist ein recht braver Bursche. Aber ich würde ihn hierbehalten, selbst wenn er neunundneunzig wäre und nur noch drüben vor dem Bunkhaus im Schaukelstuhl in der Sonne sitzen könnte…«
»Du hast doch aber kein Greisenasyl hier!« begehrte Greg auf.
»Nein, ganz sicher nicht. Hier wird hart und schwer gearbeitet, Tag für Tag. Bei uns gibt es weder Sonn- noch Feiertag, Bruder. Aber das wird uns den Respekt vor einem Menschen, dem wir Dank schulden, nie nehmen können. Zweimal hat der Alte mich vor dem Tod bewahrt. Und einmal deinen Neffen hier…«
Greg schüttelte den Kopf und blickte in den weiten Hof, der wenigstens einen Durchmesser von hundertzwanzig Yards hatte.
»Das ist ja ein richtiger Marktplatz hier!« räsonierte der Ankömmling aus Irland. »Weshalb hast du die Buden nicht näher aneinandergestellt? Und das soll ein Bauerngut sein…«
»Ein Bauerngut?« fragte John Saunders entrüstet. »Es ist eine Ranch, Greg. Eine Viehranch, wie es sie in dieser Art nur im Westen gibt. Ein Bauernhof hat vor allem Land und dann auch ein paar Kühe. Im besten Fall fünfzig, sechzig Tiere. Das hier aber ist eine Rinderfarm, wo es nur um die Aufzucht und Erhaltung von Rindern geht.«
»Willst du damit sagen, daß du mehr als fünfzig oder gar sechzig Kühe hast?«
John Saunders hatte den Wagen angehalten und stieg ab.
»Yeah, Greg. Das will ich damit sagen. Und nun steig erst mal runter. Nointa wird uns einen guten Trunk zurechtgestellt haben.«
Jonny nahm die Reisetasche des Onkels und brachte sie ins Haus. Die beiden Brüder blieben neben dem Brunnen stehen.
Greg schaute zum Corral hinüber, wo sich drei Pferde an den Schatten des anliegenden Wagendaches drängten.
»Und wo hast du die Kühe?«
»Draußen an den Sommerhängen.
»Hab’ keinen Kuhschwanz gesehen!«
»Es sind Rinder, Greg, über drei-tausend Tiere.«
Dem Ankömmling blieb der Mund offenstehen.
»Waaas? Mann, das ist doch Aufschneiderei! Kein Mensch kann drei-tausend Kühe unterbringen. Einen so großen Stall gibt es ja nicht. Ich habe gehört, daß in Germany Bauern wohnen, die dreißig oder sogar vierzig Rinder in den Ställen haben. Aber dreitausend?«
»Mehr als dreitausend, es sind wohl bald vier…«
Greg schluckte.
»Nein. Ich kann sie nicht jeden Tag zählen. Ihre genaue Zahl ändert sich ständig.«
»Woher kommt das? Man muß doch wissen, wieviel Rinder man hat. Verkaufst du vielleicht jeden Tag welche?«
»Nein, aber erstens verlaufen sich immer Tiere, werden von der Herde abgetrieben, finden nicht zurück und sind verloren. Dann gibt es schlechte Menschen, die Rinder stehlen…«
»Aber dafür sind doch die Cowboys da, um auf die Rinder aufzupassen. Du mußt sie dafür verantwortlich machen, wenn ein Tier fehlt.«
»Erstens merke ich das ja nicht, Greg, denn ich habe keine Zeit, täglich nachzuzählen – und zweitens wäre das ganz unmöglich, auch für die Weidereiter. Die Tiere weiden auf einer so großen, unübersichtlichen Fläche, daß es ausgeschlossen ist, sie ständig im Auge zu behalten. Zudem wird immer wieder Fleisch für die Küche benötigt. Nichts schmeckt einem richtigen Cowboy besser als ein tellergroßes Rindersteak.«
Greg Saunders schüttelte den Kopf.
»Vater sagte schon, ich würde mich umgewöhnen müssen. Das ist ein ganz fremdes Land.«
»Da hatte er recht. Nun kommt mit ins Haus!«
Als sie auf die saubergefegte Verandatreppe zugingen, kam oben aus der Haustür ein weißhaariger Neger, der einen Moment stehenblieb, sich verbeugte und lachend sein weißes Gebiß zeigte, um gleich darauf im Geräteschuppen zu verschwinden.
John Saunders war schon oben auf der Veranda, als er bemerkte, daß ihm sein Bruder nicht gefolgt war. Er sah sich um und sah ihn immer noch unten vor der Treppe stehen.
»Come on, Greg!«
Aus engen Augen starrte Greg dahin, wo der Schwarze verschwunden war
»Was war denn das?« fragte er, ohne dabei zu dem Bruder hinaufzusehen.
»Das war Sam. Er ist die gute Seele der Ranch…«
»Eine verdammt schwarze Seele. Du beschäftigst einen Neger?«
»Weshalb nicht? Er ist seit siebzehn Jahren bei mir, Greg. Und als das Haus brannte, lag ich damals allein oben in meiner Kammer und schlief, da holte er mich heraus. Als wir dann keuchend auf dem Hof ankamen, brüllte einer: Jonny ist noch im Haus! Da stampfte er, ehe sich ein anderer rühren konnte, davon und verschwand wieder in der schwelenden Glut des Hauses. Er brachte den Jungen heraus und brach hier, wo du jetzt stehst, mit seiner Last zusammen, von mehreren schweren Brandwunden bedeckt, vom beizenden Rauch betäubt.«
»He, du hast wohl hier jedem etwas zu verdanken.«
»Wenn du einmal länger hier bist, wirst du bald feststellen, daß man hier auf den anderen angewiesen ist wie nirgends sonst auf der Welt.«
»Verrücktes Land, ich sage es ja!«
Sie gingen ins Haus.
»Gerade als sie die große Wohnstube von der Halle her betraten, huschte zur anderen Tür ein Wesen hinaus, das den Blick des Iren bannte. Es war eine junge Frau mit braunroter Haut und Kohlenaugen. Eine Indianerin.
Obgleich sie längst verschwunden war, sah er noch ihr bronzefarbenes Gesicht, ihre schimmernden dunklen Augen, ihr glattes Gesichtsoval, umrahmt von blauschwarzem, schulterlangem Haar. Sie trug eine lange Jacke aus hellem dünnen Hirschleder, einen Gurt aus rotem Stoff, ein rotes Haarband, einen Rock aus dunklerem Leder und an den kleinen Füßen bestickte Mokassins.
Greg rührte sich nicht.
Der Bruder stieß ihn an. »Komm zu dir, Boy.«
»Was war denn das?«
»Sie heißt Nointa, es ist ein Apachenmädchen. Wir haben es seit seiner Jugend auf der Ranch. Eines Tages kam ein sterbender Indianer hier an und legte sie vor unsere Ranchhaustreppe.«
Greg höhnte:
»Hast du ihr auch etwas zu verdanken?«
»Nein, aber sie ist jetzt schon so lange hier wie sie denken kann. Sie ist fleißig, sehr still, genügsam und zuverlässig. Mehr kann man in diesem Lande von keinem Menschen verlangen.«
»Aber sie ist doch eine Indianerin!«
»Na und…?«
»Du beschäftigst Indianer und Neger – ich verstehe dich wirklich nicht. Bei uns drüben würde kein Mensch auf den Gedanken kommen, einen Neger zu beschäftigen.«
»Auch das ist etwas, was du hier lernen mußt, Greg. Es ist ein großes freies Land. Abe Lincoln hat die Sklaverei abgeschafft, Gott sei Dank. Die Neger sind Menschen wie du und ich.«
»Nie werde ich mich mit einem Schwarzen auf die gleiche Stufe stellen. Und erst die Roten! Haben sie nicht Millionen Weiße ermordet…?«
»Nein, Greg, das stimmt nicht. Das ist ein übles Greuelmärchen. Fest steht, daß die Weißen in das Land, das immer den Indianern gehört hat, wie die Barbaren einbrachen, das Land ganz einfach beanspruchten und die Indianer fast ausgerottet haben.«
Greg wandte den Kopf und zischte:
»Ansichten hast du!«
*
Es gab niemanden auf der Ranch, dem die Anwesenheit des Mannes aus Irland wirklich Freude bereitet hätte.
Überall hatte Greg Saunders etwas herumzunörgeln. Das Essen schmeckte ihm nicht. Es war ihm nachts in seiner Schlafkammer zu kalt, obgleich der Rancher ihm sein eigenes Zimmer überlassen und selbst in einen Bodenraum gezogen war. Der Arbeitslärm auf dem Hof begann ihm zu früh und das »Gejohle« der Cowboys störte ihn gewaltig. Er trank unglaubliche Mengen Whisky, dessen Qualität er unentwegt zu rügen hatte – und erwies sich überhaupt als ein sehr unliebsamer Gast.
Eines Abends sprach der Rancher mit ihm.
»Greg – so kann es nicht weitergehen. Eine Ranch ist kein Sanatorium und kein gemütlicher Bauernhof. Hier wird sehr hart und verbissen gearbeitet. Ein Cowboy ist im Grunde ein armer Teufel, denn die Arbeit, die er für knapp vierzig Dollar im Monat leistet, ist Berserkerarbeit. Und es ist schwer, gute Cowboys zu bekommen. Ich bin froh, daß ich eine brauchbare Crew zusammengebracht habe.
Hier ist die große Ranch, Greg – du gehörst zu unserer Familie. Wenn du ein Cowboy wirst, so bleibst du doch mein Bruder…«
Greg verstand – aber er wollte nicht verstehen.
Eines Vormittags stand Greg im Vorratsraum im Dunkeln hinter einem mit Blech ausgeschlagenen Fleischschrank, als sich vorn die Tür öffnete und der Neger Sam den Raum betrat.
Greg wußte, wann der Schwarze kommen mußte, um das Fleisch für das Mittagessen zu holen. Als der ahnungslose Mann an dem Schrank vorbeikam, schnellte Greg blitzschnell vor, packte ihn mit beiden Händen am Hals und würgte ihn.
»Du verdammter schwarzer Hund hast hier nichts zu suchen! Das ist unser Haus, unsere Ranch. Wir füttern keine Schwarzen!«
Er würgte ihn, als wollte er ihn umbringen.
In seiner Verzweiflung und Todesnot gelang es dem Neger, eine große Porzellanschüssel zu packen und sie gegen die Tür zur Halle zu schleudern, wo sie mit einem enormen Lärm zersprang.
Jonny kam sofort herein. Mit einem Blick übersah er die Situation, sprang hinzu und befreite den Neger von dem Würgegriff.
»Onkel Greg!« stieß er erregt hervor. »Was war denn los?«
Keuchend stand der Ire da und stierte auf den um Atem ringenden Alten.
»Dieser verdammte Hund! Er hat mir hier aufgelauert und mich angefallen. Ich bringe ihn um!« Wieder wollte er sich auf den Schwarzen stürzen.
Aber der Bursche schob sich dazwischen.
»Halt! Das geht auf keinen Fall. Wir müssen Vater die Sache vortragen!«
»Vater die Sache vortragen? Was gibt es da vorzutragen, wenn mich dieser schwarze Bandit angefallen hat? Aufhängen muß man ihn, und zwar sofort!«
Der Rancher war schwach genug, nachzugeben: er entließ den Neger Sam mit einem größeren Geldgeschenk – um den Bruder zu retten.
Das Geld, das er dem Schwarzen gegeben hatte, fand er anderen Tags vor seiner Zimmertür. Und der schwarze Mann hatte sich unweit vom Haus das Leben genommen.
»Zufrieden?« fragte Jonny seinen Onkel mit bitterem Lächeln. »Jetzt bist du ihn ja endlich los.«
Dieser Vorfall lag noch nicht ganz drei Tage zurück, als John Saunders eines Abends ein merkwürdiges Geräusch aus dem Anbau vernahm, in dem gewaschen und geplättet wurde.
John wollte die Tür öffnen. Sie war verschlossen. Da warf er sich kurz entschlossen mit seinem Zweizentnergewicht dagegen.
Sie sprang auf – und der Rancher sah zu seinem Entsetzen die Indianerin Nointa halb ohnmächtig drüben an der Wand lehnen und vor ihr - seinen Bruder, der beide Hände um ihren Hals geklammert hatte.
»Greg!«
Der Ire sah sich nicht um.
»Erdrosseln sollte man diese Schlange! Sie hat mir mit dem Messer aufgelauert. Nach Indianerart! Da liegt das Messer noch. Diese Teufelin wollte mich umbringen! Aber das werde ich dieser Hexe versalzen!«
»Laß sie los, Greg!«
Erst als der Rancher ihn von der Frau wegriß, gab Greg auf. Er taumelte zurück, stand mit schweißtriefendem Körper da, blutige Kratzer im Gesicht und an den Händen.
»Ich hätte sie umgebracht, diese Schlange, das schwöre ich dir!«
Da stand plötzlich der Bursche in der Tür. Sein Gesicht wurde kalkweiß.
»Dad!« sagte er schneidend. »Sprich kein Wort! Und wenn du sie aus dem Hause weist wie den alten Sam, gehe ich mit ihr!«
John Saunders fuhr herum. Wie vom Schlag getroffen stand er da und starrte seinen Sohn an.
»Was hast du da gesagt, Jonny?« kam es heiser von seinen Lippen.
»Well, ich werde es deutlicher sagen, Vater. Du hast den Neger Sam wegen dieses Mannes, der ja leider dein Bruder ist, aus dem Haus, das seine Heimat war – und in den Tod getrieben! Ich weiß, daß du jetzt Nointa seinetwegen verjagen wirst. Aber du brauchst es nicht. Sie geht freiwillig – und ich gehe mit ihr. Und dieser Mann da…«, mit ausgestrecktem Arm und flammendem Blick stand der Bursche da und deutete auf seinen Onkel, »kann froh sein, daß er der Bruder meines Vaters ist, sonst würde ich ihn jetzt in den Hof zerren, zum Gunfight fordern und aus den Stiefeln schießen. Für mich ist er ein Strolch. Ein Bandit, den ich gnadenlos niederschießen werde, wenn ich ihn eines Tages außerhalb dieser Ranch einmal treffen sollte! – Nointa komm!«
Das Mädchen wischte sich durchs Gesicht und ging grußlos hinaus.
Jonny Saunders folgte ihr.
Wenige Minuten später ritten die beiden schon auf Jonnys Schimmel vom Hof. Als sie das Tor fast erreicht hatten, kamen vier Reiter angesprengt.
Bei dem seltsamen Anblick hielten sie ihre Pferde an.
Der vorderste von ihnen saß auf einem Fuchs, ein kleiner hagerer Mann mit scharfen Augen und faltigem Gesicht. Er trug, wie seine Begleiter, Weidereiterkleidung. Es war Norman Teck, der Vormann der Saunders Ranch.
»Wohin, Jonny?«
»Weg, Mister Teck.«
»Aha. Und darf ich fragen wohin?«
»Nein«, entgegnete Jonny knurrend.
»Hören Sie, Jonny, dies ist zwar die Ranch Ihres Vaters und wird eines Tages vielleicht einmal Ihre Ranch sein. Aber noch bin ich hier Vormann, und Sie sind nichts weiter als einer meiner Cowboys. Sollten Sie das vergessen haben?« Der kleine Mann hatte es ohne Hast und Lautstärke gesagt.
»Nein, Vormann, ich habe es nicht vergessen. Aber ich bitte Sie, von heute ab auf den Cowboy Jonny Saunders zu verzichten. Ich habe dem Boß aufgesagt.«
»Und mir? Wagen Sie vielleicht auch, mir aufzusagen? He, Sie elender Flegel, Sie!« Die letzten Worte hatte der Vormann plötzlich gebrüllt. »Wie wollen Sie je ein guter Cowboy werden, wenn Sie wegen jeder Lappalie von der Ranch rennen. Wie erst wollen Sie je ein guter Rancher werden, wenn Sie so leicht aufgeben? Sie haben sich erst mit dem Vormann zu besprechen, ehe Sie gehen, und dann dem Boß zusammen mit dem Vormann Bescheid zu sagen!«
Jonny biß sich in die Lippen. Er wußte, daß der kleine Teck recht hatte, und vor allem, daß er es gut mit ihm meinte.
Einer der Cowboys riß ein Zündholz an und hielt es Teck an die reichlich krummgedrehte Zigarette.
»Jonny, Sie dürfen nicht glauben, daß ich Sie jetzt wegen des Indianermädchens aufhalte. Wir alle mögen die Roten nicht – haben aber das Mädchen geschätzt, weil es einfach zur Ranch gehörte. Daß Sie Nointa – lieben, ist Ihre Sache. Und dann müssen sie es natürlich auch vor irgendwelchen krummen Hunden beschützen.« Teck sagte es, ohne zu wissen, was sich inzwischen auf der Ranch ereignet hatte. »Aber die Ranch verlassen zu dürfen, dann sind Sie für mich ein Feigling.«
Jonny erwiderte mit zusammengebissenen Zähnen:
»Es ist mir einerlei, Mister Teck! Ich gehe nicht mehr zurück!«
»All right! Dann reiten Sie. Aber wenn der Rancher eines Tages mal die Augen zumacht und Sie tauchen dann hier auf, dürfen Sie sich nicht einbilden, daß Ihr Vormann dann Norman Teck heißt. Lizzy, go on!«
Er gab seinem Pferd die Sporen. Die anderen folgten ihm.
Jonny Saunders hielt auf der Stelle und sah hinter den Reitern her.
Da hörte er das Apachenmädchen sagen:
»Du darfst nicht wegreiten, Jonny.«
Er wendete seinen Schimmel und ritt langsam zurück. Aber er ging nicht mehr ins Ranchhaus zurück.
Als John Saunders ihn am nächsten Morgen beim Holzhacken traf, knurrte er:
»Ich dachte, du wolltest den Corralzaun reparieren.«
»All right!« gab Jonny muffig zurück.
Der Vater hatte ihn nur von den anderen Cowboys wegholen wollen.
»Ich danke dir, daß du zurückgekommen bist, Jonny!«
»Der Vormann hat mich zurückgeholt. Und wenn Greg sie noch einmal anfaßt, erschieße ich ihn.«
»Er wird sie nicht mehr anrühren – und du brauchst niemanden zu erschießen.«
Damit schien der Friede auf der Ranch wiederhergestellt zu sein. Aber es schien eben nur so.
Greg, von der Schwäche des Bruders gestützt, unterschätzte seine Position auf der Ranch. Und eines Morgens kam, was kommen mußte.
Er, der gar nicht daran dachte, irgendwelchen Arbeiten auf dem
Ranchhof nachzugehen, traf in der Scheune auf die Indianerin, die mit Wäsche von den Leinen hinter der Scheune kam. Zu Tode erschrocken blieb Nointa mit dem schweren Wäschekorb stehen.
Der Ire ging auf sie zu – und spie ihr ins Gesicht. »Verdammte Natter! Bist du noch immer hier, he? Wirst du nicht freiwillig den Ranchhof verlassen? Träumst du vielleicht davon, daß du bei deinem Jonny bleiben kannst? Da hast du dich gewaltig geirrt, Girl! Ich – ich, Gregory Saunders, ich werde das zu verhindern wissen! Verlaß dich drauf. Und damit du dreckige
Rothaut auch weißt, daß ich nicht spaße…«
Er wollte zum Schlag ausholen. Aber ein scharfer Ruf ließ ihn herumfahren.
Im nur angelehnten Scheunentor stand Jonny Saunders.
»Wenn du sie anrührst, knalle ich dich nieder!«
»Was hast du gesagt, Bursche?« krähte Greg. »Niederschießen willst du mich? Komm, das kannst du ja mal deinem Vater erzählen…«
»Dein Gewäsch interessiert mich nicht. Geh weg von dem Mädchen!«
Der rauhe, entschlossene Ton genügte, um Greg Saunders zu warnen. Er trat zwei Schritte zur Seite und bellte:
»Was das bedeutet, weißt du ja, Jonny. Jetzt verläßt du die Ranch!«
»Das hätte ich auch ohne deinen frommen Rat getan! Und vergiß nicht, was ich dir jetzt sage: du hast kein Glück! Ich weiß, was du vorhast, aber das gelingt dir nicht. Du willst diese Ranch beherrschen? Das schaffst du nicht, Greg Saunders.«
Dann ging Jonny mit der Indianerin hinaus.
Und diesmal verließ er die Ranch, ohne sich um den Vormann zu kümmern. Als der Rancher beim Abendbrot seinen Sohn nicht antraf, lief er in die Küche, wo die beiden Mägde mit gesenkten Gesichtern herumhantierten.
»Wo ist Nointa?«
»Wir wissen es nicht, Rancher.«
Jonny und die Indianerin waren verschwunden.
*
Der Rancher wurde sehr still und in sich gekehrt. Er hatte seinen Sohn sehr geliebt. Und daß der Bursche in das hübsche Indianermädchen verliebt war – war ja seine Sache gewesen. Nointa war wie ein eigenes Kind auf der Ranch aufgewachsen.
Greg, dem das muffige Wesen seines Bruders mißfiel, stellte ihn eines Morgens beim Kaffee.
»Sag mal, willst du jetzt ewig mit dieser sauren Miene herumlaufen?«
»Wenn mein Sohn noch auf der Ranch wäre, brauchte ich keine saure Miene zu machen. Er hat zweiundzwanzig Jahre keinen Grund gehabt, seinen Vater zu verlassen. Plötzlich hat er einen…«
»Ja, und zwar eine verdammt rot-häutige Frau. Ihretwegen hat er die Ranch verlassen. Weil die Schlange es verstanden hat, den schwachköpfigen Burschen um den…«
»Schweig!« donnerte ihn der Rancher plötzlich an. »Und nie wieder ein solches Wort! Sonst wirst du es, der von der Ranch gewiesen wird!«
Wie eine Natter fuhr Greg Saunders zurück.
»So also sieht das aus. Erst lockst du mich hierher, und jetzt bin ich dir lästig. Weil du gemerkt hast, daß die Cowboys mich schätzen! Weil sie wissen, daß ein Mann mit Verstand auf die Ranch gekommen ist. Weil du fürchtest, sie könnten mich als Boß haben wollen. Du armseliger Kuhbauer!«
Da rutschte dem Rancher die Hand aus und knallte hart in Gregs Gesicht.
Der taumelte zurück.
»Was hast du gewagt, Kerl?! Das zahlst du mir heim! Elender Schuft! Ich wußte gleich, daß ich dir über war. Einen Greg Saunders schlägt man nicht. Mit Blut wird das abgewaschen, nur mit Blut!«
Leicht vorgebeugt stand er da, aschfahl, mit roten hektischen Flecken auf den eingefallenen Wangen, mit gefletschten Zähnen und stierem Blick.
»Ich werde dich vernichten, John. Das schwöre ich dir hier! Ich werde dich zu vernichten wissen. Und deine eigenen Leute werden mir dabei helfen. Loftus Ginger ist schon auf meiner Seite, und Mac Friggers auch. Die anderen werden folgen. Sie werden einen Saunders als Boß haben wollen, der Grips statt Stroh im Schädel hat – und du und wie dein Sohn, der obendrein mit seiner Squaw zum Verräter an seiner Rasse geworden ist.«
»Verschwinde!« brüllte der Rancher außer sich vor Zorn. »Verschwinde, ehe ich vergesse, daß du mein Bruder bist. Norman Teck wird dir dreihundert Dollar geben. Davon kannst du nach Boston zurückfahren und eine Zeitlang leben, bis du dir dort das Geld für die Überfahrt nach Europa selbst verdient hast! Hinaus!«
Sogar ein Pferd gab John Saunders seinem unseligen Bruder mit. Und die dreihundert Dollar hatte er, bevor er Teck die Anweisung gab, auf vierhundert erhöht.
Mit finsterer Miene ritt Gregory Saunders kurz vor Mittag vom Ranchhof. Er war ein schlechter Reiter, gab eine scheußlich Figur ab, hatte keine Waffen, obwohl der Rancher ihm eine hatte mitgeben wollen, und hing seinen düsteren Gedanken nach.
Der Rancher wandte sich nach dem Vormann um.
»Ich möchte mit Mac Friggers und Loftus Ginger sprechen!«
Teck runzelte die Stirn.
»Ich wollte es Ihnen gerade sagen. Boß – die beiden sind verschwunden.«
»Seit wann?«
»Seit gestern.«
Wortlos wandte sich der Rancher ab und ging ins Haus.
*
Am nächsten Morgen glaubte der Rancher seinen Augen nicht trauen zu dürfen: Im Schaukelstuhl auf der Veranda saß sein Bruder Greg, den er von der Ranch gejagt hatte.
John blieb neben ihm stehen und sah ihn aus harten Augen an.
»Wer in diesem Lande, das du nie begreifen wirst, auf Ehre hält, der kehrt nie an den Ort zurück, von dem er verjagt wurde.«
Greg lachte zynisch.
»Glücklicherweise bin ich nicht ganz so beschränkt wie die Leute dieses Landes – und außerdem nicht nachtragend. Ich bleibe.«
Vor soviel Charakterlosigkeit verschlug es dem Rancher die Sprache. Er stampfte davon, ging seiner Arbeit nach und kümmerte sich nicht mehr um den Zurückgekehrten.
Mit der Zeit gewöhnten sich die Ranchbewohner an diesen Mann. Zwar mochte ihn niemand leiden, aber er war gerissen genug, sich hin und wieder einer Beschäftigung zuzuwenden. Vor allem klemmte er sich hinter den Vormann und suchte mit allen erdenklichen Mitteln dessen Zuneigung zu gewinnen.
Aber Norman Teck war ein richtiger Cowboy. Er ließ sich nicht bestechen. Aber er hatte andererseits auch nichts dagegen, daß der Ire sich mit dieser oder jener Arbeit befaßte.
Dann kam der Tag heran, an dem die Herde hinauf nach Santa Fé getrieben werden sollte, von wo aus sie den langen Treck nach Dodge City zurückzulegen hatte.
Dieser Trail hatte bisher jedes Jahr Cowboy Eddie Flash angeführt. Er war ein erfahrener Trailboß und besaß das ganze Vertrauen des Ranchers und seines Vormannes. Flash war hochgewachsen, stiernackig und etwas eigensinnig, aber ein hundertprozentiger Weidereiter.
An dem Abend, an dem alles auf der Ranch für den Trail vorbereitet wurde, saß der Rancher in seinem Arbeitszimmer und rechnete.
Da wurde plötzlich die Tür geöffnet, und Greg kam herein.
»Ich muß mit dir sprechen, John.«
Der Rancher sah auf. »Was gibt’s?«
»Morgen geht der Trail nach Santa Fé hier ab?«
»Das weißt du ja.«
»All right. Hast du nicht in den letzten Tagen gesagt, daß ich schon ganz gut reiten und mit den Rindern umgehen könne?«
Der Rancher, der dieses voreilige Lob nur ausgesprochen hatte, um den Bruder möglicherweise dadurch auf eine bessere Bahn bringen zu können, entgegnete mißtrauisch:
»Doch, Greg, gewiß, das habe ich gesagt…«
Greg kam näher an den Schreibtisch heran.
»Well, dann kannst du deineWorte jetzt dadurch unterstreichen, indem du mir einen Vertrauensbeweis gibst.«
»Einen Vertrauensbeweis? Wie soll ich das verstehen? Du mußt dich schon deutlicher ausdrücken.«
»Laß mich den Trail führen, John.«
Der Rancher sah den Bruder völlig verblüfft an.
»Den Trail führen? Was ist denn in dich gefahren? Weißt du, was es heißt; anderthalbtausend Rinder über mehrere hundert Meilen durch dieses Land zu treiben? Mit nur fünf Cowboys! Hast du Erfahrungen darin? Hast du je einen solchen Trail mitgemacht, auch nur als Treiber? Und da willst du ihn gar führen? Ich werde dir etwas sagen, Greg. Du kannst mein Vertrauen gewinnen, wenn du mir sagst, daß ich dich als Treiber mitschicken soll.«
Da fuhr Greg zurück.
»Du mußt doch verrückt sein! Und größenwahnsinnig dazu.«
»Nein, Greg. Es ist dein Fehler, daß du dich ständig überschätzt. Ich müßte sogar mein ganzes Gewicht bei dem Trailboß einsetzen, wenn ich erreichen will, daß er dich als Treiber, selbst als hinterster Treiber, als Staubschlucker, mitnimmt. Du mußt wissen, daß ein Trailboß nicht nur für die Rinder, sondern auch für die Leute verantwortlich ist. Ein Mann, der noch nie ein Viehtreck mitgemacht hat, ist eine Behinderung für die anderen. Er bringt sich und sie in Gefahr.«
Da sprang Greg Saunders mit zwei raschen Schritten näher und fegte in loderndem Jähzorn eine schwere Blumenvase vom Tisch, daß sie an der Wand zerschellte.
»Jetzt habe ich dich erkannt. Du gönnst mir nichts! Du willst mich nichts werden lassen, weil du wieder einmal befürchtest, ich könnte dich ausstechen. Die Leute könnten mich als ihren Boß…«
John Saunders war aufgesprungen.
»Ich habe mir dein Gefasel lange genug angehört. Schon neulich, ehe ich dich von der Ranch wies, hast du ähnlichen Unsinn geredet. Hör gut zu, Greg. Du verschwindest jetzt, und zwar für immer. Ich will dich nicht mehr auf der Ranch sehen. Wenn du es dir einfallen lassen solltest, hier wieder aufzutauchen, lasse ich dich von meinen Leuten wegjagen! Ich bin es leid mit dir. Du verdammter Herumtreiber, du elender Faulenzer, du Großmaul! In meiner Jugend hast du mich aus dem Haus getrieben. Den Schwarzen hast du auf dem Gewissen. Und Jonny…«
Greg ging im Krebsgang bis an die Tür.
»Well, ich werde gehen. Aber du bereust es, John. Ich schwöre es dir, ich werde nicht eher rasten und ruhen, bis ich dich vernichtet habe. Neulich bin ich zurückgekommen, weil ich der klügere und bessere Mensch von uns beiden bin. Ich habe dir die Freundeshand geboten, und du hast darauf gespuckt. Das wirst du bezahlen, und zwar mit deinem Leben!«
»Hinaus!«
Greg Saunders verließ die Ranch.
Und diesmal kam er nicht zurück.
Aber der Rancher wußte, daß er seinen Bruder wiedersehen, und er wußte auch, daß das ein bitterer Tag für ihn werden würde.
*
In Tombstone hatten sich nach dem Kampf im O.K. Corral die Wogen noch immer nicht geglättet.
Die Clantons hatten ihre Toten in Särge gelegt, in deren Deckel sie über den Gesichtern Fenster eingeschnitten hatten. Tagelang konnte man die toten Banditen im Hankoker House betrachten. Eine wahre Wallfahrt setzte auf das Gebäude ein.
Mehrmals waren die tödlichen Wunden untersucht worden, da immer neue Protokolle angefertigt wurden.
Am Schluß zeigte es sich, daß Wyatt Earp und Doc Holliday genau wußten, was in der einen fürchterlichen Minute geschehen war, und es bei Aufnahme ihres Protokolls wahrheitsgemäß angegeben hatten.
Ike Clanton selbst hatte die Stadt zunächst verlassen. Wahrscheinlich mußte er den Schock überwinden, den der höllische Fight in ihm hinterlassen hatte.
Immer wieder schreckte ihn nachts das fürchterliche Stakkato, das die Geschosse in die Enge des Corrals verursacht hatten, aus dem Schlaf. Und grauenhafte Bilder quälten ihn.
Er sah seinen jüngsten Bruder Billy vorn am Tor fallen. Er sah das harte, entschlossene Gesicht des Dodger Marshals Wyatt Earp. Links daneben das bleiche eisäugige Gesicht Doc Hollidays. Rechts von Wyatt die abweisende Miene des Tombstoner Marshals Virgil Earp, und ganz rechts am Torpfosten den jungen Morgan Earp.
Sie waren gekommen, weil er, Ike Clanton, sie zu diesem Fight gezwungen hatte.
Virgel hatte gesagt, nehmt die Hände hoch, Boys.
Und beim Hochnehmen der Hände hatte der spitzbärtige Frank McLowery seinen Revolver gezogen und auf Wyatt Earp angelegt.
Bis zu seinem letzten Augenblick würde Isaac Clanton diese ersten Sekunden des Fights bestimmt nicht vergessen.
Gedankenschnell mußte Wyatt Earp gezogen haben, denn es blitzte an seiner linken Hüfte auf, und der verräterische Frank McLowery wurde schwer getroffen.
Was weiter geschah, hatte sich in der Erinnerung des Banditen völlig verwischt.
Curly Bill und Frank Stilwell hatten sich vorher aus dem Staub machen können. Und Bill Clayborne war buchstäblich im allerletzten Augenblick im hinteren Wagenabstellplatz verschwunden.
Dann war Tonn McLowery gefallen. Drüben sank Virgil Earp, der Tombstoner Marshal, in die Erde. Auch Morgan brach in die Knie. Nur Wyatt Earp und Doc Holliday standen noch.
Und dieser Anblick muß es wohl gewesen sein, der den eisenhaften Bandenführer zerbrochen hatte. Er hatte etwas gerufen, geschrien, dann hatte er die Arme hochgenommen und war vorwärtsgerannt.
Es mußte Wyatt Earp gewesen sein, der ihn zurückgestoßen hatte und ihn andonnerte: Kämpfe oder verschwinde! Da hatte er sich umgewandt und war geflohen. Durch die Rückfront des Wagenabstellplatzes und durch die Stallungen des O.K.Corrals war er mit kalkigem Gesicht auf die Allenstreet gekommen und hatte nur im Unterbewußtsein wahrgenommen, daß Jonny Behan bei seinem Anblick rasch im Sheriffs Office verschwunden war.
Isaac Clanton lebte zwar noch, war sogar völlig unverwundet, hatte überhaupt nur die erste Hälfte, ja, vielleicht nur fünfzehn oder zwanzig Sekunden des grauenhaften Gefechtes miterlebt, aber er zählte nicht mehr. Er zählte für alle Zukunft nicht mehr – wenn er es viel später noch einmal versuchen würde.
Die Stadt hatte sich in zwei Lager geteilt: Die eine Hälfte war für die Earps, die andere hielt zu den Clantons. Clantons verbreitete Verwandtschaft in Tombstone stand natürlich zu ihnen. Der Rest der Earp-Gegner bestand aus Menschen, die die Clantons nach wie vor fürchteten.
Da die Earp-Gegner mit der ersten Verhandlung nicht zufrieden waren, wurde tatsächlich, was im Westen einmalig war, eine zweite Verhandlung anberaumt. Wohl nicht zuletzt deshalb, weil Wyatt Earp, der ein reines Gewissen hatte, eine weitere Verhandlung forderte.
Die Clanton-Freunde, zu denen, wenn auch nicht öffentlich, der Hilfssheriff Behan zählte, hatten in der zweiten Verhandlung versucht, vor allem gegen den berühmten Wyatt Earp Material zu beschaffen. Nicht nur, weil sie in ihm den Anführer ihrer Gegner sahen, sondern weil sie davon überzeugt waren, daß er es war, der den Revolverkampf gewonnen hatte, zusammen mit seinem Freund Holliday.
Deshalb versuchten sie, ihm unter allen Umständen eine Grube zu schaufeln. Aber es gelang ihnen nicht. Der Stern, den die Earps bei diesem harten Gang abgelegt hatten, blieb dem Missourier.
Die Earps und Doc Holliday wurden von jeder Schuld freigesprochen. Es war der selbstgewählte Kampf der Clanton-Bande gewesen; der Fight, den ihrer Anführer den Gesetzesmännern regelrecht aufgezwungen hatten.
Der Gunfight war auf Seiten der Earps fair geführt worden. Daß drei Menschen dabei den Tod gefunden hatten, war furchtbar. Aber der Richter betonte, bei etwa dreißig Schüssen, die nachweislich in dem engen Hof gefallen waren, sei es unfaßlich, daß von neun Menschen noch sechs mit dem Leben davongekommen waren.
Die Macht der Clantons war gebrochen. Der gefährlichste der Bande, der dem Fight nur eben noch entronnen war, der Revolverschwinger William Brocius, der unter dem Namen Curly Bill in ganz Arizona berüchtigt und gefürchtet war, hatte die Stadt verlassen.
Auch die anderen Banditen hatten sich größtenteils aus dem Staub gemacht.
Virgil Earp gesundete bald wieder, und auch Morgan konnte sich recht schnell von seinen Verletzungen erholen.
Die beiden blieben in Tombstone; Virgil, weil er einfach dazugehörte, und Morgan, weil er beschlossen hatte, Deputy bei seinem Bruder zu werden.
Völlig spurlos schien das Gefecht an Doc Holliday vorübergegangen zu sein. Nach den Verhandlungen saß er am grünen Spieltisch wie eh und je. Und als ihm der Keeper vom Crystal Palace eines Abends ins Ohr flüsterte, daß Wyatt Earp die Stadt verlassen habe, rührte sich im Gesicht des Gamblers kein Muskel. Mit ausdruckslosen Augen sah er vor sich hin und spielte weiter, als berührte es ihn nicht im geringsten, als habe er mit dem Marshal Earp niemals etwas zu tun gehabt.
Wyatt Earp wollte zurück nach Dodge reiten, in die alte Treibherdenstadt, die er erst vor wenigen Jahren mit dem eisernen Besen saubergefegt hatte.
*
Es war früher Morgen.
Auf dem weiten Hof der Saunders Ranch herrschte schon geschäftiges Leben. Vorn neben dem Tor wurden Holzstämme zersägt. Aus der Schmiede drang helles, klingendes Hämmern, und dann stieg beizender Qualm vorn vom Horn eines Pferdehufes hoch.
Im Stall wurde gefegt und geschrubbt, und drüben an der kleinen Scheune zimmerten drei Cowboys einen neuen Türflügel.
Quietschend ging in der Hofmitte die Brunnenwinde, mit der die beiden Mägde das Wasser aus der Tiefe holten, um es in die Küche und in die Waschkammer zu bringen.
John Saunders war, wie so oft in den letzten Tagen, nach schlafloser Nacht aufgestanden und stand müde und zerschlagen drüben am Corral.
Der Rancher durchquerte die weite Pferch und streichelte seinen alten Braunen, auf dessen Rücken er vor vielen Jahre, als seine Frau noch lebte, den kleinen Jonny durch den Hof geführt hatte. Jonny!
Der Gedanke an den Jungen quälte den Rancher sehr. Warum hatte er den braven Jungen gehen lassen? Wegen Greg! Wegen eines Schurken!
Wo mochte der Bursche sein? Er hatte weder Geld noch sonst etwas bei sich, wovon er hätte leben können. Also mußte er irgendwo einen Job angenommen haben.
John Saunders hatte seine Boys auf alle Rancher der Umgebung geschickt. Ohne Erfolg!
Er selbst war in Little Blue gewesen und hatte dort ebenfalls nichts erreicht. Der Cowboy Jonny Saunders blieb verschwunden. Auch von der Indianerin Nointa, die die Ranch mit ihm verlassen hatte, vermochte niemand eine Spur zu entdecken.
Als mehrere Reiter vor einer Wolke von Staub auf die Ranch zustoben, beschattete der Rancher die Augen mit der Hand.
Jonny ist nicht dabei, sagte er zu sich selbst.
Es waren sieben Reiter. Genauer gesagt acht, denn einer sprengte vor ihnen her. Ein mittelgroßer blaßgesichtiger Bursche mit schiefergrauen Augen. Greg Saunders!
Die Männer im Hof hielten den Atem an, als sie ihn erkannten und die sieben Reiter musterten, die ihm folgten.
Greg hielt neben dem Brunnen an und gab zwei Schüsse zur Veranda hinüber ab.
»John, altes Großmaul, wo steckst du?«
Mit schweren harten Schritten verließ der Rancher den Corral.
Als Greg ihn sah, schob er den Revolver ins Halfter.
John Saunders blieb fünf Schritte vor ihm stehen und musterte ihn voller Verachtung.
»Fällt dir nichts auf, Brother?« rief Greg mit krächzender Stimme.
»Doch, Greg. Es fällt mir auf, daß du ein Schießeisen trägst.«
»Gut, daß es dir auffällt, John. Und da du weißt, wozu diese Dinger dienen, wirst du hoffentlich bei deinen weiteren Worten vorsichtiger sein.«
»Was willst du?« fragte der Rancher.
Greg lachte zynisch. »Zunächst wollte ich dir einen Gruß meines Freundes Curly Bill bestellen.«
»Curly Bill?« entfuhr es dem Rancher.
»Yeah. Ich sehe, daß du ihn kennst. Ein großartiger Bursche. Hat eine prächtige Crew um sich versammelt. Das hier ist sein County.«
»Und was willst du hier?« wiederholte der Rancher seine Frage.
Greg Saunders stützte sich mit dem linken Ellbogen auf das Sattelhorn und grinste den Bruder höhnisch an.
»Und was ich hier will, sagte ich schon. Curly Bill ist jetzt hier im County der Boß. Das läßt er dir sagen. Und zum Zeichen dafür, daß du damit einverstanden bist, wirst du morgen um diese Zeit tausend Dollar an ihn mitgeben.«
Da stieß der Rancher den Atem vor.
»Verschwinde!«
Langsam richtete sich der Ire im Sattel auf.
»All right, John, ich reite jetzt. Aber morgen früh um diese Stunde bin ich zurück mit den Boys. Und wenn du dann die tausend Dollar nicht freiwillig geholt hast, gibt’s Zunder. Du weißt also Bescheid!«
*
In der Frühe des nächsten Morgens stand John Saunders mitten auf seinem Hof. Norman Teck, der Vormann, stand mit hartem Gesicht und finsterem Blick neben ihm.
»Er hat sich die Zeit verdammt gut ausgesucht!« knurrte Teck.
»Yeah«, gab der Rancher zurück.
»Er weiß, daß Sie mit ein paar alten Burschen hier allein sind, daß der Hauptteil der Crew auf dem Trail ist, und daß ich mit dem kleinen Rest unabkömmlich auf der Weide draußen hänge. Es war doch purer Zufall, daß ich gestern abend zurückkam.«
»Haben die Männer ihre Waffen bereit?«
»Yeah, Boß. Aber Sie sollten sich mit dem Gedanken befreunden, daß die Männer nicht viel ausrichten werden. Wir müssen uns damit abfinden, daß wir praktisch nur Ihr Gewehr und meinen Revolver haben. Kid Maduse ist über siebzig, Laffort auch, die anderen sind wenig jünger, und der alte Sam Barney ist fast achtundsiebzig. Das sind keine Schützen mehr. Vielleicht wäre es besser, wenn sie erst gar nicht mit ihren Kanonen in Erscheinung treten würden.«
»Wie meinen Sie das?«
»Wenn es wirklich Curly Bills Leute sind, ist nicht mit ihnen zu spaßen. Sie mähen die alten Burschen nieder, ehe die ihre Flinten auch nur hochbekommen haben. Das bringt uns doch nichts ein.«
»Sie haben recht, Teck. Anderen Leuten würden einige Cowboys mit Revolvern und Gewehren vielleicht noch Eindruck machen. Den Halunken, die gestern hier waren, sicher nicht.« Der Rancher seufzte. »Well, sagen Sie den Männern, daß sie die Waffen wieder fortbringen und stur an ihrer Arbeit bleiben sollen.«
»All right, Boß.«
Der Vormann stiefelte davon.
Auf dem Hof wurde gearbeitet wie an jedem Tag. Nichts deutete darauf hin, daß die Ranch eine Horde schießwütiger Banditen erwartete.
Und dann kamen sie, schneller und eher als erwartet. Gewaltig wirbelte der Staub hinter ihren Pferden hoch, bildete eine gelbgraue Wolke, die sich erst nach Sekunden legte. Greg Saunders war wieder an ihrer Spitze.
Teck knurrte:
»Ob ich den Burschen wecke, der drüben im Bunkhouse schnarcht?«
»Wen?« fragte der Rancher, ohne dem Vormann das Gesicht zuzuwenden.
»Ah, nichts von Bedeutung. Ein Cowboy wahrscheinlich. Er kam gestern abend spät und fragte, ob er hier übernachten könne. Will weiter nach New Mex.«
Saunders winkte ab.
»Der kann uns auch nichts nützen.«
Da sprengte der Trupp der Banditen schon in den Hof.
Greg Saunders brachte sein Pferd so nahe vor dem Rancher und dem Vormann zum Stehen, daß die beiden von der Staubwolke eingehüllt wurden.
»Hallo, John! Ah, ich sehe, du hast dir Verstärkung von der Weide geholt.«
»Irrtum, Saunders«, entgegnete Norman Teck rauh. »Ich kam zufällig gestern abend auf die Ranch. Aber ich sehe, daß Sie hier mit jedem Mann gerechnet haben!«
Greg zischte:
»Der Kerl hat ein ziemlich großes Maul, findest du nicht auch, Fred?«
Der Bandit Fred Gennan grinste und kam näher heran.
»Kannst recht haben, Greg!«
Der Rancher hatte ein finsteres Gesicht.
»Was willst du hier?«
Greg sah sich zur anderen Seite um, so wenige Yards hinter ihm ein dunkelhäutiger Mann mit schmalem Schnurrbart, schwarzen Augen und glattem Gesicht im Sattel saß. Er trug sich mexikanisch und hatte eine lange Bullpeitsche an der Schulter. Tief über den Oberschenkeln hingen in mit Silbernägeln bestückten Halftern zwei große vierundvierziger Colts.
»Cherry! Hast du das gehört?«
Der berüchtigte Grenzbandit Manuel »Cherry« Pika verzog keine Miene. Fast leise entgegnete er:
»Yeah, ich habe es gehört.«
Greg sah seinen Bruder höhnisch an.
»Du weißt, weshalb ich hier bin, John. Raus mit den tausend Böcken, die du Bill schuldest!«
»Wem schulde ich tausend Dollar?« fragte der Rancher scharf.
»Curly Bill!«
»Ich schulde niemandem einen roten Cent, Greg. Es wäre gut, wenn du dir das einprägen würdest. Im Gegenteil, ich kenne einige Leute, die mir Geld schulden.«
Greg lief rot an.
»Pika!«
Der Grenzbandit näselte:
»Ich bin hier!«
»Hast du das gehört?«
»Yeah.«
Langsam kamen auch die anderen näher, so daß sie jetzt eine gerade Front vor dem Rancher und dem Vormann bildeten.
»Was soll das lange Gefasele«, schnarrte Cherry Pika. »Raus mit dem Geld. Ich habe keine Lust und keine Zeit, mich mit dem Kuhknecht abzugeben.«
Dem Vormann zuckte es in den Händen.
»Hör zu, mein Junge, wenn du vielleicht Manuel Pika sein solltest, so kann ich nur hoffen, daß bald ein Sheriff auf deinen Fersen sitzt.«
Der Bandit wurde vor Zorn einen Ton dunkler im Gesicht.
»Yeah, Kuhknecht, ich bin Manuel Cherry Pika, und die Tatsache, daß du mich kennst, ist dein Pech.«
Blitzschnell zog er den Revolver.
Der Schuß stieß dem Vormann den Hut vom Schädel.
»Los, erst bringst du das Geld her«, schnarrte Pika.
Greg Saunders sah die bestürzten Gesichter der Cowboys drüben am Stall. Er sah auch, daß das Gesicht seines Bruders grau geworden war. Diese Situation glaubte er nützen zu müssen.
»Es wird Ernst, Mister Saunders«, spöttelte er.
»Spuck die Bucks aus, Rancher!« meldete sich Fred Gennan.
Dann schossen Pika und Gennan zusammen.
Auf der rechten Wange des Ranchers brannte eine blutrote Wunde.
»Ihr habt sowieso ausgespielt!« krächzte der kleine Joe McLean.
John Saunders blickte in die Augen seines Bruders.
»So geht es also mit dir zu Ende.«
Mit sich überschlagender Stimme kreischte Greg:
»Vorbei mit deinen Predigten! McLean hat recht, du hast ausgespielt! Curly Bill hat entschieden, daß die Ranch mir gehört!«
Wieder jonglierte Pika mit dem Colt, um einen weiteren Schuß auf den Rancher abzugeben.
Aber ehe der Bandit den Abzug durchziehen konnte, brüllte von der linken Hofseite her ein schwerer fünf-undvierziger Revolver auf. Das heranfauchende Geschoß stieß dem Verbrecher den Revolver aus der Hand.
Pikas Kopf flog herum.
Auch Saunders und die anderen Curly-Bill-Leute sahen zur Seite. Verdutzt blickten der Rancher, Teck und die anderen hinüber, wo in dem Häuserspalt zwischen Bunkhouse und Stall ein Mann stand.
Er war groß, breitschultrig und schmalhüftig. Sein Gesicht war wetterbraun, und unter dem tief in die Stirn gezogenen schwarzen Hut blickte ein stahlblaues Augenpaar hervor. Es war ein hartes, markant geschnittenes Gesicht.
Er trug ein weißes Hemd und eine schwarze, sauber gebundene Halsschleife. Schwarz waren auch die kurze Weste und die enganliegende Hose, die unten über die hochhackigen, mit Steppereien besetzten Texasstiefel hing. Auch der breite büffellederne Waffengurt war schwarz und hielt zwei Revolverhalfter.
Als Pika den Kopf gewendet hatte, hielt der Fremde keine Waffe in der Hand. Und doch mußte der Schuß von ihm gekommen sein.
Fünf Sekunden krochen über den breiten Ranchhof.
Die Frage, die dann der Rancher aussprach, hätte auch von den Banditen kommen können.
»Wer ist denn das?«
Teck krächzte: »Das ist doch der Cowboy, von dem ich Ihnen erzählt habe.«
Greg Saunders, der nichts begriff, rief schrill:
»Hat der da eben geschossen?«
»Sieht so aus«, knurrte Pika. »Aber es war ganz bestimmt die größte Dummheit seines Lebens.«
Rasch griff der Bandit zu seinem zweiten Revolver und riß ihn hoch. Er hatte ihn noch nicht gespannt, als es drüben an der linken Hüfte des Fremden aufblitzte.
Cherry Pika war auch seinen zweiten Colt los.
Die Stille im Hof hatte Bleigewicht.
Es war Greg Saunders, der plötzlich kreischte:
»Was ist denn los, Männer? Ihr laßt euch von diesem einzelnen Kerl da überfahren?«
Der Ire begriff wieder einmal gar nichts. Wie er dieses Land nicht verstand, so verstand er auch nicht seine Menschen.
Greg Saunders riß seinen Revolver hoch.
Aber nicht ihm galt das nächste Geschoß des Fremden, sondern dem säbelbeinigen, schlitzohrigen Outlaw Joel McLean, der zugleich mit Greg, nur bedeutend schneller gezogen hatte.
Während der Fremde den übergroßen sechskantigen Revolver hoch über den Mittelfinger der Linken rotieren ließ, röhrte auf der anderen Seite die rechte Waffe los.
Greg brüllte auf, als sei er verletzt worden, und doch hatte der Fremde ihm nur mit der Kugel die Waffe aus der Hand gestoßen.
Mit schmalen Augen blickte Joe McLean auf den Colt, der neben den Vorderhufen seines Pferdes im Staub des Ranchhofes lag.
Fred Gennan, der nur einen Sekundenbruchteil mit dem Gedanken gespielt hatte, auch zu ziehen, war der erfahrenste der Bande. Er wandte sich dem Rancher zu.
»Da haben Sie sich ja einen prächtigen Revolvermann zugelegt, Saunders.«
Der Fremde, der die großen schwarzknäufigen Colts mit geradezu brillanten Handsaltos in die Lederhalfter hatte zurückfliegen lassen, kam dem Rancher mit der Antwort zuvor.
»Sei vorsichtig, Gennan!« Während er langsam näher kam, schien es so, als habe er den Blick nur auf den Brunnen gerichtet und die Reiter nicht mehr im Auge.
Es war das Pech des gnomenhaften Outlaws Andy Lederer, daß er das annahm. Er glaubte eine Chance für seinen hundertfach geübten Trickschuß durch den Halfterboden zu bekommen.
Doch da sah er schon die Mündung eines der beiden Revolver des Fremden auf sich gerichtet.
»Nicht doch, Junge. Bei solchen Sachen werde ich ärgerlich.«
Mit wutverzerrtem Gesicht nahm Lederer die Hand wieder hoch.
Der Fremde ging weiter, bis er fast neben dem Rancher stand.
»Nett, daß wir uns kennenlernen, Boys. Ich bin ein neuer Cowboy von Mister Saunders. Er weiß übrigens noch nichts von seinem Glück. Ich wollte es dem Vormann gerade beibringen. Es ist immer gut, wenn man weiß, was für Leute sich in der Gegend herumtummeln. Ihr gehört also zu Curly Bill. Na, viel Fuore kann er ja mit solchen Figuren nicht machen. Cherry Pikas Schnurrbart grinst einem doch von jedem schwarzen Brett entgegen, und Fred Gennan und Joel McLean hätten sich auch besser aus Ariziona verduftet. Aber was Curly Bill mit dieser Gipsfigur hier anfangen will«, dabei deutete er mit dem Kinn auf Greg Saunders, »ist mir direkt ein Rätsel. – Hallo, Rancher. Mein Name ist Berry. Natürlich habe ich noch ein paar andere Namen, aber es hat wenig Zweck, Sie damit zu belästigen. Wie steht’s mit dem Job? Ich bin an jede Sattelarbeit gewöhnt, bin Lassoreiter und Trailmann. Und wenn es sein muß, bin ich mit dem Revolver auch zur Stelle.«
John Saunders schluckte. »Yeah, davon bin ich überzeugt«, sagte er heiser.
Dann wandte der Fremde den Kopf den Banditen zu.
»Moment mal! Das Gelichter ist ja immer noch hier? Verschwindet, Boys. Ich könnte mir vorstellen, daß ihr nicht gerade scharf darauf seid, eurem Boß einen schönen Gruß von mir auszurichten.«
Da wandte Fred Gennan das Pferd.
Aber die heißen Minuten auf dem Saunders-Ranchhof waren noch nicht vorüber. Ganz rechts außen hatte der Muskelprotz Owen Thumb auf seinem Pferd gesessen. Mit steigendem Mißbehagen war er den Ereignissen gefolgt. Jetzt rutschte er aus dem Sattel und kam mit schweren stampfenden Schritten heran. Er blieb vor dem Rancher stehen und wies auf den Fremden.
»Ist das einer Ihrer Cowboys, Saunders – Oder ist das ein Schießer?«
»Er ist einer meiner Cowboys«, erwiderte der Rancher heiser.
Dann schnallte der Muskelprotz seinen Waffengurt ab und warf ihn hinter sich, krempelte seine Hemdsärmel hoch und spie in die Hände.
»Dann werde ich dem Jungen gleich mal die Schnauze polieren. Come on, Boy!«
Der Fremde blickte den Rancher an.
»Sie werden wahrscheinlich wichtigere Arbeiten für mich haben, Boß, aber die zwei Minuten werden sch nach Feierabend schon rausschinden lassen.«
»Zwei Minuten«, röhrte der untersetzte Bandit Thumb. »Mensch, so lange stehst du doch nicht auf den Beinen! Owen Thumb hat noch jeden Burschen, den er sich vorgenommen hat, zurechtgestutzt. Dich Großmaul aber werde ich in den Boden stampfen!«
Damit stürmte er auf den Fremden zu. Wild schwingend riß er einen rechten Haken nach vorn, der aber über Berrys etwas abgeduckten Kopf hinwegpfiff.
Der neue Saunders Cowboy wuchtete unter der hochgerissenen Rechten des Banditen eine steifangewinkelte Linke in die kurzen Rippen des Gegners. Sofort darauf ließ er eine krachende Rechte gegen den Schädel folgen.
Diese blitzschnelle Doublette verfehlte ihre Wirkung auf Thumb nicht. Schwer atmend stand er da und sah den Gegner verblüfft an.
»He, da hast du Glück gehabt, Brother. Aber jetzt fängt Owen Thumb erst richtig an. Hier, jetzt kommen die Sachen – das, und das!« Bei jedem Ruf schickte er einen wilden Schlag nach vorn, der aber entweder auf der Deckung des Fremden zerplatzte oder aber überhaupt danebenging. Der Fremde steppte zur Seite und rief dem Rancher zu: »Ich sehe, daß Sie die Sache langweilt, Boß. Zwar sind meine zwei Minuten noch nicht um, aber mich langweilt dieser Halunke auch.«
Und dann kam er, ein linker Uppercut, der wie der Prankenhieb einer Raubkatze genau auf die Kinnspitze krachte und Owen Thumb vom Boden hochzuheben schien.
Der Outlaw kippte über seine Absatzkanten nach hinten und stürzte der Länge nach in den trockenen Staub des Ranchhofes.
Cowboy Berry blickte Fred Gennan an.
»Tu mir den Gefallen, Fred, und nimm den Burschen mit, der liegt hier nur im Weg herum.«
Mit finsterem Gesicht stieg Gennan aus dem Sattel, packte den Körper des Zweizentnermannes, schleppte ihn zu seinem Pferd und rief dem schlitzäugigen Lewt Brown zu, Thumbs Waffengurt aufzuheben. Zu zweit schoben sie den schwerbetäubten Tramp in den Sattel.
Wie ziemlich begossene Pudel trotteten die Banditen aus dem Ranchhof hinaus.
Schweigend blickten drei Männer in der Hofmitte hinter ihnen her.
Der Vormann räusperte sich und blickte den Fremden an.
»Das mit dem Job, das war wohl nur ein Scherz?«
»Keineswegs. Wenn hier noch ein Job frei ist, nehme ich ihn gern.«
Norman Teck schnäuzte sich umständlich die Nase.
»Den Winter über können wir allerdings keine Leute mehr gebrauchen. Aber jetzt für ein paar Wochen ist uns jeder Mann lieb.«
»Genau das paßt mir«, entgegnete der Fremde.
Teck sah den Rancher an.
»Was sagen Sie, Boß?«
John Saunders musterte den Fremden forschend und erklärte dann: »Was gibt’s da noch zu sagen? Er hat uns aus der Klemme gerissen, und wir sind ihm zu Dank verpflichtet. Wenn er nur ein halb so guter Cowboy ist, wie er schießen kann, kann er meinethalben fünf Winter hindurch bei uns bleiben.«
»All right, Boß«, meinte Berry. »Dann werde ich mich gleich mal an die Arbeit machen. Hoffentlich haben Sie auch noch andere Dinge zu besorgen als solche, die mit dem Revolver erledigt werden müßten.«
Der Rancher blickte ihn ziemlich ernst an.
»Ganz sicher, Mister Berry. Aber im Augenblick ist es leider so, daß ein Mann, der so gut mit dem Revolver umzugehen versteht, auf der Ranch wichtiger ist als alles andere.«
Normen Teck teilte den Neuen zu einer Arbeit am Corral ein. Dann ging er zusammen mit dem Rancher zum Stall hinüber, wo eine Fuchsstute ein Fohlen erwartete.
Ein alter Cowboy kniete neben dem Tier in der Box und sah dem Boß entgegen.
»Hell and devils. Ich habe den Mann schon gesehen!«
»Wen?« fragte der Vormann rasch.
»Den mit dem Revolver.«
Der Rancher beugte sich zu dem Alten nieder.
»Du kennst ihn, Jeff?«
»Yeah.«
»Wer ist es?«
»Ich weiß es nicht – kann mich auch nicht mehr daran erinnern, wo ich ihn gesehen habe. Aber ich habe ihn gesehen. Darauf kann ich einen Eid schwören. Und auch da spielte der Colt eine Rolle. Ich wußte es sofort, als ich seine Hände hier durch die Ritze der Wand sah. So etwas von Schnelligkeit habe ich nicht wieder erlebt.«
»Das muß ich auch sagen«, knurrte der Vormann.
Der Rancher hatte eine steile Falte zwischen den Brauen stehen, als der Vormann sagte:
»Vielleicht ist er wirklich ein bekannter Schießer.«
»Und wenn!« stieß John Saunders rostig hervor. »Wir brauchen ihn jetzt! Nur das zählt. Er kam buchstäblich wie gerufen – im allerletzten Augenblick. Wir wollen uns nichts vormachen, Teck. Was hätten wir gegen Greg und seine Kerls ausrichten wollen? Es waren regelrechte Banditen. Und vielleicht war es keine Lüge, daß sie zu Curly Bill gehörten. Leider muß ich meinen lieben Bruder jede Schweinerei zutrauen.«
»Was mir auffiel war, daß Berry einige von der Bande zu kennen schien. Cherry Pika zum Beispiel, von dem ich auch schon gehört habe, den ich aber niemals zuvor sah.«
»Well, er kannte sie, aber sie kannten ihn nicht.«
Schnell kam die Nacht.
Greg Saunders ließ diesmal keine Nacht verstreichen.
Kurz vor zwölf schlugen die beiden Hunde an.
Als der Rancher aus seinem Zimmer mit dem Windlicht zum Vorbau lief, stürmte auch der Vormann schon drüben aus dem Bunkhouse.
Mehrere Reiter sprengten in den Hof. Greg Saunders war bei ihnen. Der Rancher sah ihn sofort.
Und dann trat ein anderer Mann, den er noch nicht auf dem Hof gesehen hatte, in den zuckenden Schein des Windlichtes. Es war ein großer, stämmiger Mensch mit wildem Schnauzbart, kurzer eingeschlagener Nase und weit vorspringendem Kinn. Sein struppiges rotes Haar umwucherte ein nach unten seltsam unförmig sich verbreiterndes Gesicht.
Weit stand das schreiendrote Hemd über der haarigen Brust offen. Die beiden Revolver hingen so tief auf den Oberschenkeln, daß man davon überzeugt sein konnte, einen wirklichen »Zweihandmann« vor sich zu haben. Mit nach innen gesetzten Stiefeln stampfte er an Greg vorbei auf den Vorbau.
»He, du bist John Saunders? Mensch, was hat mir mein neuer Mann hier berichtet? Du hast dir einen Coltman angelacht? Raus mit dem Burschen. Ich habe eine Schwäche für diese Stümper, die sich hier im Land herumtreiben! – Mein Name ist William Brocius, aber ich bin berühmt als Curly Bill!«
Er hatte tatsächlich berühmt gesagt, der berüchtigte Tombstoner Desperado.
»Wo ist der Halunke! Ich will ihn auseinandernehmen. Kleine Wichte gibt’s eine Menge. Und die, die sich größer machen wollen, muß man am besten gleich skalpieren. Vorwärts, Saunders, wo ist der Bursche, der sich da mit ein paar albernen Tricks dick machen wollen? Ich habe die richtige Medizin für diese Boys. Gleich mit der Nase in den Dreck. Wenn solche Kerle ein paar Unzen Blei zwischen den Rippen haben, kommen sie meistens zu Verstand. Entweder sind sie dann in meiner Crew – oder ich schicke sie auf den Boot Hill! Du mußt zugeben, daß dies die beste Methode ist!« Diesem leiser hervorgestoßenen Geschwafele folgte eine röhrende Lache.
Greg stieß seinen Bruder an.
»Los, schick den Revolverjungen raus. Bill macht ihn fertig, und dann ist das erledigt. Dann spuckst du die Dollars aus.«
Hart fuhr die Hand des Ranchers in das Gesicht des Bruders.
Greg Saunders torkelte zurück.
Da stieß der Tombstoner Bandit aus der zerschlagenen Crew des Ike Clanton mit einem Wutschrei die Hand zum Colt.
»Nicht so hastig, Brocius!« kam da eine schneidende Stimme über den Ranchhausvorbau.
Der Desperado verharrte in der Bewegung, stand wie versteinert da und lauschte dem Ton der Stimme nach.
Er kannte sie genau. Zu genau!
Da kam ein harter, sporenklirrender Schritt über die Vorbaubohlen bis in den äußersten Kreis des Windlichtes. Curly Bill erkannte auch den Schritt – und jetzt den Mann.
»Hölle und Verdammnis! Wyatt Earp!« entfuhr es ihm.
Friedhofsstille herrschte auf der Veranda.
Bis Cherry Pika brüllte: »Bist du verrückt, Boß? Wer ist das?«
Der Desperado wandte sich ganz herum und starrte den verhaßten Mann aus Missouri an.
Wyatt Earp war doch gerade erst in Dodge gewesen, wo Curlys Freunde ihm und Doc Holliday den Prozeß hatten machen wollen. Well, er war freigekommen, aber wie konnte er so plötzlich hier, ausgerechnet hier in der neuen Zone, im »County« Curly Bills auftauchen?
Langsam öffneten sich die wulstigen Lippen des Verbrechers:
»Wyatt Earp!« wiederholte er. »Yeah, Pika, er ist tatsächlich Wyatt Earp!«
Der Grenzbandit trat neben Curly Bill.
»Aber das ist doch Unsinn. Du mußt dich irren! Wie kann er denn Wyatt Earp sein? Er ist ein Cowpuncher, ein Schießer, yeah, und ein Schläger. Er hat mir die Colts aus beiden Händen geschossen und Owen Thumb auseinandergenommen wie eine Kartoffel. Aber Wyatt Earp – kann er doch nicht sein!«
Ohne Pika anzusehen stieß Brocius hervor:
»Halt’s Maul, Pika. Was ich sage, stimmt. Niemand kennt diesen Mann besser als ich. Es ist Wyatt Earp!«
Fred Gennan wich zurück und suchte ins Dunkel zu kommen. Und der kleine McLean wollte ebenfalls verschwinden.
Andy Lederer war so bestürzt, daß er erneut seinen Trick vom Morgen anzuwenden gedachte.
Da hob Curly Bill die Hand.
»Nichts da, Leute. Das geht ins Wasser!«
»Wieso denn?« zeterte McLean. »Der Mann ist doch wegzupusten.«
»Das sieht nur so aus«, belferte der Bandenführer. »Und da waren schon bessere Männer als du, Joel, die ihn gern von den Beinen geholt hätten. – Vorwärts, Boys. Wenn das der neue Cowboy ist, dann haben wir hier nichts mehr zu suchen!«
Mit düsteren verkniffenen Gesichtern zogen sie sich in ihre Sättel.
Als Curly Bill auf seinem Rotschimmel saß, wandte er sich noch einmal um. »All right, Marshal, die Runde geht an Sie. Aber ich habe diesmal den längeren Atem. Denn ewig können Sie ja nicht hierbleiben.«
»Irrtum, Brocius. Ich bleibe genau so lange hier, bis ich dir sämtliche Zähne gezogen habe. Und nun zieh ab, sonst gibt’s noch Regen!«
Mit gefletschten Zähnen nahm der Desperado die Zügel auf und trabte vor seinen »Boys« aus dem Ranchhof.
Auf der Veranda war es still.
John Saunders stand da und spannte beide Hände um das Windlicht, das einen zuckenden Schein über die rohbehauenen Dielen bis hin zu dem großen Mann schickte, der also nicht irgendein unbekannter Cowboy, sondern der berühmte Wyatt Earp war.
Der alte Peon, der am Morgen gesagt hatte, daß er den Fremden schon gesehen hatte, rief:
»Jetzt weiß ich es. Ich habe ihn in Wichita auf der Mainstreet gesehen, als er Mannen Clements und seine Boys zum Teufel jagte! By Gosh! Er ist Wyatt Earp! Der große Wyatt Earp!«
Beklommene Stille.
Endlich löste sich der Vormann unten von seinem Platz neben der Vorbautreppe und kam auf die Veranda. Er sah zu dem Missourier hinüber.
»Es ist also wahr: Sie sind wirklich Wyatt Earp?«
»Yeah, Mister Teck.«
»Und weshalb haben Sie es uns nicht gesagt?«
»Weil es absolut unnötig war. Wenn Curly Bill erfahren hätte, daß ich es bin, der seine Leute so hat abfahren lassen, dann hätte er sich schwer gehütet, sich selbst so offen hier zu begeben. Jetzt hat er es getan. Er hat sich damit bloßgestellt. Es war eine doppelte Abfuhr, die er heute einstecken mußte. Selbstverständlich wird er nun auf Rache sinnen; aber dazu braucht er Zeit. Und diese Zeit wird auch uns nützen…«
»Uns…?« fragte der Rancher etwas rauh.
»Yeah, uns! Denn wenn Sie nichts dagegen haben, Rancher, bleibe ich noch eine Weile.«
John Saunders’ Augen blitzten.
»Was könnte ich dagegen haben. Es ist mir eine Ehre, daß Sie hier bei uns sind und uns geholfen haben. Aber was soll jetzt werden? Curly Bill weiß jetzt, daß Sie hier sind. Er wird vermutlich jetzt mehr Leute ansammeln, um schwereres Geschütz aufzufahren. Darüber kann es doch kaum einen Zweifel geben.«
»Stimmt genau. Nur – er braucht Zeit dazu, die auch wir her nützen können.«
»Und was glauben Sie, was wir noch tun könnten? Unsere jungen Leute sind auf dem Trail nach Santa Fé. Mein Bruder wußte das genau. Deshalb hat er jetzt zum Schlag gegen mich ausgeholt. Er träumt davon, daß er die Ranch bekommt. Erst hat er unseren schwarzen Hausdiener aus dem Haus getrieben, dann meinen Jungen – und eine kleine Indianerin.«
»Ihren Jungen?«
»Yeah«, versetzte der Rancher mit gesenktem Kopf.
»Er ist mit einer Indianerin weggeritten?«
»Sie lebt seit vielen Jahren auf der Ranch. Mein Sohn ist mit ihr aufgewachsen. Ich weiß, daß sie ihm alles bedeutet.«
»Sie wissen nicht, wo er ist?«
»Nein, Marshal. Ich habe ihn schon auf den umliegenden Ranches suchen müssen. Denn er kann doch nur auf einer Ranch arbeiten.«
John Saunders berichtete dem Missourier, wo überall er schon hatte nach seinem Jungen suchen lassen.
Wyatt Earp nickte. »All right. Ich glaube, es ist das beste, wenn wir uns jetzt schlafen legen.«
»Glauben Sie nicht, daß Curly Bill zurückkommen wird?«
Ein stilles Lächeln blinkte in den Augenwinkeln des Marshals.
»Nein, Rancher, ganz sicher nicht.«
*
Als Jonny Saunders die Ranch seines Vaters verlassen hatte, wandte er sich dorthin, wo ihn niemand suchen sollte, nach Südosten, der Stadt Harpersville zu.
Was seinen Weg erheblich erschwerte, war der Umstand, daß er die Frau bei sich hatte. Kein Reiter wirkte so lächerlich wie der, der eine Frau vor sich im Sattel hat.
Er wußte, wie die meisten Leute in diesem Land die Indianer noch immer haßten. Aber um keinen Preis hätte er das unglückliche Mädchen auf der Ranch zurückgelassen.
Jonny verstand seinen Vater nicht mehr. Wie hatte er diesen Bruder, dessen Charakter er doch kennen mußte, überhaupt nach Amerika kommen lassen können? Greg war doch ein durch und durch bösartiger Mensch, der mit allen Mitteln die Ranch an sich reißen wollte. Wenn der Vater das nicht merkte, wenn seine Nachsicht dem Bruder gegenüber so groß war, dann trug er selbst die Schuld an seinem Untergang. Jonny wollte an diesem Ende nicht mitschuldig sein, es nicht einmal mit ansehen.
Er hatte es so eingerichtet, daß er erst bei Einbruch der Dunkelheit in die Stadt kam. Schnell aber bog er von der Mainstreet ab und suchte einen Mietstall auf.
Er hatte zwar nur ein paar Dollar bei sich, aber er konnte es nicht riskieren, Nointa bei dem Pferd allein auf der Straße zu lassen.
Der Mietstallbesitzer war ein alter Mann mit weißem Haar und breiter Nase, zahnlosem Mund und gewaltigen Kinnladen. Er schien nicht nur schwerhörig zu sein, sondern auch noch halbblind.
Nachdem Jonny sich davon überzeugt hatte, daß niemand in den Stallungen war, forderte er Nointa auf, bei dem Schimmel zu bleiben. Er selbst machte sich auf den Weg.
Als er die Mainstreet erreichte, sah er in dem aus den Fenstern von Joe Wimmerts Blechhütte fallenden Lichtschein eine Reihe Pferde stehen.
Der Bursche blickte über die Schwingarme der Pendeltür in den Schankraum. An der Theke lehnten sich mehrere Männer in Cowboytracht.
Jonny schob die Tür auseinander und trat ein. Zu spät bemerkte er die Frau, die aufgeputzt wie ein Pfau girrend zwischen den Tischen herumtanzte. Es war Mary Frosch.
Als sie seiner ansichtig wurde, stürzte sie sofort auf ihn zu und rief: »Ah, da kommt ja dieser hochnäsige Bursche auch einmal in die Blechhütte. Na, Kleiner, was macht denn der Stadtfrack, den ihr neulich von der Bahn abgeholt habt? War der nach Schaf stinkende Schnauzer etwa dein Vater? Ich muß sein Gesicht hier schon mal gesehen haben.«
»Ja, Miß Frosch«, entgegnete Jonny kühl, »er hat hier mal einen Whisky getrunken.«
Da zeterte das Dancing Girl: »Was fällt dir ein, Kleiner! Mein Name ist Queen, Mary Elisabeth Victoria Queen. Aber natürlich ist das zuviel für ein Spatzengehirn, wie du es unter deinem Lausedeckel trägst.«
Der Bursche wandte sich ab.
Da brüllte die aufgetakelte Frau hinter ihm her: »He, Boys, riecht ihr den Schafsgestank nicht? Schmeißt ihn raus, den stinkenden Burschen. Nicht genug, daß er Schafzüchter ist und eure Weide verdirbt, wagt dieser Bengel es auch noch, mich zu beleidigen. Raus mit ihm!«
Die Männer an der Theke hatten sich umgewandt. Aber bei dem Anblick des kräftigen Burschen machte keiner von ihnen Anstalten, der Aufforderung der Frau nachzukommen.
Da packte die Frau ein Glas Bier und schleuderte es auf den Boden.
»Ihr Feiglinge! Alle miteinander seid ihr Feiglinge.«
Der Wirt rannte zum Orchestrion und warf eine Münze in den Schlitz. Hämmernd spie der große Musikkasten den Arizonasong in den verqualmten, lärmerfüllten Raum.
Kalter Zorn flammte in den Augen der Frau auf. Sie wandte sich um und fixierte einen riesigen Schlaks, der seinen winzigen Kopf in beide Fäuste gestützt hatte und in seinen Whisky starrte.
Es kostete sie Überwindung, aber dann ging sie doch zu seinem Tisch und stieß ihn an. Der Mann hob den Kopf und wandte ihr ein Gesicht von abgrundtiefer Häßlichkeit zu.
Die Frau schauderte. Dennoch raunte sie ihm vertraulich zu:
»Joe, Sie haben doch oft genug gesagt, daß Sie gern mein Freund sein möchten.«
Der Lange verzog seinen Mund zu einem verständnisvollen Grinsen.
»Selbstverständlich, Miß Mary«, lallte er mit alkoholschwerer Zunge. »Ich bin ein Mordskerl!«
»Schon gut. Sehen Sie da drüben den Burschen? Er hat mich beleidigt.«
Der lange Joe Holster erhob sich ziemlich schwerfällig, stieß den Tisch zur Seite und stampfte auf Jonny Saunders zu.
»He, Dreckskerl«, brüllte er, riß den Burschen herum und hieb ihm einen krachenden Faustschlag ins Gesicht.
Benommen torkelte der Cowboy gegen die Theke. Aber noch ehe ihn der zweite Schlag traf, hatte er sich wieder gefaßt und schlug dem Schlaks sofort die geballte Rechte gegen das Jochbein. Gleich darauf die Linke ans Ohr und wieder die Rechte gegen den Kinnwinkel.
Der lange Holster war schwer erschüttert und sackte lächerlich langsam auf einem Stuhl nieder, wo er mit glasigen Augen sitzen blieb, zum Gelächter einiger Cowboys.
Das Tanzgirl aber schoß wie eine Furie nach vorn und schrie die Männer kreischend an:
»Ihr verdammten Flegel! Ihr dummen Büffel steht da und lacht, während dieser stinkige Schafshirte einen von euch niederschlägt. Ich spucke auf euch, ihr feigen Schufte!«
Da warf sich ein Mann, der schon lange ein Auge auf die noch immer recht gutaussehende Frau geworfen hatte, in die Brust.
»Yeah, du hast recht, Mary. Hier stinkt es tatsächlich wie in einem Schafsstall. Es scheint mir, daß es von dem Burschen da kommt.«
Jonny Saunders hatte sich schon umgewandt und wollte die Schenke verlassen, als ihm der bullige Ronny Carpenta folgte.
Und Carpenta kam nicht allein. Plötzlich waren es drei, vier, fünf, sechs Mann, die auf den Cowboy eindrangen.
Als er sich schließlich mit schmerzendem Schädel draußen vom Vorbau erhob, preßte er einen Fluch durch die Zähne. Taumelnd ging er bis zu der Ecke, wo die Gasse in die Mainstreet mündete, in der der Mietstall lag.
Jess Hawkins und Mike Anderson, zwei Cowboys von der Lupton Ranch, hatten bis jetzt in Slim Corners Bar getrunken. Ziemlich beduselt schlenderten sie dem Mietstall zu, um ihre Pferde abzuholen.
Larry Cornwall, der auch zu ihrer Crew gehörte, folgte ihnen. Er war ein großer, starker Bursche, der sein Geld nicht in der Stadt vertat und nur mit den anderen ritt, um nicht allein draußen auf der Ranch zu hocken. Er war vollkommen nüchtern.
Hinter ihm kamen die beiden Briggers, Zwillingsbrüder, die auf der gleichen Ranch arbeiteten und verrufene Schläger waren. Auch sie hatten nur wenig getrunken.
Nacheinander rollten die fünf Burschen in den Mietstallhof und zerrten ihre Pferde aus den Boxen.
Larry Cornwall zündete sich, den Zügel in der Linken und den Gaul hinter sich herziehend, noch in der Box eine vorgedrehte Zigarette an.
Er glaubte nicht richtig zu sehen: drüben an der Wand der Nachbarbox tauchte für Bruchteile einer Sekunde das Gesicht einer hübschen jungen Frau aus der Dunkelheit. Das Gesicht einer Indianerin.
»By gosh, seht euch das an«, brüllte er.
Die beiden Briggers, die noch im Stall waren, kamen heran, blieben neben ihm stehen und glotzten mit großen Augen auf die Indianerin. Dann ging ein Gegröle los, daß der tödlich erschrockenen Indianerin in den Ohren gellte.
Brigger stürzte auf Nointa zu, zerrte sie aus der Box in den Stallgang und stieß sie vorwärts.
»He, roter Engel!« bellte er. »Wo kommst du denn so plötzlich her? Hat dich Cochise hier etwa in dem Stall vergessen?«
Die anderen lachten brüllend.
Ronny Carpenta packte Nointa an den Haaren und riß sie zu sich heran.
»Na, Sonnygirl, rieche ich dir etwa nicht fein genug? Los, gib mir einen Kuß!«
Und wieder erscholl das Grölen der anderen.
Blitzschnell riß sich Nointa los und suchte in den Hof zu entkommen.
Aber sofort war Jess Hawkins hinter ihr her. Er bekam ihren Lederkittel zu fassen und riß sie zu Boden.
Johlend stürmten die anderen heran. Wie ein waidwund gequältes Tier schrie die Frau auf.
Dieser Schrei dröhnte bis zu Jonny Saunders auf die Mainstreet. Einen Herzschlag lang blieb er vor Schreck stehen, um dann mit wilden weiten Sätzen durch die Gase auf den Mietstall zuzuhasten.
Er stieß das Tor auf und stürzte sich sofort auf den Knäuel der Männer, die sich geifernd und johlend am Boden wälzten. Er riß sie auseinander, schleuderte sie zur Seite, zog die am Boden liegende Frau hoch und brachte sie hinter sich in Sicherheit.
So schwerhörig der alte Mietstallbesitzer auch war – dieser Lärm war doch in seine Gehörgänge gedrungen. Mit einer großen Stallampe erschien er an der Haustür und leuchtete von der obersten Treppenstufe her in den Hof.
Die Cowboys hatten sich gerade von der Überraschung erholt, und Cromwall, der wilde Flüche ausstieß, drang auf Jonny Saunders ein. Die anderen folgten seinem Beispiel.
Hilflos stand der Alte oben mit der Lampe und beleuchtete die scheußliche Szene.
Nointa stand mit angstgeweiteten Augen an die Stallwand gelehnt.
Der junge Jonny Saunders hatte nicht die geringste Chance gegen diese fünfköpfige Meute.
Da flog vorne das wieder zugefallene Hoftor auf, landete krachend an der Hauswand, und der Lichtschein der Stallaterne fiel auf einen Mann von wahrhaft herkulischen Körperformen.
Er maß mindestens sieben Fuß, hatte einen vierkantigen Schädel, breite kraftstrotzende Schultern und muskelbepackte Arme. Er trug ein graues Hemd, eine dunkle Weste und eine graugestreifte Hose. An beiden Seiten des patronengespickten Kreuzgurtes steckte je ein rotknäufiger fünfundvierziger Revolver.
Der Riese hatte die Situation sofort überblickt. Mit drei Tigersprüngen war er bei den Kämpfenden und schleuderte sie wie Zwerge auseinander.
Herb Brigger prallte neben Nointa krachend gegen die Stallwand. Jess Hawkins fing einen Backhander ein, der ihn zweimal um seine eigene Achse drehte und dann zu Boden gehen ließ. Mike Anderson mußte einen Nasenstüber schlucken, der ihm derart viel Augenwasser hochtrieb, daß er nichts mehr sehen konnte.
Ole Brigger sprang den neuen Gegner an, kassierte aber einen so fürchterlichen Handkantenschlag am Hals, daß er tagelang Schluckbeschwerden haben würde.
Larry Cornwall war zurückgefedert und wollte den Revolver gegen den Hünen hochreißen. Aber blitzschnell flog die linke Stiefelspitze des Giganten unter seine Rechte; der Revolver wurde ihm aus der Hand geschleudert.
Da machte der Cowboy Cornwall den Fehler, sein Bowiemesser aus dem Stiefelschacht zu ziehen.
»He, Junge, für diese Scherze habe ich kein Verständnis«, knurrte ihn der Riese an, wich dem ersten Stich des Cowboys aus und riß dann einen fürchterlichen Haken aus der Hüfte, der Cornwall wie ein Keulenschlag auf die Herzspitze traf und sofort umfallen ließ.
Jonny Saunders kniete am Boden, rieb sich mit dem Unterarm über das blutverschmierte Gesicht und starrte den Riesen an. Der Mann kam jetzt aus dieser Perspektive vor, als sei er zehn Yards hoch.
Da kam der Alte mit der Lampe heran, und der Lichtschein fiel auf den Fremden.
Trotz seiner Benommenheit erkannte der Cowboy den anderen sofort: Es war der sonnenverbrannte grünäugige Riese, der neulich im gleichen Zug mit Onkel Greg in Harpersville angekommen war.
»He, Mister, wo haben Sie Ihren Sattel«, preßte Jonny feixend über seine blutenden Lippen.
Der Riese half ihm auf den Wa-
gen.
»Gehört das Girl da zu dir, Junge?«
»Yeah. Ihretwegen hatte ich ja den Rummel hier.«
»Hast du dich nicht auch gerade in der Blechhütte geschlagen?«
»No – da wurde ich geschlagen, Mister.«
»Na, das stimmt nicht ganz, Boy. Der lange Holster und zwei andere Kerle wissen das ganz bestimmt besser. Leider saß ich bei der Wirtin in der Küche beim Steak und konnte die Geschichte nur durch den Türspalt beobachten. Weißt du, ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, mich beim Essen nicht stören zu lassen.«
»Eine gute Gewohnheit, Mister…«
»Mein Name ist Short, Luke Short.«
Der Kopf des Jonny Saunders war plötzlich völlig klar.
»Luke Short?« stieß er hervor.
Die Boys von der Lupton Ranch hatten es plötzlich höllisch eilig, wegzukommen. Einer nahm die Pferde, und die anderen schleppten die lädierten Kameraden mit sich fort. Der nächtliche Hof war plötzlich ziemlich leer.
»Sie sind Luke Short?« wiederholte Jonny ungläubig.
»Yeah, Boy. Ich hoffe, du hast nichts dagegen«, meinte der Riese, während er sich eine Virgina zwischen seine weißen Zähne steckte.
Wenige Minuten später hatte Jonny dem bekannten Westmann seine Geschichte erzählt.
Luke Short rieb sich das Kinn.
»Das ist eine dumme Sache, Boy. Aber ich muß dir sagen, daß ich an deiner Stelle nicht anders gehandelt hätte. Aber sei unbesorgt: dein Vater wird schon klug werden.«
»Sicher. Wenn es dann nur nicht zu spät ist…« Jonny erzählte dem Riesen, daß er einen Job als Cowboy suche.
Der Texaner lachte und bleckte seine gewaltigen Zähne.
»Das hatte ich auch vor, als ich herkam. Aber ich blieb in der Blechhütte hängen.«
»Wie kann es ein Weidereiter in einer so verräucherten Luft aushalten?«
»Das sagt sich so, Boy. Ich hatte nicht mehr sehr viel Bucks in der Tasche und fand in der Blechhütte ein paar pokerbesessene Narren, die mir auch die noch aus der Tasche ziehen wollten.«
»Und das haben sie natürlich auch geschafft?«
»Wo denkst du hin, Junge. Onkel Luke ist doch kein Idiot. Ich hatte einen Sattel, aber keinen Gaul. Also mußte ich doch Geld für einen Gaul verdienen. Und das dauert auf einer Ranch ziemlich lange. Vor allem, wenn das ein vernünftiger Gaul sein soll.«
»Haben Sie Ihr Pferd verloren?« fragte Jonny mit schiefgelegtem Kopf.
»Neugierig bist du gar nicht, Boy. Well, ich kann es dir ruhig erzählen. Ich habe mein Pferd verkauft, weil ich plötzlich eine wichtige Reise unternehmen mußte. Ein guter Freund von mir hatte unten in Tombstone ziemliche Schwierigkeiten. Er rief mich zwar nicht zur Hilfe, aber ich dach-
te mir, es kann nichts schaden, wenn
du mal da hinunter rollst und nach-siehst.«
»Und…?«
Der riesige Texaner winkte ab.
»Ich kam zu spät. Er hatte schon aufgeräumt und die Stadt längst verlassen.«
Jonny Saunders sagte halblaut: »Einen solchen Freund möchte ich auch haben.« Dann tauchte plötzlich ein Gedanke in ihm auf. »In Tombstone? He, hatte Wyatt Earp da nicht den Fight mit den Clantons?«
»Ganz recht, Boy, den hatte er. Und das war auch genau die Sache, in der ich mitmischen wollte. Aber er hat mich nicht gebraucht. Schade, dabei hatte ich von Doc Holliday lernen wollen, im richtigen Zeitpunkt aufzutauchen.«
»Sie kennen Wyatt Earp – und Doc Holliday?«
»Yeah, Boy.«
»Sie sind der Freund der beiden?«
Der Texaner kratzte sich unter seinem Hut.
»Weißt du, Jonny, das will ich nicht behaupten. Ich bin ein paarmal mit ihnen geritten – das ist eigentlich alles.«
Schweigend hatte die Indianerin abseits gestanden und dem Gespräch der beiden zugehört.
Der Texaner schleuderte seine Zigarette auf den Boden und warf einen Blick zu Nointa hinüber.
»So, Jonny, und nun holst du deinen Gaul, nimmst das Mädchen an die Hand und kommst mit.«
»Wohin?« fragte der Ranchersohn.
Der Texaner lachte. »Du wirst es nicht fassen – in die Blechhütte.«
»In die Blechhütte?« stammelte Jonny entgeistert.
»Yeah, oder hast du vielleicht die Absicht, hierzubleiben?«
»Nein, aber…«
»Kein Aber, Boy. Onkel Luke hat eine dicke Nummer in der Blechhütte. Der Salooner war albern genug, mich zu einer harten Doppelpartie aufzufordern, bei der er fünftausend Dollar verspielte. Er hatte das Geld gar nicht bar auf der Hand und – so ist er mir verpflichtet. Und selbst wenn dem nicht so wäre, möchte ich den mal sehen, der etwas dagegen hätte, wenn Luke Short für zwei Freunde in der Blechhütte noch zwei Zimmer mietet.«
Die Männer in der Schenke machten runde Augen, als hinter der Gestalt des Riesen plötzlich der vermeintliche Schafscowboy auftauchte.
»Alle mal herhören«, überbrüllte der Texaner den Lärm in der Schenke. »Dieser Junge hier ist Jonny Saunders; der gehört zu mir. Wer etwas gegen ihn hat, hat mich am Hals. Alles klar?«
Ein kleiner Mann mit spitzer Nase quäkte:
»Mary Queen hat gesagt, daß er Schafshirte sei.«
Luke Short stemmte beide Fäuste in die Hüften.
»Mary Queen hat ein ungewaschenes Maul, und wenn sie noch einmal derartigen Unsinn behauptet, packe ich sie an ihrem verstaubten Zopf und werfe sie auf die Straße.«
Die Gäste in der Blechhütte stimmten ein johlendes Gelächter an.
Der Tex hob seine Rechte, die die Größe einer Schaufel hatte, und schaffte sich Ruhe.
»Der Vater dieses Burschen ist Rinderzüchter. Er hat oben im Norden in den Hills eine große Ranch. Und wer von euch dennoch glaubt, irgendeinen schafsähnlichen Geruch in der Nase zu haben, der zwingt mich dazu, ihm an die Wolle zu gehen.«
Der Texaner war so geschickt gewesen, Nointa zuerst durch den Hof ins Haus zu bringen, um unnötiges Aufsehen zu vermeiden. Er hatte den Wirt und seine Frau verständigt und war dann erst, als das Indianermädchen schon oben auf ihrem Zimmer war, mit Jonny von der Straße hier in die Schenke gegangen.
Die kleine Nointa schlief längst, als der Bursche noch bei dem Tex auf dem Zimmer saß.
Ach, wie hätte er sich noch vor Wochen, ja, vor Tagen gefreut, einem Mann wie Luke Short zu begegnen, einem großen Westmann, der noch obendrein mit dem berühmten Wyatt Earp und mit Doc Holliday befreundet war.
Aber wie anders sah das jetzt alles aus. Er hockte hier auf dem Zimmer des Texaners und war zutiefst verzweifelt.
»Was soll werden? Ich muß doch arbeiten und Geld verdienen.«
»Das kannst du auch. Für einen guten Cowboy gibt es überall Arbeit und Brot.«
»Und Nointa?«
»Sie bleibt so lange hier.«
»Auf keinen Fall«, protestierte der Bursche. »Ich lasse sie nicht mehr allein.«
»Sie ist nicht allein. Die beiden Wimmers werden für sie sorgen und über sie wachen. Der Salooner wird dafür sorgen, daß es jeder in Harpersville erfährt: Wer das Girl anrührt, dem bricht Luke Short eigenhändig die Knochen.«
»Wollen Sie denn auch weg?«
»Natürlich, oder hast du gedacht, ich wollte hier in dieser Blechhütte verrosten?«
In Jonny Saunders stieg neue Hoffnung auf. Wenn es so war, dann würde auch er reiten. Nointa stand unter dem Schutz von Luke Short; und der Texaner würde mit ihm reiten.
In der Morgenfrühe des darauffolgenden Tages machten sich die beiden auf und ritten nach Osten. Luke Short hatte den Weg zu Floyd Frenclyns eingeschlagen.
Jonny merkte es erst, als der Weg sie an Rindern vorbeiführte, die die doppelten FF auf dem Rücken trugen.
»He, Sie wollen doch nicht etwa zu Floyd Frenclyn, Mister Short?«
»Weshalb nicht? Ich habe unterwegs von ihm gehört. Er soll eine große Ranch haben.«
»Yeah, er hat die größte in der ganzen Gegend. Aber auch die wildeste Crew, die man sich denken kann. Noch vor sieben Jahren gab es zwischen ihm und der Weide meines Vaters keine andren Ranches. Immer wieder kam es zwischen seinen und unseren Leuten zu Reibereien. Als dann George Cramer, Mike Denafon und Ralf Carlton hierher kamen, hatten sich einige Bremsklötze zwischen uns und Frenclyn geschoben. Seither haben die kleineren Rancher die Schikanen Frenclyns auszubaden.«
»Kennt der Rancher dich persönlich?«
»Nein, ich habe ihn nie gesehen.«
»Sonst jemand von seinen Leuten?«
»Nein. Ich war damals erst dreizehn Jahre alt und habe niemanden von Frenclyns Leuten oder gar den Rancher selbst zu Gesicht bekommen.«
»All right, also werden wir der Ranch einen Besuch abstatten!«
*
Als die Ranch vor ihnen auftauchte, hielt Jonny Saunders verblüfft seinen Schimmel an.
Die Bauten waren von einer hohen Fenz umgeben. In den Boden gerammt waren dicht nebeneinander Pfähle wie in der Indianerzeit.
»Der hat sich ja nicht schlecht gesichert«, meinte der Texaner. »Das ist ja das reinste Fort!«
Die Worte des Texaners wurden durch den hohen Wachturm, der hinter der Frenz auftauchte, bestätigt.
»Damned, muß der Bursche ein schlechtes Gewissen haben«, knurrte Luke Short.
Als sie am Tor waren, zog der Tex einen seinen Revolver und hämmerte gegen die schweren Bohlen.
»Was wollt ihr?« kam es da aus einem Schlitz in der Türnische.
»Wir suchen einen Job, Brother«, entgegnete der Tex.
»All right. Aber wenn ihr Satteltramps seid und nichts könnt, gibt’s Prügel.«
»So was hören wir gern, Boy. Mach endlich auf.«
Das Tor wurde geöffnet, und die beiden ritten in den Hof. Ein Mann mit Bullbeißergesicht, gewaltigem nacktem Oberkörper und schweren Muskelsträngen kam heran.
»Was wollt ihr?« knurrte er die beiden in tiefstem Baß an.
»Damned, müsen wir das hier alle zehn Schritte wiederholen?« entrüstete sich der Texaner. »Wir haben da vorne dem Türboy schon gesagt, daß wir einen Job suchen.«
»Riskiere nicht so ein freches Maul, Langer. Das wird dir hier nämlich gleich gestopft.«
»Wolltest du das vielleicht besorgen, Gorilla?«
»Yeah, und zwar sofort.«
Der Affenmensch packte mit einem raschen Griff den linken Stiefel des Texaners, um den Reiter vom Pferd zu zerren. Er hatte diesen Trick schon hundertfach geübt und erfolgreich angewandt. Jetzt aber erlebte er, daß sein Gegner hundert schärfere Tricks kannte und ihn sofort böse auflaufen ließ. Die Stiefelspitze des Texaners sauste hoch und traf den bulligen Frenclyn Cowboy an der Kehle. Mit einem erstickten Aufschrei taumelte Ric Baker zurück.
Luke Short rutschte aus dem Sattel.
»Du kannst noch eine ganze Menge besserer Sachen von mir lernen, Junge«, sagte er laut und richtete sich zu seiner vollen Größe auf. Längst hatte er oben vor der Tür des Ranchhauses den weißhaarigen Mann entdeckt, in dem er mit Recht den Rancher vermutete. »Ich kann mir nämlich nicht denken, daß dein Boß dich Schimpansen dazu bestellt hat, anständige Leute so zu empfangen, daß sie sich in einer Räuberhöhle glauben.«
Aus den Türen der Schuppen, Scheunen und Stallungen waren inzwischen Männer getreten, die den Vorgang mit verdutzten Blicken beobachtet hatten.
Der Texaner führte sein Pferd bis vor das Ranchhaus, blieb unten vor der Treppe stehen, sah den weißhaarigen Mann an und tippte grüßend an den Hutrand.
»He, Mister, Sie machen mir einen vernünftigen Eindruck. Vielleicht können Sie mir eine Auskunft geben. Wir sind Cowboys und suchen einen Job.«
Der einundsechzigjährige Floyd Frenclyn, der den Vorgang hinterm Tor genau beobachtet hatte und dem der hünenhafte Texaner gefiel, setzte ein mokantes Gesicht auf.
»Sie suchen einen Job? Als was? Vielleicht als ein Mann, der die Leute tritt?«
»No, Mister. Wenn hier noch so was gebraucht wird, dann würde ich Ihnen vorschlagen, den Gorilla da vorn noch ein bißchen ausbilden zu lassen. Wir sind Cowboys. Es tut mir leid, daß ich das noch einmal sagen muß.«
Frenclyn hatte vor Verblüffung den Mund offenstehen. So viel Kühnheit war dem selbstbewußten Mann noch nicht untergekommen.
»Sie führen da eine ziemlich derbe Sprache, Mister.«
»Ich kann wirklich nicht behaupten, daß man uns hier gerade sanft behandelt hat. Gehören Sie zur Familie des Ranchers?«
»Ich selbst bin Floyd Frenclyn«, sagte der weißhaarige Mann voller Stolz.
»Good, dann brauche ich den Song ja nicht zu wiederholen, Mister.«
Der Rancher entgegnete: »Nein, das brauchen Sie nicht, und wenn der Bursche da mit dem hellen Haar auch etwas von Ihren Qualitäten hat, dann genügt es mir, wenn ich eure Vornamen erfahre.«
»Well, ich bin Luke, und das ist Jonny.«
»All right. Das Bunkhaus ist drüben, und der Vormann wird auch jeden Augenblick kommen.«
So hatte sich der Texaner Luke Short mit Jonny Saunders auf der Frenclyn Ranch eingeführt.
Niemand fragte sie nach ihren Nachnamen. Und die beiden selbst hielten es nicht für nötig, über etwas zu sprechen, das hier offenbar niemand wissen wollte.
Da sie ausgezeichnete Cowboys waren, hatten sie sehr schnell die Zuneigung des Vormannes, des kleinen vogelköpfigen Liston, gewonnen. Schon nach wenigen Tagen betraute Liston den Texaner mit so wichtigen Aufgaben wie die Arbeitsverteilung auf der Ranch.
Die beiden Männer waren etwa drei Wochen auf der Frenclyn Ranch, als eines Abends vorn das Tor geöffnet wurde und der Wachtposten mehrere Reiter in den Hof ließ.
Luke Short glaubte nicht richtig zu sehen, als er in dem vordersten Reiter den Tombstoner Desperado Curly Bill erkannte. Rasch schob sich der Texaner hinter die Ecke des Bunkhauses und lauschte in den Hof.
Ein mittelgroß, nervös mit den Armen durch die Luft fuchtelnder Mensch rutschte aus dem Sattel, stürmte die Treppe zum Ranchhaus hinauf und rief:
»Mister Frenclyn! Der Boß ist da!«
Zu seiner namenlosen Verwunderung sah der Texaner, daß der Rancher gleich darauf in der Tür erschien und Curly Bill wie einen alten Freund begrüßte.
Da wurde die Tür des Bunkhauses geöffnet und Jonny Saunders schlich sich in den Hof. Als er die Hausecke erreicht hatte, wurde er von Luke Short zurückgezogen. Jonny starrte den Texaner erschrocken an.
»Sie sind’s!«
Luke Short sah, daß der Bursche einen Revolver in der Hand hatte.
»Steck das Eisen weg, Boy. Ich werde das Gefühl nicht los, daß wir es ohnehin bald brauchen werden.«
»Der Mann da drüben beim Rancher, der kleinere, das ist Greg, der Bruder meines Vaters.« Jonny vermied es absichtlich diesen Menschen Onkel zu nennen.
Der Texaner stieß einen fast tonlosen Pfiff aus.
»Zounds! Ich glaube, mir geht da eine gewaltige Laterne auf, Jonny.«
»Was meinen Sie?«
»Fällt dir nichts auf bei dieser Versammlung da?«
»Nein. Sind das Cowboys?«
Der Tex lachte heiser.
»Das verhüte Gott, Junge. Es sind Banditen! Der große Kerl da bei dem Rancher ist Curly Bill.«
»Curly Bill?« entfuhr es Jonny fast zu laut.
»Yeah, und wenn mich nicht alles täuscht, ist dieser glatte Typ da hinter ihm Manuelo Cherry Pika. Und der Bursche neben ihm könnte Joel Mc
Lean sein.«
»Devils, das kann doch nicht möglich sein! Curly Bill, Pika und Mc
Lean? Was sollten die denn hier?«
»Das habe ich mich auch eine Minute lang gefragt. Bis du mir gesagt hast, daß der Kerl da oben dein lieber Onkel ist. Da ging mir die Lampe auf.«
»Ich weiß immer noch nicht, was Sie meinen.«
»Überleg doch, Boy! Dein Onkel ist hier, mit den Tramps, bei dem alten Gegner deines Vaters!«
»Glauben Sie etwa, daß er sich Curly Bill angeschlossen hat und mit ihm zusammen Frenclyn gegen meinen Vater aufstacheln will?«
»Ich werde den Verdacht nicht los.«
»Aber ich dachte, Greg wäre auf der Ranch…«
»Ich sagte dir doch, daß dein Vater bestimmt bald klug werden mußte. Höchstwahrscheinlich schon kurz nachdem du weggegangen bist. Da wird er diesen sauberen Bruder mit Glanz und Gloria vom Hof gefeuert haben. Zum Dank für alles hat sich der brave Mann dann diesem Banditen da angeschlossen, der sich ziemlich rasch nach Ike Clantons Fall von Tombstone abgesetzt hat. Wie ich schon in Harpersville hörte, hat er hier in der Gegend selbst einen Verein angeheuert. Solche Halunken fallen offensichtlich immer wieder auf die Füße. Der Bursche kann von Glück sagen, daß er in Tombstone nicht mit Ike und den McLowerys in den Corral gegangen ist. Den hätte Doc Holliday bestimmt nicht übersehen.«
So sehr die beiden sich anstrengten, sie vermochten nichts von dem Gespräch oben auf dem Vorbau des
Ranchhauses zu verstehen.
Frenclyn dachte nicht daran, die Bande in sein Haus zu lassen. Er verhandelte mit ihnen vor der Tür. Er war also nicht nur ein rigoroser Raubrancher, dieser Floyd Frenclyn, er war auch ein Mann, der mit Verbrechern paktierte.
Jonny flüsterte dem Texaner zu:
»Wir müssen verschwinden!«
»Weshalb?«
»Wenn Greg mich hier entdeckt, ist es aus. Frenclyn läßt uns in Stücke reißen.«
»Das würden wir ihm auf jeden Fall so schwer wie möglich machen, Cowboy. Geh jetzt in deine Falle zurück. Ich bleibe noch ein wenig an der frischen Luft.«
»Aber…«
»Kein aber. Onkel Luke hat in diesen Dingen die größere Erfahrung. Da kannst du ruhig schlafen. Wenn sich was tut, wecke ich dich frühzeitig.«
»All right.«
Jonny ging ungern, aber er ging.
Immer noch standen drüben auf der anderen Seite des Hofes die Banditen bei dem Rancher. Luke Short konnte nicht wagen, sich ihnen offen über den Hof zu nähern. Dennoch mußte er herausbringen, was da drüben gesprochen wurde.
Der Texaner lief hinter der Scheune entlang, um so an die Seitenfront des Ranchhaues zu kommen. Vorsichtig schob er sich bis dicht an die Ecke. Hier vermochte er die Stimmen der Männer auf der Veranda gerade noch zu vernehmen.
Curly Bill schwang das große Wort.
»Die Sache rollt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, Frenclyn, darüber müssen wir uns klar sein. So leicht ist es mit diesem Kerl nicht. Darauf können Sie sich verlassen, ich kenne ihn…«
Dann meldete sich die tiefe Baßstimme des Ranchers.
»Ich verstehe euch nicht. Mit diesem Burschen muß man doch fertig werden können. Ein einzelner Mann, lächerlich! Ich habe ganze Mannschaften wilder Burschen fertiggemacht. Wenn man sich natürlich vor dem Namen versteckt und feige zusammenzuckt, schafft man solche Brüder nicht. Wenn ich mich so zimperlich angestellt hätte, wäre ich niemals das geworden, was ich heute…«
»Reißen Sie den Rand nicht so weit auf, Rancher!« fährt ihn der Tombstoner Desperado herrisch an. »Ich weiß selbst, was ich zu tun habe. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Seien Sie froh, daß Sie durch Greg Saunders auf meine Seite gekommen sind, sonst wäre Ihr Kuhstall hier jetzt auch fällig! Träumen Sie bloß nicht, daß ich mich vor Ihren paar Gestalten fürchte. Ich habe mehr Leute hinter mir; und jeder von ihnen ist fünf Ihrer Cowpuncher wert. Also keine Marotten, Alter. Sie wollen John Saunders fertigmachen – und das geschieht auch. Ihre Boys haben jedoch nur das zu tun, was ich befehle. Und Sie halten den Mund. Wenn Sie die Burschen drüben auf der S-Ranch unterschätzen, ist das Ihre Sache…«
Das war dem befehlsgewohnten Floyd Frenclyn dann doch zu viel.
»Hören Sie, William Brocius, es wäre gut, wenn Sie zwei Dinge nicht vergessen würden: Erstens, daß Sie hier auf meinem Boden stehen, und daß ich ein Mann bin, der ihn zu schützen weiß. Und zweitens, daß in mehreren Städten Ihr Steckbrief aushängt. Oder bilden Sie sich ein, ich wüßte nicht, daß Sie den Tombstoner Skandal nach dem Gunfight im O.K. Corral ausgenutzt haben, um in aller Ruhe die Bank von Mercury zu überfallen? Sie hatten Pech und sind erkannt worden, mein Lieber…«
Die Hand des Verbrechers fuhr zum Colt.
Zum erstenmal in seiner reichlich fragwürdigen Karriere in den Staaten vermochte Greg Saunders maßgeblich in Erscheinung zu treten. Er stellte sich vor den Rancher und sah Curly Bill mit blitzenden Augen an.
»Was soll das werden, Boß? Wollen Sie durch einen sinnlosen Streit alles aufs Spiel setzen? Wir brauchen Frenc-lyn, das wissen Sie genau.«
»Yeah!« keuchte der Outlaw. »Aber er hat sich keinen so herausfordernden Ton mir gegenüber zu leisten. Er ist auch nichts weiter als ein Raub-rancher, als ein Länder- und Viehdieb. Ein Bursche, der kleinere Farmen die Luft abgedreht hat und jahrelang mit dem Gewehr im County regierte. Ich kenne ihn genau, diesen Floyd Frenclyn! Er hat keinen Grund, sich hier wie der geheime Boß aufzuspielen. Der Boß bin ich! Und wenn er glaubt, etwas von mir zu wissen, dann muß er sich gesagt sein lassen, daß ich von ihm auch einiges weiß.«
Floyd Frenclyn kochte vor Zorn.
»Sie haben sich trotzdem in mir verrechnet, Curly Bill. Ich habe bis heute offen für mein Weideland gekämpft. Sie aber sind ein Bandit, ein berüchtigter Desperado, ein gefürchteter Mörder, ein bekanntes Mitglied der Clanton Gang! Sie sind in Tombstone Wyatt Earp ganz offensichtlich im allerletzten Augenblick entgangen, und jetzt haben Sie die Hose voll, weil…«
Wieder zuckte die Hand des Verbrechers zum Revolver.
Da packte Greg Saunders, der Dandy von gestern, – er packte mit beiden Fäusten das rechte Handgelenk des Banditen.
»Halt! Ihr seid beide verrückt. Das wäre doch genau das, was der Mann drüben auf der S-Ranch sich wünscht. Zerfleischt euch untereinander! Was haben Sie davon, Curly Bill? Sie wollen hier ein Ike Clanton werden, wie Sie mir selbst gesagt haben. Ich aber sage Ihnen, daß Sie auf diese Weise gar nichts werden. Mir scheint, daß Ike Clanton doch ein anderer Mann war. Denn Besonnenheit zeigen Sie nicht. Und Sie, Floyd Frenclyn, Sie gebärden sich wie ein aufgeblasener Pfau! Wollen Sie nicht die Saunders Ranch Ihrer Weide anschließen? Wollten Sie nicht den Traum Ihres Lebens verwirklichen und das Land und die große Ranch meines Bruders besitzen? Wären Sie dann nicht in der Lage, die Kleinen, die sich dazwischengeschoben haben, mühelos zu zerquetschen?!«
Frenclyn grollte:
»Curly Bill hat den Streit vom Zaun gebrochen, nicht ich! Und übrigens – Saunders, soll ich Ihnen das wirklich abnehmen, daß Sie nicht das geringste Interesse an der Ranch Ihres Bruders haben?«
»Yeah!« fuhr ihn Greg mit gebleckten Zähnen an.
Drüben vom Bunkhouse hatte sich ein Schatten gelöst, der sich langsam näherte, mitten im Hof stehenblieb und die Augen weit aufgerissen hatte!
Jonny Saunders!
Er glaubte zu träumen. Das, was er da hörte, konnte doch nicht wahr sein. Dieser Mensch da konnte doch unmöglich sein Onkel Gregory Saunders, Vaters Bruder sein. Der Mann, für dessen Reise in die Staaten der Vater eine große Stange Dollars geopfert hatte!
»Das verstehe ich nicht!« sagte der Rancher in diesem Augenblick. »Sie werden Ihre Ansprüche auf die Ranch geltend machen, sobald es außer Ihnen keinen Mann mehr in diesem Land gibt, der Saunders heißt…«
»Nein!« Wie ein Raubvogel stieß Greg den Kopf vor und zischte: »Das werde ich nicht. Weil auch ich ein Ziel habe, wie Sie und wie Curly Bill. Ich will meinen Bruder vernichten. Weil er mir etwas angetan hat, das ich ihm niemals verzeihen kann. Ich will ihn vernichten, zerstören, am Boden sehen. Und mit ihm seinen Sohn, auf den er so stolz ist, diesen verdammten Burschen. Vernichten will ich sie beide. Well…« Er hielt inne und atmete schwer.
»Weshalb soll ich es euch nicht sagen? Ich bin damals, als er nach den ersten Jahren hier einmal zu Besuch nach Europa kam, ein blutjunger Bursche gewesen und hatte eine Freundin. Als er sie sah, stahl er sie mir. Es kam zu einem Kampf. Dabei tötete er die Frau, und ich, der Unschuldige, ich mußte ins Zuchthaus. Zwanzig Jahre, Gents, zwanzig Jahre habe ich hinter Zuchthausmauern gesessen. Damals war ich neunzehn, heute bin ich neun-unddreißig. Er reiste ab – und als ich jetzt freikam, schlug ihm das Gewissen und er ließ mich herkommen. Aber nur, um mich wieder zu demütigen. Ich bin gekommen, aber mit der Rache im Herzen. Ich werde ihn vernichten. Und das spürt er. Er nämlich ist der Mörder…!«
»Nein!« gellte es da über den nächtlichen Hof.
Die Banditen fuhren zusammen und wandten die Köpfe.
Mitten auf dem Hofplatz, vom schwachen Lichtschein der Kerosinlampe, die der Rancher hielt, nur noch eben erfaßt, stand der junge Cow-
boy.
»Jonny!« entfuhr es Saunders.
»Jonny!« rief auch der Rancher. »Was suchst du hier? Was hast du dich auf dem Hof herumzutreiben? Verschwinde im Bunkhouse!«
Der Bursche aber blieb mit glimmenden Augen stehen.
Saunders starrte ihn an wie ein Gespenst. Dann krächzte er:
»Frenclyn – sind Sie wahnsinnig! Was tut dieser Hund denn hier auf Ihrer Ranch?!«
»Wieso? Er ist einer meiner Cowboys«, entgegnete Frenclyn ahnungslos.
»Einer Ihrer Cowboys!« bellte Greg. »Mann, das ist Jonny Saunders! Der Sohn meines Bruders!«
Ein Ruf der Verblüffung flog von den Lippen der Männer auf dem Vorbau.
Curly Bill stampfte sofort die Treppe hinunter.
Frenclyn stand fast fassungslos da und stotterte:
»Jonny – Saunders? Das ist doch unmöglich! Der – würde es doch niemals wagen – ausgerechnet hier…«
Curly Bill stampfte, gefolgt von Greg, Pika, McLean und einigen anderen Tramps auf den Burschen zu.
»Macht ihn fertig!« zeterte Greg hysterisch. »Bill, stampfen Sie diesen Mördersohn in die Erde, harken Sie ihn auseinander! Würgt ihn doch ab, Männer! Diesen…«
Luke Short hatte keine Wahl.
So bitter es ihn ankam und so gewiß er der Niederlage gegen dieses Aufgebot von Menschen in dem abgeschlossenen Hof war, er mußte eingreifen.
»Stop!«
Hart und schneidend kam sein Ruf über den Hof.
Curly Bill zuckte wie unter einem Peitschenschlag zusammen.
Im ersten Moment hatte er geglaubt, die Stimme Wyatt Earps zu hören. Dann wußte er, wer da an der dunklen Hausecke stand.
Die Banditen hielten inne, sahen sich um und erkannten drüben im Halbdunkel an der Hausecke die riesige Gestalt.
Auch Frenclyn sah sie.
»Luke – was fällt Ihnen ein? Hinüber ins Bunkhouse!«
Curly Bill warf den Kopf hoch.
»Luke! – Sind Sie vielleicht mondsüchtig, Frenclyn? Arbeitet dieser Mann etwa auch als Cowboy bei Ihnen?«
»Weshalb nicht, he?« knurrte der Rancher unsicher. »Schließlich ist es doch meine Sache, wen ich in meine Crew aufnehme. Er ist ein ganz ausgezeichneter Weidemann!«
»Sicher. Vielleicht präsentieren Sie uns demnächst noch Wyatt Earp, der ist auch ein ausgezeichneter Weidemann und vor allem ein hervorragender Schütze. Kennen Sie den Nachnamen dieses anderthalbmannshohen Burschen?«
»Nachnamen interessieren mich nicht, Curly Bill!«
»Well, das dachte ich mir. So was kann manchmal verdammt ins Auge gehen. Dieser Mann da ist Texaner und heißt ganz einfach Short. Spaßig nicht, hört sich nach nichts an. Wenn Sie aber jetzt seinen Vornamen, den er Ihnen ja nicht verschwiegen hat, dazunehmen, da hört es sich plötzlich nicht mehr spaßig und harmlos an. Luke Short! Wie gefällt Ihnen das, Mister Frenclyn, he?«
»Halt keine Volksreden, Bill!« fuhr die harte Stimme des Texaners dazwischen.
Frenclyn starrte zu dem Hünen hinüber.
»Sie sind – Luke Short?«
»Yeah, Rancher.«
»Und Sie haben die Stirn gehabt, mit Jonny Saunders, hierher zu kommen, sich hier einzuschleichen und mir Ihre Namen zu verschweigen.«
»Sie haben uns nicht danach gefragt, Rancher.«
»Well, Short, aber mich schrecken große Namen nicht. Ich bin nicht Curly Bill, der offenbar nur groß unter Ike Clanton war. Randy, Lawrence, Collins! Packt ihn, macht ihn fertig!«
Drei der Cowboys, die bei den Tramps an der Veranda gestanden hatten, marschierten auf den Texaner los.
»Halt!« schrie Curly Bill. »Bleibt stehen, Boys. Die Sache ist gefährlicher als ihr ahnt. Er ist nicht einfach nur ein Mann, der Short heißt. Er ist ein Mann mit zwei großen Fäusten und zwei sehr schnellen Revolvern, der es sich außerdem angewöhnt hat, plötzlich in der Nähe Wyatt Earps aufzutauchen. Ich wette, daß er nicht allein ist, Leute. Vorsicht also!«
»Großmaul!« zeterte der Rancher. »Drauf, Leute!«
Aber die »Leute« hatten offensichtlich mehr Zutrauen zu der Erfahrung des »großen« Banditen Curly Bill. Sie blieben stehen.
Da platzte Jonny los:
»Was du da geredet hast, Greg Saunders, ist Lüge. Dreckige Lüge! Mein Vater ist kein Mörder! Aber dir traue ich es zu. Denn wie du ein gemeiner, dreckiger Verräter bist, bist du auch ein Lügner! Komm her, kämpfe mit mir, wenn du Mut hast! Wir haben es nicht nötig, uns hinter Lügen zu verschanzen. Mister Short und ich, wir sind allein…«
»Sei still, Jonny!« unterbrach ihn der Texaner rasch.
»Weshalb, Mister Short? Mit diesen Verbrechern kann ich offen sprechen. Ich…«
»Trotzdem sollst du deinen Mund halten!« donnerte Luke Short.
»Nicht doch, Junge«, mischte sich Curly Bill ein, »rede dich nur aus, wir sind Leute, mit denen man reden kann. Ihr seid also ganz allein hier!«
»Yeah, ich sage es voll Stolz!« plärrte Jonny. »Wir haben es nicht nötig, eine Mannschaft hinter uns herzuschleppen.«
»Es muß ja auch keine Mannschaft sein«, lockte der Fuchs Curly Bill. »Manchmal genügt ja auch ein einzelner Mann, wenn er gefährlich ist.«
»Wir sind allein!«
»Ich nehme dich bei deinem Ehrenwort als freier Cowboy!« bluffte der Tombstoner Bandit.
»Gefasel!« brüllte Luke Short. »Laß dich doch nicht von dem Halunken bluffen, Jonny. Ehre? So ein Kerl hat doch keine Ehre!«
Curly Bill sah sich um.
»Boys, die Hunde sind allein. Drauf! Aber Vorsicht mit dem Tex…«
Mit Geschrei stürmten die Tramps und die Cowboys auf den Riesen los.
Den ersten stieß der Hüne mit dem Fuß gegen die anderen. Damit hielt er sie einen Augenblick auf.
Er glaubte noch, daß er sich vielleicht durch die Flucht aus dieser von dem unbesonnenen Jonny geschaffenen Klemme befreien könnte. Aber schon kamen sie von hinten, von rechts und von links.
Sie fielen jedoch auch vorn, hinten, von beiden Seiten. Wie Windmühlenflügel wirbelten die gewaltigen Arme des Texaners durch die Gegend.
Er hielt nach Curly Bill Ausschau, nach Pika und McLean. Aber diese Füchse waren viel zu schlau, sich in einen Nahkampf mit dem gefährlichen Luke Short zu wagen.
Sie fielen wie die Fliegen im Herbst. Aber es waren ihrer zu viele. Von allen Seiten stürmten immer neue, immer frische, immer mehr Gegner auf ihn ein, sprangen ihn an. Schließlich waren sie so dicht um ihn, daß der Koloß sich ihrer einfach nicht mehr erwehren konnte.
Mit einem bösen Glimmen in den Augen ließ sich Curly Bill den endlich überwältigten und an den Händen gefesselten Short vorführen.
»Yeah, Luke…«, höhnte er, »man soll sich eben nicht mit unreifen Burschen in den Sattel setzen. Der Grünschnabel hat Ihnen das Genick gebrochen.«
»Nicht so voreilig, Curly Bill«, schleuderte ihm der Gefangene entgegen. »Sie haben sich schon mehrmals verrechnet. Ich sage Ihnen nur soviel, daß der Bursche weniger weiß als ich!«
Es war Bluff – aber er reichte doch hin, den Bandenführer vorsichtig zu machen.
»Weg mit ihm. Vorerst irgendwo sicher einsperren, bis hier alles vorüber ist und wir uns in Ruhe an seinem Ende weiden können!«
Mit wilden Jubelschreien schleppten die Tramps den Gefangenen weg.
Jonny Saunders war übrigens ziemlich schnell am Boden gewesen.
Das hatte Curly Bill allein besorgt. McLean brauchte den Niedergeknüppelten nur noch mit seinem schmutzigen Stiefel am Boden zu halten.
Luke Short war völlig ahnungslos in diese Falle gegangen. Er hatte ja nicht wissen können, daß sich Curly Bill ausgerechnet die Frenclyn Ranch als Domizil gewählt hatte. Und ohne den Burschen wäre er ganz sicher mit irgendeinem Bluff aus der Klemme herausgekommen.
Schwer an Händen und Füßen gefesselt lag er hinter allerlei Gerümpel im Geräteschuppen. Wo Jonny Saunders steckte, wußte er nicht.
Greg hatte ihn irgendwo in die Scheune bringen wollen. Aber das hatte der Rancher nicht zugelassen. Er traute dem Iren nicht. Er ließ den gefangenen Sohn seines alten Rivalen auf den Boden des Ranchhauses in eine Kammer sperren.
*
Wyatt Earp wartete, bis die Cowboys im Bunkhouse verschwunden waren und beobachtete dann das
Ranchhaus. Als auch dort das Licht verlosch, überquerte er den Hof, holte seinen Sattel aus dem Stall und nahm seinen Rapphengst aus dem Corral.
Minuten später sprengte der Missourier in scharfem Galopp nach Osten.
Vielleicht jagte er ja einem Phantom nach, doch der Gedanke, der sich in seinem Hirn eingenistet hatte, zwang ihn zu diesem Weg.
Er ritt nach Harpersville.
Früh am Morgen erreichte er die Stadt, huschte vorm Post Office aus dem Sattel und mußte feststellen, daß noch geschlossen war.
Auf sein Klopfen kam ein junges Mädchen mit wasserhellen Augen, zierlicher Stupsnase und langem Blondhaar an die Tür.
»Morning, Miß. Kann ich eine Depesche aufgeben?«
»Ja. Mein Großvater – er ist krank. Aber kommen Sie nur herein.«
Sie öffnete die Tür und ließ den Marshal ins Office.
Die »Krankheit« des Großvaters war gleich zu riechen: der Whiskydunst schlug dem Missourier schon an der Tür entgegen. Und richtig, drüben auf dem viel zu kleinen Sofa lag ein großer, vierschrötiger bärtiger Mann und schnarchte seinen Rausch aus.
Ängstlich beobachtete das Mädchen den Fremden.
»Er – gestern hatte einer seiner Freunde Geburtstag, da hat er mitgefeiert.«
»Spielt keine Rolle, Miß. Ich will ja nur eine Nachricht aufgeben.«
»Bitte.«
Sie setzte sich hinter die Barriere an den Tisch, nahm ein Blatt Papier und tauchte die Feder ins Tintenfaß.
»An Miß Nellie Cashman, Tombstone.«
Kratzend glitt die Feder übers Papier.
»Darunter. Bitte D.H. Bescheid sagen – ich bin bei Harpersville. W.E.«
»Weh – eh!« sprach sie nach und führte die Feder kratzend übers Papier.
Dann blickte sie auf.
»Fünf Dollar.«
Wyatt zog das geforderte Geld und legte es auf die abgegriffene und zerschabte Barriere.
»So long!«
»Halt! Was heißt denn das, D.H. und W.E.?«
»Dreimal dürfen Sie raten.«
»Nichts da! Die Unterschrift muß stimmen.«
»All right. Also, das D.H. heißt Doc Holliday. Und das W.E. heißt Wyatt Earp. Genügt das?«
Sie wich entgeistert einen Schritt zurück. Dann hieb sie ihre kleine braune Faust auf die Tischplatte.
»Mister – wenn Sie glauben, mich zum besten halten zu können, Mister…«
»Earp.«
Er nahm seinen Dodgar Marshalstern aus der Tasche, hielt ihn ihr hin und sagte:
»Das ist zwar nur ein Stück Blech, aber es hat eine Bedeutung.«
Die junge Frau starrte auf den Stern des Gesetzes, drehte ihn dann um und las den eingravierten Namen des Besitzers:
»Wyatt Earp! Nein!« stieß sie atemlos hervor. »Wie kommen Sie an seinen Stern?« Sie rannte auf das Sofa zu und weckte den Alten, der seinen Rausch ausschlafen wollte.
»Grandpa! Wach auf! Schnell! Da ist ein Mann – ein Betrüger…«
Der alte Posthalter richtete sich seufzend auf, rieb sich die Augen, gähnte und setzte sich dann in aller Ruhe seine Brille auf. Eine Weile starrte er den Mann vor der Barriere an. Dann nahm er seine Brille ab, hielt sie seiner Enkelin hin und knurrte: »Putz die Gläser!«
Als der Posthalter seine Augengläser wieder auf hatte, zog er die Stirn in dicke Falten.
»All thousand devils and ded Indians! Ich werde verrückt! Liz, Goldkind! Weißt du, wer da steht? Ahnst du armes Schaf überhaupt, wer da eben Morgenglanz in unsere armselige Bude gebracht hat? Liz, es ist – du wirst es nicht glauben, aber ich kann es dir schwören, weil ich ihn schon einmal gesehen habe: Es ist Wyatt Earp! Jawohl.«
Der Alte brach in eine dröhnende Lache aus und stürmte dem Marshal mit ausgestreckten Händen entge-gen.
»Mister Earp! Ich habe Sie vor vielen Jahren oben in Ellsworth erlebt, als Sie dem lausigen Ben Thompson das Handwerk gelegt haben. Nie habe ich Ihr Gesicht vergessen. Hier, fragen Sie dieses Girl, ob ich ihm nicht schon viel zu Ihnen erzählt habe. Lizzy – he – Lizzy, wo steckst du?«
Das Mädchen stand hinter dem Großvater. Jetzt packte der Alte sie und zog sie an die Barriere.
»Da, Girl, sieh ihn dir an! Sieh ihn dir genau an. Das ist der große Wyatt Earp.«
Zugleich streckte ihr der Marshal die Hand hin und lachte sie freundlich an.
»Hallo, Miß Elisabeth!«
Da zauberte das Mädchen ein frohes Lachen in seine Augen und nahm die Hand.
Wyatt fiel es schwer, sich von dem ulkigen Posthalter und der reizenden Lizzy zu verabschieden. Aber er mußte weiter.
Ein Stück die Straße hinunter lag die Blechhütte. Er sah den Salooner mit grüner Schürze den Vorbau sauberfegen.
»Hallo, Mister, gibt’s schon einen Kaffee?«
»Heiß und stark!« entgegnete Joe Wimmerts.
»All right.«
Wyatt rutschte aus dem Sattel und band den Rappen an den Zügelholm.
Der Wirt brachte bald den Kaffee und ein großes kräftiges Käsebrot.
Wyatt hatte einen besonderen Grund, hierher zu kommen.
Neulich, als er von Süden kommend durch die kleine Stadt ritt, glaubte er an einem der Fenster über der Schenke das Gesicht einer hübschen jungen Indianerin gesehen zu haben. Er hätte es sicher längst vergessen, wenn der Rancher John Saunders ihn nicht auf die junge Indianerin hingewiesen hätte, die mit seinem Sohn die Ranch verlassen hatte.
Fast eine Viertelstunde hielt sich Wyatt Earp in der Schenke auf. Von der Indianerin war nichts zu sehen.
Und nach ihr fragen war so gut wie ausgeschlossen. Was auch immer er vorgebracht hätte, es würde einen üblen Eindruck gemacht haben.
Er wartete noch ein paar Minuten, zahlte seine Zeche und ging hinaus.
Als er sich in den Sattel gezogen hatte, trieb er den Rappen wie unabsichtlich auf die Straßenmitte, blickte hoch – und sah die Indianerin am gleichen Fenster wie damals.
Grüßend hob er die Hand. Sie sah ihn erstaunt an.
Und da sie das Fenster hochgeschoben hatte, wagte er die Frage:
»Nointa?«
Sie nickte unwillkürlich.
»Ich bin ein Freund von Jonny. Wo finde ich ihn?«
»Weggeritten. Mit einem großen Mann. Auf eine Ranch.«
Wyatt grüßte noch einmal und sprengte davon.
Auf eine Ranch! Zounds, und mit einem großen Mann? Hatte er hier vielleicht in Harpersville einen Cowboy gefunden, der ihn gleich abgeworben hatte?
Aber wohin sollte sich Jonny Saunders gewandt haben? In dieser Umgebung gab es doch nur die große Frenclyn Ranch.
Wyatt hatte von dem Vormann gesprächsweise erfahren, daß Floyd Frenclyn ein alter Widersacher John Saunders wäre. Wyatt hatte sich dafür nicht sonderlich interessiert; aber jetzt war er froh, daß er mit Teck darüber gesprochen hatte, denn Jonny würde sicher einen Job nicht ausgerechnet bei dem Feind seines Vaters suchen.
Dennoch entschloß sich Wyatt Earp, auf der Frenclyn Ranch Erkundigungen einzuziehen. Seiner Ansicht nach kannte ihn da niemand, und er ging also kein Risiko ein. Dort würde man ihm auch Auskunft über kleine Ranches und Farmen in der Nachbarschaft geben können.
Auf seinem Weg lag die alte Pferdewechselstation Balan. Anfang der achtziger Jahre war Balan ein Nest von fünf Häusern und einigen Schuppen. Es gab nicht einmal eine richtige Straße.
Das erste Gebäude war eine schuppenartige Scheune, an deren halbverfallener Seitenwand in kaum noch leserlichen Lettern stand: Balan. Darunter und bedeutend besser zu lesen: Blacksmith.
In dem Haus nebenan war unten eine Schmiedewerkstatt eingerichtet, in deren offenstehendem Tor sich ein fleischiger Mensch im Schaukelstuhl wippte.
Wyatt sah ihm eine Weile zu und rief ihn dann an:
»He, Mister. Ich möchte nach Balan.«
»Das ist ziemlich schwierig, Mister, denn es fragt sich ja, ob Sie nun nach Balan in Texas wollen, nach Balan in Kandada, nach Balan in Arizona oder zu Mister Balan.«
»Zu Mister Balan? Gibt’s den denn auch?«
»Ich bin selber Ed Balan. Und die Stadt hier hat ihren Namen von mir.«
Wyatt blickte die Straße hinunter.
»Hm. Das ist immerhin eine stolze Leistung. Eine ganze Stadt in Amerika trägt Ihren Namen.«
Der Dicke stand plötzlich aus seinem Schaukelstuhl auf.
»Ich will doch nicht annehmen, Mister, daß Sie die Absicht haben, mich zu verspotten.«
»Das würde ich mir nie einfallen lassen, Mister Balan. Im Gegenteil. Ich bin sogar eigens Ihretwegen hergekommen.«
»Wegen mir?« knurrte der Dicke mißtrauisch.
»Yeah, Sie sollen so ein großartiger Schmied sein. Und mein Gaul braucht hinten links einen neuen Huf. Klar, daß ich mir den nicht von einem Stümper aufsetzen lassen will.«
Der Schmied nickte. »Ja, damit tun Sie recht, Mister. Ich habe gleich gewußt, daß Sie ein Gentleman sind und auf Ihr Pferd halten. Nur her mit dem Rappen, der alte Ed Balan wird ihm einen handfesten Eisenstiefel verpassen. Gehen Sie derweil in den Saloon. Zwei Häuser weiter. Sie können sich nicht verlaufen.«
»Ja, das scheint hier ziemlich schwer zu sein.«
Wyatt rutschte aus dem Sattel und brachte den Schwarzen in die Schmiede.
Der dicke Balan untersuchte gleich den angegebenen Huf und nickte zustimmend.
»Well, das war keine schlechte Arbeit, aber das Eisen ist durch.«
Wyatt steckte sich eine schwarze Zigarre an und fragte wie nebenbei:
»Haben Sie zufällig in letzter Zeit zwei Reiter hier durchkommen sehen? Ein junger blonder Bursche um die Zwanzig und einen größeren Mann?«
Der Blacksmith sann nach; und das Denken schien ihm offensichtlich schwerer zu fallen als das Beschlagen von Pferden.
»Nein, Mister. In den letzten beiden Monaten jedenfalls nicht. Vor einem Vierteljahr ungefähr kam mal ein junger Bursche hier vorbei, der wenig über zwanzig Jahre gewesen sein mochte. Aber er hatte schwarzes Haar und war fast so groß wie Sie. Er war übrigens allein…«
»Thanks.« Der Missourier warf das abgebrannte Zündholz weg und schlenderte auf den Saloon zu.
Es war ein flacher, langgestreckter Holzbau mit aufgestockter Bretterfassade. Innen war alles so primitiv eingerichtet wie in den meisten Bars der fünfziger Jahre im Westen. Die Theke war nichts weiter als ein dickplattiger Tisch, und die drei anderen Tische im Schankraum sahen wie kleine Ableger der Theke aus.
Der Marshal trat ein und nahm an einem der Tische Platz. Obgleich er mehrmals rief und mit den Knöcheln der Faust auf die Tischplatte klopfte, ließ sich niemand sehen.
Es dauerte fast eine Viertelstunde, bis die Tür zum Nebenraum endlich geöffnet wurde und ein Mann hereinkam. Er war mittelgroß, hatte einen kahlen roten Schädel und war so dicht wie…
Damned, er sah nicht nur so aus wie der Blacksmith, er war es auch. Er hatte seine Schmiedeschürze abgebunden und trug jetzt eine grüne Schürze. Ohne Hast kam er an den Tisch des Marshals.
»Hier läßt sich überhaupt niemand sehen«, sagte Wyatt.
»Na, hören Sie mal, sie scheinen mir ein reichlich ungeduldiger Mann zu sein. Glauben Sie denn, ich könnte Ihrem Gaul den Huf raufzaubern?«
»Was haben Sie denn mit dem Wirt hier zu tun?«
»Wenn Sie die Augen aufgemacht hätten, Mister, dann hätten Sie draußen lesen können, daß hier Ed Balans Saloon ist. Und ich bin Ed Balan, wie ich Ihnen schon sagte.«
»Aha, und die Pferdewechselstation, gehört die etwa auch Ihnen?«
»Selbstverständlich. Oder denken Sie, ich ließe sonst jemanden an den wichtigsten Punkt in der Stadt? Mit den Overlandgäulen muß man umgehen können.«
»Und das können die anderen Leute hier in der Stadt nicht?«
»Nein.«
Wyatt fand es ziemlich merkwürdig, daß er außer dem vielseitigen Ed Balan noch keinen anderen Menschen hier gesehen hatte. Die ganze Stadt konnte doch unmöglich nur aus dem Dicken bestehen.
Wyatt bestellte einen Kaffee.
»Kaffee?« krächzte der Dicke verächtlich. »Um diese Zeit? Wo gibt’s denn so was? Kaffee gibt’s in Balan nur morgens. Nehmen Sie einen anständigen Brandy, der bringt Sie nach der Hitze und dem Staub wieder zu Verstand.«
»All right, dann bringen Sie mir einen Whisky. – Gibt’s auch was zu essen?«
»Natürlich, in zwei Stunden.«
»Weshalb erst dann?«
Entrüstet warf der Dicke die Arme in die Höhe.
»Wollen Sie vielleicht für mich das Brot backen? Außerdem muß ich den frischgeschlachteten Ochsen jetzt aus dem Hof in die Fleischkammer bringen.«
Wyatt stieß seine Zigarre im Aschbecher aus.
»Nur eine bescheidene Frage, Mister Balan. Sie sind doch ganz sicher der Sheriff dieser hübschen Stadt?«
»Ich hoffe doch nicht, daß Sie daran gezweifelt haben«, knurrte der Dicke und öffnete seine Weste, so daß der Marshal auf der linken Brustseite des Dicken tatsächlich einen verbeulten Sheriffstern sehen konnte.
»Haben Sie nun von dem Black-smith, von dem Sheriff, von dem Sa-looner, von dem Butcher, von dem Bäcker oder von dem Stationsmaster gehört, Mister?«
»Ich glaube von dem Blacksmith, Mister Balan.«
Der kauzige Dicke holte die Brandyflasche und versäumte es nicht, bevor er das bereitgestellte Glas seines Gastes einschenkte, die Flasche an den Hals zu setzen und selbst einen herzhaften Schluck zu nehmen.
Und dann konnte der Missourier feststellen, daß Balan tatsächlich nicht nur aus dem vielseitigen Eddie bestand.
Drei Männer kamen in die Schenke, nahmen an einem Tisch Platz und begannen zu pokern.
Balan kam zwischendurch herein, bediente sie ohne allzu großen Eifer, legte seine weiße Bäckerschürze ab und verbreitete einen angenehmen Duft von frischem Brot. Dann machte er sich davon, höchstwahrscheinlich, um den Ochsen in tellergerechte Steaks aufzuteilen.
Als nach einer Stunde unter rumpelnden Gepolter und mit knarrenden Rädern, von vier schnaubenden Füchsen gezogen, die Overland nebenan vor der Pferdewechselstation anhielt, sah Wyatt, der inzwischen auf der anderen Straßenseite auf einem Stein Platz genommen hatte, daß der Dicke tatsächlich in den Corral watschelte, um die vier Wechselpferde hinauszubringen.
Wyatt sprach ein paar Worte mit dem Driver und erfuhr von ihm, daß die nächste Ranch fast neunzig Meilen von hier entfernt im Nordosten lag.
Und als der Marshal sich nach Balan erkundigte, meinte der Driver: »Hier wohnen noch drei oder vier andere Familien. Sie sind mit dem Dicken gekommen, und ich werde das Gefühl nicht los, daß sie anscheinend ohne ihn aufgeschmissen sind. Denn der einzige, der in diesem Nest etwas kann, ist er. Und nicht nur etwas kann, sondern auch tut. Das Verrückte ist nur, daß sich die ganze Bande darauf verläßt.«
Wyatt schüttelte lachend den Kopf. Dann fragte er den Overlanddriver nach Jonny Saunders.
Der Postkutschenfahrer hatte weder den Burschen noch den größeren Mann gesehen, von dem die Indianerin gesprochen hatte. Ehe er weiterfuhr, meinte der Driver:
»Ich weiß nicht, ob es Sie interessiert, Mister, aber in Fort Apache hieß es, daß Geronimo aus der Gefangenschaft ausgebrochen ist.«
»Geronimo?« fragte Wyatt verblüfft. »Lebt der überhaupt noch?«
»So was stirbt doch nicht, Mister.«
Drüben winkte der Dicke, der den Pferdewechsel erledigt hatte, und mit einem heiseren Schrei trieb der Driver die neuen Pferde an. Polternd und gefährlich schaukelnd rollte die Postkutsche nach Westen davon.
Wyatt ging zur Schmiede hinüber, um sein Pferd zu holen.
Der Dicke war ihm gefolgt. Als er sah, daß der Fremde den beschlagenen Huf anhob und begutachtete, fragte er:
»Zufrieden?«
»Ja.«
»Dann zahlen Sie zwei Dollar.«
»He, ich habe für den Brandy auch zwei Dollar bezahlt«
»In Balan kostet alles zwei Dollar. Wenn Sie übernachten wollen, wenn Sie sich die Haare schneiden lassen wollen…«
»Sind Sie etwa auch Barbier?«
»Weshalb denn nicht? Das ist doch die leichteste Sache der Welt. Und wenn Sie zum Beispiel bis zum Abendessen geblieben wären, dann könnten Sie für zwei Dollar ein Steak á la Balan probieren.«
Wyatt beschloß, noch in den Genuß des billigen Steaks zu kommen und die Zeit des Abendrots abzuwarten.
Er hatte sich in der ›Stadt‹ inzwischen etwas umgesehen, war um die Häuser herumgezogen und gewahrte plötzlich einen Reiter, der von Süden her auf die Ansiedlung zugeritten kam.
Zu seiner Verwunderung stellte er fest, daß es ein Indianer war. Der Rote saß auf sattellosem Pferd, hatte eine faltenzerrissene Lederhaut und tiefdunkle, nur wenig schräg sitzende Augen.
Er führte sein geschecktes Pony vor die Schenke, stieg ab und warf die Zügelleine um den Querholm. Dann warf er einen forschenden Blick über die Häuserfront. Endlich schob er die Schwingarme auseinander und trat ein.
Wyatt hatte ihn beobachtet. Interessiert folgte er ihm auf den Vorbau und sah über die hölzernen Türklappen in den Raum.
Der Apache war an die Theke getreten. Balan kam aus der Nebentür, knurrte einen Gruß, den der Rote erwiderte, und nahm dann ein Glas Wasser, das er dem Indianer hinschob.
Der trank in langsamen Schlucken.
Das Geräusch näherkommenden Hufschlags ließ den Missourier aufblicken. Oben an der Anhöhe, zu der die Overlandstraße hinaufführte, kamen drei Reiter.
Obgleich sie noch ein gutes Stück entfernt waren, erkannte Wyatt zwei von ihnen sofort: Manuel ›Cherry‹ Pika und Joel McLean.
Den dritten Mann kannte er nicht.
Da er es für unnötig hielt, den drei Banditen hier zu begegnen, trat er rasch in die Schenke und setzte sich hinten an den letzten Tisch im Dunkel.
»Da sehen Sie ja nichts!« meinte der Salooner.
»Macht nichts, Mister Balan. Es kommen da drei Männer, die ebenso wenig Wert auf mich legen werden wie ich auf sie.«
»All right. Noch einen Brandy?«
»Wenn es sein muß.«
»Muß nicht…«
Der Wirt stellte ihm ein Glas auf den Tisch und legte eine Zeitung dazu.
Draußen klang Hufschlag auf.
Die drei Tramps sprangen von den Pferden.
Wyatt hatte also richtig vermutet: sie kamen in die Schenke.
Joel McLean als erster. Lärmend und wie ein Dragoner aufstampfend kam er an die Tür und hängte sich über die Schwingarme.
»Müder Laden!«
»Bleib draußen, wenn es dir hier nicht gefällt!« knurrte ihn der Wirt ahnungslos an.
McLean blickte auf.
»He, Cherry, sieh dir diesen Fleischklotz an, der kann sprechen.«
Der federnde Grenzbandit war draußen zu hören. Dann tauchte sein schmaler, scharfkantiger Schädel über McLeans Schulter auf.
»Damned, bin ich farbenblind, oder steht da tatsächlich eine Rothaut?«
McLean stieß die Schwingarme der Tür so hart auseinander, daß sie gegen die Wand schlugen.
»Nicht so hastig, Brother!« rief Balan. »Die Tür hat eine Reihe von Jahren gehalten, und ich habe bestimmt, daß sie erst aus den Angeln genommen wird, wenn nicht genug Bretter für meinen Sarg in der Stadt aufgetrieben werden können.«
»Wenn du noch viel redest, Fett-wanst, dann kann die Sägerei gleich losgehen!« schnarrte Pika.
Der dritte Mann kam herein. Es war ein mittelgroßer Mensch, dessen Schädel nackenlos auf dem massigen, untersetzten Rumpf zu kleben schien.
»But!« rief McLean, »häng mal eine der Schwingtüren aus. Der vollgefressene Schnapspanscher da wüßte gern, wie es sich anhört, wenn so ein Ding auf die Straße poltert!«
Zum Gejohle der beiden anderen riß der Bandit Henry die rechte Tür heraus und schleuderte sie mit aller Kraft auf die Straße.
Balan richtete sich auf.
»Hol die Tür rein, Satteltramp. Und wenn du sie nicht sofort wieder ordentlich einhängst, kommst du ins Jail.«
Auf seiner mächtigen Brust war plötzlich der Sheriffsstern zu sehen.
Die drei Outlaws stutzten. Aber es war nur ein gewohnheitsmäßiges Stutzen vor dem Stern. Dann brachen sie in ein geradezu hysterisches Gelächter aus.
Pika brach plötzlich ab, trat an den Dicken heran und meinte: »Sheriff bist du auch, Fettwanst? Well, dann höre genau zu, was ich dir sage: Ich bin Manuelo Pika. Wenn du Sheriff bist, wirst du ja von mir gehört haben. Mit mir gibt’s keine Späße. Und dieser Mann da ist Joel McLean. Auch sein Name wird dir etwas sagen.«
»Well!« knurrte der Dicke. »Und ob er mir was sagt. Da hat sich ja eine saubere Gesellschaft bei mir eingefunden.« Er zog sich hinter seine Theke zurück.
»Whisky!« bellte Pika.
Der Wirt stellte eine Flasche und drei Gläser hin. McLean probierte.
»Dein Glück, Fleischklotz – wenn es Schlangengift gewesen wäre, hätte ich dir die Flasche eingetrichtert!«
Die beiden anderen glaubten, diesen armseligen Witz mit schallendem Gelächter quittieren zu müssen.
Pika nippte nur an seinem Glas. Er hatte, wie auch die beiden anderen, den Indianer nicht weiter beachtet; jedenfalls tat er so. Dabei kribbelte es in seinen Händen.
Der Apache hatte sein Glas ausgetrunken, sagte einen kurzen Dank und wollte hinaus.
Da stellte ihm Pika einen Fuß.
Er hatte Pech, der Indianer hob das Bein rasch an und ging weiter.
Da schnellte Pika ihm nach und riß ihn herum. Wilder Zorn brannte in seinen tückischen Augen.
»Was denn, du dreckige rote Kröte! Bildest du dir vielleicht ein, daß du mit Manuelo Pika spielen kannst?«
Der Indianer sah ihn verächtlich an.
Da zischte But Henry:
»Was gibst du dich lange mit dem Stinktier ab? Schlag den Hund nieder und wirf ihn zur Tür hinaus!«
Pika feixte.
Da sprang Henry vor und drang auf den Indianer ein.
Aber er hatte nicht viel mehr Glück als vor ihm Pika. Der Apache wich geschickt aus – und der Bandit fiel polternd auf den Boden.
Da stürzten sich die beiden anderen mit Wutschreien auf den Roten.
Der Missourier hatte sich heraushalten wollen; jetzt aber wurde es ihm zuviel. Rasch stand er auf und stürmte auf die Tramps zu. Er bekam McLean an der Schulter zu packen, riß ihn herum und hieb ihm einen krachenden Haken gegen die Kinnlade.
Der Outlaw ging lautlos in die Knie.
But Henry, der wieder hochgekommen war und ein Messer gegen den Roten gezogen hatte, fing eine rechte Gerade gegen die Herzspitze ein. Er legte sich widerspruchslos gleich neben seinen Kumpanen McLean.
Pika hatte den Kopf herumgeworfen.
»Wyatt Earp!« entfuhr es ihm. »Hölle! Wyatt Earp!«
»Yeah, Cherry Boy!«
Der Bandit federte zurück und wollte zum Colt greifen. Aber er war kein solcher Klasseschießer, daß er den Dodger Marshal hätte überrumpeln können. Wyatt hatte den Bunt-line Special schon in der Linken.
»Ich sagte es dir schon einmal, Pika: Du mußt entweder bedeutend schneller oder sehr viel vorsichtiger werde. – Hand von der Waffe!«
Pikas Gesicht war eine Studie rasender Wut. Er vermochte sich nicht zu beherrschen. Zwar nahm er die Hand vom Colt, senkte dafür aber den Kopf und hechtete dem Missourier mit einem heiseren Schrei entgegen.
Wyatt machte nur eine kaum merkliche Körperbewegung zur Seite, ließ den Tramp passieren und hieb ihm einen Handkantenschlag zwischen Ohr und Schulter.
Der fürchterliche Hieb schien den Verbrecher rechtsseitig gelähmt zu haben. Er kniete am Boden und vermochte nicht hochzukommen.
Es war alles so schnell gegangen, daß weder der Indianer noch der Wirt etwas hatten unternehmen können.
Jetzt riß der Apache ein Messer heraus.
Wyatt blickte ihn an.
»Der rote Mann kann seine Klinge im Gurt lassen – es ist vorbei.«
Auch Balan kam jetzt heran. Er hatte eine Schrotflinte in seinen Wurstfäusten.
»He, was war das, Mister? Sie sind Wyatt Earp?«
»Yeah.«
»Moment mal – das kann ich gar nicht so rasch verdauen! Soviel wie in den letzten fünf Minuten hier passiert ist, ist ja in den letzten drei Jahren zusammen nicht passiert!«
Der Indianer verließ grußlos und mit finsterer Miene die Schenke.
McLean kam zu sich, richtete sich keuchend auf und stierte den Missourier aus blutunterlaufenen Augen an.
»He, Pika!« Er stieß seinen mit verzerrtem Gesicht immer noch an der Erde knienden Genossen an. »Komm, mir ist die Lust am Whisky gründlich vergangen!«
»Habe ich dir nicht gleich gesagt, daß du draußen bleiben sollst, Tramp?« spottete der Dicke. »Ich habe noch mehr solcher Überraschungen bereit!« prahlte er.
»Noch mehr?« Pika kam ächzend hoch. »Well, der Boß wußte es doch, daß der andere Halun… daß der andere auch da ist.«
But Henry hatte das Ganze gar nicht richtig mitgekriegt. Als er zu sich kam, waren seine beiden treuen Kameraden schon draußen. Er richtete sich fluchend auf und wollte schon wieder erneut auf den Missourier losstürzen.
Der fing ihn mit einem linken Stopper ab, packte dann den wieder Heranstürmenden am Oberarm und schleuderte ihn gegen den schweren Thekentisch, daß man glaubte, sämtliche Knochen des Banditen knacken zu hören.
»Komm raus, But!« brüllte Pika draußen. »Er ist Wyatt Earp. Und wo der ist, ist auch Doc Holliday! Der Boß hat es sofort gewußt, als er den Tex bei Frenclyn…«
Cherry Pika brach ab.
Henry war blaß geworden. Er wollte sich an dem Missourier vorbei zur Tür drücken.
Wyatt hielt ihn fest.
»Augenblick, Boy. Da stehen drei halbvolle Gläser mit Whisky. Die sind noch zu bezahlen. Und dann noch etwas: Hast du den Tex auch bei Frenclyn gesehen?«
But Henry schüttelte den Kopf.
Wyatt mußte die Wahrheit aus dem Tramp herauspressen. Blitzschnell klatschten zwei hageldicht aufeinanderfolgende Ohrfeigen in das Gesicht des Banditen.
»Mach den Mund auf, Junge, sonst wird’s härter!«
But Henry war kein besonders widerstandsfähiger Mann. Außerdem würgte die Angst vor dem berühmten Gesetzesmann ihm in der Kehle; er hatte ein ganz beachtliches Sündenregister auf dem Buckel.
»Yeah…«
»Wen?«
»Short.«
Wyatt Earp hatte Mühe, seine Überraschung zu meistern; aber es gelang ihm glänzend. »Und…?«
»Was wollen Sie noch, Marshal?« stotterte der Outlaw heiser.
»Jonny Saunders!«
Der Tramp nickte.
»Ich wußte es«, sagte Wyatt. »Es ist dein Glück, daß du die Wahrheit gesagt hast. Und nun hör genau zu, Brother: Sieh zu, daß du hier schnellstens aus der Gegend kommst. Hier wird die Luft in Kürze so heiß, daß sie
Burschen wie dir nicht bekommen wird!«
Henry wollte weg.
»Erst zahlst du den Whisky!«
Da kramte der Verbrecher einen Dollar hervor.
»Zwei!« fuhr ihn der Salooner an.
Da nestelte er wohl oder übel noch eine Münze hervor und legte sie auf die Theke. Ohne sich noch einmal umzusehen, trollte er sich hinaus.
Seine beiden Genossen waren schon fast eine halbe Meile weit weg. Von dem Indianer war weit und breit nichts zu sehen.
Wyatt und der Wirt standen in der Tür.
Da rief Balan einen Jungen an: »He, bring den Schwingarm her und häng ihn da ein!«
Zehn Minuten später machte sich auch der Missourier auf den Weg.
Was er da durch einen puren Zufall erfahren hatte, war mehr, als er erwarten konnte. Unbewußt hatte er die Pferdewechselstation angesteuert. Well, er hatte gehofft, einen Menschen anzutreffen, der vielleicht dem Ranchersohn irgendwo begegnet war. Aber was er da aus diesem Banditen herausgepreßt hatte, war ja toll: Luke Short war im County!
Er und Jonny Saunders waren auf der Frenclyn Ranch! Und Curly Bill und seine Banditen auch!
Der lange Tex war also der ›große Mann‹, von dem die Indianerin gesprochen hatte.
Wyatt glaubte, daß Luke Short und der Bursche irgendwie in die Hand der Bande gekommen waren. Denn daß die beiden freiwillig auf die Frenclyn Ranch geritten waren, wäre ihm nie in den Sinn gekommen.
Da gab es nichts zu überlegen: er mußte die beiden heraushauen!
Und das war in Anbetracht der Bande und der Ranchmannschaft sicher keine Kleinigkeit. John Saunders hatte ihm erzählt, daß Frenclyn eine unerhört starke und wilde Crew habe. Wenn diese Cowboys mit Curly Bill gemeinsame Sache machten, dann hatte der Marshal womöglich zwanzig Leute gegen sich.
Wyatt hatte sich auf der Pferdewechselstation unauffällig nach der genauen Lage der Ranch erkundigt. Er war nun in der Lage, sich bei Nacht anzuschleichen.
Es ging dem Abend entgegen.
Das Land wurde jetzt stark hügelig und war mehr und mehr mit dichtem Buschwerk besetzt. Kleine Waldungen tauchten auf. Hin und wieder sah man riesige rote Sandsteinsäulen in den Himmel ragen. Im Westen hatte sich der Horizont purpurrot gefärbt.
Eben hatte der Missourier einen Hügelkamm erreicht und den Rappen in die nächste Talmulde gesenkt, als er plötzlich vor sich auf dem nächsten Hügelgipfel einen Reiter auftauchen sah.
Es war ein Indianer. Ein hochgewachsener Mann mit breiten Schultern und langem Haarschopf, in dem eine große schwarze Feder steckte. In der rechten Hand trug er eine Winchester.
Wyatt ritt noch ein paar Yards den Hang hinan und hielt dann an.
Er konnte das Gesicht des Roten jetzt deutlich erkennen. Es war ein grobes Gesicht; scharf und eckig. Böse und kalt funkelten die Augen aus engen Schlitzen.
Es war ein Apache. Er trug eine leichte, aus dünnem Leder gegerbte Jacke und eine fransenbesetzte lange Hose. Sein Pferd war ein prächtig gewachsener Weißfuchs, der nervös den Kopf hochwarf und ein ungebärdiges Schnauben ausstieß.
Wie ein Denkmal stand der Indianer auf der Hügelkuppe.
Schon nach dem ersten Blick wußte der Missourier, daß dieser Mann da oben ein Häuptling war. So, wie er da stand, verhielt sich kein Indianer, der allein war. Zudem ritt ein Häuptling selten allein.
Schon im nächsten Augenblick sollte sich Wyatts Befürchtung bewahrheiten. Rechts und links neben dem Apachen Chief tauchten mehrere Reiter auf.
Es waren wenigstens dreißig Indianer. Der Missourier wußte, daß er sich nicht umzudrehen brauchte: auch hinter ihm hielten Indianer.
Immer noch rührte sich der Häuptling nicht.
Auch der Marshal regte kein Glied. Wenn ein Indianer etwas imponiert, dann war es überlegene Ruhe.
Mehrere Minuten waren verronnen. Da hob der Apache die linke Hand.
Daraufhin ritt einer der Indianer vorwärts, bis auf etwa sechs Yard an den Weißen heran. Im gebrochenen Englisch erklärte er:
»Der Häuptling läßt dich fragen, ob du kämpfen oder freiwillig mitkommen willst.«
»Sage deinem Chief, daß ich keinen Grund habe, mit euch zu kämpfen, und daß ich keine Zeit habe mit euch zu kommen.«
Wortlos wandte der Rote sein Pferd und ritt zu den anderen zurück.
Der Häuptling hörte sich die Antwort des Weißen an, trug dem Boten dann wieder etwas auf und schickte ihn erneut zu dem Weißen hinüber.
»Der Häuptling sagt, daß du ein kluges Blaßgesicht bist, denn wer ohne Hoffnung auf Erfolg kämpfen muß, hat keinen Grund mehr zu kämpfen. Es ist allerdings ein Irrtum von dir, daß du keine Zeit habest, denn du wirst ungefähr noch drei Tage Zeit haben. Dann stirbst du.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, wandte sich der Indianer um.
Fieberhaft überlegte der Missourier, ob er diesen Mann festhalten und versuchen sollte, ihn als Geisel zu benutzen. Aber er wies diesen Gedanken rasch wieder von sich. Mit dreimal zehn Indianern vor sich und vielleicht noch einem Dutzend im Kreuz war tatsächlich jeder Kampf sinnlos.
Jetzt kam der Häuptling selbst heran. Drei Schritte vor dem Weißen hielt er sein Pferd an und hob das Gewehr.
»Woher kommt der weiße Mann?«
»Von Balan.«
»Dann gehört er zu den Männern, die meinen Späher angegriffen haben.«
»Du irrst dich. Und ich bin sicher, daß du deinen Späher fragen wirst.«
Ganz sicher hatte dieser Apachentrupp in irgendeinem Lager festgesessen. Es war in den siebziger Jahren, als die großen Reservate angelegt wurden, nicht selten vorgekommen, daß ganze Indianertrupps ausbrachen, um mordend, plündernd und sengend durch das Land zu ziehen und so Rache an dem weißen Mann zu nehmen, der für die großen ›Menschenpferche‹ für den roten Mann geschaffen hatte. Aber seit sechs, sieben Jahren hatte sich das gegeben. Die Indianer waren still geworden und schienen sich in ihr unvermeidliches Schicksal ergeben zu haben. Es war nicht zuletzt das Verdienst des großen Häuptlings Cochise, der es verstanden hatte, nicht nur die Apachen, sondern auch viele andere Stämme dazu zu bewegen, Ruhe zu halten.
Eines Tages hatte man dann von einem Unterchief gehört, von einem Mescalero Apachen namens Geronimo, der sich von Cochise losgesagt hatte und den Kampf gegen die Blaßgesichter fortsetzen wollte. Dieser Geronimo hatte seinen roten Brüdern mit seinem ›Freiheitskampf‹ alles andere als Nutzen gebracht. Denn dieser Kampf war nutzlos. Und ein so kluger Mann wie er wußte das. Sinnlos opferte er Menschenleben, um sein persönliches Machtbedürfnis zu befriedigen.
Daß der Mann, der jetzt auf dem Hügel hielt, Geronimo sein sollte, glaubte Wyatt nicht, obwohl ihm über das Geschick dieses berühmt-berüchtigten Rebellen nichts wirklich Genaues bekannt war. Es gingen so viele Gerüchte über Geronimo durchs Land, daß man am Schluß tatsächlich nicht mehr wußte, was man überhaupt glauben sollte.
Die Legende ließ den roten Geronimo immer wieder auftauchen; ob er tatsächlich noch lebte, oder ob es immer ein anderer war, den die weißen Behörden dann kurzerhand für Geronimo hielten, schien niemand genau zu wissen.
Wyatt Earp hatte immer bezweifelt, daß sich irgendein aufständische Indianerboß den großen Namen des roten Rebellen zulegen würde, um draus irgendeinen Nutzen zu ziehen. Ein Indianer-Chief, dem es gelungen war, Aufsässige um sich zu scharen, hatte ganz sicher darauf verzichtet, den Namen irgendeinen anderen Indianers zu benutzen, sondern im Gegenteil dafür gesorgt, daß sein eigener Name bekannt wurde.
Der Mann mit der schwarzen Feder, der jetzt vor dem Missourier hielt, musterte ihn aus kalten Augen. Dann sprangen seine Lippen wie Gesteinsbrocken auseinander, und er erklärte im gutturalen Tonfall seiner Rasse:
»Ich bin Geronimo.«
Der Indianer suchte die Wirkung dieses Namens auf den weißen Mann zu beobachten. Aber obgleich Wyatt Earp einen Augenblick verblüfft war, war ihm jedoch nicht das geringste anzumerken.
Sollte er sich so getäuscht haben? Well, Ausnahmen bestätigen die Regel. Natürlich konnte es entartete Typen auch unter den Indianern geben, Männer, die sich den großen Namen zulegten, um sich an der Furcht zu weiden, die andere davor empfanden. Aber ein solcher Mann besaß keinen Stolz.
Der Missourier durchforschte das Gesicht des Roten. Es war steinern, eckig und wirkte abweisend. Der erfahrene Westläufer aus Dodge City glaubte in den Augen des Roten und in seiner Haltung echten Stolz zu sehen. Sollte dieser Mann wirklich der berüchtigte Geronimo sein?
Aber dieser Erwägung widmete der Marshal kaum einen Gedanken. Für ihn war nur die scheußliche Lage wichtig, in der er sich befand. Oben auf der Frenclyn Ranch waren Luke Short und der junge Jonny Saunders gefangen, und er saß hier von Indianern umringt in der Klemme.
Der Blick des Indianers, in dem eine Spur von Erwartung gelegen hatte, wurde wieder vollends finster.
»Kennt mich der weiße Mann nicht?«
»Nein, aber ich habe von dir gehört.«
»Das ist gut. Dann weißt du, was dir bevorsteht. Ich kämpfe für die Freiheit meines unterdrückten Volkes…«
»Yeah, ich weiß«, unterbrach ihn Wyatt schroff.
»Wagt der weiße Mann das etwa zu bezweifeln?«
»Ich weiß, daß Cochise für die Freiheit des roten Volkes gekämpft hat und noch immer kämpft.«
Der Indianer warf den Kopf herum und blitzte den Marshal an.
»Was fällt dir ein? Nenn mir diesen Namen nicht ein zweites Mal, sonst töte ich dich auf der Stelle!«
In diesem Augenblick wußte der Missourier, daß der Indianer wirklich Geronimo war. Nur der einstige Unterführer Cochises, der von dem großen Apachenhäuptling verstoßen worden war, konnte so bei Nennung des verhaßten Namens reagieren.
Wyatt sah ihn unerschrocken an. »Ich fürchte mich nicht vor dem Tod, Geronimo. Aber da du überhaupt mit mir gesprochen hast, habe ich dir geantwortet.«
Der Indianer suchte das Gesicht des Weißen zu durchforschen. Dann griff er in seine Satteltasche und brachte ein ziemlich neues Nelson-Glas zum Vorschein.
»Ich habe oben im Gras gelegen und dich mit dem Teufelsauge schon eine Weile beobachtet. Du hast ein sonderbares Gesicht. In deinen Augen ist etwas, das sonst in den Augen der weißen Männer fehlt – wer bist du?«
»Mein Name ist Earp.«
Wieder warf der Häuptling den Kopf herum und sah Wyatt forschend an. »Wie heißt du?«
»Earp.«
»So wie der Sheriff?«
»Genauso.«
Geronimo stieß das Fernglas wieder in die Satteltasche. Ohne den Missourier wieder anzusehen, fragte er heiser:
»Bist du etwa der Sheriff Earp?«
»Yeah. Das heißt, ich bin einer davon, meine beiden Brüder sind auch Sheriff.«
Der Indianer hob den Blick nach Westen, wo jetzt ein violettfarbener Ton den ganzen Horizont bedeckte, und sagte mit einer sonderbaren Selbstverständlichkeit:
»Du bist Wyatt Earp!«
Der Marshal schwieg.
»Weshalb antwortest du nicht? Bist du zu stolz, mir zu antworten? Well, ich glaube, daß du Wyatt Earp bist; aber ich bin ebenso berühmt wie du und ebenso stolz.«
Wieder schwieg der Marshal.
Auch Geronimo schwieg jetzt. Stumm und reglos verharrten oben die Indianer, als seien sie aus dem Hügel heraus in den Abendhimmel gewachsen.
Erst nach einer vollen Minute brach der Häuptling das Schweigen.
»Dann bist du es also gewesen, der meinem Späher in der Schenke beigestanden hat.«
Anstatt einer Antwort fragte der Missourier:
»Kann ich jetzt weiterreiten?«
»Weiterreiten?« kam es heiser von den Lippen des Indianers. »Ja, das kannst du. Und zwar mit mir. Ich habe viele tausend Bleichgesichter gesehen und zehntausend von ihnen vergessen. Und du wirst doch nicht glauben, daß ich Wyatt Earp weiterreiten lasse. Ich nehme dich mit in mein Lager, und ich weiß, daß du die Ehre zu würdigen weißt, den langen Tod am kahlen Baum zu sterben. Du sollst nicht sterben wie ein Hund oder wie all die anderen Blaßgesichter, die ich zur Hölle geschickt habe. Dein Tod wird ein großes Fest für die Apachen sein.«
»Für die Apachen?« fragte Wyatt rauh. »Die leben oben in den roten Bergen bei dem großen Häuptling Cochise, den du glaubst verachten zu können. Wenn ich bei den Apachen sterben soll, dann mußt du mich hinauf in die Berge bringen.«
Mit einem Blick tiefster Verblüffung starrte der Indianer Chief den Weißen an.
»Das wagst du mir zu sagen?« krächzte er.
»Hast du eine Unwahrheit von mir erwartet?«
Die mächtige Brust des Indianers hob und senkte sich.
»Nein«, sagte er schließlich. »Ich habe den Stolz in deinen Augen gesehen, als du hier über den Hügel rittest. Du bist Wyatt Earp. Und dein Tod wird das größte Fest sein, das meine Krieger je erlebt haben.« Geschickt hatte er jetzt den Ausdruck Apachen vermieden.
Er hob die Rechte mit der Winchester und stieß einen heiseren Schrei aus.
Sofort setzten die Indianer ihre Pferde in Bewegung und nahmen in Schlangenlinie hinter ihrem Häuptling und dem Weißen Aufstellung.
»Ich werde meinen Männern noch nicht sagen, wer du bist. Es soll eine große Überraschung für sie werden, wenn sie morgen hören, wen ihr Häuptling eigenhändig an den kahlen Baum des Todes fesseln wird.«
Morgen? Lag das Camp der Rebellen noch so weit?
Der Marshal sollte es erfahren. Es lag noch sehr weit im Norden. Aber die Indianer ritten in Eile davon.
*
Zwei Tage waren vergangen.
Auf der Frenclyn Ranch herrschte eine sonderbare Stimmung. Seit der Nachtstunde, in der But Henry zurückgekommen war und berichtet hatte, was unten im Tal auf der Pferdewechselstation geschehen war, hatte Curly Bill die Ranch nicht mehr verlassen. Mit fanatischem, fast ängstlichem Eifer war er unentwegt damit beschäftigt, die schon so stark befestigte Ranch noch weiter gegen einen plötzlichen Überfall zu sichern. Er hatte seine Leute so verteilt, daß es selbst eine Maus schwer geworden wäre, unbemerkt durch den Palisadenzaun auf die Ranch zu kommen.
Nach zwei Tagen jedoch wurde den Tramps die Wache leid. Sie hatten nur wenig geschlafen, und die Verpflegung von der Ranch war schlecht. Zudem ärgerte es sie, daß Frenclyn seine Leute nach dem zweiten Tag zum Teil wieder hinaus auf die Weide schickte, während sie selbst wie Holzfiguren auf ihren Plätzen verharren sollten. Und bald verließen die ersten meuternd ihre Posten.
Luke Short war von einem alten Cowboy bewacht worden, der ihn einmal am Tage für fünf Minuten aus dem Schuppen führte und dann wieder hinten an die Bohlen zwischen dem Gerümpel fesselte. Das Essen, das schon für die Tramps sehr schlecht war, fiel für die Gefangenen geradezu haarsträubend aus.
Dennoch fühlte sich der eisenharte Texaner in recht guter Verfassung. Er hatte sich keineswegs aufgegeben und machte sich nur Sorgen wegen Jonny.
Dicht hinter dem Geräteschuppen saß einer der Tramps vor einer Schießscharte an der Fenz und unterhielt sich ungezwungen laut mit seinem Nachbarn, der sich nur ein Stück entfernt von ihm mit der gleichen Aufgabe langweilte.
Der alte Cowboy, der bei dem Texaner Wache hielt, war ein schweigsamer Bursche. Ein paarmal hatte Luke versucht, den stoppelbärtigen, mißmutigen Alten auszuhorchen, aber ohne jeden Erfolg.
Der Bursche, der hinter dem Schuppen hockte, hieß Jimmy. Schon hundertmal wurde er am Tag und in der Nacht von den anderen gerufen. Er war ein besonders geschwätziger Bursche. Luke Short kannte bereits seine ganze Lebensgeschichte, kannte die Namen aller Mädchen, die er haben wollte, und auch sonst alles, was den Schwätzer anging.
Ohne allen ersichtlichen Grund hatte der Bandit Jimmy Foster plötzlich die Schnute voll. Er begann zu krakeelen, spazierte auf und ab und ging an der Längsseite des Schuppens entlang auf den Hof zu.
Stampfende Schritte näherten sich vom Ranchhaus her, und dann war Curly Bills whiskyrauhe Stimme zu hören:
»Was soll das, Jim, bist du plötzlich übergeschnappt?«
»Nein, Boß, aber ich habe die Schnauze voll. Wir hocken hier Tag und Nacht hinter dem Zaun und starren die Pfähle an. Das ist doch Irrsinn. Was der Rancher uns vorsetzen läßt, ist der reinste Hundefraß. Sie haben uns Beute versprochen, einen Haufen Geld, tolle Weiber und was weiß ich sonst noch. Statt dessen hocken wir wie die Narren hinter einer Wand von Pfählen, die dieser hirnverbrannte Rancher um seinen Laden gezogen hat.«
»Wirst du dein Maul halten?« herrschte ihn der Desperado an.
»Nein, Brocius. Bloß, weil Sie die Hosen gestrichen voll haben, seit da neulich auf der Saunders Ranch der Marshal aufgetaucht…«
Ein klatschendes Geräusch unterbrach das Gebrüll des Tramps. Dann knackte ein Revolverhahn.
»Da hast du Pech gehabt, Curly Bill«, keuchte Jimmy Foster. »Ich bin schneller als du. Und den Faustschlag wirst du mir bezahlen. Überhaupt, wer bist du denn? Irgendeiner von den zahllosen Leuten, die Ike Clanton nachliefen. Ein großmäuliger Bursche, der nichts auf dem Kasten hat. Wyatt Earp und Doc Holliday haben im O.K.-Corral nicht nur Ike Clanton besiegt, sie haben euch alle fertiggemacht.«
»Da!« rief Curly.
Der Texaner, der dieser Auseinandersetzung mit äußerster Spannung gefolgt war, versuchte verzweifelt, durch die Bretterritzen etwas zu erkennen.
Ein Schuß peitschte über den Hof. Dumpf schlug der Körper eines Menschen gegen die Bretterwand. Dann drang die rauchige Stimme des Tombstoner Desperados an das Ohr des Texaners.
»Armseliger Dreckskerl. Hat sich eingebildet, einen Curly Bill schaffen zu können. Und ihr anderen merkt es euch, so wie ihm wird es jedem von euch ergeben, der meutert.
Was weiß denn dieser Idiot von Wyatt Earp? Nichts, überhaupt nichts. Wenn ich nicht vermuten müßte, daß ich mir den Marshal nur dadurch vom Leibe halten kann, daß ich Luke Short freigebe, lebte der Tex längst nicht mehr. Wyatt Earp war auf der Saunders Ranch. Und er war nicht zufällig da. Das weiß ich genau. Ich kenne ihn schließlich seit Jahren. Dieser Wolf hat es sich zum Ziel gesetzt, jeden Rebellen zu stellen.
Jetzt bin ich dran. Und wenn ich ihn schlagen will, dann brauche ich dazu meine ganze Energie und jeden einzelnen von euch. Wer aber nicht spurt, wird rücksichtslos ausgelöscht. Ich habe mir mit größter Anstrengung ein neues County gesucht und eine Crew geschaffen. Ich denke nicht daran, dies alles wegen einigen Feiglingen aufzugeben!« Dann schrie der Desperado mit lauter Stimme: »Und vergeßt es nicht: Ich bin Curly Bill, der größte lebende Rebell Arizonas!«
Als der Tote von der Hüttenwand fortgeschafft war, herrschte tiefste Stille auf dem Hof. Es gab ganz sicher nur einen einzigen Menschen, der seit wenigen Minuten glaubte, Grund zu haben, aufatmen zu können: Luke Short!
*
Im Schatten des Stationsgebäudes von Harpersville hockte, wie meistens, der verschrumpelte alte Stationshalter Hutkins. Über seiner erkalteten Pfeife tanzte beharrlich ein kleiner Mückenschwarm. Der Schienenstrang lag unter flimmernder Sonne.
Das Donnern und Poltern des herannahenden Zuges schreckte den Alten aus seinem Schläfchen auf.
Mechanisch erhob er sich, schob den Hocker mit tausendfach geübten Griff durch die Tür in den Raum, knüpfte sein Hemd zu und zwirbelte seinen Schnurrbart.
Wie immer, rollte der Zug auf die Station. Und wie fast immer, stieg niemand aus.
Die Lok stieß einen schrillen Pfiff aus, und als die letzten Wagen fortrollten, langte sich Hutkins mit der Linken den Hocker wieder heraus. Er saß kaum, als er wie von der Tarantel gebissen wieder hochfuhr.
Schlängelnd war der letzte Wagen vorübergerollt, und nun stand drüben auf der anderen Seite des Schienenstranges, dem Alten direkt gegenüber, ein Mann. In der rechten Hand trug er eine kleine schwarze, krokodillederne Tasche.
Er war sehr groß und hatte eine sehnige Figur. Sein Gesicht war blaßbraun und hatte einen fast aristokratischen Schnitt. Der Schnurrbart auf der Oberlippe war dunkel wie das Haar des Mannes und sauber getrimmt. Ein eisblaues Augenpaar beherrschte dieses eigenartige Gesicht.
Der Fremde trug einen schwarzen, flachkronigen Hut, ein blütenweißes Rüschenhemd, einen schwarzen, langschößigen Rock und eine schwarze Hose. Die Stiefeletten blitzten in der Sonne und schienen so ladenneu zu sein wie die zitronengelbe Weste mit den prächtigen schwarzen Stickereien oder auch der große Waffengurt mit den tief über den Oberschenkeln hängenden Halftern, aus denen die elfenbeinbeschlagenen Kolben zweier schwerer fünfundvierziger Revolver hervorsahen.
Der Stationshalter rieb sich die Augen und hüstelte:
»He, Mister, wo kommen Sie denn her?«
»Aus Tombstone.«
Der Fremde kam langsam über den Schienenstrang.
»Woher?« stammelte Hutkins.
Der Fremde zündete sich eine Zigarette an, warf noch einen blinzelnden Blick hinter dem Zug her und blickte dann zur Mainstreet hinunter.
»Eine prächtige Stadt, dieses Harpersville.«
»He…?« stotterte der Alte.
Der Fremde reichte ihm eine Zigarette und meinte:
»Ach, wissen Sie, ich habe einen komischen Freund, der scheint eine leidenschaftliche Vorliebe für Kuhdörfer dieser Art zu haben. Weiß der Teufel…«
Damit schlenderte er mit elastisch federndem Schritt der Mainstreet zu.
Gleich rechts war das Postoffice. Der Fremde hielt darauf zu. Als er die Tür öffnete, fuhr ein blondhaariges Mädchen, das in der Mitte des Raumes gestanden hatte, zurück und schlug sich die Hände vor den Mund.
»Doc Holliday!«
Der Mann in der Tür warf ihr einen forschenden Blick zu.
»Hallo, Lady. Haben wir uns schon irgendwo gesehen?«
Der Georgier Doktor John Henry Holliday hatte sich in kompromißloser Eile auf die Depesche des Marshals hin auf den Weg gemacht.
Aber leider wußte die kleine Lizzy Duncer, die ihn wie ein Fabelwesen anstarrte, ihm nicht weiterzuhelfen.
Holliday verließ das Office wieder und blickte die Straße hinunter. Schräg gegenüber war der Saloon. Damned, er würde erst einen trinken, nach der heißen Fahrt.
Die Schenke war leer. Holliday wartete eine Weile, und als noch immer niemand kam, trat er durch die Nebentür in den Flur.
Zu seiner Verblüffung sah er in das Gesicht eines bildhübschen Indianermädchens, das oben am Treppenabsatz stand.
»He, Miß, ich hätte gern einen Brandy.«
Die Indianerin kam langsam die Treppe hinunter.
»Ich darf nicht in den Saloon, Mister.«
»Weshalb denn nicht? Soll ich mir die Flasche vielleicht selbst suchen?«
Nointa blickte den Mann mit großen Augen fragend an.
»Ich darf nicht«, wiederholte sie.
Der Spieler wollte sich schon umwenden, fragte dann aber doch:
»Haben Sie hier vor ein paar Tagen zufällig einen großen schwarzhaarigen Mann gesehen, dessen linker Revolver überlang war und der…«
»Es war ein sehr gut aussehender Mann, und er saß auf einem schwar-zen Hengst«, sagte die Indianerin leise.
Der Gambler schnipste mit den Fingern.
»Hören Sie zu, Miß. Der Mann ist ein Freund von mir, und ich muß ihn unbedingt finden.«
»Ich kann nicht mehr sagen«, erklärte die Indianerin.
Er verzichtete auf den Brandy, kaufte sich in dem Mietstall nach kurzem Handel einen guten Fuchs und ritt an den nördlichen Stadtausgang.
Nach hundertfach erprobter Ma-nier erfuhr er hier bald, daß Wyatt Earp die Stadt in dieser Richtung verlassen hatte. Er erfuhr auch, daß weit im Osten die Frenclyn Ranch liege.
Er wählte den gleichen Weg, den der Dodger Marshal gemacht hatte: zu der Pferdewechselstation Balan.
Er war noch nicht ganz aus dem Sattel heraus, als ein Schuß aufbrüllte und ihm den Hut vom Kopf stieß.
Im Fallwurf hechtete der Georgier unter den Vorbau.
Oben in der Pendeltür stand mit bleichem Gesicht der Bandit Manuel Cherry Pika.
Er war von Curly Bill auf diesen Posten geschickt worden, um sofort zu melden, wenn der Marshal auftauchen sollte. Nach der harten Abfuhr, die ihm Wyatt Earp bereitete, hatte er auch in der darauffolgenden Nacht die Nachricht zur Ranch gebracht. Als der Missourier sich nicht im Bereich der Ranch hatte blicken lassen, war er von Curly Bill zusammen mit Joe McLean wieder hinunter zur Station geschickt worden mit der Weisung: Wenn ihr ihn seht, löscht ihr ihn aus.
Mit kalkigen Gesichtern standen die beiden Outlaws an den Seiten der Tür.
Erregt zischte McLean Pika zu:
»Bist du sicher, daß du dich nicht getäuscht hast?«
»Nein.«
»Aber das ist doch ausgeschlossen. Der Mann ist doch niemals Doc Holliday.«
»Halt’s Maul!« kreischte Pika. »Hast du Idiot nicht gesehen, wie wieselflink und geschickt der Bursche vom Pferd herunter war und unterm Vorbau verschwand?«
»Das kann doch Angst gewesen sein.«
»Angst?« Pika stieß sich mit dem Revolverlauf den Hut aus der Stirn.
»Du ahnungsloses Schaf! Wenn ein Mann in diesem Leben keine Angst hat, dann ist es der da.«
»Mensch, du siehst Gespenster. Ich werde dir jetzt beweisen, daß dieser Stadtfrack da eine ganz lausige Null ist.«
Er wollte hinaus.
Pika hielt ihn auf.
»Bleib hier, Mensch, sonst bist du es, der eine fingerdicke Null im Kopf hat, und zwar eine aus glühendem Blei. Gegen diesen Kerl hast du absolut keine Chance.«
»Willst du hier ewig stehenbleiben?«
Der Schotte sprang auf den Vorbau und setzte mit einem weiten Sprung auf die Straße, wobei er sich herumwarf, um unter den Vorbau zu feuern.
Aber noch in der Luft riß ihm die Kugel des Georgiers den Revolver aus der Hand.
Dann verließ Doc Holliday seine Deckung und sprang mit einem ganz waghalsigen Satz auf den Vorbau. Jetzt stand er zwischen Fenster und Tür.
Drinnen war ein zweiter Mann. Der Spieler hatte das Flüstern gehört. Jeden Augenblick konnte dieser Mann einen raschen Schuß um den Türpfosten riskieren.
Holliday hatte den Revolver in der vorgestreckten Linken, nahm nun auch den rechten Colt aus dem Halfter, packte ihn am Lauf und zertrümmerte mit dem Kolben die Fensterscheibe.
Cherry Pika war zu aufgeregt, als daß er den Bluff durchschaut hätte. Er sprang zwei Schritte zurück und feuerte wie wild auf das Fenster.
Im gleichen Augenblick brüllte der Revolver des Spielers. Holliday hatte sich nach vorn hinter die Tür geworfen.
Die Kugel traf Manuel Cherry Pika rechts in den Oberarm. Er wollte noch nach seinem zweiten Revolver greifen, aber da war der Spieler schon bei ihm, drückte ihm die Revolvermündung auf die Brust und riß ihm den linken Colt aus dem Halfter.
»Auf die Straße!«
Mit wachsbleichem Gesicht stakste der Grenzbandit auf den Vorbau hinaus.
»Idiot!« kreischte er den gebannt auf der Straße stehenden waffenlosen Genossen an. »Heb doch den Revolver auf und schieß.«
Holliday stieß Pika mit dem Colt vom Vorbau.
»So idiotisch ist er nun wieder nicht, Pika. Sieh da, welch freudige Überraschung! Der flotte Cherry!«
Von der Schmiede her kam der dicke Balan. Der Stern blitzte an seiner Brust.
»Großartig, Mister. Das war ja enorm. Aber Sie werden es nicht glauben, so etwas Ähnliches hatten wir diese Woche schon einmal. Da war es Wyatt Earp.«
»Haben Sie ein Jail?« fragte der Spieler.
»Ein sehr schönes. Aber da hat noch niemand drin gesessen.«
»Dann wird’s Zeit, daß diese beiden Banditen es einweihen.«
Manuel Cherry Pika und Joe Mc
Lean waren endgültig aus dem Spiel.
Als Balan wieder auf die Straße kam, blickte er den Fremden an. Plötzlich blieb er stehen.
»Hören Sie, Mister, ich hab mir das überlegt. Wenn Sie nicht Doc Holliday sind, will ich auf der Stelle Abraham Lincoln sein.«
»Doch, Sheriff, Sie haben recht. Und jetzt würde mich interessieren, wie es um einen Brandy bestellt ist.«
»Ausgezeichnet. Sie sollen den besten Tropfen bekommen, Doc, den der alte Balan je ausgeschenkt hat.«
Als der Spieler die Station verließ, wußte er nur, daß Wyatt Earp nach Osten hinübergeritten war.
Und im Osten lag die Frenclyn Ranch. Teufel noch mal, alles schien auf diese Ranch hinzudeuten!
Am späten Nachmittag entdeckte der Spieler zufällig auf einer Anhöhe einen Indianer.
Er verbarg sich hinter einem Gebüsch und wartete, bis der Rote heran war. Dann tauchte er plötzlich vor ihm auf. Mit zwei gezogenen Revolvern. Nicht, weil ein Revolver etwa nicht ausgereicht hätte, sondern wegen der moralischen Wirkung.
»Was träumst du denn hier durch die Gegend, Rothaut?«
Der Indianer schwieg.
Er schwieg auf alle Fragen.
Plötzlich zog der Gambler die Brauen zusammen. Aus der ledernen Gurttasche blickte eine winzige Blechspitze hervor.
»Hör genau zu, Rothaut, was ich dir jetzt sage: Mein Name ist Holliday, Doc Holliday – wenn dir das etwas sagt. Ich bin der humorloseste Bursche, der je hier über diese Savanne geritten ist. Du siehst und hörst, daß ich hier diese beiden Revolver jetzt spanne. Wenn du jetzt nicht auf den ersten Anhieb das Metallstück da aus deiner Gurttasche ziehst und hier zur Seite wirfst, gehen die beiden Revolver los und pusten so viel Löcher durch dich, daß der Wind hindurch-pfeifen kann.«
Gebannt starrte der Indianer in die eiskalten Augen des Georgiers. Wie unter einem Zwang tastete seine Linke nach der Gurttasche, packte den Metallgegenstand und warf ihn auf den Boden.
Doc Holliday wurde um einen Schein bleicher. Das blitzende, handtellergroße Metallstück, das da auf der Erde lag, kannte er so genau wie seine Taschenuhr: Es war der Marshalstern Wyatt Earps.
Er hatte den Kopf ein wenig gesenkt, als er die nächsten Worte durch die zusammengebissenen Zähne preßte:
»Wo – ist – er…?«
Der Indianer kannte den Namen des berühmten Gunfighters, wie jeder ihn im ganzen Westen kannte. Und er wußte auch, daß dieser Doc Holliday der Freund Wyatt Earps war.
Heiser stieß er hervor: »Geronimo hat Wyatt Earp gefangen.«
»Geronimo? Bursche, wenn du mir eine Fabel andrehen willst, dann hörst du dich gleich schreien.«
Der Indianer hob beide Hände und blickte zum Himmel empor.
»Ich sage die Wahrheit. Geronimo hat den berühmten Sheriff Wyatt Earp gefangen.«
»Willst du mir vielleicht weismachen, daß irgendo so ein lächerlicher Indianer-Bandenboß Wyatt Earp einfangen konnte?«
»Es war Geronimo. Und mehr als vier mal zehn Krieger sind bei ihm gewesen.«
Wenige Minuten später wußte der Georgier, daß der abtrünnige Apachen-Chief Wyatt Earp in diesem Hügelland umzingelt und ihn ins Lager geführt hatte, wo er heute beim Sinken der Sonne sterben sollte.
»Vorwärts, Rothaut, dreh dich um. Lauf vor mir her und hol deinen Gaul. Und dann geht’s los! Und wenn wir beide nicht vor Sonnenuntergang in Geronimos Camp sind, siehst du die Sonne nicht mehr aufgehen.«
Der Indianer trottete vor dem weißen Reiter her, holte das Pferd aus einem Gebüsch, wo er es versteckt hatte, und dann ging es in fliegendem Galopp nach Norden.
*
Das Apachenlager war längst nicht so weit entfernt gewesen, wie Wyatt nach den Reden Geronimos vermutet hatte. Der Indianer-Chief hatte sich für den Ritt unendlich viel Zeit gelassen.
Wyatt saß in einem primitiven Zelt, ungefesselt, und hörte den Wächter, den Geronimo ihn bestellt hatte, ununterbrochen die Runde um die kleine Lederhütte machen. Sie hatten ihm die Waffen abgenommen, den Stern, die Zigarren und die Zündhölzer.
Drüben am Feuer saß der »große Geronimo«, starrte in die Glut und freute sich hinter seinem unbeweglichen Gesicht an dem Gedanken, daß er morgen den großen weißen Sheriff Wyatt Earp am kahlen Baum sterben lassen würde.
Der Bursche, der das Zelt bewachte und neben Wyatt saß, hatte den Buntline-Revolver bekommen. Er hatte ihn rechts in seinen Waffengurt gesteckt.
Von dem Augenblick an, da der Marshal auch sein Pferd sehen konnte, das die Roten nicht abgesattelt hatten und das nur wenige Schritte vom Zelt entfernt stand, wußte er, daß er fliehen würde.
Aber dazu mußte er abwarten, bis die Roten sich zum Schlafen gelegt hatten. Und leider schienen sie in dieser Nacht nicht daran zu denken. Sie waren, nachdem Geronimo ihnen das große Ereignis verkündet hatte, in eine Art Hysterie verfallen und hatten sich in stummer Versunkenheit um ihren Häuptling geschart.
Endlich, als die Sterne schon zu bleichen begannen, gab der »Rebell von Arizona« ein Zeichen, worauf sich die Roten niederlegten.
Wyatt, der diesem Augenblick entgegengefiebert hatte, mußte zu seiner Enttäuschung feststellen, daß Geronimo nicht daran dachte, auch zu schlafen.
Er blieb noch am Feuer sitzen, erhob sich aber plötzlich und kam auf das Zelt zu. Deutlich verstand Wyatt die Worte in der Apachen-Sprache:
»Auch du wirst dich jetzt hinlegen, und ich werde die Wache selbst übernehmen.«
Da wußte der Missourier, daß er keine Sekunde mehr zu verlieren hatte.
Die beiden Indianer standen etwa anderthalb Yards auseinander. Wyatt schätzte, daß das Reaktionsvermögen des Häuptlings größer sei als das des Wächters, und hatte beschlossen, Geronimo zuerst anzugreifen.
Mit einem federnden Satz schnellte er aus dem Zelt heraus und war sofort zwischen den beiden Männern. Ein fürchterlicher Uppercut, tief aus der Hüfte hochgerissen, traf den Kinnwinkel des Häuptlings.
Wyatt wußte um die Wirkung dieses Schlages, kümmerte sich deshalb nicht mehr um den stürzenden Indianer, sondern wandte sich blitzschnell dem Wächter zu, der vor Schreck ganz starr dagestanden hatte, jetzt aber die Luft zu einem Schrei einzog. Noch im Ansetzen des Tones wurde er von einem Handkantenschlag an die Kehle getroffen und fiel hintenüber.
Wyatt nahm den Buntline-Revolver an sich und sah sich um.
Als er hinüber zu den Pferden ging, richtete sich drüben beim Feuer einer der Indianer auf. Entgeistert starrte der Apache zu dem Zelt hinüber und stieß dann einen gellenden Schrei aus.
Jetzt spurtete Wyatt los.
Rasch war er bei dem Rappen. Er mußte feststellen, daß die linke Zügelleiste an einem Lasso verknotet war. Blitzschnell hakte er den Zügel unten an der Kandarre aus, nahm das andere Zügelende und schwang sich auf den Rappen.
Im Lager war alles erwacht. Sogar der niedergeschlagene Wächter hatte sich wieder hochgerappelt. Nur Geronimo schlief – in tiefer Betäubung lag er zwei Yards vor dem Zelt, in dem noch vor Sekunden der berühmteste Gefangene gesessen hatte, den seine Indianer jemals gemacht hatten.
Weit beugte sich der Missourier über die Mähne seines Pferdes. Zu höchster Eile angetrieben, preschte der schwarze Hengst talabwärts in die Savanne.
Aber schon nach wenigen Minuten wußte Wyatt, daß die Verfolger hinter ihm waren.
Der Ritt mit nur einer Zügelhälfte war nicht so leicht und mühelos. Immer wieder zeigte es sich, daß der Rappe unsicher war.
Aber der Missourier war ein außergewöhnlich guter Reiter; es gelang ihm, das Pferd auch ohne vollen Zügel dahin zu dirigieren, wohin er es haben wollte.
Geschickt nutzte er ein Waldstück aus, preschte dann auf ein Gesträuch zu, hielt sich scharf hinter ihm und vermochte so den Roten zunächst einmal aus den Augen zu kommen.
Aber dann lag die offen sich nach Südwesten senkende Savanne vor ihm.
Oben hatten mehrere Rote den Fliehenden ausgemacht, während die Hauptmasse scharf nach Westen preschte. Aber Wyatt Earp behielt seinen Abstand, ja, er vermochte ihn sogar allmählich zu vergrößern.
Wenn es dunkle Nacht gewesen wäre, dann hätten sie ihn wahrscheinlich verloren – aber es begann zu tagen. Rasch stieg der rote Feuerball der Sonne vom Osten über den Horizont und warf gigantische Feuergarbenbündel über die Savanne.
Sieben Indianer saßen auf der Spur des flüchtenden Weißen.
Wyatt prüfte während des scharfen Rittes den Revolver: er war auf allen sechs Kammern geladen. Und sieben halbwilde Rote saßen ihm im Genick.
Nach einer Stunde bemerkte er, daß es nur noch sechs waren. Einer fiel mehr und mehr zurück und gab schließlich ganz auf.
Allmählich verlief sich die offne Savanne in hügeliges, unübersichtliches Land, das stark von Buschwerk durchsetzt war. Rote Sandsteinpyramiden tauchten auf.
Es gelang dem Missourier mit einem Trick, die Roten abzuschütteln. Sie jagten weiter.
Er ließ sein Pferd hinter dem Felsfuß einer Sandsteinsäule etwas verschnaufen.
Aber als er nach einer Viertelstunde sein Versteck verließ und an den westlichen Rand des Gesteins schlich, sah er zu seinem Schrecken die Indianer kaum zweihundert Yards entfernt die Büsche durchstreifen.
Damned! Da mußte er sofort verschwinden.
Siebenhundert Yards etwa kam er, da erspähte ihn einer der Leute Geronimos. Die Hetzjagd ging von neuem los.
Der schwarze Hengst war ein unvergleichlicher Renner. Er preschte hügelauf, hügelab und hielt den großen Abstand zu den Indsmen. Wyatt hatte inzwischen den Zügel notdürftig repariert, jetzt war es erheblich leichter, den Rappen zu lenken.
Mehrere Stunden ging die Verfolgungsjagd durch die Steppe. Zuweilen gelang es den Roten, näherzukommen, dann aber entwischte ihnen der weiße Mann mit dem schnellen Pferd wieder.
Endlich hatte der Marshal ein neues Versteck gefunden. Aber es war ihm doch nicht gelungen, seine Spuren so zu löschen, wie er es beabsichtigt hatte.
Die Roten hatten sich geteilt. Und einer von ihnen sprengte auf Wyatts Versteck zu.
Der Marshal wartete.
Bis auf fünfzehn Yards kam der Apache heran, dann rutschte er vom Pferderücken und drückte sich in die Büsche. Eine Viertelstunde später lag er gefesselt am Boden.
Der weiße Prärieläufer war ihm in allem überlegen gewesen, hatte ihn angeschlichen und niedergeschlagen. Zu einem Bündel zusammengeschnürt lag der rote Bandit mitten auf dem Saumpfad. Seine Kameraden sollten ihn erst am späten Nachmittag aufspüren.
*
Die Sonne stieg höher und höher.
Wyatt hatte sein Versteck verlassen.
Aber da er nicht wußte, wo sich die fünf Geronimo-Leute herumtrieben, war er gezwungen, äußerste Vorsicht walten zu lassen.
Noch lag die Frenclyn Ranch wenigstens zehn Meilen entfernt. Der Missourier hielt bewußt darauf zu.
Schon hatte er geglaubt, die Verfolger hinter sich gelassen zu haben, als er plötzlich in dem Tal vor sich zehn braun-rote Gestalten auf gescheckten Pferden dahinjagen sah.
Wyatt mußte also das Tal vermeiden und hielt sich rechts auf der Höhe mehr westlich. Die Apachen behielt er im Auge.
Urplötzlich, als hätten sie ihn entdeckt, verließen sie die Mulde und sprengten der Höhe zu.
Wyatt warf sich vom Pferd und zerrte den Hengst in ein Gebüsch. Er selbst kroch bis an die Wurzel der Tamariske zurück.
Da preschten sie auch schon heran, wilde heisere Schreie ausstoßend, jagten sie auf ihn zu.
Pistolenschüsse zischten ihm entgegen, und dicht vor ihm wippte federnd ein Pfeil am Boden.
Eins, zwei, drei, vier…! Wie die Präriehasen purzelten die roten Rebellen von den Pferderücken.
Die anderen jagten davon, sammelten sich aber nach einer Weile wieder. Der geplagte weiße Mann konnte sicher sein, daß sie in Kürze zurückkamen.
Er zerrte den Rappen aus dem Gebüsch, schwang sich in den Sattel. Schon schoß das Tier mit ihm nach Süden davon.
Wyatt hatte die linke Faust um den Revolver gespannt. Zwei Kugeln noch! Und sechs Verfolger auf den Fersen.
Als er sich einmal umsah, erspähte er sie hinter sich. Ihre Pferde waren ausgeruht, da sie in gerade Linie geritten waren und nicht die vielen Haken hatten schlagen müssen, zu denen er gezwungen worden war.
Näher und näher kamen die Indianer. Es ging jetzt durch buschbesetztes Land.
Wyatt hoffte auf eine gerade Strecke, auf der er noch einmal die Schnelligkeit des Rappen ausspielen konnte. Dann wollte er irgendwo von dem Pferd springen und sehen, daß
er so in den Rücken der Indsmen
kam.
Aber die gerade Strecke blieb aus. Unentwegt kamen die Roten näher. Schon schickten sie die ersten Schüsse hinter ihm her.
Wyatt wandte sich um. Es waren noch alle sechs, und der vorderste war schon bis auf etwa acht Yards herangekommen.
Aber noch sparte der Missourier seine beiden letzten Patronen.
Da! Rechts aus dem Gebüsch federte ein schwarzer Schatten, wie ein Phantom! Und dann bellte das harte Stakkato blitzschnell hintereinander fallender Revolverschüsse auf.
Holliday! Doc Holliday war da!
Wyatt hätte einen Jubelschrei ausstoßen mögen.
Er riß den Rappen herum und kam zurück. Mitten in dem Paß zwischen zwei Felsbrocken stand der Georgier in einer Pulverwolke.
Die Verfolgungsjagd war zu Ende.
Wyatt Earp rutschte aus dem Sattel und blieb neben dem Spieler stehen.
»Hallo, Doc!«
»Hallo, Marshal!«
»Geronimos Leute. He, einer von ihnen hat ja tatsächlich meinen Waffengurt und den zweiten Revolver. Und dieser Halunke da hat meine Winchester.«
Das Magazin der Winchester war leer. Irgend jemand hatte dem Roten die Patronen herausgenommen, deshalb hatte er auch keinen Gebrauch von der Waffe machen können.
»Thanks, Doc«, meinte Wyatt. »Der Teufel mag wissen, wie Sie das immer so pünktlich schaffen.«
»Der Teufel?« meinte der Gambler, während er sich eine Zigarette zwischen die Lippen steckte. »Wenn Sie den roten Burschen da, den ich für eine Viertelstunde schlafen gelegt habe, für den Teufel ansehen wollen…«
Der Missourier streichelte den glänzenden Hals seines Pferdes.
Da sagte der Georgier: »Wir machen uns am besten gleich auf den Weg zu Onkel Luke. Oder haben Sie noch irgend etwas hier zu suchen?«
»Nein, bis auf meinen Stern, den mir einer der Halunken gestohlen hat, habe ich alles zurück.«
Holliday nestelte den silbernen Fünfzack im Wappenkranz aus seiner Tasche und reichte ihn dem Marshal hin.
»Hier, der rote Teufel da hielt es für richtig, ihn mir gleich entgegenzubringen.«
Die beiden Männer schüttelten einander noch einmal die Hände, dann stiegen sie auf ihre Pferde und preschten davon, der Frenclyn Ranch entgegen.
*
Es war Mittag.
Unter unsäglichen Kraftanstrengungen war es dem Texaner in der Nacht gelungen, an einem rosti-
gen Nagel seine Fesselung zu zerreiben.
Dösend hockte der Alte vorn an der Tür und merkte nicht, was hinter seinem Rücken vorging.
Luke Short war plötzlich neben ihm, preßte ihm die Hand auf den Mund – und wenige Minuten später lag der Alte gefesselt da, wo bisher der Texaner gelegen hatte.
Draußen war es noch dunkel.
Der Riese hatte jetzt einen Revolver und konnte den Weg hinüber ins Ranchhaus wagen.
Unten in der Halle brannte noch Licht. Am Tisch saß ein Mann, der den Kopf in beide Hände gestützt hatte.
»Brochus.«
Der Bandit schrak zusammen und fuhr hoch. Als er den Texaner mit dem Revolver vor sich sah, wurde der sonst immer so prahlerische Bandit totenblaß.
Dann stieß er einen Schrei aus, warf sich zurück und vermochte in der großen Dunkelheit des Hauses zu entkommen.
Im Flur fand der Texaner seinen Waffengurt und zwei Winchestergewehre.
Mit lauten Schreien hatte Curly Bill draußen seine Leute aufgeweckt.
Es begann zu tagen.
Luke Short rannte die Treppe hinauf, nachdem er die hinteren Räume durchgestöbert und leer gefunden hatte, und prallte oben mit einem Mann zusammen. Es war der Rancher.
Die riesige Hand des Texaners spannte sich um den Hals des räuberischen Viehzüchters.
»Wo ist der Bursche, Frenclyn?«
Als der verstockte Mann nicht antworten wollte, stieß Luke Short ihn so derb gegen die Wand, daß das Holz dröhnte.
»Mach das Maul auf, Frenclyn!«
»Ihr kommt doch nicht raus. Curly Bill ist mit neun Leuten hier.«
»Das interessiert mich einen Dreck. Wo ist der Bursche?«
»Ich selbst habe noch sechs Leute drüben im Bunkhaus. Die anderen können jeden Augenblick von der Ranch zurückkommen.«
»Erzähl keine Stories, Alter. Sag endlich, wo der Bursche ist, sonst kann sich der Sheriff von Harpersville den Strick für dich sparen.«
»Er ist ganz oben in der Bodenkammer.«
Merkwürdigerweise wagte sich aber niemand von den Banditen ins Haus.
Short ließ den Rancher vor sich her, die Bodentreppe hinauf, und befreite den Burschen.
Jonny Saunders befand sich keineswegs in so guter Verfassung wie der Texaner. Er nahm den Revolver, den Short dem alten Wächter abgenommen hatte, und torkelte hinter den beiden her hinunter in die Halle.
Die Sonne war schon aufgegangen. Im Hof war alles still. Eine volle Stunde verging.
Dann richtete sich Luke Short, der mit beiden Revolvern in einer Fensternische gekauert hatte, auf.
»Verdammt noch mal. Die Geschichte gefällt mir gar nicht, Jonny. Ich sehe keinen einzigen Menschen.«
Mit grinsendem Gesicht hockte der Rancher am Tisch.
Die Stunden rannen dahin.
Gegen ein Uhr stahl sich der Texaner durch eine Bodenluke aufs Dach, robbte bis zu dessen Westrand hin – und sah die gesamte Besatzung der Ranch.
Sie bestand aus Curly Bill und vier ganzen Gestalten.
Sie hatten sich hinter dem Stallhaus verschanzt und ihre Pferde bereitgestellt.
Zweifellos hatte Curly Bill den Hauptteil seiner Leute und vielleicht auch Frenclyn-Cowboys gestern auf Kundschaftsritt ausgeschickt.
Und jetzt dachte der Desperado, daß der Texaner sich kaum allein befreit haben könnte, daß also noch andere Gegner auf der Ranch sein könnten.
Von dem verhältnismäßig hohen Dach aus vermochte Luke Short weit über die Ranch hinauszublicken. Vorn der alte Wachturm war unbesetzt. Vielleicht getraute sich keiner der Tramps mehr auf den Ausguck.
Schon hatte sich der Texaner wieder in die Bodenluke zurückziehen wollen, als plötzlich vier Revolverschüsse draußen im Hügelland abgegeben wurden. Zwei, und dann noch zwei.
Der Hüne lag flach auf dem Dach und lauschte dem Geräusch nach. Dann bleckte er plötzlich die Zähne und grinste.
»Ich will auf der Stelle skalpiert werden, wenn ich diese beiden Revolver nicht kenne«, flüsterte er vor sich hin.
Die ersten beiden Schüsse waren aus dem langläufigen, sechskantigen Buntline Special Wyatt Earps abgegeben worden, und die zwei darauffolgenden Schüsse kamen aus dem vernickelten Single-Acton-Revolver Doc Hollidays.
Der Riese hob seinen Revolver und feuerte zwei Schüsse in den Himmel ab.
Unweit von der Ranch, wo die beiden Verbündeten hinter einem Gebüsch steckten, gab es ein ähnliches stilles Schmunzeln.
»Das war seine Antwort«, sagte Wyatt Earp.
»Und zwar prompt wie immer«, fügte Doc Holliday hinzu.
Inzwischen hatte sich Curly Bill entschlossen, auszubrechen. Aber als der Outlaw mit seinen vier Leuten, tief auf die Pferdemähnen geduckt, auf das Tor zuschoß, feuerte Luke Short mit der Winchester hinter ihm her.
Curly Bills Pferd war getroffen. Der Tramp stürzte aus dem Sattel, aber er sprang sofort hoch, rannte zum Tor und riß es auf.
Seine Kumpane aber nahmen ihn nicht mit – und rannten dem Marshal und dem Georgier in die Hände.
Keiner entkam.
Die Verletzten mußten einander zurück in den Hof schleppen.
Und mit fahlem Gesicht stand der Tombstoner Desperado William Curly Bill Brocius am Tor, hinter sich Luke Short und vor sich seine ›Erzfeinde‹ Wyatt Earp und Doc Holliday.
*
Keiner der Banditen entging seiner Strafe. Zwar wurde keiner mit dem Tod bestraft. Aber alle kamen sie in Straflager.
Auch der verbrecherische Ire Gregory Saunders, der in jener Nacht versucht hatte, seine eigenen Schandtaten seinem rechtschaffenen Bruder anzudichten.
An einem sonnigen Morgen ritten der Rancher John Saunders, sein Sohn Jonny und die Indianerin Nointa der großen Hügel-Ranch entgegen. Der alte Saunders hatte in der Verhandlung noch versucht, für seinen alten Widersacher Frenclyn ein gutes Wort einzulegen.
Wyatt Earp, Doc Holliday und Luke Short ritten nach Nordosten, dem fernen Dodge entgegen.