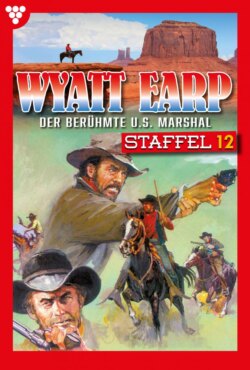Читать книгу Wyatt Earp Staffel 12 – Western - William Mark D. - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEs war um elf Uhr am Vormittag.
Über Tombstone lag rosarotes Dezemberlicht, das die Häuser seltsam unwirklich aussehen ließ.
Am Ende der Vierten Straße, da, wo schon die Miner Camps anfingen, lag seit drei Jahren in einem der letzten Häuser Fleggers Bar.
Es war eine schmalbrüstige Schenke, die der Österreicher John Flegger zusammen mit seinem Bruder Billy führte und die in der Stadt nicht eben den besten Namen hatte. Ganz im Widerspruch zu ihrem Ruf standen die Getränke, die die Fleggers führten: sie hatten beispielsweise den besten Brandy weit und breit, und man mußte schon in den Crystal Palace gehen, um einen ähnlichen Tropfen genießen zu können, nur, daß man da fast das Doppelte dafür ausgeben mußte.
Dann hatten die Fleggers einen Lieferanten, der ihnen wirklich originalen Scotch bieten konnte. Vielleicht war das das Geheimnis von Fleggers Bar. Denn sonst hätte sich niemand zu erklären vermocht, wie sich die kleine Schenke da unten am Stadtrand halten konnte. Die Leute aus den Miner Camps hatten andere Bars, beispielsweise gingen sie zu dem Chinesen Wong oder aber zu Rozy Ginger, der sie geradezu die Treue hielten. Aber die Feinschmecker aus der Stadt suchten Fleggers Bar auf.
An diesem Vormittag lehnte an der Theke nur ein einzelner Mann.
Er war mittelgroß, hatte ein breitflächiges Gesicht, dessen untere Hälfte mit millimeterlangen Bartstoppeln besetzt war.
Die Nase war breit und etwas schief, ihr Flügel hochgezogen.
Die Augen lagen tief in ihren Höhlen und hatten eine gelbliche Tönung. Der Mann trug einen mißfarbenen Melbahut und dickes Lederzeug. Sein graues Kattunhemd stand am Hals offen und gab ein verwaschen gelbes Halstuch frei, das der Mann oben stark geknotet hatte. Was diesen Mann sonderbar erscheinen ließ, war die Tatsache, daß er keinen Waffengurt trug, sondern unter seiner nicht zugeknöpften Jacke zwei Revolver im Hosenbund stecken hatte.
Das war Steve Shaddons eigene Note.
Ihm gegenüber stand mit grämlichem blassem, faltigem Gesicht John Flegger, der ältere der beiden Salooninhaber, hemdsärmelig mit offenem Kragen, schmutziger grüner, bestickter Weste und gewaltiger Uhrkette. Er hielt eine Flasche in der Hand und goß Shaddon eben noch einen ein.
Es fiel dem Salooner nicht auf, daß sein Gast die linke Hand unter der Theke verborgen hielt.
Shaddon griff nach dem ledernen Würfelbecher und kippte ihn auf die Thekenplatte. Ohne ihn anzuheben, sagte er: »Wetten, daß er hier bald ausgesungen hat!«
»Ich wette nicht«, gab der Keeper in knarrendem Englisch zurück.
»Ist auch nicht notwendig. Ich gebe einen Drink extra dafür aus.«
»Wofür?«
»Dafür, daß er bald ausgesungen hat.«
»Von wem sprechen Sie eigentlich, Mister…?«
»Mein Name ist Shaddon.«
»Also, Mr. Shaddon, wovon sprechen Sie?«
Da hob Shaddon den Kopf an und blickte unter dem zerfransten Hutrand hervor in die Augen des Keepers.
Er zog auf eine merkwürdige Weise den linken Mundwinkel hoch, so daß man zwischen ihn und das untere Augenlid kaum drei Finger hätte bringen können. Es war eine unangenehme, schmierige Lache, die jetzt in seinem Gesicht stand.
»Ich spreche von unserem großen Marshal Earp. Von dem stolzen Gesetzesmann, der sich eingebildet hat, uns hier das Gesetz bringen zu müssen.«
Flegger wischte sich unbehaglich über die Stirn.
»Ich weiß es nicht, Mr. Shaddon, ich kümmere mich nicht darum.«
Dinge, die den Marshal anbetrafen, gefielen ihm nie. Er hatte sich bisher immer aus allem herausgehalten. Zwar war damit keinerlei Charakter bewiesen, aber er fürchtete sowohl die Männer, die bei ihm verkehrten und gegen den Marshal waren, als auch den Marshal selbst. Er hielt es für ratsam, es mit keiner der beiden Seiten zu verderben.
»Ich weiß nicht, Mr. Shaddon«, sagte er jetzt, »ich kümmere mich wirklich nicht darum. Von mir aus soll jeder tun und lassen, was er will.«
In Shaddons Augen war plötzlich ein harter Glanz getreten.
»So, das also ist Ihre Ansicht. Tut mir leid, kann ich nicht teilen, Salooner. Wo kämen wir hin, wenn wir solche Leute so groß werden ließen. Die beherrschen uns nachher. Kommt nicht in Frage, wir sind freie Menschen. Da stehe ich auf der Seite von Ike Clanton…«
»Ike Clanton?« Der Keeper hatte seine kränklichen Augen spalteneng geschlossen. »Wie soll ich das verstehen, Mr. Shaddon?«
»Wie Sie das verstehen sollen?« Die Stimme Shaddons hatte einen dumpfen, heiseren Klang bekommen. »Das werde ich Ihnen sagen, Salooner. Ike Clanton, das heißt Rebellion! Ike Clanton, das heißt Widerstand! Ike Clanton – das ist ein Symbol für unsere Freiheit. Aber vielleicht verstehen Sie das nicht.«
Der Keeper schüttelte den Kopf. »Nein, das verstehe ich auch nicht.«
»Ist vielleicht auch nicht nötig. Leute, die nicht wissen, was sie wollen, brauchen sich ja auch für nichts zu entscheiden.«
Der Salooner blickte seinen Gast scharf an.
»Sie haben sich also für Ike Clanton entschieden?« Er hatte es sehr leise gesagt.
Shaddons Kopf flog hoch. Wieder zog er den linken Mundwinkel dem Auge zu. Dann fiel das Lachen plötzlich aus seinem Gesicht und schien in einem gelben Gebiß hängenbleiben zu wollen.
»Ich habe mich für die Freiheit entschieden, Salooner!«
»Ike Clanton?« wiederholte der Salooner. »Ich weiß nicht, eine gefährliche Sache. Ich finde es am besten, wenn man sich aus allem heraushält.«
Die Faust des Fremden spannte sich um den Lederbecher und quetschte ihn zusammen wie eine Tomate, die man auspreßt.
»So, finden Sie! Tut mir leid, Salooner, daß ich anderer Ansicht bin. Ich finde, der Mensch muß sich zu etwas bekennen.«
»Was soll das für einen Nutzen haben?«
»Der Nutzen liegt auf der Hand. Leute wie Wyatt Earp sind wie Brandherde in unserem Land. Wir brauchen sie nicht. Wir können ohne sie leben. Wir haben vorher gelebt und werden auch nachher weiterleben.«
Der Salooner wußte nicht recht, was er mit diesem Gerede anfangen sollte und worauf Shaddon hinauswollte.
Aber John Flegger wollte es auch gar nicht wissen. Er war ein bequemer, gleichgültiger Typ, der sich mit diesen Dingen nicht abgeben wollte.
Da ließ Shaddon plötzlich den Lederbecher los und legte seine linke Hand auf den Unterarm des Wirtes.
»Hören Sie, Flegger, ich will Ihnen etwas sagen. Sie sitzen auf dem falschen Gaul!«
»Ich sitze auf gar keinem Gaul«, empörte sich der Wirt.
»Doch, Flegger. Sie sitzen auf einem Gaul –?und zwar auf dem falschen.«
Der Wirt schüttelte den Kopf und nahm den Zigarrenstummel aus dem Aschenbecher, riß ein Zündholz an und hielt es an die schwarz verkohlte Brandstelle.
Scharfer, beizender Qualm stieg Shaddon in die Nase.
Er prustete und nahm eine Zigarette aus der Tasche, die er an der bereitwillig hingehaltenen Zigarre des Wirtes anzündete.
»Ich sagte, Sie sitzen auf dem falschen Gaul, Flegger. Und das ist die Wahrheit. Die Zeit von Männern, wie Wyatt Earp einer ist, geht zu Ende. Sie können sich darauf verlassen. Das war eine ungute Zeit. Wir leben hier in einem großen, freien Land, in dem wir auch in Frieden und Ruhe leben wollen. Männer wie der Marshal Earp stoßen uns aus dieser Ruhe. Ist es Ihnen vielleicht schon aufgefallen, daß jedesmal, wenn der Marshal in der Stadt ist, irgend etwas los ist?«
Flegger lachte dümmlich.
»Das kann sein. Es ist doch nicht sehr verwunderlich. Irgendein Strolch fühlt sich entdeckt und schwingt den Revolver durch die Luft.«
In Shaddons Augen trat wieder der harte, böse Glanz, den der Salooner nicht bemerkte.
»Sie irren, Flegger. Es sind nicht die anderen – es ist der Marshal. Sonderbarerweise fühlen sich die Menschen sonst nicht bedroht und verhalten sich friedlich und ruhig.«
»Das stimmt zwar nicht ganz, aber ich will nicht mit Ihnen streiten«, entgegnete der Wirt.
Da spannte Shaddon die Unterlippe über die Oberlippe und ließ den Würfelbecher los. Seine Lippen sprangen auseinander. »Sie sehen die Zeichen der Zeit nicht, Salooner. Schade um Sie, Sie werden in dem großen Run unter die Räder kommen.«
Der Salooner nahm die Zigarre aus dem Mund und stieß sie wütend im Aschenbecher aus. »Ach was, Mann, lassen Sie mich doch zufrieden mit Ihrem Gerede. Es gibt keinen Run und auch keine Räder, und mich kümmert der ganze Kram nicht. Was habe ich damit zu tun? Ich habe Sorgen genug. Darauf können Sie sich verlassen. Mein Bruder ist krank…«
Sie waren beide krank, die Fleggers. Der große Treck, den sie von dem fernen Tirol bis hierher an den Fuß der Blauen Berge im fernen Arizona gemacht hatten, hatte sie krank gemacht. Mitten im Winter waren sie drüben in Boston angekommen, und da sie dort nirgends Hilfe fanden, waren sie weitergezogen; mittellos durch den Westen getrampt.
In Lexington brach Billy Flegger zusammen und mußte drei Monate in einem Hospital liegen.
John arbeitete währenddessen an einer Baustelle und verdiente wenigstens so viel, daß er sich am Leben halten und die Behandlung des Bruders bezahlen konnte. Als der Winter zu Ende ging und Billy entlassen worden war, zogen sie weiter. Aber sie kamen in ein schlechtes, naßkaltes Frühjahr, und an der Grenze von Oklahoma wurde Billy wieder krank. Aber sie hatten kein Geld, ein Hospital aufzusuchen.
In einer Baumwollpflückerei fanden sie Arbeit und Unterschlupf. John arbeitete wieder für beide, und als es dem Bruder besserging, war es Mai geworden. Dann zogen sie weiter durch das nördliche Texas hinüber nach New Mexico. Den Weg hinauf nach Santa Fé sparten sie sich, da sie unterwegs gehört hatten, wie schwer es war, dort Fuß zu fassen.
Sie waren auf den Gedanken gekommen, eine Bar aufzumachen. Aber auch dazu brauchte man Geld.
Billy war kein schlechter Spieler. In einer Schenke in Roswell verdiente er an einem Abend am grünen Tisch vierzehnhundert Dollar.
Das war der Grundstock zu der heute im ganzen Cochise County bekannten Bar am Südostrand Tombstones.
Die beiden hatten mehr als drei Jahre geschuftet, um das Haus und alles, was zu der Kneipe gehörte, bezahlen zu können. Sie hatten es mit Geld – und auch mit ihrer Gesundheit bezahlt.
Billy lag fast dauernd oben in seinem Zimmer und quälte sich mit einer Lungenkrankheit herum, und auch sein Bruder John kränkelte ständig.
Aber die Schenke ging.
Die alte Frau, die den beiden Junggesellen den Haushalt führte, half zuweilen zusammen mit ihrem Sohn auch in der Schenke aus.
Obwohl erst vierunddreißig Jahre alt, hatte Johann Flegger seine Lebenserwartungen auf ein Mindestmaß reduziert. Politische Fragen interessierten ihn so wenig wie Fragen, die die Stadt angingen. Er nahm an den Dingen der anderen nicht teil, da ihn sein eigenes Leben, seine schwache Gesundheit und die Krankheit seines Bruders über Gebühr beschäftigten.
Außerdem war dieser Tiroler in keiner Weise fanatisch.
Ganz im Gegenteil war der Mann, der jetzt bei ihm an der Theke lehnte.
»Wir müssen uns nur zusammentun. Dann sind wir stark. Und brauchen niemanden zu fürchten.«
»Aber ich weiß nicht, was Sie wollen, Mr. Shaddon. Ich fürchte niemanden. Ich fürchte nur den Husten, den großen Husten, den beispielsweise oben mein Bruder hat.«
Shaddon winkte ab. »Ja, ja, ich habe schon davon gehört. Eine traurige Geschichte.« Er sagte es ohne jede Anteilnahme, um sofort wieder auf sein Thema zurückzukommen. »Wir dürfen sie nicht groß und mächtig werden lassen. Es hätte längst einer kommen müssen, der ihn aus den Stiefeln geschossen hätte.«
»Wen?« fragte der Wirt, während er ein blankpoliertes Glas zu der Batterie der anderen Gläser stellte.
»Wen?« Shaddon hatte die Zähne zusammengebissen und stieß die beide Worte gallig durch die Lücken: »Wyatt Earp!«
Der Wirt schrak förmlich zusammen. »Aber Mister, ich weiß nicht, weshalb Sie sich aufregen. Was haben Sie mit Wyatt Earp zu tun? Sie leben Ihr Leben, ich lebe mein Leben, und der Marshal lebt sein Leben.«
Da ballte Shaddon seine Faust, hieb sie auf die Theke, daß der Würfelbecher umfiel und drei Sechsen zum Vorschein kamen.
Während der Wirt verblüfft auf die Würfel blickte, die einen goldenen Ring, das heißt, drei Lagen erforderten, starrte Shaddon ihn gallig an.
»Ich habe gesagt, Sie sitzen auf dem falschen Roß, Mr. Flegger!«
Diesmal klang es schon richtig feindselig.
Es wäre dem Salooner lieber gewesen, wenn der Gast seine Freidrinks zu sich genommen hätte und dann gegangen wäre.
Aber Steve Shaddon war nicht gewillt, so leicht aufzustecken. Er schien offenbar bei seinem Lieblingsthema zu sein. Aus haßerfüllter Seele keuchte er: »Es ist schon richtig, was Ike Clanton getan hat und was er immer tun wollte. Leute wie Wyatt Earp müssen vernichtet werden. Wir brauchen keine Disteln hier in unserem Feld. Wir brauchen Ruhe und wollen in Frieden leben können. Und wer das nicht versteht, der hat kein Recht auf dieses Leben hier in unserem Lande. Soll er doch hinaufgehen in sein verdammtes Kansas, wo er hingehört.«
Der Salooner stützte sich mit beiden Händen auf die Thekenkante und döste vor sich hin. Die Worte Shaddons prallten von ihm wie stumpfe Pfeile ab. John Flegger besaß eine ausgesprochene Fähigkeit, abzuschalten.
Eine beneidenswerte Fähigkeit.
Unterdessen redete Shaddon weiter, stieß die Worte immer schneller und lauter hervor.
»Ich werde Ihnen etwas sagen, Flegger: Sein Bruder war hier Marshal. Er hat die Stadt verlassen, weil er anderwärts wahrscheinlich mehr Geld verdient…«
Unvermittelt warf Flegger ein: »Oder weil er da weniger Banditen vorfindet.«
Shaddon kniff das linke Auge ein.
»Was soll das heißen?« Mit schiefgelegtem Kopf blickte er den Wirt an.
Der Österreicher zog die Schultern hoch.
»Nichts Besonderes. Nehmen Sie es nicht wichtig, Mr. Shaddon.«
»Doch, es ist wichtig.«
Shaddon schoß die linke Hand nach vorn und preßte sie um den Unterarm des Wirtes.
Mit weit vorgestrecktem Kopf zischelte er: »Sie verstehen die Zeichen der Zeit nicht, Mister. Hier geht etwas vor, hier in Tombstone.«
»Sind Sie denn aus Tombstone?« fragte der Salooner plötzlich.
Shaddon ließ den Arm des Wirtes los und zog den linken Mundwinkel wieder auf das Auge zu.
»Nicht unbedingt. Aber das will nichts besagen. Ich lasse mich hier nieder. Und wo sich Steve Shaddon niederläßt, da herrscht Ruhe. Da gibt es keine Leute, die sich aufspielen wie dieser Earp. – Was sind das schon für Gestalten, die sich hier in unser Leben einmengen, sich um alles kümmern wollen. Sehen Sie sich doch den Kerl an, diesen aufgeblasenen Earp! Und den Doktor, den er wie einen Schatten mit sich herumschleift. Diesen unheimlichen Burschen. Sie müssen verschwinden, beide. Und dann kommt der andere dran, der oben im Office sitzt. Haben Sie ihn zum Sheriff gewählt? Dieses Ungeheuer aus Texas.«
»Ich weiß nicht, Luke Short ist ein guter Sheriff«, meinte der Salooner abwehrend.
Wieder schnellte die Hand des seltsamen Gastes nach vorn.
»Ein guter Sheriff? Sie sollten vorsichtig sein mit solchen Äußerungen, Flegger!«
Da zerrte der Salooner seinen Arm aus der feuchten Hand Shaddons.
»Hören Sie, Mister. Nehmen Sie Ihren Drink und lassen Sie mich zufrieden. Ich fühle mich nicht gut, verdammt noch mal!«
Da kam von draußen die klagende Stimme: »Jo-hon!«
»Ich habe jetzt keine Zeit, mein Bruder ruft mich. Es ist schon ein Jammer.«
Seufzend wollte er sich abwenden.
Da aber hatte Shaddon ihn wieder am Arm gepackt und zerrte ihn zu sich herum. Mit dem wilden, spuckenden Eifer des Fanatikers fauchte er dem Salooner entgegen: »Sie sollten aber die Zeichen der Zeit hier erkennen, Brother! Es kann Sie teuer zu stehen kommen, wenn Sie gegen uns sind!«
Verständnislos sah der Wirt ihn an.
»Gegen wen?«
»Gegen uns. Gegen die Übermacht! Gegen die Leute, die vernünftig sind, die in Frieden leben wollen. Wir sind eine Gemeinschaft. Ein Bund, der aus Ranchern und Cowboys besteht und aus Arbeitern und Händlern. Wir haben Menschen aus allen Kreisen in unserem Bund.«
Der Wirt musterte ihn jetzt aufmerksam und fragte argwöhnisch: »Was ist das für ein Bund?«
Shaddon ließ ihn los und stützte sich mit dem linken Ellbogen auf die Theke, wobei er den Blick abwandte und das kitschige Ölgemälde rechts an der Wand beobachtete, das einen Indianerhäuptling im Federschmuck hoch zu Roß auf einer Hügelkuppe zeigte. »Schönes Bild. Ist es zu verkaufen?« fragte er ablenkend.
Da ergriff der Wirt seinen Arm und zog ihn zu sich herum.
»Hören Sie, Mister, mich interessiert der Bund. Was ist das für ein Bund?«
»Ein Bund? Es ist kein besonderer Bund. Es ist, eh, well, es ist eine lose, eine lose Verbindung von Leuten, die eben dagegen sind, daß sich Menschen wie dieser Wyatt Earp überall breitmachen können. Wir kämpfen für die Freiheit. Man könnte vielleicht sagen, wir sind Rebellen! Ja, Rebellen sind wir!«
»Aha«, meinte der Wirt schon wieder apathisch, nahm seinen Zigarettenstummel aus dem Aschbecher und riß ein neues Zündholz an.
»Jo-hon!« kam es kläglich durch die halb offenstehende Tür aus dem Treppenhaus.
»Ach ja, ich muß jetzt gehen.«
Kaum hatte der Wirt den Schankraum verlassen, als vorn die Tür geöffnet wurde.
Shaddon warf einen forschenden Blick in den Thekenspiegel und musterte den Mann, der jetzt eingetreten war.
Es war keine gewöhnliche Erscheinung, die da im Türrahmen stand.
Ein hochgewachsener Mann im eleganten schwarzen Anzug mit weißem Rüschenhemd und schwarzer Samtschleife. Auch sein breitrandiger Kaliforniahut war schwarz und hatte wenigstens dreißig Dollar gekostet.
Das sah Steve Shaddon sofort.
Überhaupt fesselte ihn der Anblick des Fremden ungeheuer.
Der Mann hatte ein auffallend gutgeschnittenes, ja, aristokratisches Gesicht, das sehr männlich wirkte und von einem eisblauen, harten Augenpaar beherrscht wurde.
Diese Augen waren es, die Shaddon faszinierten.
Langsam kam der Mann von der Tür auf die Theke zu.
Nur wenig Zoll neben Shaddon blieb er stehen.
Obgleich Steve Shaddon den Mann nicht kannte, verspürte er doch in seiner Nähe ein sonderbares, unbehagliches Gefühl im Genick.
Der Mann überragte ihn fast um Haupteslänge und stand hochaufgerichtet, irgendwie unnahbar wirkend, neben ihm.
Shaddon hätte nie gewagt, das Wort an ihn zu richten.
Ohne darüber nachzudenken, hatte Shaddon seine Linke hochgenommen und auf die Thekenkante gelegt. Am Mittelfinger dieser Hand saß ein großer goldener Ring mit einer Platineinlage, in die ein großes Dreieck eingraviert war.
Der Blick des Mannes, der neben ihm stand, hatte die Hand nur kurz gestreift und ruhte jetzt auf der Tür zum Flur.
Da waren auf der Treppe draußen Schritte zu hören. Und gleich darauf wurde die nur angelehnte Tür geöffnet.
John Flegger erschien wieder hinter der Theke.
Aber er hatte kaum anderthalb Schritte in den Raum getan, als er wie angenagelt stehenblieb und den Fremden anstarrte.
»Doc Holliday!« entfuhr es ihm.
Wie unter einem Peitschenschlag zuckte Shaddon zusammen.
Doc Holliday? Dieser Mann also war Doc Holliday!
Das konnte doch nicht gut möglich sein!
Die Tatsache, daß der gefürchtete Georgier jetzt neben ihm stand, lähmte ihn regelrecht.
Aber der Mann kannte ihn ja nicht.
Plötzlich fiel Shaddons Blick auf seine linke Hand, die auf der Thekenkante lag.
Der Ring!
Die Hand rutschte sofort von der Theke herunter.
Hölle und Teufel! Der Spieler mußte ihn gesehen haben! zuckte es durch das Hirn des Banditen.
Ja, er war ein Bandit. Dieser Henry Halman Woodcock, wie er in Wirklichkeit hieß.
Sehr wohl fing er den Blick auf, mit dem ihn der Salooner jetzt bedacht hatte. Es schien ihm ein hämischer Blick voller Spott und Schadenfreude zu sein.
Aber das schien nur so. Denn der Salooner fürchtete jetzt lediglich, daß Shaddon, wie er sich beim Wirt genannt hatte, mit dem Georgier anlegen würde. Und was dabei herauskam, brauchte man sich gar nicht erst auszurechnen.
War Doc Holliday zufällig in die Schenke gekommen?
Diese Frage stellte sich der Wirt jetzt nicht, denn schließlich hatte der Georgier ihn schon öfter aufgesucht, um bei ihm einen guten Brandy zu trinken.
Der Spieler liebte es zwar im allgemeinen nicht, kleine Winkelschenken aufzusuchen, aber der gute Brandy der Brüder Flegger hatte es in sich. Und wenn Doc Holliday hier in der Nähe war, sah er auch schon mal hier herein, um einen Drink zu nehmen.
Für Woodcock sah die Sache entschieden anders aus!
Er war fest davon überzeugt, daß der Georgier nur seinetwegen in den Saloon gekommen war.
Er hat mich verfolgt. Er weiß längst, wer ich bin und ist nur meinetwegen in die Bar gekommen.
Wilder Zorn stieg in dem Desperado auf. Er hatte an diesem Morgen nämlich viel getrunken.
Vielleicht hätte er auch gar nicht so mit dem Salooner gesprochen. Es war sonst gar nicht seine Art, so wild zu räsonnieren.
Außerdem war es ihm verboten.
Rechnete er sich doch zur Elite der Graugesichter und kannte er doch als einer ihrer Anführer das Gesetz des großen Boß: Schweigen. Wer nicht schweigen kann, ist ein Verräter.
Und ein Verräter stirbt!
»Einen Brandy, Mr. Holliday?« fragte der Salooner.
Der Gambler nickte.
Woodcocks Blick zuckte zum Spiegel hinauf und suchte das Gesicht des Georgiers. Hatte der ihn nicht gerade scharf fixiert?
Aber es war Einbildung. Der Georgier blickte gelassen vor sich hin.
Woodcock krächzte mit belegter Stimme: »Mir einen Whisky. Ich habe ihn zuerst bestellt. Also bekomme ich ihn auch zuerst.«
Ganz langsam wandte der Mann neben ihm den Kopf und musterte ihn von der Seite.
Da warf Woodcock den Schädel herum und stieß sein breites, brutales, in der Mitte gespaltenes Kinn vor.
»Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, Mister!«
Der Georgier blickte ihn unverwandt an. Eine seltsame Kälte drang aus seinen Augen und schien dem Outlaw in die Adern zu fließen. Es war ihm, als ränne eisiges Blei statt Blut durch seinen Körper.
Wie hypnotisiert stand er vor dem Spieler.
Da nahm Doc Holliday den Kopf wieder herum und blickte den Wirt an. »Meinen Brandy bitte, Mr. Flegger.«
Woodcock hatte den Bann, in den ihn die Augen des Spielers gezwungen hatten, sofort abgeschüttelt.
»Meinen Whisky!«
Der Salooner blieb stehen und blickte die beiden Männer an.
»Ich kann nur einen zur Zeit bedienen. Der Doc hat zuerst bestellt.«
Da flog die linke Faust des Outlaws über die Theke und packte den Wirt am Hemdsärmel.
»Flegger, ich denke, Sie erinnern sich daran, was wir besprochen haben.«
Der Wirt machte sich los und meinte unbehaglich: »Besprochen? Wir haben nichts besprochen, Mr. Shaddon. Sie bekommen Ihren Whisky sofort. Ich schenke dem Doc jetzt den Brandy ein.«
»Das werden Sie nicht tun!«
»Doch, das werde ich tun!«
Doc Holliday war kein Mann des Streites. Er liebte es nicht, sich mit dem Pöbel, der dieses Land bevölkerte, herumzuschlagen.
»Geben Sie diesem Mann seinen Whisky, ehe er verdurstet, Mr. Flegger. Ich habe es nicht so furchtbar eilig.«
Dieser Hieb saß!
Woodcock ballte beide Fäuste und wandte sich dem Spieler zu.
»Ich habe es noch nicht eilig, Doc Holliday! Aber ich wollte Ihnen zeigen, daß ich mich nicht vor Ihnen fürchte! Niemand braucht sich vor Ihnen zu fürchten. Und dieser lappige Wirt da hätte es auch nicht nötig. Aber er ist ein Feigling, wie die meisten anderen hier in diesem Kaff. Das ist es, was Sie groß gemacht hat! Aber mich können Sie nicht ducken. Was kümmert es mich, ob Sie Herr Doktor Holliday sind. Ich bin Henry W… Henry Steve Shaddon!«
Der Spieler hatte ihn unendlich verächtlich gemustert. Jetzt sprangen seine Lippen auseinander.
»Aha.« Er wandte sich um und blickte den Salooner an.
Der aber hatte nach der Brandyflasche gegriffen und hielt sie über ein Glas.
Da sauste die Faust des Banditen wieder über die Theke und hieb dem Wirt die Flasche aus der Hand, die klirrend am Boden zersprang.
Es war original Kentucky Brandy. Die Flasche zu dreißig Dollar!
Es war totenstill in der Schenke geworden.
Eine wächserne Blässe hatte das Gesicht des Salooners überzogen.
In die Stille hinein fiel die klirrende Stimme des Georgiers.
»Wieviel kostet die Flasche, Mr. Flegger?«
»Dreißig Dollar, Doc. Dreißig Dollar. Dafür stehe ich viele, viele Stunden hier hinter dieser verdammten Theke!«
»Aber regen Sie sich nicht auf, Mr. Flegger«, sagte Doc Holliday mit halblauter Stimme. »Mr. Shaddon wird Ihnen den Schaden ersetzen.«
»Ersetzen?« geiferte der Desperado. »Ich denke nicht daran. Wie komme ich dazu? Er hat mich zu bedienen.«
Jetzt wandte sich Doc Holliday dem Desperado voll zu. Als Shaddon den Blick wieder spürte, den der andere in seine Augen senkte, wich er unwillkürlich einen Schritt zurück.
»Ich hasse Sie!« stieß er keuchend hervor. »Ich hasse Sie und den Marshal. Und dieses ganze Pack, das seine Lebensaufgabe darin sieht, friedliche Menschen zu belästigen! Ihr seid wie Schmeißfliegen…«
Ohne den Salooner anzusehen, sagte der Spieler, wobei er seine Hände über der Brust verschränkt hatte: »Ein bedauernswerter Fall, Mr. Flegger, der Mann ist geistesgestört.«
Da wich Woodcock noch einen Schritt zurück, stieß den Kopf vor und ballte seine schweren Fäuste.
»Geistesgestört? Das ist eine Unverschämtheit! Das habe ich nicht nötig, mir bieten zu lassen. Von so einem…« Jäh brach er ab.
Die Augen des Spielers waren schmal geworden, und Blitze schienen aus ihnen hervorzuzucken.
»Sprechen Sie sich nur aus, Mr. Shaddon.«
Seine Stimme war schneidend scharf geworden.
Woodcock mochte wohl gefühlt haben, daß er zu weit gegangen war. Er wandte sich jetzt ab und stützte beide Ellbogen auf die Theke, legte seinen Kopf in die Hände und stierte vor sich hin.
»Der Teufel soll’s holen. Mich ekelt das hier alles an, in dieser dreckigen Stadt. Ich möchte weg hier.«
»Dann gehen Sie doch!« Es war zu Woodcocks Verwunderung der Wirt, der diese Worte gesprochen hatte.
Er schoß einen wütenden Blick zu ihm hin und knurrte: »Ich gehe, wann ich will, verstehen Sie? Sie haben ja nur jetzt Mut, weil Doc Holliday hier steht.«
»Mut?« fragte der Wirt. »Nein, ich habe keinen Mut. Überhaupt keinen Mut mehr, Mr. Shaddon. Zu nichts, zu gar nichts mehr. Ich bin krank! – Es wäre mir lieb, wenn Sie mir jetzt den Brandy bezahlen würden.«
Woodcock griff in seine Tasche und nahm dreißig Dollar daraus hervor, die er auf die Theke legte.
Im Geheimen schwor er sich, Rache an Doc Holliday zu nehmen. Der Keeper strich das Geld ein und hob bedauernd die Hände.
»Tut mir leid, Doc. Es war die letzte Flasche.«
Der Spieler winkte ab. »Macht nichts, Mr. Flegger. Bis auf ein anderes Mal.« Er tippte mit dem Zeigefinger der Rechten an den Hutrand und wandte sich um.
Es waren vielleicht acht oder neun Yards bis zur Tür.
Welch eine kurze Strecke doch – und wieviel konnte ein Mensch auf dieser Distanz denken!
Der Desperado Henry Halman Woodcock jedenfalls dachte eine ganze Menge, obgleich das Denken sonst gar nicht seine Sache war.
Als Doc Holliday sich noch umwandte, starrte er ihm nur haßerfüllt nach. Doch dann erinnerte er sich plötzlich blitzartig an seinen Ring.
Der Doc mußte ihn gesehen haben! blitzte es in seinem Hirn.
Holliday hatte die Hälfte des Schankraums bereits durchmessen, da flog die Hand des Banditen plötzlich unter die Jacke, riß einen sechsschüssigen Smith and Wesson Revolver hervor, den er im Ziehen gespannt hatte, stieß ihn nach vorn und drückte ab!
Wie ein Keulenschlag traf die Kugel den Spieler in den Rücken und warf ihn nach vorn.
Aber, obgleich schwer getroffen, flog Doc Holliday im Fallwurf herum, hatte einen seiner beiden vernickelten Frontier-Revolver in der Faust und jagte dem Verbrecher einen fauchenden Schuß entgegen.
Die Kugel traf Woodcocks rechte Hand!
Weißgrauer Pulverrauch stand in einer dicken Wolke in der Mitte des Schankraumes und verdeckte für die beiden Gegner sekundenlang die Sicht. Sie sahen nur die Beine voneinander.
Woodcocks Revolver war auf die schmutzigen Dielen des Bodens gefallen.
Da geschah etwas so Ungeheuerliches, daß der Salooner den Atem anhielt.
Die schwarzen Beine des Spielers sanken plötzlich nach vorn, der Oberkörper folgte durch die Pulverwolke nach und schlug hart der Länge nach auf die Dielen auf.
Regungslos lag Doc Holliday am Boden.
Der Galgenmann starrte gebannt auf ihn nieder. Obgleich ein Höllenschmerz in seiner rechten Hand brannte, schien er nicht den geringsten Schmerz zu spüren.
Er war unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen!
Was war geschehen?
Wenige Yards vor seinen Stiefelspitzen auf den staubbedeckten Schankhausdielen lag ein Mann.
Langausgestreckt und bewegungslos.
Doc Holliday!
Eine volle Minute kroch durch Fleggers Bar – verrann in der Ewigkeit…
*
Vor der Theke stand der Desperado mit der blutenden Hand. Sein Revolver lag neben ihm am Boden.
Es dauerte lange, ehe er zu sich kam.
Er wandte den Kopf und sah den Salooner hinter der Theke stehen. Mit wachsbleichem Gesicht und weit aufgerissenen Augen.
»Er ist tot!« Fast lautlos kam es von den Lippen des Verbrechers.
Flegger war unfähig, etwas zu erwidern.
Da warf sich der Bandit herum und hieb mit beiden Fäusten auf das Thekenblech, daß die Gläser tanzten und klirrend aneinander schlugen.
»Was wollen Sie? Er hat mich doch bedroht. Er hat doch meinen R…« Jäh brach er ab und wandte sich um, um wieder auf den Mann am Boden zu starren.
Der Niedergeschossene regte sich nicht mehr.
Wie lange die beiden Männer so dagestanden hatten, wußten sie selbst nicht.
Ein Geräusch an der Flurtür schreckte sie auf.
Das totenkopfähnliche Gesicht eines Mannes blickte in den Schankraum.
Er hatte einen kahlen Schädel und eingefallene Wangen. Die Augen saßen tief in den Höhlen.
Billy Flegger.
Er kam herein, trat neben seinen Bruder und folgte dem Blick der beiden. Entsetzt starrte er auf den Mann am Boden.
»Um Gottes willen, John. Was ist da passiert?«
John war immer noch nicht in der Lage, etwas zu sagen.
Bill beugte sich weiter vor.
»Ist er tot?« stammelte er.
Woodcock stand mit dem Rücken gegen die Theke und hatte mit der Linken die blutende Rechte gegen die Brust gepreßt.
»Ich weiß es nicht«, keuchte er, »wahrscheinlich ist er tot. Ja, er wird wohl tot sein.«
»Aber, wer hat ihn niedergeschossen?« stotterte Billy Flegger, den die Schüsse herbeigelockt hatten.
»Ich«, brach es heiser von den Lippen des Verbrechers.
»Sie? Weshalb denn?«
»Weil er Doc…«
Woodcock brach ab und drehte sich langsam um. Aus glimmenden Augen blickte er den Kranken an.
»Er hat mich bedroht. Ihr Bruder ist Zeuge.« Er hatte den Unterkiefer vorgeschoben und die Zähne aufeinander gepreßt. Die Worte zischelten durch das lückenhafte Gebiß. »Nicht wahr, John Flegger, Sie sind Zeuge. Er hat mich bedroht!«
John Flegger rührte sich nicht. Unfähig, auch nur ein Glied zu bewegen oder einen Laut hervorzubringen, stand er da.
Sein Bruder Bill stieß ihn an.
»Wer ist der Mann?«
»Mein Name ist Shaddon.«
»Der Tote, wie heißt der?«
»Das kann ich Ihnen genau sagen. Sein Name ist Holliday, Doktor Holliday.«
Wie von einem Faustschlag getroffen, taumelte Billy Flegger zurück, stieß gegen das Flaschenbord.
Drei Flaschen stürzten herunter und zerschellten neben ihm am Boden.
Er blickte nicht hinunter, sondern starrte über Woodcock hinweg in den Schankraum auf die dunkle Gestalt des Niedergeschossenen.
Und jetzt sah er auch hinten im Rücken in der schwarzen Jacke ein Loch, durch das es hell schimmerte.
»Doc Holliday!« brach es rostig aus seiner Kehle. Dann preßte er beide Hände gegen die Schädelseiten, riß die Augen weit auf und schrie: »Nein!«
Woodcock zuckte zusammen und flog herum, riß mit der Linken den zweiten Revolver aus dem Hosenbund und richtete ihn auf Billy Flegger.
»Schweigen Sie!«
»Doc Holliday«, kam es wieder keuchend.
Billy wich zurück und torkelte gegen die angelehnte Tür.
»Doc Holliday«, kam es wieder keuchend über seine Lippen. »Aber das kann doch nicht wahr sein. Er ist doch nicht Doc Holliday. Der… der bekannte Doc Holliday. Das kann doch nicht wahr sein. Sie werden doch nicht den Freund des Marshals ermordet haben! Das kann doch nicht…«
Klick!
Henry Woodcock hatte den Revolverhahn gespannt. Es war ein vierundvierziger Parker Colt, den er vor siebzehn Jahren von seinem Vater bekommen hatte, als er sich mit den Worten zum Sterben hingelegt hatte: »Henry, gebrauche ihn nur, wenn du in Not bist!«
Auch der andere Revolver war vom Vater. Er hatte ihn ihm geschenkt, als er den ersten Job bei der Wells Fargo als Overlanddriver bekommen hatte. Der Vater hatte ihm damals die gleichen Worte mit auf den Weg gegeben, gebrauche ihn nur, Junge, wenn du wirklich in Not bist…
Und jetzt hatte er ihn gebraucht. Zum erstenmal in seinem Leben hatte er ihn gebraucht.
Und mit der ersten Kugel, die er verschossen hatte, war auch ein Menschenleben ausgelöscht worden…
In diesem Bewußtsein stand er jetzt da und war bereit, ein zweites Mal abzudrücken, um einen Menschen zu töten.
Aber Bill Flegger war von anderem Schrot und Korn als sein Bruder John.
Nicht, daß er mutiger gewesen wäre, daß er einen besseren Charakter gehabt hätte – ganz gewiß nicht. Aber er war härter, kälter, verbitterter. Vielleicht war es der Tod, sein schleichender Begleiter, der seit Jahren wie ein düsterer Schatten neben ihm herging, der ihn rücksichtsloser und weniger ängstlich gemacht hatte.
»Drücken Sie nur ab, Mister. Sie haben Doc Holliday erschossen, was zeigt es dann noch, wenn Sie den wehrlosen, siechen Billy Flegger umfegen.«
Der Bandit starrte ihn aus flackernden Augen an.
»Faseln Sie nicht, Mensch!«
»Ich fasele nicht, Mister. Drücken Sie nur ab. Mein Leben ist ohnehin keinen roten Cent mehr wert. Sie haben den Mut gehabt, den großen Doc Holliday zu erschießen – putzen Sie mich nur weg! Vielleicht ist es ganz gut so. Es hätte ohnehin nur noch kurze Zeit gedauert, und so nehmen Sie meinem Bruder eine große Last ab.«
In diesem Augenblick erst kam John Flegger zu sich.
»Was redest du da, Bill. Sei still! Sei still! Ich will nicht, daß er dich erschießt. Ich habe allein keine Lust, hier zu leben.«
Bill legte die Hand auf die Schulter des Bruders, ohne den Blick von dem Verbrecher zu lassen.
»Laß nur, John, es geht ohnehin mit mir zu Ende. Mein Leben ist nur eine Plage für dich. Allein wirst du es besser haben. Du wirst gesund und findest eine Frau.«
»Sei still!« brüllte der Bruder.
Aber Bill ließ sich nicht beirren. »Schieß nur, Bandit«, sagte er, während er Woodcock in die Augen blickte, »schieße nur. Du hast den Mut gehabt, den da auszupusten, der ein Großer, ein ganz Großer in diesem Lande war. Well, er war nicht mein Freund, auch nicht der Freund meines Bruders. Aber wir haben ihn doch geachtet. Er hat mit Wyatt Earp für das Recht, für das Gesetz gekämpft.«
Es war entsetzlich, aber es geschah: Henry Woodcock zog den Stecher durch.
Einmal, zweimal, und jedesmal bekam der schlaffe, ausgemergelte Körper des Todgeweihten einen Stoß und warf ihn zurück.
John schrie auf, suchte den Bruder aufzufangen, stürzte aber mit ihm gegen die Tür und kniete dann neben ihm am Boden.
Wie im Rausch sah sich der Mörder um, starrte noch einmal auf den schwarzen Körper des Spielers, dessen unbedeckter Haarschopf gerade von einem Sonnenstrahl, der durch das Fenster in die Schenke fiel, getroffen wurde.
Dann torkelte er aus der Bar hinaus, blieb einen Augenblick auf dem Vorbau stehen, sog die frische, kühle Luft in die Lungen und ging dann zu seinem Pferd.
Dort blieb er stehen. Erst nach und nach kam ihm die Besinnung.
Ich habe Doc Holliday erschossen!
Doc Holliday und Billy Flegger!
Billy Flegger wiegt nichts, überlegte er. Aber Doc Holliday wiegt bleischwer!
Und John Flegger ist Zeuge gewesen. Das wiegt noch schwerer.
Ich darf ihn nicht zurücklassen!
Sofort machte er kehrt und betrat die Schenke wieder.
Aber der Salooner war nirgends zu sehen.
Woodcock rannte um die Theke herum, stieß die Tür zum Flur auf – und erhielt in diesem Augenblick einen fürchterlichen Hieb über den Schädel, der ihn sofort niederstreckte.
Es war der sterbende Bill Flegger, der seinen Bruder gewarnt hatte.
»Schnell! John! Schnell, weg hier. Hinter die Tür! Laß mich liegen. Er kommt zurück! Er muß zurückkommen – er kann dich doch nicht am Leben lassen! Du bist Zeuge, daß er Doc – Holliday ermordet hat!«
Da packte der Bruder mit plötzlich erwachenden Kräften den Sterbenden, schleppte ihn in den Küchenraum hinüber, packte den erstbesten Gegenstand, den er fand – einen schweren Feuerhaken – und sprang zur Tür.
Keinen Augenblick zu früh, denn vorn in der Schenke flog die Tür wieder auf, und mit stampfenden Schritten kam der Mörder zurück, hastete um die Theke herum, stürmte in den Flur – und da schlug John Flegger zu.
Er hatte den Haken über den Kopf genommen und riß ihn mit aller Kraft nach unten. Aber er traf den Schädel des Banditen nicht genau. Der Schlag rutschte am Hut ab, hatte aber noch Wucht genug, den Verbrecher schwer zu betäuben und zu Boden zu strecken.
John Flegger starrte sekundenlang auf den Körper des Niedergeschlagenen, dann hörte er die Stimme des Bruders aus der Küche: »John! Schnell! Du mußt den Marshal – den Marshal holen!«
Flegger nickte und stürmte hinaus.
Es dauerte sieben Minuten, bis er die Allenstreet erreichte. Als er ins Sheriffs Office kam, sah er sich dem riesigen Texaner Luke Short gegenüber.
»Sheriff«, keuchte er. »Schnell, Doc Holliday!«
»Was ist mit ihm?«
»Er ist erschossen worden.«
Ein dunkler Schatten huschte über das Gesicht des Goliaths.
»Was faselst du da, Mensch?«
»Kommen Sie schnell. Bei uns in der Bar.«
Da packte ihn der Hüne am Arm und schüttelte ihn wild hin und her. »Bist du betrunken, Flegger?«
»Nein«, flehte der Mann, »es ist die Wahrheit. Er hat auch meinen Bruder niedergeschossen.«
Während der Texaner mit ihm hinausstürmte, rief er ihm zu: »Wer war es denn?«
»Shaddon!«
»Wer ist das?«
»Ich kenne ihn nicht.«
Der Tex hatte den Wirt schon mehrere Yards hinter sich gelassen und sprintete mit Riesenschritten der Gasse entgegen, in der Fleggers Bar lag.
Mit einem einzigen Satz sprang er über den Vorbau, stieß die Tür auf und sah wenige Schritte vor sich Doc Holliday am Boden liegen.
Der Riese schluckte. »Nein!« kam es nun lautlos über seine Lippen. »Das kann doch nicht sein!«
Dann rannte er an dem Körper des Spielers vorbei auf die Theke zu, stieß die Tür zum Flur auf und sah rechts hinter der halboffenen Küchentür einen Mann am Boden liegen.
Bill Flegger. Er war tot.
Luke wandte sich um, lief in die Schenke zurück und beugte sich über den Spieler.
Er wandte ihn auf den Rücken und blickte in ein totenbleiches Gesicht.
»Doc!« keuchte er. »Doc!« Verzweifelt spannte er seine riesigen Hände um die Schultern des Spielers. »Doc!«
Er schlug sich gegen die Stirn. »Allmächtiger! Was soll ich bloß tun? Der Marshal.« Er stand auf. »Wo ist der Marshal?«
In diesem Augenblick kam John Flegger keuchend in die Schenke.
»Hier, bleiben Sie bei ihm. Ich muß sofort den Marshal holen. Oder nein, holen Sie einen Arzt. Doc Sommers oder Doc Garfield. Oder – hier wohnt doch ein Zahnflicker in der Nähe, dieser Baxter. Los, holen Sie ihn, schnell!«
»Ja, Doc Baxter wohnt am nächsten«, hechelte der Wirt, wandte sich um und lief wieder davon.
Luke Short tigerte mit gewaltigen Schritten durch die Gasse davon, dem Russianhouse zu.
Im Eingang des Hotels sah er den Neger Sam, einen Bediensteten von Nellie Cashman, damit beschäftigt, eine Topfblume zu begießen.
»Sam! Wo ist der Marshal?«
»Ich weiß es nicht, Sheriff. Er ist vor einer Viertelstunde weggegangen.«
»Damned!«
Da trat die Inhaberin des Hotels aus ihrem Kontor.
Sie sah den Texaner in der Tür stehen. Die Erregung auf seinem Gesicht konnte der sensiblen Frau nicht entgehen.
»Ist etwas geschehen, Mr. Short? Mit Wyatt Earp?«
»Nein, aber mit Doc Holliday. Der ist unten in Fleggers Bar niedergeschossen worden.«
»Nein«, keuchte die Frau und preßte die Hand vor den Mund.
»Wo ist der Marshal?«
Die Frau schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht. Warten Sie, ich komme sofort mit.«
Sie lief zurück in ihr Kontor, holte eine Tasche, in die sie in fliehender Hast Medikamente und Verbandszeug packte, dann folgte sie dem Sheriff hinaus.
Luke Short wies in Richtung der Gasse, in der die Bar lag.
»Sie wissen ja, wo es ist. Ich muß hinauf zur Allenstreet. Ich muß den Marshal suchen.«
Die Frau nickte nur und lief davon.
Aber als sie im Eingang der Schenke ankam, sah sie schon den alten Doc Baxter über die reglose Gestalt Doc Hollidays gebeugt.
Der Arzt hatte den Spieler eben untersucht.
Im Raum herrschte eine bedrückende, bleierne Stille.
»Ist er tot?« entfuhr es der Frau.
Der greise Arzt wandte den Kopf und blickte über den Rand seiner goldgefaßten Brille. »Ich weiß es nicht, Miß Cashman. Wo ist der Marshal?«
Die Frau zog die Schultern hoch. Dann kam sie heran.
»Doc, Sie müssen ihm helfen. Sie müssen ihm helfen!«
Der alte Arzt richtete sich hilflos auf und preßte die Hände zusammen. »Ja, helfen, das will ich schon. Aber, ich weiß nicht…«
Da nahm die Frau Doc Holliday am Arm und schleppte ihn zu einem der Tische.
»Kommen Sie, helfen Sie mir, Doc.«
Der Arzt und auch der Salooner halfen ihr, den Georgier auf einen großen Tisch zu legen.
Sie nahm rasch zwei Kissen von den Stühlen, rollte sie zusammen und legte sie dem Spieler unter den Kopf.
Völlig bewegungslos lag der Georgier da. Die Augen geschlossen, mit wachsbleichem, totenähnlichem Gesicht.
»Doc, Sie müssen mir helfen«, flehte die Besitzerin des Russianhouses den Arzt an. »Er hat so vielen Menschen geholfen. Mr. Baxter, bitte, helfen Sie.«
»Er hat eine Kugel im Rücken. Das ist eine teuflische Sache. Ich kenne eigentlich nur einen Mann in Tombstone, der sich wirklich gut darauf verstand, anderen Leuten Kugeln aus dem Leib zu ziehen: und das ist er selbst.«
»Doc, ich flehe Sie an! Tun Sie doch etwas!«
Der Arzt hatte dem Georgier den Kragen schon geöffnet, nahm ihm jetzt die Halsschleife ab und öffnete ihm auch die Weste und das Hemd.
Nellie Cashman starrte mit kaltem Entsetzen in das bleiche Gesicht Hollidays. Da hörte sie den Arzt neben sich sagen: »Ich fürchte, da kommt jede Hilfe zu spät…«
*
Schräg gegenüber vom Crystal Palace lag Tombstones Grand Hotel.
In dem Augenblick, in dem der Texaner um die Ecke der Allenstreet bog, trat aus dem Hoteleingang eine Frau.
Sie war groß, hatte eine fabelhafte Figur und ein bildschönes Gesicht, das von einem smaragdgrünen berückenden Augenpaar beherrscht wurde. Das kupferrote Haar umrahmte das etwas blasse Gesicht der eleganten Frau vorteilhaft.
Es war die Spielerin Laura Higgins.
Die Frau zog die linke Braue mokant in die glatte Stirn und blickte dem rasenden Sheriff spöttisch lächelnd entgegen.
»Überschlagen Sie sich nur nicht, Mr. Short!«
Der Tex hielt inne und warf ihr einen raschen Blick zu.
»Haben Sie den Marshal gesehen?«
»Den Marshal?« fragte sie, wobei sie die Linke, die das dunkelblaue, mit Silberfäden bestickte Samttäschchen hielt, in die Hüfte stemmte. »Den großen Wyatt Earp? Nein, ich habe ihn nicht gesehen, Sheriff. Und ich muß auch gestehen, daß ich mich nicht für ihn interessiere.«
Luke Short winkte ab und wollte weiterlaufen. Doch dann fiel ihm plötzlich etwas ein. Er machte kehrt und kam nah an den Vorbau heran.
»Übrigens«, sagte er mit beißender Kälte. »Ihr Freund liegt unten in der dreckigen Bar von John Flegger und ist höchstwahrscheinlich tot.«
Die Frau nahm die Hand von der Hüfte und hatte plötzlich eine steile Falte in der Stirn.
»Was reden Sie da? Wer liegt in Fleggers Bar?«
»Doc Holliday.«
Als die Frau ihren Schrecken überwunden hatte, sah sie den Sheriff schon drüben im Oriental Saloon verschwinden.
Der Salooner blickte dem Riesen entgegen.
»Hallo, Sheriff!«
»War der Marshal hier?«
»Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Aber ich weiß, daß der Boß heute morgen mit ihm sprechen wollte, wegen der Whisky-Geschichte. Sie wissen doch. Die Halunken haben das Geld bekommen und nicht geliefert.«
»Ja, ja«, winkte Luke ab und lief wieder hinaus. Auch im Occidental Saloon hatte niemand den Marshal gesehen.
Luke Short lief hinauf zur Fremontstreet und fragte bei Jonny Hawkins nach, der dort eine Bäckerei betrieb.
Nein, auch er hatte den Marshal nicht gesehen.
Laura Higgins hatte nur wenige Sekunden vorm Hoteleingang gestanden, dann wandte sie sich zur Seite und lief auf das Haus von Doc Sommers zu, das gleich nebenan lag.
Die Schwester des Arztes kam an die Tür.
»Oh, Miß Higgins«, meinte sie pikiert und blickte die Spielerin gallig an.
»Ist der Doc zu Hause?«
»Ja, aber er hat keine Zeit. Es geht nicht, daß er drüben mit Ihnen pokert, während hier die Patienten sitzen. Es ist schlimm genug, daß das zweimal passiert ist, Miß Higgins. Ich wollte Ihnen das sowieso schon einmal sagen und…«
»Ich habe Sie gefragt, ob der Doc zu Hause ist«, schnitt ihr die Spielerin das Wort ab.
Da tauchte im Hintergrund des Flures an der Tür des Behandlungszimmers der Arzt auf.
Sein Gesicht hellte sich sofort auf, als er die schöne Frau erkannte.
»Oh, Miß Higgins!«
Er schob seine Schwester zur Seite und kam an die Tür.
»Doc, kommen Sie schnell. Doc Holliday ist in Fleggers Bar niedergeschossen worden!«
»Was?«
»Ja, holen Sie Ihre Tasche und Ihre Instrumente.«
Der Arzt packte in fliegender Eile seine Doktortasche und lief mit der Frau hinunter zu Fleggers Bar.
Der alte Doc Baxter blickte kurz auf, als Sommers eintrat.
»Wie sieht es aus?« fragte Sommers, während er neben den Tisch trat und in das kalkige Gesicht des Georgiers blickte.
Baxter hob die Arme. »Was soll ich Ihnen sagen. Er ist noch nicht tot. Aber…« Plötzlich begegneten seine Augen dem Blick der Frau.
Laura Higgins hatte den Blick von der leblosen Gestalt des Spielers erhoben und blickte den alten Zahnarzt an.
»Dr. Baxter, ich weiß, daß Sie Larry Cashin zwei Kugeln aus dem Leib geholt haben, als er oben in der Allenstreet lag, und als Joel Dempsey von Lister Gordon angeschossen worden war, haben Sie ihm auch die Kugel aus dem Oberschenkel geholt!«
»Es tut mir leid, Miß Higgins. Aber das ist weder Larry Cashin noch Joel Dempsey.«
»Ja!« rief die Frau. »Es ist Doc Holliday. Und ihm wollen Sie wohl nicht helfen!«
Eine dunkle Röte überzog das Gesicht des alten Zahnarztes.
»Es tut mir leid, Miß Higgins, daß Sie mich so mißverstehen. Ich möchte Ihnen nur sagen, daß ich es nicht kann. Vielleicht kann Doc Sommers ihm ja helfen.«
Der jüngere Arzt hatte den Georgier vorsichtig auf den Bauch gedreht und betrachtete die Wunde.
Verzweifelt ballte er die Hände.
Laura Higgins, die verzweifelt sein Gesicht beobachtet hatte, glaubte, Angst und Mutlosigkeit entdeckt zu haben.
»Nun? Was sagen Sie, Mr. Sommers?«
»Ich kann nichts anderes sagen, als was Mr. Baxter gesagt hat«, entgegnete der Arzt.
»So, nichts anderes. Mr. Baxter ist ein Zahnarzt. Er muß das nicht können. Aber Sie, Sie müssen es können.«
»Ich kann es so wenig wie Mr. Baxter«, entgegnete Sommers und spannte die Hände um das Revers seiner neuen dunkelblauen Jacke.
»Ich kann es vielleicht weniger als er. Ich behandle Leute, die Kopfschmerzen haben. Die kranke Füße haben und kranke Arme, offene Finger und Ohrenschmerzen. Doc Baxter aber operiert im Kiefer der Menschen herum. Das kann ich nicht. Er wäre geeigneter für diese Aufgabe.«
Laura Higgins wandte sich wieder an Baxter. »Sie haben gehört, was Mr. Sommers gesagt hat, Baxter. Ich fordere Sie hiermit auf, etwas zu tun.«
Verzweifelt stieß der alte Arzt hervor: »Ich kann es nicht, Miß Higgins. Ich kann es nicht!«
Da griff sie in ihre Tasche und packte ein großes Bündel Geldscheine, das sie dem alten Arzt entgegenhielt.
»Hier, nehmen Sie es.«
Baxter schüttelte den Kopf.
»Es sind fast zweitausend Dollar. So viel Geld verdienen Sie vielleicht in einem ganzen Jahr nicht.«
»Trotzdem, Miß Higgins«, stammelte der alte Arzt. »Ich kann es nicht.«
»Warum nicht«, schleuderte sie ihm heftig entgegen. »Sie müssen es tun.«
»Ich kann es nicht, Miß Higgins«, erklärte der Arzt mit belegter Stimme. »Die Kugel sitzt im Rücken. Verstehen Sie mich doch. Im Rücken, links hinten im Rücken. Sehen Sie doch selbst.«
»Ja, ich sehe es! Ich habe es gesehen, und darum ist jede Sekunde kostbar. Sie müssen ihm helfen!«
In diesem Augenblick kam Nellie Cashman aus der Küche in den Schankraum. Sie trug eine Schüssel mit dampfendem, heißem Wasser.
Laura Higgins blickte ihr feindselig entgegen.
»Sie – hier?«
Nellie Cashman antwortete ihr nicht.
Laura Higgins sah seit eh und je in der schönen dunkeläugigen, aber viel zurückhaltenderen Hotelbesitzerin eine Rivalin. Sie wußte, daß Doc Holliday gern im Russianhouse wohnte und sah den Grund vor allem in der Person der schönen Hausinhaberin.
Nellie Cashman stellte die Schüssel mit dem heißen Wasser auf den Tisch.
»Hier ist das Wasser, Doc.«
Baxter schüttelte den Kopf.
»Ich brauche es doch nicht, Miß Cashman.«
»Aber Sie haben doch gesagt, daß ich heißes Wasser machen soll.«
»Ja.« Baxter sah sich verzweifelt in der Runde um.
Nellie Cashman blieb vor ihm stehen. »Aber Doc, Sie haben gesagt, daß Sie ihm die Kugel herausholen wollen.«
»Ja, das habe ich vorhin gesagt, da waren wir auch allein. Und jetzt, da steht Doc Sommers. Er muß das besser können als ich.«
»Ich habe gesagt, daß ich es nicht kann!« preßte der jüngere Arzt fast lautlos durch die Zähne.
»Aber Sie haben anderen Menschen auch schon Kugeln aus den Knochen herausgeholt«, ging ihn der Zahnarzt an.
»Anderen Menschen ja, aber nicht ihm!«
»Aha!« kam es heiser über die Lippen der Spielerin. »So sieht das also aus. Ihr habt Angst. Ihr habt beide Angst, weil es Doc Holliday ist.«
»Ja«, stieß der alte Baxter hervor. »Ich möchte mir nicht von Wyatt Earp sagen lassen, daß ich ihn umgebracht hätte.«
»Das ist es also, Angst!« zischte die Spielerin. »Angst vor dem Marshal! Ich habe es ja gewußt.«
Sie wandte sich um und ging auf die Tür zu. Dort blieb sie stehen.
Die Anwesenden sahen ihre Schultern zucken.
Voller Mitleid trat Nellie Cashman auf sie zu.
»Miß Higgins, kommen Sie, Sie müssen gehen. Das hier ist doch nichts für Sie.«
Da flog der Kopf der Spielerin herum. Mit zornverdunkelten Augen fauchte sie die vermeintliche Nebenbuhlerin an.
»Nein, für mich ist es nichts, aber es ist etwas für Sie. Können Sie ihm vielleicht helfen? Wissen Sie einen Rat?«
»Ja, ich weiß schon einen Rat. Suchen Sie Wyatt Earp.«
Die Spielerin wich zurück. »Ich?«
»Ja, Sie!«
Nellie Cashman wandte sich um und trat zu den beiden Ärzten.
»Unternehmen Sie doch endlich etwas!«
Doc Sommers rieb sich in stummer Verzweiflung die Hände, und der alte Baxter knurrte heiser: »Das ist leicht gesagt, Miß Cashman. Was sollen wir denn unternehmen? Die Kugel sitzt hinten im Rücken über dem Herzen.«
»Das wissen Sie doch gar nicht.«
»Das weiß ich nicht? Doch, ich weiß, wo das Herz eines Menschen liegt. Und bei ihm sitzt die Kugel dicht darüber. Ich werde mich hüten, da einen Eingriff vorzunehmen. Dann stirbt er todsicher unter meinen Händen.«
»Aber Sie müssen es doch versuchen. Wenn die Kugel drinbleibt, ist er auf jeden Fall verloren.«
»Das ist er auch so«, kam es leise von Doc Sommers Lippen.
»Aber eines weiß ich«, sagte Nellie Cashman mit bebender Stimme, »wenn er hier stünde – statt Ihrer – er würde handeln.«
Da legte ihr der alte Arzt die Hand auf die Schulter.
»Ja, Miß Cashman. Davon bin ich sogar überzeugt«, sagte er leise. »Er würde handeln. Und ich kenne keinen Menschen außer ihm, der sonst noch den Mut dazu haben könnte.«
»Beschämt Sie das nicht«, kam es da von den Lippen der Spielerin, die hinter den alten Arzt getreten war.
Baxter schüttelte den Kopf. »Nein, Miß Higgins, das kann mich nicht beschämen. Doc Holliday war ein besonders begabter Arzt. Vor dreizehn Jahren habe ich in Boston einer schweren Kiefernoperation beigewohnt, die er am Gouverneur vorgenommen hat. Er war damals ganze einundzwanzig Jahre alt. Und die Professoren haben ihn ans Messer geschickt, weil sie keine sicherere Hand wußten als seine. Und der Gouverneur lebt heute noch. Was erwarten Sie von mir? Ich bin nicht Doc Holliday! Ich habe nicht seine Hand. Ich habe nicht das Geschick, das er besaß.«
»Besaß?« keuchte die Spielerin. »Sie sprechen von ihm, als wenn er schon tot wäre.«
Baxter, der vorhin schon seine Jacke ausgezogen und den linken Hemdsärmel hochgekrempelt hatte, krempelte sich jetzt auch den rechten hoch.
Laura Higgins hielt ihm das Geld noch einmal hin.
Er schüttelte den Kopf. »Nein, behalten Sie Ihr Geld, Miß Higgins, beten Sie lieber.« Er griff in seine Instrumententasche und nahm ein kleines Skalpell heraus, das er erst in das heiße Wasser und dann in eine Flüssigkeit tauchte, die er in einem Fläschchen mit sich geführt hatte.
Genau in dem Augenblick, in dem sich der alte Arzt über den Rücken des Georgiers beugte, wurde vorn die Tür aufgestoßen. Im Türrahmen stand ein junger Mensch. Groß, drahtig, mit kantigem, hartem Gesicht und dunklem Haar. Seine Augen standen etwas zu weit auseinander, was ihn aber nicht häßlich machte.
Obgleich ihn die meisten der im Schankraum Anwesenden noch nicht gesehen hatten, sahen sie eins sofort: dieser Mann war ein Clanton!
Ja, es war Jerry Clanton, Ikes Vetter, der erst am Vortage mit seinem Vater, einem Bruder von Ikes Vater, nach Tombstone gekommen war.
Jerry war schon am Vortage mit Wyatt Earp zusammengeraten und nur um Haaresbreite am Jail vorbeigekommen. Ike Clanton selbst hatte ihn in der Stadt abgeholt und auf die Ranch gebracht.
Aber in der Morgenfrühe dieses Tages hatte sich der ungebärdige Bursche davongestohlen und war in die Stadt zurückgekehrt.
Offensichtlich wurde er von dem gleichen unseligen Widerstandswillen und der Streitsucht getrieben, die auch Ikes jüngeren Bruder Phin beherrschte. Er verehrte zwar seinen berühmten Vetter Ike sehr, besaß aber nichts von dessen Besonnenheit.
Fleggers Bar war die erste Schenke auf dem Weg von der Ranch in die Stadt. Er hatte zwar nicht vor, sich zu betrinken, aber zwei, drei Drinks wollte er doch zu sich nehmen, ehe er wieder in die Mainstreet, die Allenstreet also, reiten würde.
Was hatte der Bursche vor? Wahrscheinlich wußte er es selbst nicht genau. Widerstand! Protest! Gegen wen? Gegen den Marshal, der ihm gleich so hart auf die Finger geklopft hatte.
Er war wild wie Billy Clanton, aber noch weniger besonnen als der junge Bursche, der im O.K. Corral sein Leben – vermeintlich für die Familienehre – gelassen hatte.
Jeremias Clanton war gefährlicher als Bill und Phin zusammen. Er war ein Mann, der in seiner Gefährlichkeit fast an Kirk McLowery heranreichte.
Jetzt stand er in der Tür und blickte verblüfft zu der Gruppe hinüber, die den Tisch umstand, auf dem der Schwerverletzte lag.
»He, was gibt es denn hier? Ist das eine Schenke oder ein Hospital?«
»Seien Sie still!« mahnte ihn Laura Higgins.
»Was wollen Sie? Wie reden Sie mit mir? Wissen Sie, wer ich bin? Mein Name ist Clanton, Jerry Clanton. Sie sollten sich den Namen merken, Madam.«
»Ihr Name interessiert mich nicht, Mister.« Die Frau vertrat ihm den Weg.
Jerry schob sie zur Seite und trat an den Tisch heran. Er ging um ihn herum und beugte sich nieder, um das Gesicht des Verwundeten zu sehen.
Er fuhr zwei Schritte zurück und prallte gegen Nellie Cashman.
»Doc Holliday!« entfuhr es ihm. »Das ist doch nicht möglich.« Er beugte sich noch einmal nieder, um sich davon zu überzeugen, daß er sich nicht geirrt hatte. »Das ist ja tatsächlich Doc Holliday!« Er blickte von einem zum anderen.
Die beiden Männer sahen ihn stumm an.
Nellie Cashman hatte die Zähne zusammengebissen und die Hände ineinander verkrampft.
»He!« Jerry Clanton schnalzte mit der Zunge und schnipste mit den Fingern. »Das ist ja eine tolle Geschichte. Wer hat ihn umgelegt?«
»Schweigen Sie!« rief Laura Higgins ihm zu.
»Halt die Klappe, Sweety!«
Da griff die Frau in ihre Handtasche, und plötzlich blinkte in ihrer Rechten ein kleiner versilberter Derringer.
Jerry blickte sie verdutzt an und brach dann in ein wildes dröhnendes Lachen aus.
»Was willst du mit dem Spielzeug, Puppe?«
Klick! machte es. Laura Higgins hatte den Hahn gespannt.
»Hören Sie zu, Jeremias Clanton. Da auf dem Tisch liegt ein Mann im Sterben, der tausendmal mehr wert ist als Sie. Er hat vielleicht nur noch wenige Minuten zu leben. Aber vielleicht gelingt es dem Arzt, ihn zu retten. Aber wenn Sie sich einbilden, Sie können den Arzt daran hindern, dann knalle ich Sie nieder.«
Es war einen Augenblick still im Saloon. Dann preßte Jerry durch die Zähne: »Teufel auch! Die hat Nerven. Sind Sie seine Frau?«
»Mein Name ist Laura Higgins.«
Da zuckte die Hand des jungen Outlaws plötzlich zum Revolver, und auch er hatte seine gespannte Waffe in der Hand. Tausendmal hatte er es daheim geübt, um hier in Arizona nicht hinter den anderen zurückzustehen. Er war ein schneller und gewandter Schütze. Wie anders hätte er sich auch sonst hierher getrauen können. Wie hatte er sich überhaupt das Leben hier gedacht!
Nacht für Nacht hatte er von dem Wege nach Arizona geträumt, von dem Augenblick, in dem er dem Vetter gegenübertreten konnte und sagen: Ike, hier bin ich! Sag, was ich tun soll! Wo ist Wyatt Earp und wo ist Doc Holliday? Stell mich auf meinen Platz in deinem großen Kampf.
Nichts von alldem hatte sich erfüllt. Tombstone war nicht die heiße, brennende, lodernde Stadt, in der der wilde mörderische Kampf gegen die Earps tobte. Es war ein stilles, verlassenes Kaff, in dem alles zu schlafen schien, in dessen Winkeln die Angst nistete und die Furcht vor dem Marshal.
Und Ike – wie hatte er ihn enttäuscht.
Er war äußerlich zwar noch der gleiche, wie er ihn in Erinnerung gehabt hatte von seinem damaligen Besuch, als sie alle noch lebten, die Brüder. Billy – und die beiden McLowerys. Tom – und der scharfsinnige Frank, der so schnell mit dem Revolver war, aber was war von ihm übriggeblieben, von dem großen Ike Clanton!
Er schien nur noch ein Schatten seiner selbst zu sein, was seine Persönlichkeit und seinen Willen anbetraf.
Wie sehr der junge Clanton sich irrte, wußte er nicht. Er wußte nur eins: Anstatt in dem von ihm ersehnten Kampf gegen die Earps zu stehen, stand er hier in einer düsteren Schenke mit dem Revolver in der Hand einer Frau gegenüber.
»Nun, Miß Higgins, haben Sie Mut?«
Das Gesicht der Frau war zur Maske erstarrt. »Es ist Ihr Pech, Mr. Clanton, daß Sie mich unterschätzen.«
Jetzt wurde der Bursche doch etwas unsicher.
»Was soll das heißen? Sie werden doch nicht den Nerv haben, auf einen Mann abzudrücken, außerdem – Sie können sicher sein, daß ich schneller bin.«
»Das ist mir einerlei, Mr. Clanton. Sie werden jetzt schweigen, den Doc nicht daran hindern, die Kugel herauszunehmen.«
Um den Mund des jungen Clanton lief ein böses, gefährliches Lächeln. »Doch, Miß Higgins, ich werde ihn daran hindern, denn an nichts ist mir mehr gelegen als an dem Tod von Doc Holliday! Er hat im O. K. Corral meinen Vetter Billy erschossen, falls Sie das noch nicht wissen sollten.«
»Mich interessiert das nicht, Mr. Clanton. Mich interessiert nur das Leben dieses Mannes. Nehmen Sie den Revolver herunter.«
Da brach ein dröhnendes Lachen über die Lippen des Outlaws.
»Hören Sie, Miß Higgins. Sie haben Pech gehabt. Es wird gleich zwei Tote hier geben.«
Da waren stampfende Schritte auf dem Vorbau zu hören. Die Tür flog auf. Luke Short trat ein.
Seine riesige Gestalt verdunkelte den Eingang.
Das rosarote Licht der Sonne umrahmte die Konturen seiner herkulischen Gestalt.
»Sheriff«, wande sich Laura Higgins an den Texaner. »Dieser Mann will Doc Baxter daran hindern, die Kugel herauszuholen!«
Der Riese fixierte den Burschen kurz.
»Bist du denn verrückt geworden, Mensch?«
Luke stampfte auf ihn zu.
Gewandt federte der Bursche zwei Schritte zurück und stieß seinen Revolver vor.
»Bleiben Sie stehen, Sheriff.«
Aber Luke ging weiter. Und plötzlich schnellte er zur Seite, riß den linken Fuß hoch und trat dem Outlaw den Revolver aus der Hand.
Die Waffe wurde gegen die hölzerne Decke geschleudert und fiel dicht vor Nellie Cashman auf den Boden.
Luke Short hatte mit einem blitzschnellen Griff seiner Polypenarme den zurückweichenden Burschen gepackt, schleuderte ihn nach vorn, fing den Hochschnellenden mit der Linken auf wie einen Spielball und schleuderte ihn gegen die Fensterwand, wo er benommen liegenblieb.
Luke trat auf ihn zu, nahm ihm den anderen Revolver aus dem Halfter und wandte sich dann, als ob nichts geschehen wäre, zu den anderen um.
»Fangen Sie an, Doc!«
Baxter nickte.
Aber die Hände, die das Skalpell hielten, zitterten.
Luke Short sah es, und die anderen sahen es auch.
Laura Higgins biß die Zähne aufeinander. Doc Sommer schloß die Augen.
Nellie Cashman senkte den Kopf.
Aber Luke Short konnte es nicht mit ansehen. Seine Rechte schoß nach vorn, packte die Hand des Arztes, die das Messer hielt.
»Warten Sie, Doc.«
Der alte Arzt blickte ihn verzweifelt an. Wie ein getretener Hund.
Luke ging mit weiten Schritten zur Theke, nahm die Whiskyflasche, aus der Henry Woodcock das letzte Glas bekommen hatte, stieß den Stopfen mit dem Daumen davon und kam zurück zu dem Arzt.
»Hier, Doc, nehmen Sie einen Schluck!«
Der Arzt blickte auf die Flasche. »Ich habe noch nie aus einer Flasche getrunken.«
»Dann werden Sie es jetzt tun!« herrschte ihn der Goliath an.
»All right, Sheriff.« Doc Baxter nahm die Flasche und setzte sie an die Lippen. Aber er nahm nur einen kurzen Schluck. Da schob Luke die Flasche wieder hoch.
»Vorwärts, trinken Sie einen Schluck. Noch einen und noch einen! So, und jetzt fangen Sie an.«
Aber Baxters Hände zitterten immer noch. Verzweifelt blickte er von einem zum anderen. Seine Augen blieben schließlich an den grünen Lichtern des Sheriffs hängen.
»Es tut mir leid, Mr. Short…«
Luke schluckte. »Ja, ich weiß.« Er nahm ihm das Skalpell aus der Hand und hielt es Sommers hin. »Doktor Sommers, jetzt sind Sie an der Reihe.«
Die Zähne des jüngeren Arztes schlugen aufeinander.
»Sheriff, ich bitte Sie. Ich kann es nicht. Ich kann es viel weniger als Doc Baxter. Das wissen Sie genau. Ich – ich würde ihn umbringen!«
»Davon rate ich Ihnen ab.«
Luke Short zog einen seiner großen rotkolbigen Revolver aus dem Halfter und hielt ihn dem Arzt entgegen.
»Fangen Sie an, Doc Sommers. Tun Sie Ihre Pflicht.«
Der Arzt starrte auf den Revolver, dann packte er das Messer und ging zu der Schüssel mit heißem Wasser, tauchte es hinein, nahm dann die kleine Flasche, die Doktor Baxter mitgebracht hatte und goß einige Tropfen über das Messer.
Ein Tropfen fiel auf den Rücken des Georgiers.
Sommers stand jetzt dicht am Tisch, und seine Linke lag auf dem Rücken des Verwundeten. Die Rechte hielt das Messer.
Dicke schwere Schweißperlen standen auf der Stirn des Arztes. Er hob den Kopf und blickte in die Augen des Sheriffs. Er schluckte und stieß heiser hervor: »Mr. Short! Sie können es nicht von mir verlangen! Ich kann es nicht!«
»Fangen Sie an, Doc«, entgegnete der Texaner mit eisiger Kälte.
»Ich – ich kann es noch weniger als – als er!« jammerte Sommers.
»Er ist sechzig Jahre alt. Und Sie sind höchstens vierzig. Ein junger Mann gegen ihn. Fangen Sie an. Ich zähle bis drei.«
Klick! Der schwere Revolverhahn wurde von dem großen Daumen des Texaners zurückgezogen.
Der Arzt starrte in die kreisrunde schwarze Mündung der Schußwaffe, dann tauchte er das Messer noch einmal in das Fläschchen und nahm die Mullbinden, die ihm Nellie rasch hinreichte, in die Linke.
*
Draußen, am Nordwestrand der Stadt, lehnte über dem obersten Brett eines großen Corralgatters ein Mann und blickte zu dem flachen Hügel des Graveyards hinüber.
Es war ein sehr großer Mann, breitschultrig und schmalhüftig, er hatte ein markant geschnittenes tiefbraunes männliches Gesicht von edlem Schnitt. Dunkelblaue, langbewimperte Augen lagen unter hochgewölbten, feingeschwungenen Brauen. Unter dem schwarzen breitrandigen Stetson blickte blauschwarzes Haar hervor. Er trug eine kurze gefütterte Lederjacke aus schwarzem Büffelleder und ebensolche Hosen, die unten über die schwarzen, mit texanischen Steppereien verzierten Stiefel ausliefen. Um die Hüften trug er einen breiten patronengespickten Waffengurt, der an jeder Seite einen schweren Revolver hielt.
Die Waffe auf der linken Seite hatte einen auffallend langen sechskantigen Lauf und einen schwarzen Kolben, es war einer jener seltenen Fünfundvierziger-Revolver, die im weiten, fernen Westen unter der Bezeichnung Buntline Special berühmt geworden waren.
Links über der Brust, auf der Lederjacke des Mannes, war ein dunkler Fleck, und wer genauer hinsah, konnte feststellen, daß da auch zwei Einstiche waren. Hier hatte lange Zeit ein Sheriffs-Stern gesessen.
Der Mann hatte seine braunen Hände auf dem riesigen Holz des Gatters liegen und den rechten Fuß auf die unterste Gattersprosse gestemmt.
Unverwandt blickte der Mann zum Boot Hill hinüber und beobachtete den Reiter, der vor wenigen Sekunden angekommen war, seinen Rappen an einen Aloebaum gebunden und den Friedhof betreten hatte.
Es war ein großer, bärenhafter Mensch mit vierkantigem Schädel und braunem Lederzeug: Isaac Joseph Clanton. Im ganzen Westen besser bekannt und lange Jahre gefürchtet unter dem Namen Ike Clanton.
Der einstige Bandenführer war in die Stadt gekommen und hatte den Friedhof aufgesucht.
Der Mann drüben am Corral beobachtete ihn bewegungslos.
Ike ging durch die Gräberreihen, bog dann zum Zaun hinüber ab, passierte achtlos die beiden eingefallenen Grabhügel, über denen die Kreuze mit den Namen Tom und Frank Robert McLowery standen und blieb dann vor dem letzten Grab stehen, über dem ein dunkles Holzkreuz stand, das den Namen William Clanton trug.
Der Mann drüben am Corral, der durch die jetzt kahlen Aloe- und Tecarillabüsche zum Graveyard hinübersehen konnte, verharrte regungslos.
Ike hatte den Hut abgenommen und hielt ihn in beiden Händen. Stumm starrte er auf den eingesunkenen Grabhügel nieder.
Dann hob er den Blick zu dem kleinen Kreuz.
»Billy«, flüsterte er.
Seine Augen wanderten über die Buchstaben und die Zahlen 1864 bis 1881.
Siebzehn Jahre, ganze siebzehn Jahre war Billy Clanton geworden. Gegen den Willen des Bruders war er mit in den O. K. Corral gegangen, an jenem fürchterlichen Tag, und hatte geglaubt, für die Ehre der Clantons kämpfen zu müssen. Für den großen Bruder Ike!
Der stand jetzt da, senkte den Kopf wieder, zog die Brauen zusammen und preßte die Lippen hart aufeinander.
Es würgte ihn in der Kehle wie jedesmal, wenn er hier stand.
Und dennoch kam er immer wieder.
Magisch zog es ihn zu der Grabstätte des Bruders hin.
»Ich habe ihn unter die Erde gebracht!« Wie Donnerschläge dröhnten diese Worte in seinem Hirn. Er hatte keine direkte Schuld am Tod des Bruders. Er hatte ihm sogar befohlen, daheim auf der Ranch zu bleiben.
Aber Billy war ihm gefolgt, war mit in die Stadt gekommen.
Er hatte sich nicht abhalten lassen, obgleich auch er die Gefahr kannte, war in den Tod gegangen, furchtlos, um der wahnwitzigen Idee des Bruders willen.
Niemals würde sich Isaac Joseph Clanton das verzeihen können.
Der Wind, der von den Bergen kam und über die Savanne strich, erreichte den Friedhofshügel und zerzauste das dunkle Haar des Ranchers.
Aber der stand wie aus Stein gehauen da.
Und der Mann unten vor dem Corral beobachtete ihn unverwandt.
Endlich kam Leben in die Gestalt des Ranchers. Er stülpte sich den Hut auf, warf noch einen letzten Blick auf den Grabhügel, wandte sich dann ab und ging dem Ausgang des Graveyards zu.
Noch ehe er sein Pferd erreicht hatte, sah er den Mann unten am Fuß des Hügels vor dem Corral stehen.
Er setzte sich wieder in Bewegung, ging an seinem Rappen vorbei, auf den Corral zu.
Als er dessen Ecke erreicht hatte, blieb er stehen.
Zwanzig Yards trennten ihn von dem Mann, der ihn anblickte.
Es war der Augenblick, in dem der sechsundsechzigjährige Doktor Jules Baxter unten in der finsteren Schenke der Gebrüder Flegger mit dem Skalpell über dem Körper des Georgiers stand und zum Öffnungsschnitt ansetzte. Es war der Augenblick, in dem der greise Arzt mit zitternder Hand nach dem scharfen Löffel griff, um die Wunde weiter zu öffnen.
Da setzte Ike Clanton sich in Bewegung und ging langsam vorwärts. Drei Yards vor dem anderen Mann blieb er stehen.
Er war nur ein wenig kleiner als der andere.
Hart und braungrau wie das Land ringsum war das Gesicht des Ranchers.
Seine bernsteinfarbenen Augen hingen an dem tiefbraunen Gesicht des anderen.
Da sprangen die Lippen Ike Clantons wie Gesteinsbrocken auseinander. Rostig klangen die beiden Worte, die aus seiner Kehle kamen: »Hallo, Marshal!«
Ja, der Mann, der dem einstigen Bandenführer Ike Clanton gegenüberstand, war niemand anderes als der große Marshal Wyatt Earp. Jener Mann, dessen Namen jeder Schuljunge und jeder Richter, jeder Bandit und jeder Cowboy, jeder Trader und jede Frau von Texas bis nach Montana und von Missouri bis nach Kalifornia genau kannte.
Wyatt Earp! Der König der Western-Sheriffs, der furchtlose, schlagstarke und schußschnelle Mann, der wie kein anderer Sternträger für den Vormarsch des Gesetzes im weiten Westen gekämpft hatte. Sein Name sollte in die Geschichte Amerikas eingehen. Noch heute, fast achtzig Jahre nach den Ereignissen dieser Tage, ist sein Name in aller Munde. Die Jungen der Vereinigten Staaten zählten ihn immer noch zu ihren bedeutendsten Vorbildern, und in den Fünfziger Jahren ist sein Ruhm hinüber über den großen Teich nach Europa gedrungen und hat dem berühmten Marshal auch hier Millionen Freunde und Verehrer gebracht.
Von alldem ahnte der stille, einfache, ernste Mann ganz sicher nichts, als er hier an einem späten Dezembertage am Rande der wilden Stadt Tombstone, dem Mann gegenüberstand, der ihm die heißesten und gefährlichsten Kämpfe geliefert hatte.
Wyatt Earp, der oben in Kansas, in der Rinderstadt Dodge City, seit Jahren Chief Marshal war, hielt sich seit einiger Zeit hier unten im südlichen Arizona auf, da er der größten Gang (Verbrecherbande), die damals in den Weststaaten aufgetaucht war, den Kampf angesagt hatte.
Die Bande, die sich durch graue Gesichtstücher kennzeichnete, hatte im Volksmund den Namen ›die Galgenmänner‹, da sie häufig vor den Häusern ihrer Opfer einen halbhohen Galgen errichtete. Es handelte sich bei den Galgenmännern oder Graugesichtern – wie sie auch genannt wurden –?um eine Verbrecherbande, die zunächst nur am südöstlichen Grenzstrich Arizonas aufgetaucht war, sich aber sehr schnell ausbreitete und bald in weiten Teilen Arizonas, New Mexicos und Mexiko selbst auftauchte wie eine schwärende Krankheit.
Eine Seuche in dem jungen Land, das sich gerade erst aus einem blutigen Bruderkrieg aufgerichtet hatte.
Die besondere Gefahr der Maskenmänner, unter diesem Namen sind sie eigentlich in die Geschichte der United States eingegangen, lag in ihrer unheimlich guten Organisation und in der schattenhaften, gespenstischen Manier, in der sie auftauchten und wieder verschwanden. Die Galgenmänner schlugen zu – und wenn sie verfolgt wurden, tauchten sie einen Tag später oft viele Meilen entfernt auf. So wußte der Marshal erst nach Wochen, daß die Bande sehr viel größer sein mußte, als er zunächst vermutet hatte. Von Kom Vo aus war er nach Costa Rica hinüber, nach New Mexico und wieder zurück nach Arizona geritten, wo er Nester der Graugesichter ausgehoben hatte. Aber sehr bald führte ihn der Weg – zu seinem eigenen Entsetzen – hinunter, in die von ihm gemiedene Stadt Tombstone, in der er die fürchterlichste Stunde seines Lebens erlebt hatte.
Auch sein Bruder Virgil hatte die düstere Stadt verlassen, die den Earps kein Glück gebracht hatte. War doch an einem Märztag des Jahres 1882 in einer Billardschenke in der Allenstreet ihr jüngster Bruder Morgan von hinten niedergeschossen worden. Und immer und immer wieder hatten sich die Anhänger der Clantons gegen die Earps gestellt, um ihnen, den zahlenmäßig ja weit unterlegenen, das Leben zur Hölle zu machen.
So hatte dann eines Tages der sonst gewiß unerschrockene Virgil Earp das Feld geräumt.
Aber es schien so, als wären zu diesem Zeitpunkt die Clantons geschlagen gewesen.
Aber – das schien auch wirklich nur so!
Wyatt Earp, der zwar über Chiricahua hinauf in die Silvermounts zum Roten See gekommen war, um auf der Fährte der Galgenmänner zu bleiben, um ihr Hauptcamp zu finden und den Großen Boß zu jagen, hatte seit einer Nachtstunde drüben in Costa Rica das Gefühl nicht loswerden können, daß niemand anders als der geheimnisvolle Ike Clanton der Boß der Galgenmänner sein müßte.
Hatte er anfänglich geglaubt, daß es verhältnismäßig leicht sein würde, Ike seiner Anführerschaft zu überführen, so hatte er doch sehr bald einsehen müssen, daß das mit größeren Schwierigkeiten verbunden war, als er angenommen hatte. Vor allem die große Mitgliederzahl der Bande war erdrückend. In manchen Orten schien es so, als ob die halbe Bevölkerung mit den Graugesichtern verbunden wäre.
Und immer wieder führte der Weg nach Tombstone zurück. Sie waren in Casa Grande gewesen und hatten nach einer strapaziösen Hetzjagd geglaubt, in Marana den Großen Boß selbst stellen zu können. Aber er war ihnen entwischt. Wyatt Earp hatte mehrere prominente Mitglieder der gefürchteten Gang gestellt und zur Strecke gebracht.
Aber den Chief der Bande hatte er nicht stellen können.
Obgleich er längst wieder nach Hause hätte reiten müssen, hinauf nach Dodge City, war er geblieben. Nicht zuletzt aus dem Bewußtsein heraus, daß sich kein anderer der Aufgabe stellen würde, die er dann aufgegeben hätte. Das Militär in Arizona war zu schwach, als daß man es ernsthaft gegen die Gang hätte einsetzen können. Und freiwillige Trupps brachte niemand gegen die Maskenmänner in den Sattel.
So kämpfte er denn seinen Kampf allein, der unbeirrbare, eiserne Marshal Earp. An seiner Seite nur der phantomhafte Mann aus Georgia, von dem der Marshal in diesem Augenblick noch nicht wußte, daß er auf den Tod darniederlag unter dem Messer eines zitternden alten Arztes. Und als zweiten Helfer hatte der Marshal noch den texanischen Abenteurer Luke Short, den er dazu gebracht hatte, wenigstens vorübergehend in dem gefährlichen Tombstone den Sheriffs-Stern zu nehmen, den der feige, wankelmütige Jonny Behan abgelegt hatte.
Immer wieder hatten alle Wege den Marshal nach Tombstone geführt.
Tombstone! War es ein Zufall, daß die Stadt Grabstein hieß?
Heute mag es den stillen Beobachter jener Zeit wie ein makabrer Scherz anmuten.
Und doch hat es diese Stadt unten im südlichen Arizona gelegen –?und es gibt sie noch! Es hat Ike Clanton gegeben und den Kampf im O. K. Corral! Und die Maskenmänner und gefährlichen Widersacher, die sich dem Marshal wie eiserne Hemmschuhe in den Weg warfen, schier unüberwindbare Hindernisse im Kampf gegen die Graugesichter. Männer wie den gefährlichen Kirk McLowery, der selbst seinen Bruder Frank an Gefährlichkeit noch überbot, und das wollte etwas bedeuten.
Wyatt Earp wußte jedoch zu dieser Stunde noch nicht, daß es neben Ike Clanton gerade dieser Kirk McLowery sein sollte, der ihm am meisten zusetzen würde. Immer noch unterschätzte er den stolzen Dandy-Cowboy aus dem San Pedro Valley.
Und schon erwuchs ihm ein neuer Gegner aus den Reihen seiner Feinde, auch ein gefährlicherer Gegner, als es jetzt den Anschein hatte: Jerry Clanton! Der Bursche, der erst vor vierundzwanzig Stunden ins Cochise County gekommen war.
Alle Wege schienen den Marshal immer wieder nach Tombstone zu führen. Und alle Fährten und Spuren schienen auf diese Stadt hin zu deuten.
Und jeder Inbegriff dieser Stadt war Ike Clanton! Wyatt wußte jetzt, daß er immer noch der Herr des Cochise County war, damals hatten sie gelacht, die Earp-Brüder, als er sich der König von Arizona nannte, der ungebärdige Rebell von der Clanton Ranch, der weiße Geronimo, wie ihn ein bekannter New Yorker Publizist einmal genannt hatte.
Wyatt Earp vermochte sich nicht aus dem Bannkreis dieses Mannes zu lösen. Das heißt, er vermochte seinen Argwohn gegen den einstigen Bandenführer nicht zu begraben.
Vielleicht war er ja völlig unschuldig, vielleicht hatte er wirklich nichts mit den Galgenmännern zu tun. Aber tief in der Brust des Marshals war der Argwohn geblieben, war zuweilen aufgeflackert, wieder verebbt, um dann unter der Asche zu neuer Glut zu werden!
Als Wyatt vor wenigen Tagen oben in Red Rock – nach einer Hetzjagd auf einen der Anführer der Galgenmänner – plötzlich auf Kirk McLowery gestoßen war und als die Spuren anderer Galgenmänner hinunter nach Südosten, also nach Tombstone deuteten, war der furchtbare Verdacht von neuem aufgeflackert!
Wyatt Earp war aus dem Haus des Schmiedes Blackwell gekommen, fast am Ende der Fremontstreet, als er den Reiter ganz zufällig auf der Overlandstreet, die früher im Westen der Stadt vorbeiführte, gesehen hatte.
Ike Clanton war auf den Boot Hill geritten.
Wyatt hatte ihn dort öfter beobachtet. Er hatte auch jetzt nicht daran gedacht, ihn zu stören. Aber er vermochte ganz einfach nicht, dem Mann den Rücken zu drehen, um in die Stadt zurückzugehen!
Beobachten muß ich ihn! Wie in Stein gemeißelt standen die Worte in seinem Hirn und ließen sich nicht auswischen.
Und jetzt war er auf ihn zugekommen, stand kaum drei Schritte von ihm entfernt und bohrte den Blick in Wyatts Augen.
Der Wind brachte den Geruch der Prärie mit und trieb dem Rancher das lange Haar ins Gesicht.
Wieder öffneten sich die harten Lippen des Viehzüchters: »Weshalb beobachten Sie mich, Marshal?«
Da erhielt der Tombstoner eine Antwort, die er ganz gewiß nicht erwartet hatte.
Der Missourier hob seine breiten Schultern etwas und ließ sie wieder fallen: »Ich weiß es nicht, Ike.«
Verstört blickte ihn der einstige Desperado an.
Eine volle Minute kroch zwischen den beiden Männern dahin.
Dann schien die Spannung von Ike Clanton abzufallen.
Er griff in seine Reverstasche und zog eine seiner langen schwarzen Virginia-Strohhalmzigarren daraus hervor, die er sich zwischen seine großen weißen Zähne schob.
Er nahm ein Schwefelholz und riß es an dem rissigen Gatterholz an.
Obwohl ihm der Wind jetzt stark über den Rücken blies, brachte der Rancher den Tabak in Brand.
Er ließ das Holz fallen und setzte den staubigen Stiefel darauf.
Während er jetzt zur Stadt hinüberblickte, sagte er mit seiner rauhen, rostigen, heiseren Stimme: »Ich war bei Billy.«
»Ja, ich weiß«, entgegnete der Marshal leise.
»Sie werden es nicht verstehen, Wyatt.«
Wyatt nickte unmerklich. »Doch, Ike, ich verstehe es.«
Der Despreado nahm den Kopf herum und fixierte den Marshal verwundert.
Dann sah er wieder auf die Dächer der Stadt hinunter, die zu Füßen des flachen Hügels lag und sich – wie mit Fingern – weit in die Savanne erstreckte. Es war groß geworden, dieses Tombstone. Fast schon eine richtige kleine Stadt.
»Und doch ein armseliges Kaff!« sagte der Rancher und sprach dem Marshal aus dem Herzen.
»Ja, wegen Billy bin ich hier. Es war schade um ihn, Wyatt. Er war erst siebzehn.«
Der Marshal kehrte der Stadt den Rücken zu und blickte über den Corral zum Friedhof.
»Ja, sehr schade. Er war ein prächtiger Bursche.«
Ike kaute auf dem Strohhalm herum und spürte den beizenden Geruch des schwarzen Tabakdeckblattes auf den Lippen.
»Und das Verrückteste ist, daß er Sie gemocht hat.«
Ike lehnte mit dem Rücken am Gatter und starrte auf die Stadt hinunter.
Nur noch etwa zwei Yards lagen jetzt zwischen den beiden Männern. Es war eine Weile still. Und der Wind zauste an den Haaren und den Halstüchern der beiden.
Da wandte Ike sich um und blickte in den Corral. »Eine Menge Vieh könnte hier stehen«, sagte er leise.
»Ja«, antwortete der Marshal.
»Wenn Billy noch lebte, könnte er eine eigene Farm haben. Ich habe Rinder genug. Ehrlich erworbene Rinder. Schade um ihn.«
Es war wieder einen Augenblick still, dann fragte der Rancher, ohne den neben ihn am Gatter lehnenden Mann anzusehen: »Was suchen Sie eigentlich, Wyatt?«
»Das will ich Ihnen sagen, Ike. Da Sie mich danach fragen. Ich suche einen verantwortungslosen, gerissenen Verbrecher, der eine Bande von Tramps anführt, um mit Hilfe dieser Schwachköpfe das Land hier in Not und Unglück zu stürzen.«
Ike Clanton schwieg. Der Marshal fuhr fort: »Ich suche den Boß der Galgenmänner, Ike.«
Der Rancher schob die Virginia von einem Mundwinkel in den anderen, ohne etwas zu sagen.
»Kennen Sie vielleicht diesen Mann?« fragte der Marshal leise.
Ike blickte in den staubigen Corral, in dem der Wind jetzt ein Rontondo drehte und den Staub bis zu den Brettern aufwirbeln ließ, an denen er wie schmirgelnd entlangtrieb.
»Eine ganze Menge Vieh ginge hier rein.«
Da wandte sich der Missourier blitzschnell um, seine Rechte packte die linke Schulter des Ranchers und zerrte den Mann zur Seite.
Aus funkelnden, jetzt tiefdunklen Augen senkte er den Blick in die gelben Lichter des einstigen Verbrecher-Chiefs.
»Ike, ich habe Sie etwas gefragt.«
Er nahm die Hand von der Schulter des Banditen.
Der kniff plötzlich das linke Auge ein und bleckte seine großen weißen Zähne. Ohne die Virginia aus dem Mund zu nehmen, lachte er dröhnend los.
»Es tur mir leid, Marshal, ich kann Ihnen nicht helfen. – Ich habe übrigens keine Zeit. Dieser Strolch, der mir da gestern zugelaufen ist, dieser Köter, er ist mir entwischt und muß wieder in der Stadt stecken. Seinetwegen bin ich überhaupt hierhergeritten.«
Wyatt zog die Brauen zusammen. »Jerry?«
»Ja, dieses ungebrannte Büffelkalb hat sich wieder davongemacht.«
»Nur keine Sorge, ich werde es schon einfangen.«
Wyatt hatte so seine eigenen Gedanken über dieses ›Büffelkalb‹.
Ike warf ihm einen lauernden Blick zu.
»Er gefällt Ihnen nicht, was?«
»Nicht wie Billy«, unterbrach ihn der Rancher schroff.
»Doch, Ike. Und Sie wissen es selbst. Sie sind ihm nicht umsonst nachgeritten.«
»Ich bin ihm nachgeritten, weil ich ganz genau weiß, daß er wieder mit Ihnen zusammenprallen wird und dann im Jail landet. Ich habe ihm gestern abend gesagt, daß er sich hier anständig zu benehmen hat. Da meinte er, er müsse gegen Wyatt Earp kämpfen. Daraufhin hat er die zweite Ohrfeige von mir bezogen. Und ich dachte, damit wäre er geheilt. Aber das ist anscheinend noch nicht so.«
»Ganz sicher ist es noch nicht so, Ike Clanton.«
Der Rancher nahm die Zigarre aus dem Mund und rieb sich mit dem Handrücken das rauhe Kinn.
»Ich wollte Sie eigentlich um einen Gefallen bitten, Marshal.«
Wyatt blickte ihn fragend an.
»Ich dachte mir, daß Sie ihn doch vielleicht als Büffelkalb ansehen könnten, wenn er Ihnen versehentlich wieder vor die Füße rennt.«
Der Marshal winkte ab. »Keine Angst, ich weiß schon, wie ich ihn zu behandeln habe.«
»Dann bin ich beruhigt.«
Da war es also heraus.
In diesem jungen Jeremias Clanton war Ike ein neuer Bruder erwachsen, ein zweiter Billy.
Der Missourier hatte es schon am Vorabend gespürt, als Ike den Burschen von seinem Office abholte und dort mit einer gewaltigen Ohrfeige empfing. Das war die Begrüßung nach jahrelanger Trennung. Und die Worte, die der Rancher dem Jungen entgegengeworfen hatte, ließen auf alles andere als auf familiär-freundschaftliche Gefühle schließen. Dennoch hatte Ike den Marshal nicht täuschen können; er hatte schon immer einen stark ausgeprägten Familiensinn gehabt, der ihm keineswegs immer Glück und Freude gebracht hatte. Das galt nicht etwa nur für seinen wilden, ungezügelten jüngsten Bruder Billy, sondern vor allem für seinen Bruder Phin, der ihm sehr viel Ärger gemacht hatte.
Und jetzt war da dieser kleine grüne Bursche aus dem Osten gekommen und brachte neue Unruhe in sein Leben.
»Ich werde mal nachsehen, wo er steckt«, meinte Ike, tippte an den Hutrand und ging davon.
Wyatt blickte ihm nach.
Er hatte einen bärenhaften schweren Gang, und doch waren seine Schritte kaum zu hören. Wie alles, war auch das an diesem Mann zwiespältig.
Er blieb geheimnisvoll wie eh und je. Weshalb hatte er eine Antwort ausgeschlagen?
Der Argwohn in der Brust des Marshals blieb.
Ja, er war sogar stärker geworden!
Wenn Ike nichts mit den Galgenmännern zu tun hatte, so konnte er es sagen. Was hätte ihn daran hindern sollen, zu erklären, daß er nichts mit der Bande zu tun hatte? Von so verblendetem Haß konnte dieser Mann gar nicht beseelt sein, daß er den Gesetzesmann an der Nase herumführen wollte, nur um ihn aufzuhalten.
Wenn er aber etwas mit der Bande zu tun hatte oder gar ihr Chief war, dann allerdings war auf die Frage natürlich kaum eine Antwort zu erwarten.
Wyatt blickte ihm nach, sah jetzt, wie er die linke Hand zum Sattelhorn erhob, die Faust den Lederknauf spannte, den Fuß in den Steigbügel setzte und sich auf seinen Rappen zog.
Er nahm mit der Linken die Zügel auf und ritt davon, leicht zurückgelehnt, die Rechte herunterhängend, so, wie der Marshal ihn seit länger als einem halben Jahrzehnt kannte; durch dieses Land reitend, dessen gefürchtester Mann er immer noch war.
*
Während vorn im Schankraum der greise Doktor Baxter mit dem Tod kämpfte, der schon seine knochige Hand nach dem Leben des Georgiers John Henry Holliday ausgestreckt hatte, hockte hinten in der düsteren Küche der Schenke der Salooner Flegger und starrte auf die Leiche seines Bruders.
Fassungslos starrte er in das Gesicht, das sonst immer von einem schmerzlichen Zug gezeichnet war und jetzt plötzlich so gelöst, so zufrieden, ja, froh schien.
Wilhelm Alois Flegger, der einstige Holzarbeiter aus dem winzigen Tiroler Bergdorf Serfaus, war tot. Und der Tod war für ihn eine Erlösung.
Johann Flegger konnte den Blick nicht von dem Bruder wenden.
Plötzlich erfaßte ihn eine bisher ungekannte Angst.
Ich bin allein! hämmerte es in seinem Hirn. Er hat mich verlassen, allein zurückgelassen. Ich habe damals die junge Lizzy Shellinger nicht geheiratet, um ihm nicht das Gefühl zu geben, völlig überflüssig zu sein. Und ihr, der Frau, hatte ich nicht zumuten wollen, den kranken Bruder pflegen zu müssen.
So hatte er denn auf sein Lebensglück verzichtet und war allein geblieben mit dem kranken Bruder.
Und jetzt lag er da und war tot. Ermordet von der Kugel eines wahnwitzigen Menschen, der sich für einen Rebellen hielt.
»Shaddon!« brach es bitter über die Lippen des Salooners. »Shaddon!«
Ein verzweifelter Haß auf den Mörder des Bruders hatte ihn erfaßt.
Er riß sich von seinem Stuhl los und ging in den Flur, starrte auf die Stelle, an der der Bandit gelegen hatte, den er mit dem Feuerhaken niedergeschlagen hatte.
Rasch mußte sich der Verbrecher von dem Schlag erholt haben, sonst wäre er noch nicht weggewesen, als der Sheriff den Saloon betreten hatte.
John Flegger verließ die Küche, wo er den Bruder auf das niedrige Sofa gebettet hatte, trat durch den Flur in den Schankraum.
Drüben um den Tisch hatten sie sich zusammengeschart und starrten gebannt auf die Hände des greisen Zahnarztes, der jetzt mit der Pinzette nach der Kugel suchte.
Plötzlich hob Luke Short, der die anderen alle um mehr als Haupteslänge überragte, den Kopf und sah zur Theke hinüber, wo er den Salooner erblickte.
Auf Zehenspitzen kam er auf ihn zu.
»Wie hat sich das abgespielt?« flüsterte er und ging mit dem Salooner in den Flur.
Da erst sah er jetzt durch die halboffene Tür den anderen liegen.
»Damned, ist das nicht Ihr Bruder?«
»Ja.«
»Was ist mit ihm?«
»Tot«, krächzte der Wirt, »er hat auch ihn erschossen.«
»Wer?«
»Shaddon.«
»Wer ist das?«
»Ich weiß es nicht. Irgendein verrückter Kerl, der hier herumgestanden und auf den Marshal geschimpft hat.«
»Wie sah er aus?«
Flegger versuchte, den Mörder zu beschreiben.
Aber seine Beschreibung war so dürftig, daß sich der Texaner kaum ein Bild von dem Geflüchteten machen konnte.
Da ließ ein tiefes Aufstöhnen die Menschen in dem Schankraum erzittern. Der Verletzte hatte den Laut ausgestoßen.
Die Pinzette des alten Arztes zuckte aus der Wunde zurück.
Leer!
Gebannt starrten die Menschen auf den Arzt.
Schweißbedeckt stand der alte Mann da und hielt die blutige Pinzette in der Hand. Seine Augen suchten den jüngeren Mann.
»Sommers, ich bitte Sie, Sie müssen es versuchen. Ich habe das Geschoß gefühlt. Es ist nicht allzu tief…«
Doc Sommers, dem es vorhin im allerletzten Augenblick gelungen war, das Skalpell noch einmal an den Alten abzutreten, preßte die Lippen zusammen.
Sommers wußte, daß er jetzt nicht mehr ausweichen konnte. Er, der doch in der Stadt als guter Arzt bekannt war, fürchtete sich vor diesem Eingriff. Aber jetzt gab es kein Zurück mehr für ihn. Er sah es dem greisen Kollegen an, daß der seine Nervenkraft nun völlig verbraucht hatte. Und er hatte ja auch genug getan und an Vorarbeit geleistet.
Sommers tauchte die Pinzette in das Wasser und anschließend noch einmal in die desinfizierende Flüssigkeit. Und dann beugte er sich über den Körper des Verletzten.
Ganz ruhig wollte er sein und völlig vergessen, wen er nun operierte.
In diesem Augenblick geschah dem Doktor Irvin Sommers das Schlimmste, was ihm passieren konnte: der Verwundete erwachte aus seiner Ohnmacht.
Doc Holliday seufzte tief auf und wandte dann den Kopf zur Seite. Er sah die Füße der Menschen, die den Tisch umstanden. Es dauerte Sekunden, bis er begriffen hatte, wo er sich befand. Aber was geschehen war, wußte er noch nicht.
Er sah die Füße, das Kleid und die Hände der Laura Higgins.
Langsam und unter dumpfem tiefem Schmerz, der ihn wieder in die Ohnmacht zurückreißen wollte, hob er den Kopf.
»Laura«, kam es leise über seine Lippen.
»Doc«, die Frau trat sofort an ihn heran und legte ihre elfenbeinernen, durchsichtigen Hände an sein Gesicht. »Doc«, stammelte sie noch einmal.
»Was… wollen die Leute hier?«
»Doc, Sie sind verletzt worden.«
»Verletzt?«
»Ja.«
»Ich verstehe nicht.«
Die Frau blickte sich verzweifelt im Kreise um.
Da kam Luke Short von der Theke her und kniete neben dem Tisch nieder.
Holliday sah sein kantiges, ebenmäßig geschnittenes Gesicht vor sich.
»Luke?«
»Ja, Doc, Sie sind hier von einem hinterhältigen Schurken niedergeschossen worden. Sie haben eine Kugel im Rücken.«
Der Kopf des Spielers sank auf die Tischplatte zurück, links war er an dem Kissen heruntergerutscht.
Es war totenstill im Schankraum.
Jerry Clanton, der sich inzwischen erhoben hatte, stand abseits und starrte auf die Gruppe hinüber. Auch er wagte sich nicht zu bewegen.
Dann war die rauhe Stimme des Georgiers wieder zu hören: »Wer ist hier?«
»Doc Sommers und Doc Baxter.«
»Welch ein Aufwand!« Wieder war es einen Augenblick still. Dann öffnete Holliday wieder die Lippen. »Doc Sommers.«
Der Arzt trat heran. Da sah Holliday die Pinzette in seiner Hand.
»Wo sitzt die Kugel?«
»Im zweiten Rippenbogen, Mr. Holliday.«
Der Spieler schloß die Augen.
»Tief?« fragte er.
»Ich weiß nicht. Aber Doc Baxter…«
Der Arzt brach ab.
Da trat Baxter vor den Spieler hin und bückte sich.
»Machen Sie sich keine Sorgen, Mr. Holliday. Ich habe das Geschoß schon ertastet. Es sitzt nicht allzutief. Doc Sommers wird es jetzt herausholen. Ich selbst… Ich…«
Er wischte sich mit dem Jackenärmel den Schweiß von der Stirn, der ihm durch die Brauen schon in die Augen zu rinnen begann.
Wieder war es eine Weile still. Ohne die Augen zu öffnen, sagte Doc Holliday: »Sie müssen eine andere Pinzette nehmen, Sommers.«
»Eine andere Pinzette, ja.« Er nahm seine Tasche und hielt sie vor Doc Holliday hin.
Der blickte hinein und schloß die Augen wieder.
Darauf holte Baxter seine Tasche und nahm mehrere Pinzetten heraus. »Hier, Mr. Holliday. Welche soll er nehmen?«
Holliday öffnete die Augen wieder.
»Die zweite, die zweite…, die zweite«, keuchte er, nach Atem ringend. »Die mit dem breiten Fuß!«
Baxter nickte und reichte Sommers das bezeichnete Instrument.
Sommers hatte neuen Mut gefaßt. Mit bebender Stimme fragte er: »Mr. Holliday, würden Sie an meiner Stelle…« Er brach jäh ab. Ein Blick des Sheriffs hatte ihm angedeutet, daß der Verwundete das Bewußtsein wieder verloren hatte.
»Fangen Sie an, Mr. Sommers«, mahnte der Sheriff.
Der nickte, und seine Hand war plötzlich völlig ruhig. Er wußte ja jetzt, daß er die richtige Pinzette hatte, und vorsichtig führte er sie in die Wunde.
Doc Baxter hatte gute Vorarbeit geleistet und die Wunde mit dem scharfen Löffel etwas vergrößert und gereinigt, so daß er unbehelligt vorgehen konnte.
Plötzlich stieß seine tastende Hand auf Widerstand.
In diesem Augenblick ließ ein gellender, markerschütternder Schrei die Menschen im Schankraum erzittern.
Luke Short lief sofort hinter die Theke auf den Flur und sah an der Küchentür eine grauhaarige Frau stehen, der die vollgepackte Einkaufstasche zu Boden gefallen war.
Es war Mrs. Liston, die Haushälterin der beiden Fleggers.
Sie hatte den Toten gesehen.
John Flegger stand hinter dem Sheriff und starrte auf den bebenden Rücken der Frau. Dann erklärte er: »Das ist unsere Haushälterin, Mrs. Liston, Sheriff.«
Die Frau drehte sich um und blickte die beiden Männer an.
Sie begriff nichts.
Luke Short wandte sich um und eilte in den Schankraum zurück.
Die Augen der anderen waren ihm fragend entgegengerichtet.
»Machen Sie weiter, Dr. Sommers!« mahnte der Arzt.
Es dauerte noch drei volle Minuten, bis die Pinzette des Arztes aus der Wunde herauszuckte. In ihrem breiten Fuß hing ein verformtes Stück Metall.
*
Wyatt Earp hatte die großen Corrals am Westrand der Stadt verlassen und hielt auf eine winzige Parallelgasse der Allenstreet zu.
Es war ein eigenartiges Bild, das diese Stadt an einem Wintertag bot.
Von der Sonne sonst so verwöhnt, hatte Tombstone sich jetzt in sich selbst verkrochen. Es war nicht eigentlich kalt, aber doch unbehaglich für die Menschen dieses Landstriches.
Wyatt Earp schritt an den Rückfronten der Höfe vorbei.
Schon von weitem hörte er das klatschende Aufschlagen von Brettern, die von einem Wagen abgeladen wurden. Als er den Hof des Zimmermanns Tucker erreicht hatte, blieb er stehen. Der krummbeinige, kleine Tucker war damit beschäftigt, lange Bretter, die er aus der Sägemühle geholt hatte, von einem Wagen abzuladen.
Plötzlich hatte er den Mann hinten am Zaun entdeckt.
Das Brett, das er eben vom Wagen gezogen hatte, fiel ihm aus den Händen. Alle Farbe wich aus dem Gesicht des Mannes. Schrecken stand in seinen Augen.
Da wandte er sich plötzlich um und rannte davon; durch das Haus, vorn auf die Straße hinaus.
Ein bitteres Lächeln zuckte um die Mundwinkel des Marshals.
Es war eine Panikhandlung des Zimmermanns gewesen, daß er die Flucht ergriffen hatte. Früher einmal war er ein Anhänger der Clantons gewesen. Und als nach dem Kampf im O. K. Corral hier in der Stadt der große Prozeß tagte, hatte er verzweifelt versucht, sich herauszuwinden. Und es war ihm mit sehr viel Mühe auch gelungen, unbeschadet aus dem gewaltigen Wirbel zu entkommen.
Jetzt hatte ihn der plötzliche Anblick des Marshals derartig erschreckt, daß er die Flucht ergriffen hatte.
Wyatt ging langsam weiter.
Stumm und verlassen lagen die Höfe da. Meist unaufgeräumt, unsauber, schmutzstarrend.
Plötzlich glaubte der Missourier, nicht richtig gehört zu haben.
Die Stimme eines Mannes war an sein Ohr gedrungen: »Ich werde es dir geben, du eingebildete Schachtel, du! Ich schlage dir den Schädel ein, wenn du nicht tust, was ich verlange.«
Wyatt beschleunigte seinen Schritt, bemühte sich aber, möglichst lautlos aufzutreten.
Er hatte eine übermannshohe Fenz erreicht, die so dicht geschlossen war, daß man nicht hindurchsehen konnte.
Rasch näherte er sich dem Tor, das anscheinend nicht ganz fest geschlossen war.
Durch eine Ritze konnte er einen vierschrötigen Mann erkennen, der eine junge, dralle Frauenperson vor sich her schob, der er die Hände auf dem Rücken zusammengebunden und einen Knebel in den Mund geschoben hatte.
Der Marshal kannte den Mann genau. Es war ein Gehilfe des Schlachters Bings, der vorn auf der Allenstreet ein Geschäft hatte.
Der rüde Bursche mit dem ausladenden Kinn und den kleinen Schweinsaugen schob das schreckensbleiche, vielleicht siebzehnjährige Mädchen vor sich her auf einen Geräteschuppen zu.
Als er die Tür aufgerissen hatte, fiel das Mädchen vor ihm nieder und sank mit dem Gesicht auf den Boden.
Der Mann merkte nicht, daß es die Besinnung verloren hatte, riß es hoch und versetzte ihm zwei klatschende, harte Ohrfeigen.
Die unglückliche Loury Smisson kam wieder zu sich und sog die Luft verzweifelt durch die Nase.
Tödliche Angst stand in ihren Augen. Der Mann zerrte sie an den Oberarmen hoch.
»Los, da rein mit dir!«
Da flog hinten der Torflügel auf.
»Du bist wohl verrückt geworden, Fred!«
Wyatt Earp trat in den Hof.
Frederic Haarmacher warf den Kopf herum und starrte entsetzt auf den Marshal.
»Wyatt Earp?« entfuhr es ihm.
Wyatt kam auf ihn zu und stieß ihn zurück. Dann zog er der Frau den Knebel aus dem Mund und schnitt ihr die Handfesseln durch.
Das Mädchen stand blutübergossen da, und plötzlich riß es dem bulligen Schlachtergehilfen eine gewaltige Ohrfeige ins Gesicht, die den Kopf des bulligen Mannes zur Seite warf.
Dann rannte sie, laut schreiend und weinend, ins Haus zurück.
Der Schlachtergehilfe blickte den Marshal aus stieren, blutunterlaufenen Augen an.
»Das werde ich Ihnen nie vergessen, Earp.«
Diese Unverschämtheit konnte der Missourier nur mit der gleichen Münze bezahlen wie das Mädchen.
Seine linke Hand klatschte auf die Wange des Strolches.
Der Bursche torkelte zurück.
»Solche Halunken wie du gehören ins Jail, Fred!« donnerte ihn der Marshal an.
Haarmacher schluckte schwer.
»Ins Jail?« Plötzlich schien er seine Lage zu begreifen. »Aber Marshal, ich bitte Sie, ich habe eine Frau und zwei Kinder.«
Wyatt senkte seinen Blick in die flimmernden Lichter des Wüstlings.
»So, eine Frau und zwei Kinder. Schämst du dich denn nicht, Mensch?«
Da sank der Kopf des Mannes auf die Brust herunter.
Ein Beben lief durch seinen Körper.
Der Marshal wandte sich um und verließ den Hof.
Erst das Zufallen des Tores ließ den Schlachtergehilfen zusammenzucken.
Er blickte auf und sah, daß der Marshal verschwunden war.
Niedergeschlagen trottete er dem Haus entgegen.
Da erschien oben die massige Gestalt seines Bosses in der Tür.
»Fred? Komm doch mal her!« sagte er mit heiserer Stimme, in der aber ein drohender Unterton mitschwang, den der Gehilfe genau kannte.
Er machte zwei Schritte auf die Treppe zu, und da holte der Schlachtermeister mit seiner gewaltigen Pranke aus und versetzte ihm einen Faustschlag, der ihn weit in den Hof zurückwarf und benommen im Staub liegen ließ.
Wyatt Earp war weitergegangen.
Fast schon hatte er die Ecke erreicht, die auf den Hof des Crystal Palaces führte, als er in einem der letzten Häuser einen hemdsärmeligen Mann von etwa dreißig Jahren breitbeinig in der Hoftür stehen sah.
Es war der ehemalige Overlanddriver Jonny Fulham.
Vor zwei Jahren, im Sommer, war er von dem Mashal der Unredlichkeit überführt worden. Er hatte kleinere Beträge der Postgelder unterschlagen und vielleicht auch wertvollere Dinge, was aber nicht nachgewiesen werden konnte.
Fullham hatte dadurch seinen Posten bei der Wells Fargo Overland verloren und war seitdem arbeitslos. Das heißt, er hätte längst eine neue Arbeit finden können. Aber er wollte es ja nicht. Er war das geblieben, was er schon vorher war – ein Tramp.
Ein Outlaw!
Ein Mann, der immer schon zu den Clantons gehört hatte. Engbefreundet mit den Flanagans, mit den Vichams und den Pattons. Mit Familien, die alle mit den Clantons verwandt waren.
Wyatt hatte Luke Short eingeschärft, auf diesen Mann ein besonders wachsames Auge zu haben.
Der Hof war von einer halbhohen Mauer umgeben.
Wyatt war stehengeblieben, lehnte sich über diese Mauer und blickte den Mann unverwandt an.
Der wurde plötzlich unsicher unter dem Blick und kam langsam in den Hof.
»Wollen Sie etwas von mir, Marshal?«
Wyatt antwortete nicht.
Fulham kratzte sich den struppigen, ungekämmten Schädel.
»Ich weiß gar nicht, warum Sie hier herumstehen und mich anstarren!«
Wyatt schwieg.
Noch unsicherer geworden, stieß der Outlaw einen Fluch durch die Zähne. »Was ist denn los? Ich habe doch nichts verbrochen, Marshal. Warum stehen Sie hier?«
Immer noch gab der Marshal keine Antwort.
Da trat der Mann einige Schritte näher, blieb vier Yard vor der Mauer stehen und ballte die Fäuste, streckte die behaarten Unterarme nach vorn und keuchte mit mühsam verhaltener Stimme: »Was stehen Sie hier, Marshal! Was wollen Sie von mir? Ich habe doch nichts getan.«
Wyatt blickte ihm kühl in die Augen.
Da preßte der Bandit heiser durch die Zähne: »Ich habe ein sauberes Gewissen, Marshal.«
»So«, entgegnete Wyatt, »dann ist es ja gut.«
Er wandte sich ab und ging langsam weiter. Als er die Schuppen, die den Hof des Crystal Palaces abschlossen, erreicht hatte, blieb er stehen.
Er wartete ein paar Minuten und ging dann langsam zurück.
Er hatte sich nicht getäuscht. Fulham hatte sein Pferd aufgesattelt und stieß gerade das Hoftor auf.
Wie angenagelt blieb er stehen, als er den Marshal plötzlich wieder vor sich sah.
»Ich… ich habe gerade einen Weg zu meinem Vetter.«
»Aha.«
»Ja.«
Fulham wischte sich über das Kinn. Er hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, eine Jacke anzuziehen.
»Scheint ja ein ziemlich eiliger Weg zu sein«, sagte der Marshal.
»Ja, ein sehr eiliger Weg.«
»Aha. Dann lassen Sie sich nicht aufhalten, Fulham.«
Fulham aber rührte sich nicht von der Stelle. Und der Marshal auch nicht. Er stand vor ihm und blickte ihn nur an.
Wut und ohnmächtige Verzweiflung kämpften in dem Gesicht des Verbrechers miteinander.
»Ich weiß gar nicht, was Sie wollen, Earp!« stieß er plötzlich hervor. »Ich habe wirklich nichts getan. Ich habe ein reines Gewissen. Und wenn ich jetzt zu meinem Freund reiten wollte…«
»Ich dachte, zu Ihrem Vetter.«
»Ja, ja, zu meinem Vetter – er ist, gewissermaßen, ja auch mein Freund.«
»Aha. Das soll’s ja geben.«
Der Bandit biß die Lippen zusammen, riß am Zügel und führte seinen Gaul zurück in den Stall. Das kleine Hoftor hatte er nicht geschlossen. Als er aus dem Stall zurückkam, war der Marshal verschwunden.
Fulham ging langsam auf das Haus zu und warf die Hoftür donnernd hinter sich ins Schloß.
Das schlechte Gewissen schien der häufigste Gast unter den Dächern von Tombstone zu sein!
*
Der Marshal war zurückgegangen.
Da, wo der kleine Pfad die hintere Seite des O.K. Corrals durchquerte, blieb er stehen und blickte auf das Stallhaus.
Langsam ging er in den offenen Hof, schritt an Wagenreihen vorbei und ging dann links hinüber, wo der Corral abbog zu der engen Öffnung, die in die Fremontstreet hinausführte.
Plötzlich stockte sein Fuß.
Neben einem umgekippten Wagenkasten lag ein grauer Lappen.
Der Marshal bückte sich und hob ihn mit spitzen Fingern auf. Es war ein dreckiges Halstuch.
Vielleicht war der Fund völlig bedeutungslos, denn es war doch ein Halstuch wie jedes andere auch.
Oder nicht?
Nein, es war kein Halstuch wie jedes andere. Kein Mensch trug graue Halstücher und schon gar nicht von dieser Größe. Es war das Gesichtstuch eines Galgenmannes!
Wyatt knüllte es zusammen und schob es in die Tasche. Langsam ging er zurück, an den Wagen vorbei, auf die Stalltür zu, deren obere Hälfte offen stand.
Im Stall unterhielten sich zwei Männer.
Wyatt öffnete die untere Hälfte der Tür und trat in den Stallgang.
Hier herrschte trübes Dämmerlicht, das auch von der halboffenen Stalltür und den drei winzigen Fensterchen kaum mehr erhellt wurde.
Im Hintergrund des Stalls sprachen die beiden Männer immer noch miteinander.
Wyatt trat in eine der Boxen und konnte jetzt, als er stehenblieb, ihre Worte verstehen.
»… doch Wahnsinn, Ed! Nein, da mache ich nicht mit.«
Die whiskyheisere Stimme des älteren Mannes kam knurrend zurück: »Du wirst mitmachen, mein Junge, wie andere mitmachen. Niemand kann sich ausschließen.«
»Nein, Ed. Das redest du mir nicht ein!«
Die Stimme des Älteren wurde drohender.
»Ich habe dir gesagt, niemand schließt sich aus!«
»Befiehlst du das etwa?«
»Ja, ich.«
»Du hast mir nichts zu befehlen!«
»Das wird sich ja zeigen, mein Lieber. Bei uns wird gehorcht.«
Es blieb einen Augenblick still im Liverystable des O. K. Corrals, und dann fragte der Jüngere: »Wer bist du überhaupt, Edward Humpton, daß du glaubst, mit mir so sprechen zu können? Du bist wie ich ein Peon dieses Mietstalls. Nichts weiter.«
Klatsch! Offenbar hatte Humpton den Jüngeren geschlagen.
Aber der schlug zurück, und es entwickelte sich eine wilde Keilerei, die damit endete, daß der Ältere den Jüngeren niedergeschlagen hatte.
Keuchend stand Humpton in der Enge der Stallbox und blickte auf den anderen nieder.
»Steh auf, Joe!«
»Laß mich zufrieden. Ich will nichts mit dir zu schaffen haben.«
»Ja, ich weiß, du willst nichts mit mir zu schaffen haben. Aber das ist jetzt unwichtig. Du gehörst zu uns.«
Da sprang der Jüngere auf. »Zu euch! Nein, ich gehöre nicht zu euch. Ich habe nichts mit euch zu tun. Ihr seid eine Verbrecherbande, und was ihr vorhabt, ist nichts anderes als Mord.«
»Das sind schwere Worte, Boy, die du da von dir gibst. Ich würde mir so etwas gründlich überlegen. Es könnte sonst passieren, daß einer unserer Leute auf den Gedanken kommt, von dir dafür Rechenschaft zu verlangen.«
»Hör zu, Ed, ich werde dir etwas sagen«, entgegnete Joe. »Ich habe mit der Bande nichts zu tun.«
»Irrtum. Du hast unseren Versammlungsabend besucht und gehörst also zu uns.«
»Nein, ich gehöre nicht zu euch. Die Tatsache, daß du mich unter einem falschen Vorwand da hingeschleppt hast, berechtigt niemanden dazu, mich zu einer Verbrecherbande zu rechnen.«
Angestrengt lauschte der Marshal dem interessanten Gespräch.
Offensichtlich hatte der Ältere irgendeinen Schlaggegenstand oder eine Waffe ergriffen, denn es raschelte im Stroh, und der Jüngere war wohl zurückgewichen.
Wieder drang die Stimme Humptons durch das Stallgebäude.
»Unser Kampf gilt den Earps…«
»Den Earps!« wiederholte Joe. »Ihr müßt wahnsinnig sein. Wie käme ich dazu, gegen Wyatt Earp zu kämpfen? Ich habe nichts gegen ihn. Im Gegenteil. Er ist ein rechtschaffener Mann, der für das Gesetz kämpft.«
Humpton versetzte: »Ich habe jetzt keine Zeit, mich mit dir darüber zu streiten, Junge. Zunächst stellen wir einmal fest, daß du zu uns gehörst. Zu unserer Crew. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, diesen Marshal auszulöschen.«
»Das ist Mord! Blanker Mord! Ich habe es dir schon gesagt. Und ich bleibe dabei. Ich habe nichts damit zu tun!«
Ein pfeifendes Zischen kam durch den Stallgang, dem ein hartes Klatschen folgte.
Der Bursche schrie auf.
»Bist du wahnsinnig! Du hast mich ins Gesicht getroffen. Ich werde zum Boß gehen, und was für dich dabei herausspringt, kannst du dir denken; du verlierst deinen Job!«
Keuchend hatte der Bursche die Worte hervorgestoßen.
Der andere aber riß die Peitsche wieder hoch.
In das Pfeifen der Lederschlange hinein hörte Wyatt hastiges Atmen und dann einen dumpfen Aufschlag. Und dann war die Stimme des jüngeren Mannes zu hören. »So, und jetzt steh auf, und dann reden wir weiter!«
Ächzend erhob sich Humpton vom Boden.
»Das büßt du mir!«
Gleich darauf war das harte Klicken eines Revolverhahns zu hören.
Schon wollte der Marshal sein Versteck verlassen, als er die Stimme des jüngeren Peons hörte.
»Du wirst es doch nicht wagen, mich niederzuknallen, Ed.«
»Da gibt es nichts zu wagen. Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns.«
»Was verlangst du von mir?« fragte Joe jetzt in unterwürfigem Ton.
»Wir treffen uns heute abend gegen acht. Dann ist es dunkel, und niemand wird uns erkennen. Bring dein graues Gesichtstuch mit.«
»Ich habe es nicht mehr.«
»Was faselst du da?«
»Ich habe es nicht mehr. Ich muß es verloren haben.«
»Bist du verrückt? Wie kannst du dieses Tuch verlieren. Du weißt genau, daß wir darauf zu achten haben. Wenn es irgend jemand findet, kann er auf deine Spur kommen und damit auch auf meine Spur. Was das bedeutet, ist klar. Du weißt ja, daß der Marshal eisenhart durchgreift.«
»Ja, ja, das muß er auch«, meinte der Peon gedankenlos.
»Er wird bald nichts mehr müssen. Nur noch ins Gras beißen«, entgegnete Ed. »Und dafür werden wir sorgen. Heute abend um acht treffen wir uns bei Flanagan.«
»Weshalb dort?« fragte der andere.
»Das geht dich nichts an. Und du wirst um acht Uhr dort sein. Mit deinem grauen Gesichtstuch.«
Und dann sprach der ältere Pferdeknecht wie zu sich selbst: »Heute wird aufgeräumt. Seine Stunde ist gekommen. Der Boß hat es beschlossen, ihn auszulöschen.«
»Hat er das nicht schon öfter beschlossen?« wagte der Bursche zu fragen.
»Red nicht so frech. Schließlich ist es kein Kinderspiel, einen Wyatt Earp zu schlagen.«
»Nein, das werdet ihr heute abend auch erleben.«
Der ältere Mann stieß einen Fluch aus. »Du hast ein ziemlich großes Maul, Joe Ferkas. Sieh zu, daß es dir nicht gestopft wird. Der Boß duldet keine Aufrührer. Wir haben uns zusammengeschlossen, um für unsere Freiheit zu kämpfen. Wir sind nicht in dieses Land gekommen, um uns von einem Polizeibullen herumkommandieren zu lassen. Das Gesetz sind wir.«
»Die Galgenmänner?« Joe Ferkas hatte es ausgesprochen.
Klatsch! Eine harte Ohrfeige brannte in seinem Gesicht.
»Dies nur zur Warnung, Ferkas. Ich werde dich lehren, dich an die Regeln unserer Crew zu gewöhnen. Es wird über nichts gesprochen.«
»Und du?« entrüstete sich Ferkas. »Du sprichst doch die ganze Zeit darüber.«
Humpton schwieg einen Augenblick und stieß dann wütend hervor: »Ja, weil du Idiot nichts verstehst.«
Wieder war es einen Augenblick still.
Da waren draußen im Hof Schritte zu hören.
Wyatt duckte sich eng in den Winkel der neuen Pferdebox.
Die Stalltür wurde geöffnet, und ein Mann kam herein.
»Ed!«
»Ja, Boß.«
»Wie sieht es aus mit den Gäulen. Sind sie gestriegelt?«
»Gleich fertig, Boß. Nur noch die Fuchsstute.«
»Wo ist Joe?«
Rasch entgegnete Humpton: »Der säubert die Geschirre.«
»Gut, dann findet euch drüben zum Futtermachen ein. Jim hat verdammt viel zu tun heute. Er braucht euch.«
»All right.«
Die Stalltür wurde wieder zugeschlagen.
Im Stall war es sekundenlang still.
Dann war Humptons Stimme zu hören.
»So, jetzt war der Boß da. Und du hast das Maul nicht aufgemacht. Es war dein Glück.«
»Wie konnte ich es aufmachen, wo du mich mit deinem Revolver bedrohst. Ich bin doch nicht lebensmüde.«
»Also bist du bereit?«
»Wozu?«
»Zu unserem Kampf.«
»Ich bin dazu gezwungen worden«, entgegnete Ferkas eisig.
»Ich rate dir gut, Joe. Mach keine Dummheiten. Du weißt, daß ich immer in deiner Nähe bin. Und – ich schieße sofort.«
»Ja, das traue ich dir zu.«
»Also, um acht Uhr bei den Flanagans.«
»Und, was soll dann passieren?«
»Es wird über alles beraten. Hinten in dem Hofzimmer, wo uns niemand stört. Und dann geht es los. Wir sind zwei Dutzend Leute.«
»Und? Glaubst du, das imponiert dem Marshal?«
Verächtlich entgegnete der ältere Peon: »Du darfst nicht vergessen, daß nicht alle Boys so feige sind wie du.«
»Ich bin nicht feige. Ich bin nur nicht wahnsinnig!«
»Los, mach dich an die Arbeit, daß die Geschirre sauber werden. Ich habe noch drei Gäule zu striegeln.«
Er hatte seinen Boß unbekümmert angelogen, wie er es immer tat, der einstige Hilfskeeper aus dem Occidental Saloon, der wegen Trunksucht von dem Salooner entlassen worden war. Der Trinker Humpton war übrigens schon aus drei Schenken Tombstones davongeschickt worden.
Da die beiden jetzt ihre Arbeit aufgenommen hatten, hielt es der Marshal für angebracht, den Stall zu verlassen.
Ungesehen kam er in den Hof und auf die Fremontstreet.
Sein Argwohn war also nicht unbegründet gewesen. Die Galgenmänner steckten auch in Tombstone.
Es war ein purer Zufall gewesen, daß er von der Rückseite des Liverystable O. K. Corral an dem Stall vorübergekommen war, wo er das graue Tuch gefunden hatte.
Also heute abend bei Flanagans.
Die unselige Familie Flanagan spielte also wieder eine Rolle wie eh und je. Damals, als die Clanton Gang noch das Land beherrschte, waren sie ständig an der Seite der Clantons und McLowerys zu finden. Jetzt, wo die Galgenmänner ihre Geißeln über Arizona schwangen, machten sie wieder von sich reden.
*
Ike Clanton hatte die Allenstreet passiert und ritt durch die Gasse, in der Rozy Gingers Bar lag. Der Rancher blickte weder rechts noch links, scherte sich nicht um die Leute, die gaffend stehenblieben, als sie ihn erkannten.
Unten am Rande der Miner Camps lenkte er nach Osten hinüber und hielt plötzlich seinen Rappen an.
Von der Gassenmündung aus sah er drüben vor Fleggers Bar das Pferd seines Vetters Jerry stehen.
Ike ritt auf die Schenke zu, glitt aus dem Sattel, warf die Zügelleinen über den Querholm und betrat den Vorbau.
Die Verblüffung, die die Leute im Schankraum von Fleggers Bar ergriff, als sie den Eintretenden erblickten, war unbeschreiblich.
Luke Short stand vorn an der Theke und maß den einstigen Desperado mit scharfem Blick.
Den beiden Frauen war ein Ausruf des Schreckens entfahren.
Doc Sommers hatte zusammen mit Doc Baxter den Verband angelegt. Sie waren eben damit beschäftigt, ihn zu verknoten.
Der größte Schreck jedoch stand im Gesicht Jerry Clantons.
Namenlose Verwunderung malte sich auf dem Gesicht des Ranchers.
Ike Clanton tippte an den Hutrand und machte zwei Schritte auf den Tisch zu.
Jetzt konnte er das Gesicht des Mannes erkennen, den man dort verband.
»Doc Holliday?« sagte er leise.
»Ja, Doc Holliday«, kam es von den Lippen des Sheriffs.
Ike warf den Kopf hoch und fixierte Jerry.
Sofort sah er, daß der entwaffnet war – und zog einen falschen Schluß.
Mit raschen Schritten ging er um den Tisch herum.
Klatsch! Klatsch!
Die beiden Ohrfeigen waren so gewaltig, daß sich der Bursche mehrmals um die eigene Achse drehte und genau dort wieder zu Boden glitt, wohin ihn Luke Short vor kurzem geschickt hatte.
Der Texaner rief: »Wahrscheinlich kann dem Burschen eine doppelte Tracht Prügel nichts schaden, aber an dieser Geschichte trägt er keine Schuld. Doc Holliday ist von einem anderen Schurken niedergeschossen worden.«
Der Rancher hatte das Wort ›anderer Schurke‹ sehr wohl herausgehört.
Er wandte den Blick wieder dem Spieler zu.
»Sehr schlimm?«
»Ja«, entgegnete der Texaner, »sehr schlimm.«
Ike biß die Lippen aufeinander. Dann gab er seinem Neffen einen Wink mit den Augen, die Schenke zu verlassen.
Jerry blickte den Sheriff an und sah dann zu seinem Revolver hinüber.
Luke nickte.
Da hob der Bursche seine Waffen auf und verließ mit eingezogenem Schädel die Schenke.
»Ich glaube, mit dem werden Sie noch eine ganze Portion Ärger bekommen«, sagte der Sheriff.
»Ja«, entgegnete Ike, »das Gefühl habe ich auch.« Er tippte wieder an den Hutrand und ging ebenfalls zur Tür. Da blieb er noch einmal stehen und drehte sich um. Seine Augen ruhten auf dem Körper des Spielers.
»Sie wissen nicht, wer es war, Sheriff?«
»Nein, noch nicht.«
Die Tür fiel hinter Ike Clanton zu.
Jerry saß schon auf seinem Pferd.
Ike trat an ihn heran und blieb neben ihm stehen.
»Hör zu, Junge, ich sage es dir jetzt zum letztenmal. Wir sind hier weder in Texas noch irgendwo in Kentucky. Du wirst dich anständig benehmen, verstehst du?«
»Ich bin ein Clanton! Und ich werde…«
»Eben, weil du ein Clanton bist«, unterbrach ihn der Rancher, »wirst du dich anständig benehmen. Und wenn du das nicht kannst, Jerry, dann wäre es besser für dich, wenn du nicht hierhergekommen wärst.«
Ike wandte sich um und zog sich in den Sattel.
»Vorwärts!«
»Wohin?« fragte der Bursche trotzig.
»Auf die Ranch. Wohin sonst?«
Der Brusche trabte los.
Ike ritt ein Stück hinter ihm her und blieb in der Mündung der Dritten Straße stehen. Er hatte soeben am anderen Ende einen Mann gesehen, der aus der Fremontstreet kam und langsam auf die Allenstreet zuhielt.
Ike nahm sein Pferd herum und ritt ihm entgegen.
Noch ehe der Marshal die Allenstreet von oben her erreicht hatte, hielt Ike vor ihm. Die beiden Männer blickten einander in die Augen.
»Wie ist das passiert mit dem Doc?« erkundigte sich Ike.
Wyatt zog die Brauen zusammen. »Mit dem Doc? Wovon sprechen Sie?«
Sollte er etwa gar nichts wissen? überlegte der Rancher.
»Doc Holliday ist doch niedergeschossen worden.«
Eine fahle Blässe überzog plötzlich das Gesicht des Missouriers. Er schluckte.
»Was ist passiert?« kam es heiser aus seiner Kehle.
Da rutschte der Rancher aus dem Sattel.
»Ich weiß auch nichts Näheres, Marshal. Vor ein paar Minuten sah ich vor Fleggers Bar den Gaul meines Vetters. Sie wissen ja, daß ich den Burschen suchte, und deshalb betrat ich die Schenke. Zuerst sah ich Luke Short und dann die Frauen und Doc Sommers und Doc Baxter. Doc Holliday lag auf dem Tisch. Ich glaube, sie haben ihm eine Kugel aus dem Rücken geholt. Ich vermutete schon, daß Jerry da etwas angestellt hätte, weil der Tex ihm die Revolver abgenommen hatte, und gab ihm ein paar Ohrfeigen. Aber Luke Short sagte mir, daß er nichts mit der Sache zu tun hätte.«
Das Gesicht des Marshals war plötzlich verändert. Es wirkte wie versteinert. Graphitgrau schien seine Haut geworden zu sein. Er hatte die Fäuste geballt. Aber völlig ruhig stand er da. Kein Muskel an ihm bewegte sich.
»Ist er – tot?«
»Nein«, entgegnete der Rancher, »das heißt, ich weiß es nicht.«
Wyatt nickte. »Thanks, Ike.« Er wollte weiter.
Da hielt der Rancher ihn mit der Linken auf.
»Tut mir leid, Wyatt.«
Wyatt nickte. »Schon gut.«
Er ging mit großen, federnden Schritten weiter.
Der Viehzüchter blickte ihm gedankenvoll nach.
Genau hatte er die Veränderung beobachtet, die im Gesicht des Marshals vor sich gegangen war.
So also wirkte es auf ihn, wenn der Freund getötet worden wäre.
Wehe dem Mann, der Doc Holliday einmal auf dem Gewissen haben würde. Ike zog sich in den Sattel und ritt langsam aus der Stadt.
Der Marshal betrat wenige Minuten später Fleggers Bar.
Nellie Cashman eilte ihm sofort entgegen. Als sie sein Gesicht sah, rief sie mit unterdrückter Stimme: »Er lebt, Wyatt.«
Der Marshal blickte über sie hinweg und sah in die Augen des Texaners.
Der nickte nur beruhigend.
Da trat der Marshal an den Tisch.
Doc Holliday lag noch auf dem Leib wie vorhin, mit dem Kopf auf einem Kissen. Sie hatten ihm das Hemd wieder heruntergezogen und die Jacke darüber gelegt.
Wyatt blickte Baxter an.
Der sagte leise: »Im zweiten Rippenbogen.«
Dann nahm er ein verformtes Metallstück von einem Teller und hielt es dem Marshal hin. »Doc Sommers hat es herausgeholt.«
Der winkte ab. »Hören Sie auf. Darauf kann ich nicht stolz sein. Ich wollte es nicht tun. Und ich hätte es auch nicht geschafft, wenn Mr. Baxter nicht die Vorarbeit geleistet hätte.«
»Sie wollten es alle beide nicht tun«, sagte der Texaner. »Ich mußte mit dem Revolver ein wenig nachhelfen. Tut mir leid, Gentlemen.«
Wyatt stand am Fußende und blickte auf den Körper des Spielers. Als er den Blick hob, sah er in die grünen, schillernden Augen von Laura Higgins. Er hatte sie bis jetzt noch gar nicht bemerkt.
»Was soll mit ihm werden?« fragte sie. Und anstatt die Ärzte anzusehen, blickte sie Wyatt Earp an.
»Wir müssen ihn ins Hotel bringen.«
»Ja«, meinte Nellie Cashman, »bei uns wird er gut gepflegt.«
Da meldete sich John Flegger, der bisher am Stirnende der Theke gestanden hatte.
»Ich habe einen leichten Wagen. Das würde wohl das beste sein.«
Eine Viertelstunde später lag Doc Holliday im Russianhotel in seinem Zimmer. Niedergeschlagen standen Wyatt Earp und Luke Short am Fußende des Bettes und blickten auf den Freund nieder.
Als die Frauen den Raum verlassen hatten, meinte der Texaner: »Eine schöne Schweinerei ist das. Eine ganz verdammte Sache. Aber das kann ich Ihnen sagen, Marshal. Wenn ich den Burschen kriege, dann zerdrücke ich ihn zwischen den Fingern meiner Hände…«
Da wurde die Tür wieder geöffnet, und Laura Higgins trat ein. Sie brachte auf einem Tablett eine Karaffe mit Wasser und auf einem kleinen Teller einen Riechstoff.
Dann zog sie einen der rotgepolsterten Stühle heran und ließ sich nieder.
Luke rieb sich das Kinn. »Sind Sie sicher, Madam, daß er Sie sehen will, wenn er zu sich kommt?«
Flammende Röte übergoß das Gesicht der Frau. Sofort stand sie auf und eilte auf die Tür zu, um hinauszugehen.
Der Marshal hielt sie auf. »Warten Sie, Miß Higgins. Mr. Short meinte es nicht so. Er ist ein bißchen rauh. Sie müssen sich nichts daraus machen. Bleiben Sie bitte.«
Der Texaner zog die Schultern hoch und schob ab.
Laura Higgins stand vor dem Marshal, den Kopf gesenkt.
Mit unsicherer Stimme fragte sie: »Sie meinen, ich sollte bleiben?«
»Natürlich, weshalb nicht? Ich glaube nicht, daß er etwas dagegen haben wird.«
Sie hob den Blick und sah ihn an.
Wie schön sie doch eigentlich ist, dachte Wyatt. Schade, daß sie eine so verbissene Spielerin ist. Vielleicht hätte sie das Herz des Doc doch gewinnen können, wenn sie sich weniger selbstsüchtig gegeben hätte.
Wyatt ging hinaus.
Luke Short stand am Ende des Korridors. »Ich werde ins Office gehen.«
»Ist gut, Luke.« Der Marshal blieb noch im Korridor sehen.
Um das, was in den nächsten Augenblicken geschah, verständlich zu machen, ist eine kurze Erklärung notwendig: das Russianhouse war in Form eines Hufeisens gebaut: Also ein großer Querflügel zur Straße hin und zwei Längsflügel. Allerdings waren auch die Längsflügel wieder geschlossen, und zwar durch eine hohe Fenz, in der sich ein Tor befand. Das Russianhouse bildete also so gesehen ein Quadrat mit einem großen Innenhof.
Zwar bot das große Grand Hotel oben in der Allenstreet mit seinen zwei Geschossen mehr Aufwand und Komfort, aber Nellie Cashmans Russianhouse stand ihm kaum nach. Die Zimmer waren groß, sauber und gepflegt, und das Essen, das in der großen Halle eingenommen wurde, war sicherlich nicht schlechter als oben im Grand Hotel, es unterschied sich wohl nur durch den niedrigeren Preis davon. In den Dezembertagen des Jahres 1883 befanden sich an den Enden der Seitenflügel je ein großes Fenster, durch das man von außen ohne weiteres die Gänge sehen konnte.
Erst nach den Ereignissen dieses Tages ließ die Hausbesitzerin die Fenster vernageln. Das hatte natürlich den Nachteil, daß die Gänge dunkel waren und infolgedessen auch tagsüber von vielen Kerosinlampen erleuchtet werden mußten.
Unten bei Fred Olbers, nicht sehr weit vom Russianhouse entfernt, arbeitete seit anderthalb Jahren ein siebenundzwanzigjähriger eingewanderter Bulgare: Osrodan. Niemand wußte genau, ob er wirklich so hieß. Seinen Vornamen kannte man nicht. Er wurde einfach Billy genannt. Billy Osrodan war von untersetzter Statur, schmal, mit hagerem Gesicht und langer, spitzer Nase, die fast bis zum Kinn hinunter lief. Seine Augen standen zu nahe bei der Nase, und er schien etwas zu schielen. Struppig und schwarz war sein kurzgeschorenes Haar. Er trug zumeist abgetragenes Tuchzeug, das ihm viel zu groß war. Waffen schien er nie bei sich zu haben. Nie hat jemand begriffen, was diesen Mann zu der Tat getrieben hat, die er an jenem Dezembertag ausführte.
Sein Weg wurde später genau verfolgt: Er hatte bis ein Uhr in der Sägemühle gearbeitet und war dann mit einer flüchtigen Entschuldigung beim Boß – hinaus in den Hof gegangen. Niemand hatte etwas dabei gefunden, da man mit seiner baldigen Rückkehr rechnete.
Osrodan mußte um die Hinterhöfe der beiden Häuser, die zwischen der Sägemühle und dem Vieh-Corral standen, herumgegangen sein. Wie er allerdings ungesehen an dem großen Corral vorbeigekommen ist, war schwer zu begreifen, da zu dieser Zeit drei Männer dort mit dem Abreißen schadhaft gewordener Latten beschäftigt waren.
Von diesem Corral aus zum Ostflügel des Russianhouses waren es noch über dreihundert Yards. Eine weite Strecke, auf der man ihn ebenfalls hätte sehen müssen. Aber niemand schien ihn gesehen zu haben.
Wyatt Earp stand etwa in der Mitte des Ganges, nicht ganz zehn Yard von dem Fenster entfernt, als plötzlich ein Schatten das Licht im Flur verdunkelte.
Wyatt drehte sich sofort um, sah den Mann und den auf ihn gerichteten Revolver.
Aber es war ein Doppelschuß, der aufblitzte.
Die Kugel des Bulgaren streifte die linke Wange des Marshals und hinterließ eine blutige Spur.
Wyatt zog, und die Kugel stieß den Mann zurück.
Der Marshal war indessen vorsichtig genug, nicht sofort auf das Fenster zuzustürmen, um hinauszuspringen. Denn es war ja, nach dem, was er vor einer Dreiviertelstunde im Liverystable des O. K. Corrals gehört hatte, nicht ausgeschlossen, daß draußen noch weitere Heckenschützen auf ihn lauerten.
Die Eingangstür flog auf, und die riesige Gestalt des Texaners erschien in der Halle.
»Wyatt!« brüllte er, als er den Marshal links in einer Türnische am Boden knien sah.
Der Marshal hatte den Revolver in der Faust.
»Hinten am Fenster!« rief der Missourier dem Freund zu.
Luke Short nickte und verschwand sogleich wieder durch die Tür.
Er rannte um die längere Ecke des Hauses herum, doch als er die Südfront erreicht hatte, versperrte ihm das etwas offenstehende Tor den Blick auf die Seite, an der das Flurfenster lag.
Langsam entfernte sich der Tex vom Haus.
Nichts! Der Platz vor dem Fenster war leer. Luke sah die zertrümmerten Scheiben und gleich darauf sah er auch den Marshal am Fenster erscheinen. Er schüttelte den Kopf.
Da sprang Wyatt durch das Fenster und lief um die Ostecke des Hauses herum. Auch hier war nichts zu sehen.
Allerdings zog sich etwa in der Mitte des Hauses eine lange, jetzt aber völlig kahle Tecarillahecke unter den Fenstern entlang.
Es war fast ausgeschlossen, daß sich dort ein Mensch verbergen konnte.
Wyatt lief mit blutendem Gesicht an der Hausfront entlang vorwärts und durchstöberte die Hecke.
Da waren Schritte hinter ihm.
Er wandte sich um.
Es war der Texaner.
»He, hat er sich in Luft aufgelöst?«
»Keine Ahnung.«
Die beiden liefen jetzt in entgegengesetzter Richtung um das ganze Anwesen herum und trafen oben an der Nordwestecke wieder aufeinander.
»Nichts?« fragte der Marshal.
Der Texaner zog die Schultern hoch. »Nein, nichts.«
Während Wyatt auf den Eingang zuging, sagte er halblaut: »Es ist sicher am besten, wenn Sie jetzt ins Office gehen und dort Wache halten.«
Der Tex nickte und schlenderte davon, so, als habe er die Absicht, in die Allenstreet hinaufzugehen.
Wyatt Earp stieß hinterm Eingang auf den Diener Sam.
»Mr. Earp! Sie sind verletzt, um Himmels willen!«
Aus dem Kontor kam Nellie Cashman. Als sie das Blut im Gesicht des Missouriers sah, stieß sie einen Schrei aus und hielt sich an der Tür fest.
»Es ist nicht schlimm«, beruhigte Wyatt sie – und ging mit raschen Schritten auf Doc Hollidays Zimmer zu. Als er die Tür öffnete, sah er in einen fast dunklen Raum.
Die Fensterläden waren zugezogen. Im schwachen Licht, das durch zwei Ritzen fiel, sah er die Gestalt der Frau neben dem Bett des Verwundeten.
»Alles in Ordnung?« fragte Wyatt.
»Ja, Mr. Earp«, entgegnete Laura Higgins.
»Gut.«
Er wollte sich umwenden. Doch jetzt, als er in der Tür stand, sah auch sie das Blut in seinem Gesicht.
»Sie sind ja verwundet.« Rasch kam sie auf ihn zu.
»Nicht so wichtig.«
»Wer hat geschossen?«
»Das weiß ich nicht.«
»Um Himmels willen!« flüsterte sie. »Das ist ja schrecklich.«
In plötzlich aufsteigender Furcht griff sie sich an die Kehle. »Man hat es auf ihn abgesehen. Auf Doc Holliday. Ich weiß es. Der Mann, der ihn heute morgen in den Rücken geschossen hat, weiß, daß er noch nicht tot ist. Er muß es erfahren haben. Und das war ja auch nicht schwer.« Plötzlich wandte sie den Kopf und starrte den Marshal an. Ein Name brach über ihre Lippen: »Ike Clanton!«
Wyatt blickte sie verblüfft an. »Ike?«
»Ja, er muß es gewesen sein. Er, und kein anderer. Schon in dem Augenblick, als er die Schenke betrat, glaubte ich es.«
»Aber wie wollen Sie das beweisen.«
»Beweisen? Ist es notwendig, das zu beweisen? Er muß es gewesen sein. Wie kam er so plötzlich in die Schenke?«
»Er hat seinen Vetter gesucht.«
»Seinen Vetter«, entgegnete sie höhnisch. »Das ist eine gute Ausrede. Wie kam der Vetter in die Schenke?«
»Das weiß ich natürlich auch nicht. Wahrscheinlich war es der erste Whiskystall auf seinem Weg in die Stadt.«
»Ja, auch das ist eine gute Ausrede. Nein, Mr. Earp. Das können Sie mir nicht einreden. Ich bin eine Frau und habe ein besonderes Gefühl für diese Dinge. Als Ike den Schankraum betrat, wußte ich sofort, daß er es gewesen sein muß. Am liebsten hätte ich meinen Derringer aus der Handtasche gerissen und ihn erschossen!«
Wyatt entgegnete ruhig: »Sie müssen froh sein, daß Sie es nicht getan haben, Miß Higgins, denn dann wären Sie eine Mörderin gewesen. Und ganz sicher würden Sie kaum den Abend erlebt haben… Die Anhänger Ikes hätten Sie gelyncht, noch ehe der Richter Sie zum Galgen verurteilt hätte.«
»Wie können Sie so sprechen?« entgegnete sie keuchend. »Sie wissen so gut wie ich, wer er ist.«
»Wer ist er denn?«
Laura Higgins preßte die Lippen hart aufeinander und schluckte die Antwort hinunter.
»Vielleicht wissen Sie mehr als ich«, versuchte der Marshal sie zu ermuntern. Immerhin hielt er es für nicht ausgeschlossen, daß die Spielerin, die oft bis tief in die Nacht im Crystal Palace zwischen den Menschen saß, etwas erfahren haben konnte, das er nicht wußte.
»Reden Sie nur, Miß Higgins. Ich finde sogar, daß es Ihre Pflicht ist, zu reden.«
»Ich habe nichts zu sagen.« Sie wollte sich umwenden und in den dunklen Raum zurückkehren, blieb aber stehen und sagte leise: »Er ist der Boß der Galgenmänner.«
Wyatt ergriff sie am Arm und zog sie zu sich heran. Ganz dicht war jetzt sein gesenkter Kopf vor ihrem Gesicht.
»Wie kommen Sie zu dieser Behauptung?« fragte er leise.
»Ich weiß es!« zischelte sie ihm entgegen.
»Woher?«
»Weil ich es fühle.«
Der Marshal nahm seine Hand von ihrem Arm. Ein bitteres Lächeln zuckte um seine Lippen.
»Von dem Gefühl einer Frau wird ein Richter wenig Notiz nehmen, Laura Higgins.«
Jetzt wollte er sich umwenden. Da spannte sie beide Hände um seine Oberarme. »Mr. Earp, jetzt werde ich Ihnen etwas sagen. Sie müssen blind sein, wenn Sie nicht sehen, was sich hier tut. Die ganze Stadt hängt noch an ihm, an Clanton. Das ganze County. Ja, ich bin überzeugt, daß ganz Arizona an ihm hängt. In fanatischer, blinder Treue. Er ist der große Mann von Arizona. Irgend jemanden müssen sie haben, den sie verehren, diese Dummköpfe hier. Dieses zusammengewürfelte Pack, das aus den großen Städten ausgewandert ist, weil man es da nicht brauchen konnte. Was sind es denn für Menschen, die sich hier in Tombstone angesammelt haben. Verkrachte Existenzen, Banditen! Leute, die zum Abschaum der Gesellschaft gehören.«
»Pardon, Madam, auch Sie halten sich in Tombstone auf«, sagte der Marshal kühl.
Sie ließ ihre Hände sinken. »Ja, auch ich halte mich in Tombstone auf. Aber nicht, weil ich hier leben will, sondern weil ich…« Sie senkte den Kopf und sagte leise: »Weil ich auf ihn warte.«
»Es steht mir vielleicht nicht zu, Madam. Aber ich glaube, da warten Sie vergebens.«
Als sie jetzt den Kopf hob, brannte in ihren Augen ein kaltes Feuer. »Es ist gut möglich, daß es so ist, Wyatt Earp. Und wenn es so ist, dann weiß ich auch weshalb… Es ist nicht seine Krankheit, die ihn davon abhält, ein vernünftiges Leben zu leben. Ein Leben, wie es einem Menschen wie ihm zukäme. Sie – Sie verschulden die Rastlosigkeit, die von ihm Besitz ergriffen hat. Sie haben einen anderen Menschen aus ihm gemacht. Wie Ahasver reitet er durch das Land – schießend, kämpfend, dem großen Wyatt Earp den Rücken freihaltend. Ich hasse Sie, Wyatt Earp! Sie haben einen guten, wertvollen Menschen zu einem Werkzeug Ihres Berufes gemacht. Schleppen Sie doch einen dummen Deputy mit sich herum! Es gibt doch genug davon. Sie brauchen ja nicht einmal einen Dummkopf zu nehmen. Es gibt ja genug Leute, die für dieses Handwerk taugen. Warum nehmen Sie nicht den prächtigen Bat Masterson mit? Oder Bill Tilgham, Bob Neels oder sonst irgend jemanden. Warum muß es Doc Holliday sein! Ich weiß ja, daß es Ihre Lebensaufgabe ist, für das Gesetz zu kämpfen, daß Sie durch das Land reiten müssen, um Banditen zu jagen. Und wenn der Staat Ihnen schon einen Hungerlohn dafür zahlt, dann sollten Sie wenigstens Ehre genug im Leibe haben, Doc Holliday nicht auch noch mit sich herumzuschleppen. Ich weiß, daß Sie beide oft genug darben und hungern, nur um irgendeinen Verbrecher zur Strecke zu bringen. Er könnte ein besseres Leben führen. Er ist ein gebildeter Mann. Weshalb müssen Sie ihn mit sich herumschleppen. Bob Neels oder der junge Cornelly können Ihnen den Rücken ebensogut freihalten. Warum soll es Doc Holliday sein? Was haben Sie davon, daß er hinter Ihnen her reitet mit seinen beiden Revolvern. Ich an Ihrer Stelle würde darauf verzichten. Ich würde mich überhaupt schämen. Ich…« Jäh brach sie ab und preßte beide Hände vor den Mund, wich einen Schritt zurück und prallte gegen den Türrahmen.
Wyatt Earp blickte sie durchdringend an. »Reden Sie nur weiter, Miß Higgins.«
Sie nahm die Hände herunter und keuchte: »Nein, pardon, es tut mir leid, Mr. Earp. Ich habe es nicht so gemeint. Ich… ich weiß es ja, daß Sie ein schweres Leben haben, und wie ich schon sagte. Ich weiß es ja auch, daß Sie ein Lumpengeld für diesen schweren Job bekommen. Und…, aber weshalb muß er mit Ihnen reiten? Er ist doch nicht gesund…, vielleicht hat er nur noch ein paar Jahre zu leben.«
Wyatt senkte den Kopf und wandte sich ab.
Sie hatte ja recht. Ganz sicher hatte er nur noch ein paar Jahre zu leben. Vielleicht nur noch Monate. Wer konnte das wissen. Die Krankheit war schon so schlimm zum Ausbruch gekommen, daß Wyatt gefürchtet hatte, der Georgier würde den nächsten Tag nicht erleben. Aber immer wieder hatte sich die eiserne, starke Natur des einstigen Bostoner Arztes durchgerungen und dem Leben wiedergegeben.
Ja, warum ließ er ihn mit sich reiten. Wie konnte er von dem gebildeten, hochintelligenten Mann verlangen, daß er Tag um Tag, Woche um Woche, Monat um Monat, ja – Jahr für Jahr mit ihm durch den Westen streifte.
Laura Higgins hatte längst eingesehen, daß sie mehr gesagt hatte, als sie hätte sagen dürfen.
Behutsam legte sie ihre Hände auf den Arm des Marshals.
»Mr. Earp! Es tut mir leid, sehr leid. Ich wollte Sie nicht kränken. Es ist nur…« Plötzlich schluchzte sie leise, »weil ich ihn liebe.«
Der Missourier wußte, daß die schöne Spielerin den eleganten Doktor Holliday liebte. Er wußte es seit langem. Und er hätte ihm, dem Freund, doch jedes Glück gegönnt.
Hatte er vielleicht nicht tief und lange genug darüber nachgedacht, welch ein Unding es war, daß er Holliday mit sich reiten ließ. Daß er ihm all die unendlichen Strapazen, die Kämpfe und Scheußlichkeiten zumutete, die er selbst durchstand?
Doch, er hatte mehrmals mit Holliday darüber gesprochen. Und immer hatte der Spieler abgewinkt. Es war ja sein freier Entschluß gewesen, der ihn immer Sattel an Sattel mit Wyatt geführt hatte.
Kurz bevor sie nach Tombstone kamen, hatte der Georgier noch gesagt, wie schön es doch wohl jetzt oben in Dodge wäre, in der Frontstreet, wo sich die Kinder des Inhabers des großen Dodge Hotels auf Weihnachten freuten, wo die Alten in den Zimmern hinter den Öfen saßen und aus Holz Spielzeug schnitzten, das dann mit bunten Farben bemalt wurde, um dann unterm Lichterbaum zu stehen, den die Deutsche Kolonie in Kansas seit einigen Jahren eingeführt hatte und der einen so heimeligen Glanz in die weihnachtlichen Abende brachte.
Sicher, es war kalt oben in Dodge City, in ganz Kansas war es kalt. Und er, der Georgier, liebte die Kälte nicht allzusehr. Aber hier unten in Tombstone hätte er nicht begraben sein mögen. Wyatt war das Gefühl nicht losgeworden, daß der Gambler diese Stadt hatte meiden wollen.
Hatte er gespürt, was ihn hier erwartete? Sie hatten sich heute morgen noch nicht gesehen.
Als Wyatt in der Halle erschien und auf den Tisch zuging, an dem meistens für ihn, Doc Holliday und Luke Short gedeckt war, sah er, daß der Georgier schon gefrühstückt haben mußte. Das heißt, seine Kaffeetasse war benutzt, sein Messer und das Holz war benutzt, gegessen hatte er, wie so oft, nichts.
Wo war er hingegangen.
Wie mochte er in Fleggers Bar gekommen sein?
Und warum hatte er die Schenke aufgesucht? Wyatt wußte zwar, daß er ab und zu einmal zu Flegger gegangen war, um einen Brandy zu trinken, aber nun schon sehr lange nicht mehr dort gewesen war. Das zunehmend schlecher werdende Publikum der Schenke hatte ihn schließlich ganz von dort ferngehalten.
Was hatte er heute vormittag da gesucht?
War er vielleicht dem, was sich hier in der Stadt anbahnte, auf die Spur gekommen? Wußte er, wer der Mann war, der ihn dann in den Rücken geschossen hatte? Wußte er vielleicht schon von der Verschwörung der Graugesichter in Tombstone? Wußte er, daß sich der Ring um den lästigen Police Officer enger und enger schloß zu einem eisernen Würgegriff, der die Earps ein für allemal von der Bildfläche verschwinden lassen sollte?
Wie aus weiter Ferne hörte der Missourier Laura Higgins’ Stimme.
»Es tut mir wirklich leid, Mr. Earp. Bitte, verzeihen Sie mir.«
Er nickte müde. »Ja, ja, es ist schon gut.«
Sie preßte ein blütenweißes Taschentuch auf die immer noch blutende Wunde in seinem Gesicht.
Er wandte sich ab und ging langsam den Gang entlang in die Halle.
Gleich neben der Ecke am Kamin stand die dunkle Gestalt einer anderen Frau. Nellie Cashman. Sie blickte dem Mann nach, der jetzt zum Eingang schritt.
Als der Missourier die Tür öffnete und das fahle Licht der Dezembermittagssonne auf seine Gestalt fiel, bohrte sich ein brennender Schmerz in die Brust Nellie Cashmans.
»Wyatt.« Fast lautlos kam es über ihre Lippen.
Der Mann in der Tür war stehengeblieben.
Langsam wandte er sich um und blickte durch die Halle zu der Frau hinüber, die neben dem Kamin lehnte.
Ohne die Tür zu schließen, kam er langsam zurück und blieb vor ihr stehen.
Die Gedanken schossen durch den Kopf der Frau wirr hin und her. Sie wußte genau, daß sie jetzt nichts Falsches sagen durfte.
»Sie haben den Mann nicht gefunden?« fragte sie leise.
Der Marshal schüttelte den Kopf.
»Vielleicht ist er drüben zu Cramers hinübergelaufen.«
»Nein, das ist nicht gut möglich. Dazu hätte er an dem Corral vorbeirennen müssen, da hätte ihn Luke Short gesehen.«
Die Frau schwieg. Und der Mann schwieg auch.
Mit einer nervösen Geste griff Nellie Cashman nach dem Schlüssel eines gläsernen Wandschranks, öffnete die kleine Tür und nahm einen Zinkbecher mit Zigarren heraus.
Es waren lange schwarzbraune Virginias mit einem Strohhalm, wie man sie in Tombstone mit Vorliebe rauchte.
»Bitte«, sagte sie leise.
Der Marshal schüttelte den Kopf. »Nein, danke, jetzt nicht.« Und wie zu sich selbst sagte er: »Ich habe ihn getroffen. Die Kugel hat ihn herumgestoßen. Sie muß ihn oben links in der Schulter erwischt haben.«
»Wo kann er denn geblieben sein?«
»Das weiß ich ja eben nicht.« Nellie Cashman griff sich an die Kehle wie vorhin Laura Higgins.
Auch sie wurde in diesem Moment von jenem unheimlichen Gefühl beschlichen, das wie ein Gespenst nach ihnen allen griff.
Und jetzt sagte die Frau, die immer beteuert hatte, dieses Land und diese Stadt zu lieben: »Es ist eine furchtbare Stadt, dieses Tombstone.«
Wyatt blickte auf und sah ihr in die Augen.
Die Frau erschauerte unter dem Blick.
»Das sollten Sie nicht sagen, Nellie Cashman.«
Am liebsten hätte sie jetzt seine Hand ergriffen, um ihm das zu sagen, was sie ihm wirklich gern gesagt hätte. Aber es fehlte ihr an Mut dazu. Sie hatte nicht einmal so viel Mut wie die Spielerin, die ihm ihr Taschentuch auf die blutende Wunde gepreßt hatte. Nellie Cashman hatte es hier vom Kamin aus beobachtet, und ein schmerzendes Gefühl von Eifersucht war jäh in ihr aufgestiegen.
Da wandte sich der Mann um und ging mit seinem harten, unverkennbaren Schritt, sie hätte ihn aus Tausenden von Schritten mit geschlossenen Augen herausgekannt, auf den Eingang zu und schloß die Tür hinter sich.
*
Osrodan war schwer an der linken Schulter getroffen worden. Die Kugel saß noch in seinem Körper.
Er war zurückgeflogen und in einem Wirbel über die Wand am Fenster geprallt. Nur für den Bruchteil einer Sekunde blieb er dort stehen. Dann raffte er, in plötzlich aufsteigender, tödlicher Angst, all seinen Mut zusammen, rannte um die Hausecke und sah das erste Fenster an der Linksfront des Hotels offenstehen. Es war nicht sehr schwer, es vom Boden aus im Sprung zu erreichen. Er zog sich hoch und jumpte über die Fensterbank in das Zimmer. Sofort schloß er das Fenster wieder und duckte sich unter der Bank nieder.
Kurz darauf hörte er die Schritte der Männer. Doch keiner der beiden kam auf den Gedanken, daß der Heckenschütze die Stirn gehabt hatte, in eines der Zimmer zu steigen.
Da kauerte er tief am Boden und lauschte mit schalgenden Pulsen hinaus. Die Kugel oben in seiner Schulter schmerzte ihn fürchterlich.
Er mußte einen Arzt aufsuchen, der ihm die Kugel herausschnitt.
Aber es war taghell. Unmöglich, jetzt aus dem Fenster zu steigen, um vom Russianhouse wegzukommen.
Verzweifelt überlegte der Heckenschütze, was er tun könnte.
Wenn er jetzt aus dem Fenster stieg und versuchte, die andere Straßenseite zu erreichen, so sah man ihn von allen Seiten. Zudem war die gegenüberliegende Straßenfront auch nur lückenhaft bebaut.
Vorhin, als er kam, hatte sich wohl niemand für ihn interessiert. Aber jetzt, nachdem der Schuß gefallen war, hielt man in der Nachbarschaft bestimmt die Augen sperrangelweit auf.
Osrodan war vor sieben Monaten von einem Trader, einem vierzigjährigen Mann, den er abends in der Schenke kennengelernt hatte, für die Galgenmänner gewonnen worden.
Anfangs war der verstockte, ziemlich verschlossene Mensch wenig begeistert von der Bande gewesen. Aber das hatte sich mit der Zeit gegeben. Vor allem, nachdem er einmal versucht hatte, sich zu weigern, einen Auftrag auszuführen. Da hatte ihn der Anführer, der hier in Tombstone bestimmte, eigenhändig niedergeschlagen und ihn dann mit vorgehaltenem Revolver aufgefordert, zu schwören, daß er für die Graugesichter leben wolle.
Von diesem Tag an war Osrodan so eingeschüchtert, daß er es nicht mehr wagte, Widerstand zu leisten.
Dennoch war er kein sehr rühriges Mitglied der Bande geworden.
Am vergangenen Abend war bei den Flanagans eine Versammlung gewesen, bei der der Anführer von jedem Mitglied den Tod der Earps gefordert hatte.
Ja, es hatte geheißen: Tod den Earps!
Aber ›die Earps‹ gab es ja in diesem Sinne gar nicht mehr. Virgil Earp war nicht mehr in der Stadt, und Morgan war erschossen worden. Nur der Marshal Wyatt Earp war da.
Damals waren es die Clantons, die er gestört hatte, und jetzt waren es die Galgenmänner.
Tod den Earps! So lautete die Parole. Jeder hatte die Pflicht, dieser Parole nachzukommmen, wenn ihm das Leben lieb war.
Vor etwas mehr als einer Stunde hatte Osrodan zufällig beim Aufladen eines Wagens vorn vor dem Tor auf der Straße gesehen, daß Wyatt Earp das Russianhouse wieder betreten hatte.
In diesem Augenblick beschloß der Galgenmann zu handeln. Es war weniger der eigene Antrieb oder Haß auf den Marshal, als die Angst vor den anderen und dem Boß. Wie würde er dastehen, wenn er sagen könnte: Ich habe Wyatt Earp ausgelöscht.
Sehr lange und tief hatte er nicht darüber nachgedacht. Ganz plötzlich war er mitten aus der Werkstatt verschwunden, an den beiden Höfen vorbeigelaufen, hatte den Corral passiert und war ungesehen an die Rückfront des Russianhouses gekommen, wo er den Marshal sofort im Korridor hatte stehen sehen.
Ohne Besinnen hatte er den Revolver gezogen und geschossen.
Wie ein Blitzschlag hatte ihn fast im gleichen Augenblick die Kugel des Missouriers getroffen.
In der Verzweiflung hatte der Galgenmann den füchsischen Mut aufgebracht, durch eines der Fenster zu kriechen und hier – im Haus selbst – Unterschlupf zu suchen. Aber jetzt? Was sollte jetzt geschehen? Er war in diesem Bau gefangen. Es war doch so gut wie ausgeschlossen, ihn bei Tageslicht zu verlassen.
Aber bis zur Dunkelheit konnte er nicht warten. Die Kugel in seiner Schulter brannte wie Feuer.
Zu der Angst vor den Verfolgern gesellte sich jetzt die Angst um sein Leben.
Das kleine Metallstück in seiner Schulter ließ ihn vor Verzweiflung aufheulen.
Aber sofort preßte er sich die Rechte vor den Mund und schwieg.
Nach einer halben Stunde war er zu der Erkenntnis gekommen, daß es ausgeschlossen war, das Zimmer durch das Fenster zu verlassen.
Er mußte den Weg wählen, der ihm die größte Deckung gewährte. Und zwar den Weg mitten durch das Russianhouse zum Ausgang.
Wenn er das nämlich schaffte, den Ausgang zu erreichen, hatte er es nicht mehr weit zu der Gasse hinauf, die zur Allenstreet führte.
Und dahin mußte er. In der Allenstreet wohnte Doc Sommers.
Es war nicht notwendig, ganz bis zur Hauptstraße hinaufzulaufen. Er konnte ja vorher in die kleine Parallelgasse abbiegen und durch den Hof in das Haus des Doktors kommen.
Der Gedanke war fast so wahnwitzig wie der, den er vor einer Stunde drüben in der Werkstatt gehabt hatte, als er beschloß, das Russianhouse anzuschleichen, um den Marshal zu erschießen.
Aber Billy Osrodan spürte, daß er keine andere Chance hatte. Er mußte handeln.
Vorsichtig erhob er sich und schlich zur Tür.
Der Schlüssel, das hatte er vorhin schon gesehen, steckte von innen. Hinaus konnte er also auf jeden Fall. Er versuchte die Tür zu öffnen. Sie war nicht verschlossen.
Behutsam zog er sie einen Spaltbreit auf und lugte hinaus. Im Gang war alles still. Kein Mensch weit und breit zu sehen.
Er befand sich im letzten Zimmer des Korridors.
Links lagen Scherben des zerschlagenen Fensters. Es hatte noch niemand Zeit gefunden, die Glasreste aufzusammeln.
Osrodan verließ das Zimmer und machte einige Schritte, als er oben von der Halle her Schritte hörte. Er wollte zurück.
Zu spät.
Er drängte sich in eine Türnische und lauschte mit angehaltenem Atem. Aber das Dröhnen des eigenen Pulsschlages ließ ihn nichts hören. Er schob den Kopf ein wenig vor und sah einen Mann den Gang herunterkommen. Verzweifelt tastete er mit der rechten Hand nach dem Türgriff und betätigte ihn.
Die Tür hinter ihm öffnete sich. Er blickte in ein dunkles Zimmer und huschte hinein.
Ein unterdrückter Schrei drang an sein Ohr.
Sofort hatte er den Revolver in der Hand.
Als sich seine Augen an die Dunkelheit, die hier in dem Zimmer herrschte, gewöhnt hatten, sah er drüben neben dem Bett einen Menschen stehen.
Eine Frau!
Es war Laura Higgins! Osrodan war in das Zimmer des verwundeten Doc Holliday geraten.
Der Bandit war nicht weniger erschrocken als die Frau.
»Wagen Sie es nicht, einen Laut von sich zu geben, ich knalle Sie sonst nieder, verstehen Sie«, stieß er in gebrochenem Englisch hervor.
Da wurde draußen an die Tür geklopft.
Osrodan wich auf Zehenspitzen zur Seite.
Leise spannte er den Hahn seines Revolvers.
»Fragen Sie, wer da ist«, flüsterte er.
Laura Higgins schluckte vor Zorn und Verzweiflung und fragte dann mit belegter Stimme: »Ja?«
»Ich bin es, Madam, Sam. Ich soll nur fragen, ob alles in Ordnung ist.«
Es blieb einen Augenblick still.
Osrodan krampfte seine schweißnasse Hand um den Revolverknauf und hob die Waffe an.
So dunkel es im Zimmer war – Laura Higgins sah den Lauf des Revolvers blinken.
»Es ist alles in Ordnung, Sam«, sagte sie halblaut.
»Gut, ich komme nachher noch einmal wieder.«
Man hörte, wie sich die Schritte des Schwarzen draußen entfernten.
Osrodan entspannte den Revolver und wischte sich mit dem Jackenärmel über die Stirn.
Sein Hemd klebte ihm am Körper, und seine Knie schlotterten.
Laura Higgins hatte die Rechte nach ihrem Handtäschchen ausgestreckt.
Der Bulgare hatte es nicht bemerkt.
Langsam öffneten die Finger der Frau den Verschluß und tasteten nach dem kleinen Derringer Revolver.
Vorsichtig zog sie ihn heraus und hob ihn langsam an.
Dann ging sie vorwärts.
Osrodan konnte nicht sehen, daß sie eine Waffe in der Hand hatte, da die Fensterritzen im Rücken der Frau waren.
»Bleiben Sie stehen!« hechelte er.
Laura Higgins hatte den Revolver in der rechten Hand.
»Was wollen Sie?« fragte sie.
»Ich – ich bin verletzt worden. Ich – Sie sollen zurückgehen. Stellen Sie sich drüben neben das Bett. Ich knalle Sie sonst nieder.«
Mit eiskalter Stimme entgegnete die Spielerin: »Dazu ist es zu spät, Mister.«
»Was fällt Ihnen…«
Klick! Die Frau hatte den Revolverhahn gespannt.
»Gehen Sie zur Tür und öffnen Sie sie!« befahl sie.
»Nein, das werde ich nicht tun. Ich habe nichts zu verlieren. Ich habe vorhin auf Wyatt Earp geschossen. Wahrscheinlich habe ich ihn getötet. Ganz sicher wird mich Doc Holliday zusammen mit dem Sheriff suchen. Und ich habe nichts zu verlieren. Merken Sie sich das!«
»Sie können mich nicht beeindrucken«, entgegnete die Spielerin gelassen. »Wenn Sie nicht gehorchen, schieße ich Sie hier im Zimmer nieder. Ich befinde mich in Notwehr.«
»Was wollen Sie denn?« krächzte der Mann. »Ich gehe ja schon.«
Er lief zur Tür, nahm den Schlüssel heraus und steckte ihn von draußen ins Schloß, aber abschließen konnte er nicht mehr. Er hatte es zu eilig.
Mit weiten Schritten tastete er den Gang hinauf zur Halle und hatte diese noch nicht ganz erreicht, als der Ruf der Spielerin hinter ihm hergellte: »Halt!«
Aber Osrodan hatte bereits den Eingang erreicht, stieß ihn auf und flüchtete mit weiten Schritten über den Vorplatz des Hotels auf die enge Gasse zu, die auf die Mainstreet führte.
Wie der Blitz war er auf dem Trampelpfad zwischen den Höfen verschwunden.
Er rannte in den Hof hinein, es war der fünfte, und sah sich einem alten Mann gegenüber, der Holz spaltete.
»Wohnt hier der Arzt?«
»Nein.«
Also im vierten Haus. Osrodan lief zurück und kam in den sauber aufgeräumten Hof des Arztes.
Die Hoftür stand offen. Er ging in den Korridor und fand auch die Tür zum Behandlungszimmer offen.
Vor einigen Monaten war er einmal hiergewesen, als er sich mit der Säge in die Hand geschnitten hatte.
Das Behandlungszimmer war leer.
Osrodan trat ein und blickte auf die weißgestrichene Tür, die zum Zimmer des Doktors führte. Er öffnete sie.
Sommers saß an seinem Schreibtisch und blickte jetzt verblüfft auf.
»Sie?«
»Ja, ich, Doktor. Sie müssen mir helfen! Ich habe eine Verletzung am Arm.«
»Bei euch unten in der Mühle scheint ja auch der Teufel los zu sein. Kommen Sie sofort her.« Er setzte sich auf einen Stuhl, und der Arzt öffnete ihm die Jacke und das Hemd. Dann starrte er auf die Wunde oben am Arm. Zwei Schritt wich er zurück.
»Das ist ja – eine Schußverletzung.«
»Ja, eine Schußverletzung.«
»Ist die Kugel etwa noch drin?«
»Ja, sie steckt noch drin!« herrschte der Bulgare den Arzt an. »Holen Sie sie heraus.«
Die Backenmuskeln des Arztes arbeiteten heftig.
»Herausholen. Ja.« Er rieb die Finger seiner Linken am Daumen nevös hin und her. »Wo haben Sie sich die Kugel eingefangen?«
»Das spielt keine Rolle. Holen Sie sie heraus.«
Der Arzt wandte sich um. »Ja, das werde ich wohl.«
»Das möchte ich Ihnen auch geraten haben.« Osrodan hatte plötzlich einen Revolver in der Hand.
Der Doktor blickte auf die Waffe und zog die Brauen finster zusammen. »Was soll das heißen? Wollen Sie mich bedrohen? Sind Sie wahnsinnig! Nehmen Sie den Revolver weg!«
Osrodan senkte die Waffe.
Sommers machte sich ohne Hast an die Arbeit.
Wie anders ging er doch zu Werke als vorhin unten in Fleggers Bar.
Er schob dem Bulgaren ein Lederstück zwischen die Zähne und knurrte: »Beißen Sie darauf.«
Dann nahm er ihm die Waffe aus der Hand und legte sie auf den Tisch.
Sofort zuckte seine Pinzette in der Wunde.
Osrodan schrie auf und ließ das Leder fallen.
Sommers hob es auf und tauchte es in eine Schüssel mit Wasser. Dann hielt er es ihm wieder hin.
»Los, beißen Sie drauf!«
Wieder zuckte die Pinzette in die Wunde.
Osrodan stöhnte vor Schmerz.
Dann hatte der Arzt das Geschoß und ließ es in eine Schale fallen.
Der Galgenmann war nahe daran, das Bewußtsein zu verlieren. Er erhob sich torkelnd, sank auf einen Hocker nieder und riß sich wieder hoch.
»Bleiben Sie da sitzen, Mann. Sie kippen ja noch um.«
»Nein, nein, ich muß weg.«
»Sind Sie verrückt! Ich muß erst einen Verband anlegen.«
»Nein, nein, ich muß weg!«
»Sie bleiben hier!«
Osrodan machte zwei Schritte auf die Tür zu und knickte dann zusammen.
Er war ohnmächtig geworden.
Der Arzt hob ihn auf und legte ihn auf den Behandlungstisch.
Sorgfältig reinigte und verband er die Wunde.
Osrodan war noch ohne Bewußtsein. Aus einer linken Tasche sah ein Tuchzipfel hervor.
Ein grauer Tuchzipfel!
Der Arzt griff danach und zog daran.
Ein großes, dreieckiges Gesichtstuch!
Das Tuch der Galgenmänner!
Sommers kannte es genau. Er nahm den Revolver und das Tuch und verließ den Raum.
Seine Schwester stand im Hausflur.
»Wo willst du hin?«
»Warte einen Augenblick. Ich komme gleich zurück.«
Er verließ das Haus und überquerte die Straße.
Luke Short stand drüben in der Tür.
Doc Sommers trat, von Luke Short gefolgt, ein, legte beide Gegenstände auf den Tisch und sagte:
»Drüben liegt ein Mann mit einer Schußverletzung. Er hatte den Revolver in der Hand, als er kam, und das Tuch in der Tasche.«
»All right«, entgegnete der Texaner und ging mit dem Arzt zurück.
Als sie in den Behandlungsraum kamen, war Billy Osrodan verschwunden.
Luke Short stürmte sofort in den Hof und weiter in die Quergasse.
Nichts!
»Damned! Hat der Kerl vielleicht das Talent, sich unsichtbar zu machen!« preßte der Riese zwischen den Zähnen hervor. »Na warte, Bursche, wir werden dich schon kriegen.«
Er beauftragte den Arzt und die Frau, das Haus zu durchsuchen.
Nachdem das gründlich und ohne Erfolg geschehen war, griff sich der Texaner an die Stirn.
»Ist denn das die Möglichkeit! Ich habe den Stall durchsucht, den Schuppen – gar nichts.«
Er stand am Zaun zum Nachbarhof und rief den Alten an, der dort Holz hackte.
»Mister, haben Sie einen Burschen gesehen, mit schwarzem, kurzgeschorenem Haar…«
Der Alte nickte. »Ja, er war vor einer Weile hier und hat gefragt, ob das der Hof des Doktors wäre.«
»Und später, haben Sie ihn dann noch einmal gesehen?«
»Später? Nein, dann habe ich ihn nicht mehr gesehen.«
Luke wandte sich um und nagte mit seinen großen weißen Schneidezähnen an der Unterlippe. »Hol’s der Teufel! Der Kerl ist doch keine Ratte, daß er im nächsten Loch verschwinden kann. Er muß noch im Haus sein, Doc!«
Der Arzt stand oben an der Hoftür und zog die Schultern hoch.
»Ich weiß es nicht.« Starkes Unbehagen hatte ihn befallen. Der Gedanke, daß der Galgenmann sich noch im Haus befinden könnte, war alles andere als angenehm.
»Wir müssen es noch einmal durchsuchen«, erklärte der Sheriff.
»All right.«
Luke Short und Doc Sommers suchten jetzt gemeinsam.
Aber wieder ohne Erfolg.
Dennoch hatte sich Billy Osrodan nicht aus dem Haus entfernt.
Ja, nicht einmal aus dem Behandlungszimmer. Er steckte hinter der dunkelgrünen Portiere, die das Wartezimmer vom Behandlungszimmer des Arztes trennte. Nicht einmal sehr gut abgeschirmt, sondern nur von den Falten des zurückgeschobenen Vorhangs halb verdeckt.
Keuchend stand er da und lauschte auf die Geräusche im Haus.
Er konnte hier nicht bleiben. Jeden Augenblick konnte jemand in den Behandlungsraum kommen und ihn dann hier hinter der Portiere sehen.
Da hörte er, wie der Sheriff im Korridor sagte, daß sie weitersuchen müßten.
Der Bulgare hörte die Schritte der beiden auf der Treppe. Und nach einer Viertelstunde kamen sie zurück ins Untergeschoß.
Wenn sie jetzt vorn in die Stube gehen, dann muß ich hinaus!
Er hörte genau, wie die beiden hinüber in die Stube gingen.
Die Frau hantierte auf der anderen Seite des Korridors in der zum Hof gelegenen Küche.
Rasch verließ der Galgenmann seinen Platz, durchquerte das Behandlungszimmer des Arztes und öffnete die Tür einen Spalt.
Die beiden Männer mußten in der Wohnstube sein.
Er zog sich mit der Rechten die Stiefel von den Füßen und schlich zur Treppe.
Es war eine Holztreppe, und sie knarrte leise unter dem Gewicht des Mannes.
Als er das Obergeschoß erreicht hatte, war der Verwundete vor Anstrengung schweißgebadet.
Die Türen standen alle offen.
Zur Straße hin schien das Schlafzimmer des Arztes zu liegen. Daneben war ein zweites Schlafgemach. Auf der anderen Seite des Korridors lag noch eine Art Gästezimmer.
Und links von der Treppe war eine dunkelgestrichene Tür, die offenbar zu einer Rumpelkammer führte.
Das war ein geeignetes Versteck.
Osrodan tastete sich in der Kammer vorwärts, stieß mit dem Schädel gegen die Decke und hätte um ein Haar einen Schmerzenslaut ausgestoßen.
In der linken hinteren Ecke entdeckte er eine hohe Holztruhe, die man gegen die Wandschräge gestellt hatte.
Hinter ihr fand der Bandit gerade so viel Platz, daß er hineinkriechen konnte. Es war kein bequemer Platz, den er sich da ausgesucht hatte, aber der Galgenmann hatte keine Wahl.
Luke Short und Doc Sommers hatten jetzt das Wartezimmer und den Behandlungsraum des Arztes einer gründlichen Durchsuchung unterzogen. Aber auch diesmal ohne Erfolg.
Der Verbrecher war buchstäblich im letzten Augenblick entkommen.
Der hünenhafte Texaner griff sich an den Schädel.
»Hol’s der Teufel, wenn ich das kapiere! Der Kerl kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben!«
Es half alles nichts, der Bandit war nicht zu finden.
Es war am späten Nachmittag. Der Abend senkte bereits seine ersten Schatten über die Stadt und brachte eine diesige Luft mit von der Prärie.
Der Mann hinter der Truhe riskierte es jetzt, sein unbequemes Versteck zu verlassen.
Er hatte es vor Schmerzen nicht mehr aushalten können. Am liebsten wäre er hinuntergerannt, um den Arzt um Hilfe zu bitten. Aber das hätte dann auch sein sicheres Ende bedeutet. Billy Osrodan fühlte nicht mehr genug Kraft in sich, einen Kampf auf sich zu nehmen.
Er kroch auf allen vieren zur Tür und lauschte ins Haus.
Unten herrschte geschäftiges Treiben. Unentwegt kamen und gingen die Kranken, die die Hilfe Doc Sommers’ in Anspruch nahmen.
Osrodan schlich durch den kurzen Flur auf das kleine Fensterviereck zu, das ihm einen Blick auf die Allenstreet gewährte. Er konnte es wagen, sich aufzurichten und hinauszusehen, da es von einer dünnen Gardine bedeckt war.
Der Eindringling sah sich um. Rechts lag das Schlafzimmer – und an der Wand neben dem Bett sah er eine Winchesterbüchse hängen.
Er richtete sich höher auf und blickte auf die Straße und zuckte gleich darauf jäh zurück.
Drüben auf der anderen Straßenseite auf dem Vorbau des Sheriffs Office stand Wyatt Earp!
Wilder Zorn flammte beim Anblick des Marshals in dem Banditen auf und gab ihm neue Kraft. Er wandte sich um, betrat das Schlafzimmer und nahm die Büchse von der Wand.
Mit hämischer Befriedigung stellte er fest, daß sie geladen war.
Rasch kehrte er damit an das Fenster zurück. Aber der Vorbau des Sheriffs Bureaus war leer.
Dafür entdeckte der Bandit den Marshal jetzt drüben vor dem Eingang des Crystal Palace.
Gleich schräg gegenüber. Und für den Heckenschützen viel näher als das Sheriffs Bureau.
»Ich habe ihn also nicht getötet«, keuchte er. »Noch nicht! Aber warte, Amigo, deine Stunde hat jetzt geschlagen! Ich werde dich auslöschen, und die Crew wird es mir danken.«
Der Wahnwitzige lud die Waffe durch, hob das Fenster vorsichtig um einen Spalt an und schob den Lauf des Gewehres langsam über die Fensterbank.
Seine Hände zitterten. Der Schweiß rann ihm in Bächen über den Körper, von der Stirn durch die Brauen in die Augen.
Er wischte mit dem Jackenärmel über die Stirn, wischte sich die Augen trocken und blinzelte über den Gewehrlauf.
Er hatte den Kopf des Missouriers jetzt genau über der Kimme. Das Gewehr schwankte nur noch schwach.
Wo war das Korn?
»Nur Ruhe!« versuchte sich der Verbrecher einzureden. »Du mußt jetzt die Nerven behalten. Nur für ein paar Sekunden noch!«
Er hob den Lauf weiter an.
Hölle! Wo war das Korn?
Der schwarze Punkt wollte und wollte sich nicht in den Ausschnitt der Kimme schieben lassen.
Weiter hob er den Lauf an.
Da endlich verlor der scharfe Kimmeneinschnitt seine Form und wurde durch einen rundlichen Strich verändert.
Das Korn trat in die Kimme, verrutschte nach links, nach rechts, versank wieder.
Keuchend hielt der anvisierende Heckenschütze inne und wischte sich wieder über die Stirn. Dann schlug er die Zähne knirschend aufeinander und visierte sein Ziel von neuem an.
Die Kimme saß genau über dem weißen Kragen des Marshals.
Und das Korn teilte das dunkle, von der Hutkrempe halbverdeckte Gesicht des Marshals in zwei Hälften.
Billy Osrodan spannte mit dem rechten Daumen den Hahn.
Die winzige Bewegung jagte einen stechenden Schmerz durch sein linkes Schultergelenk.
»Stirb, Hund!« keuchte er tonlos – und spannte den rechten Zeigefinger um den Abzug.
Während Luke Short immer noch die Nachbarschaft, die ganze Umgebung des Arzthauses absuchte und Wyatt Earp vorn die Mainstreet beobachtete, war es im Russianhouse sehr still geworden.
Eine der Mägde hatte die Glasscherben hinten im Flur weggefegt, und drüben in der Sägemühle war bereits ein Auftrag gegeben worden, der das Schließen der Flurwand betraf.
Im Zimmer des Georgiers herrschte tiefe Stille.
Laura Higgins stand vor dem Bett des Mannes und blickte auf sein scharfgeschnittenes Gesicht, das von einer bleiernen Blässe bedeckt war.
Die Atemzüge des Mannes waren tief und regelmäßig.
Wird er wieder gesund werden? überlegte die Spielerin.
Wie sehr sie doch an diesem Mann hing. In ihren sonst so kühlen kristallenen Augen schimmerten Tränen.
Ich habe kein Glück bei ihm! Aus irgendeinem Grunde verachtet er mich. Vielleicht, weil ich eine Spielerin bin, weil ich mein Geld am Grünen Tisch verdiene. Aber tut er nicht das gleiche? Lebt er nicht auch vom Spiel? Wie kann er mich für etwas verachten, das er doch selbst tut!
Ihre Augen wanderten von dem Gesicht des Mannes zu seinen Händen.
Es waren schlanke, nervige Männerhände, die so feinmodelliert und doch so männlich wirkten.
Die Hände der Frau, die ineinander gelegen hatten, lösten sich. Ihre Rechte berührte sacht eine dieser Männerhände.
Da schlug Doc Holliday die Augen auf. Er blickte in den düsteren Raum und sah dann neben sich die Frau. Die Hand der Spielerin war zurückgezuckt.
Holliday wollte sich aufrichten.
»Bitte, Doc, Sie müssen liegenbleiben«, sagte sie.
Seine spröden Lippen sprangen auseinander.
»Was ist… passiert?«
»Sie sind doch in Fleggers Bar verwundet worden. Und Doc Sommers und Doc Baxter haben Ihnen die Kugel herausgeholt.«
Holliday hatte die Brauen zusammengezogen. Wieder sprangen seine Lippen auseinander. »Der Marshal! Wo ist er!«
Die Frau preßte die Lippen zusammen. Ein bitterer Zug beherrschte jetzt ihr Gesicht.
Also galt sein erster Gedanke wieder ihm! Diesem Mann aus Missouri.
Wieder stieg der alte Haß gegen den Marshal in ihr auf.
Da hörte sie den Georgier fragen! »Ist ihm… auch etwas passiert?«
Langsam schüttelte sie den Kopf. »Nein, nichts.«
»Weiß er…«
»Ja, er war schon hier.«
Der Verwundete schloß die Augen, und seine Züge glätteten sich wieder.
Im Herzen der Frau, in dem bisher nur Mitleid gewesen war, loderte jetzt Eifersucht und Haß wild auf. Sie wandte sich ab und trat an das Fenster, um es etwas aufzustoßen.
»Bitte, Miß Higgins«, kam da die klirrende Stimme des Georgiers an ihr Ohr, »würden Sie mich allein lassen.«
Sie zog mit einem Ruck die Lade zu, packte ihre Tasche und ging hinaus.
Wortlos ging sie durch die Halle an der Hotelinhaberin vorbei und warf die Eingangstür donnernd hinter sich zu.
Nellie Cashman und der schwarze Sam tauschten einen Blick miteinander. Dann eilte die Frau auf das Zimmer des Spielers zu.
Doc Holliday öffnete die Augen, als die Tür so rasch geöffnet wurde.
»Entschuldigen Sie, Doc«, flüsterte die Frau, »ich wollte nur nachsehen…«
»Es ist alles in… Ordnung, Miß Cashman«, kam es schwach von den Lippen des Mannes.
Laura Higgins hatte den Platz vor dem Hotel überquert und ging mit raschen Schritten die Allenstreet hinauf.
Drüben vorm Crystal Palace sah sie den Marshal stehen.
Sie ging an dem Missourier vorbei auf das Hotel zu.
Wyatt blickte ihr nach.
In der großen geschliffenen Glastür, die in der kalten Jahreszeit stets eingesetzt wurde, blieb sie stehen und wandte sich um. Ihre schimmernden Augen hafteten auf dem Gesicht des Missouriers.
Eine leise Besorgnis stieg in dem Mann auf.
»Ist etwas geschehen, Miß Higgins?«
Die Frau schwieg noch einen Augenblick.
Dann sagte sie mit spröder Stimme: »Ich gratuliere. Sie haben gewonnen, Wyatt Earp.«
Damit wandte sie sich um und wollte die Tür hinter sich schließen.
Der Mann eilte ihr nach, ergriff ihren Arm und zog sie mit sanfter Gewalt auf den Vorbau zurück.
»Einen Augenblick, Miß Higgins.«
Als er in ihre Augen blickte, sah er darin blanken Haß, Haß, wie ihn nur eine Frau empfinden konnte.
»Was wollen Sie von mir?« schleuderte sie ihm giftig entgegen.
»Ich habe Ihre Bemerkung nicht verstanden, Miß Higgins. Würden Sie so freundlich sein, mir Ihre Worte näher zu erklären?«
»Ja.«
Wyatt schob die Tür des Salons zu und ging mit der Frau bis an die Vorbaukante. »Also, ich warte.«
»Doc Holliday ist zu sich gekommen, für einen Augenblick. Ich habe mit ihm gesprochen. Seine erste Frage – galt Ihnen.«
»Na und?«
»Das halten Sie wohl für selbstverständlich!« zischte sie ihm entgegen.
»Was ist das für eine dumme Rede, Miß Higgins.«
»Er hat gefragt, ob auch Sie verletzt wären.«
»Ist das ein Wunder? Wir reiten seit Jahren zusammen durch den Westen. Und wenn einer plötzlich aus einer Ohnmacht erwacht und findet sich in einem Bett wieder, dann ist die Frage nach dem Gefährten doch wohl nicht eben verwunderlich.«
»Nein, das ist sie nicht. Aber sein Leben ist nicht mehr sein eigenes Leben. Er hat es Ihnen, oder jedenfalls Ihrer Sache gewidmet. Er ist für die Welt verloren.«
»Ich an Ihrer Stelle würde weniger pathetisch sein und die Sache nüchterner sehen. Vielleicht würden Sie dann eher etwas erreichen können.«
»Ich will nichts mehr erreichen, Marshal.«
»Ich bin vom Gegenteil überzeugt, Madam.«
»Sie irren sich. Ich verzichte jetzt auf ihn.«
»Davon bin ich nicht überzeugt. Und ich werde Ihnen jetzt etwas sagen, was ich Ihnen schon lange sagen wollte: Sie haben es falsch angefangen, Laura Higgins. Wenn eine Frau um mich wirbt, dann würde ich es auch nicht schätzen, wenn es in der Weise geschähe, wie Sie es tun.«
Verwundert wandte sie den Kopf und blickte ihn verblüfft an.
»So? Und wie würden Sie es schätzen, Wyatt Earp?«
»Das weiß ich nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Jedenfalls dürfte es nicht so geschehen. Ich teile Doc Hollidays Ansicht nicht, daß sein Leben verspielt ist. Wenn er hinauf in die Berge von Colorado gehen würde, könnte er vielleicht doch Genesung finden. Gut, er ist Arzt. Aber auch er weiß nicht, wie es wirklich in seiner Brust aussieht. Seine eisenharte Gesundheit, die ihn die schwersten Anfälle hat überwinden lassen, gibt mir längst zu denken.«
»Sie glauben also, daß er noch zu heilen wäre?« fragte die Frau rasch.
»Ich weiß es nicht. Jedenfalls verfügt er über eine eisenharte Gesundheit. Ich habe mit mehreren Ärzten und auch mit indianischen Medizinleuten gesprochen, die nach meiner Erfahrung sehr viel mehr von der heimtückischen Krankheit verstehen als unsere Ärzte, daß er oben, in der Höhenlage der Rocky Mountains, jedenfalls Linderung finden könnte und sicher länger leben würde als hier unten im Flachland. Und in Gegenden, wo die größte Zeit des Jahres über eine tropische Hitze herrscht.«
»Und Sie glauben, daß er nach Colorado reiten würde?«
Der Marshal schüttelte den Kopf. »Nein, das glaube ich allerdings nicht. Und trotzdem haben Sie eine Chance, Laura Higgins. Wer weiß, ob Doc Holliday diese schwere Verletzung gut überstehen wird. Ich meine, daß er sie überstehen wird, glaube ich schon. Aber ob er jemals wieder der Mann sein wird, der er war, bevor er Fleggers Bar betrat, das weiß niemand. Und vielleicht braucht er dann einen Menschen.«
Jetzt zeigte es sich, daß die Spielerin Laura Higgins den Georgier John Holliday wirklich liebte.
»Es wäre mir völlig egal, ob er nicht mehr der gleiche Mann wäre, der er noch heute vormittag war. Ich würde bei ihm bleiben. Ich wäre glücklich, wenn ich bei ihm bleiben dürfte.«
»Und ich wäre glücklich, wenn er gesund würde«, setzte der Marshal hinzu.
Der Heckenschütze schräg gegenüber im Obergeschoßfenster des Arzthauses war aufgehalten worden. Wyatt Earp hatte sich abgewandt und mit der Frau gesprochen.
Jetzt standen die beiden drüben auf dem Vorbau.
Osrodan riskierte den Schuß jetzt nicht, da er fürchten mußte, von der Frau entdeckt zu werden, wenn er sie nicht zugleich mit dem Marshal tötete.
Er mußte warten, bis sie verschwunden war, hatte sie doch schon vorhin in den Crystal Palace gehen wollen. Er konnte also damit rechnen, daß der Marshal dann wieder allein auf dem Vorbau stehen würde.
Da wandte sich der Missourier plötzlich der Frau zu.
»Miß Higgins, blicken Sie jetzt bitte nicht hinüber auf die andere Straßenseite. Drüben im Obergeschoß von Doc Sommers hat jemand einen Gewehrlauf durch das Fenster geschoben. Gehen Sie langsam neben mir her zum Eingang des Saloons.«
Die Frau wußte sich meisterhaft zu beherrschen, zuckte weder zusammen noch zeigte sie durch irgendeine Bewegung ihr Erschrecken.
Langsam ging der Marshal neben ihr her auf den Eingang zu, öffnete die Tür und betrat mit ihr den Schankraum des Crystal Palaces.
Drinnen hinter dem Fenster blickte Wyatt zum Haus hinüber.
Der Gewehrlauf war immer noch oben zu sehen.
Das mußte der Mann sein, den Luke Short drüben bei Sommers gesucht hatte!
Laura Higgins stand neben dem Marshal. Jetzt erst kam ihr zum Bewußtsein, in welcher Gefahr sie sich befunden hatte. Aber sie war eine hartnervige Person.
»Soll ich ins Sheriffs Office laufen, um Luke Short zu informieren?« fragte sie.
»Nein, das hat keinen Zweck«, entgegnete der Marshal, ohne den Blick von der gegenüberliegenden Häuserfront zu nehmen. »Er ist nicht im Office.«
»Was wollen Sie tun?«
Der Missourier fuhr mit einer für ihn typischen Geste des Zeigefingers der linken Hand über seine Unterlippe.
»Der Mann ist gefährlich«, sagte er leise, »wenn ich jetzt über die Straße laufe, dann weiß er, daß ich ihn entdeckt habe und gefährdet womöglich noch jemanden drüben im Haus.«
Langsam ging er auf den Eingang zu.
Die Frau starrte ihm nach. »Wyatt!«
Er blieb stehen und blickte sich um. »Miß Higgins?« fragte er kühl.
»Sie wollen doch nicht etwa wieder auf den Vorbau gehen?« fragte sie erschrocken.
»Doch, Miß Higgins, das will ich.«
Langsam öffnete er die Tür und trat wieder an die Vorbaukante.
Unter halbgesenkten Lidern beobachtete er die Fensterscheibe.
Der Gewehrlauf war immer noch zu sehen.
Da, jetzt bekam er einen Ruck.
Wyatt wich mit einer winzigen Körperbewegung zur Seite, und schon brüllte auch der Schuß über die Straße.
In diesen Schuß hinein krachten zwei fauchende Feuerschläge aus dem schweren, sechskantigen Buntline Revolver.
Oben zersplitterte das Fenster, ein gellender Schrei drang über die Straße.
Getroffen torkelte der Mordschütze ins Schlafgemach des Arztes zurück, fiel wieder nach vorn und brach oben durch das Fenster. Und der schwere Oberkörper riß ihn auf das Vorbaudach hinunter, wo er mit einem dumpfen Aufprall liegenblieb.
Mit angehaltenem Atem hatte die Spielerin den Vorgang beobachtet.
Welche Eiseskälte er doch besaß, dieser Wyatt Earp!
Ganz unten, tief in ihrer Spieler- und Abenteuerseele war plötzlich ein Gefühl, das den Georgier verstand. War es doch wirklich ein faszinierender Mann, dieser Marshal Earp aus Dodge City. Und wäre sie selbst ein Mann gewesen, so hätte auch sie es gewiß nicht ausgeschlagen, mit ihm zu reiten, wenn sie die Chance dazu gehabt hätte. Und wenn sie dazu in Betracht zog, daß Doc Holliday sein Leben ohnehin als verwirkt ansah, so war dieser Weg, den er gewählt hatte, ganz sicher nicht der schlechteste.
War es doch trotz aller Gefahren und Strapazen ein großartiges Abenteuer, mit Wyatt Earp zu reiten.
Aber sie hatte ihr Leben zu leben. Das Leben der Laura Higgins. Sie hatte die Blüte ihrer Frauenjahre erreicht, und wollte ihr Dasein ncht auch verspielen, wie es Doc Holliday tat. Sie wollte leben und zwar mit dem Mann, den sie liebte. Sie würde um ihn kämpfen.
Der Bulgare Billy Osrodan hatte sein Leben auf dem Vorbaudach des Doktorhauses ausgehaucht.
Es war ein sinnloses Leben gewesen, seit er sich den Graugesichtern angeschlossen hatte.
Wenn er auch von einem betrügerischen Menschen überredet worden war, so hatte er doch seinen freien Entschluß und seinen freien Willen gehabt und hätte sich gegen die Bande wehren können. Vor allem – nach dem ersten Zusammentreffen mit den Graugesichtern. Nachdem er allerdings dann mehrmals mit ihnen zusammengewesen war, war es nahezu unmöglich geworden, sich ihnen wieder zu entziehen.
Einer der stummen und geheimnisvollen Gegner des Marshals war ausgeschaltet. Aber noch war der Mann nicht gefaßt, der Doc Holliday in den Rücken geschossen hatte.
Wyatt warf einen Blick auf die Sonne, die jetzt schon wieder im Westen hinter den Blauen Bergen versank, und überlegte.
Bis acht Uhr habe ich noch zweieinhalb Stunden Zeit.
Drüben aus der Zweiten Straße kam jetzt der Texaner mit langen Schritten herangelaufen.
Er blickte den Marshal an und warf dann einen Blick auf das Haus von Doc Sommers. Er sah den herunterpendelnden Arm des gestellten Verbrechers. »He, Sie haben ihn ja schon!«
Das Gesicht des Marshals war von der Streifwunde, die ihm der Bulgare im Korridor des Russianhouses beigebracht hatte, entstellt.
»Sie sollten den Doc da drüben mal aufsuchen, Wyatt. Das blutet immer noch an zwei Stellen der langen Wunde.«
»Das gibt sich«, entgegnete der Marshal. »Ich gehe jetzt zu Fleggers Bar hinüber.«
»Zu Fleggers? Der hat doch sicher geschlossen.«
»Ja, kann sein. Aber ich muß den Mann finden, der auf Doc Holliday geschossen hat.« Und dann informierte der Missourier den Texaner über das, was er im Liverystable des O. K. Corrals erfahren hatte.
»Um acht Uhr also«, meinte der Hüne. »Well, wir werden ihnen einheizen, daß ihnen die Hölle wie ein Paradies vorkommen wird.«
John Flegger hatte seine Schenke nicht geschlossen.
Als der Marshal eintrat, blieb er verblüfft stehen.
Vorn, auf dem großen Tisch, auf dem heute vormittag der Georgier gelegen hatte, war ein Mann aufgebahrt worden.
Ein mittelgroßer, fahlgesichtiger Mensch mit eingefallenen Wangen, tief in den Höhlen liegenen Augen und schmalem Mund.
Es war ein Toter, Billy Flegger.
Er lag in einem schlichten Sarg, die Hände über der Brust gefaltet.
Um den Sarg herum standen mehrere Frauen, die leise Gebete murmelten.
Wyatt blickte sich im Schankraum um und sah oben neben der Theke den Salooner stehen.
Er ging auf ihn zu.
»Weshalb machen Sie das?« fragte er leise.
»Das ist bei uns daheim, in Tirol, so üblich, Mr. Earp.«
»Wirklich?«
»Ja.«
Der Mann schien dem Marshal seltsam gefaßt zu sein.
Flegger sagte: »Es ist gut, daß Billy tot ist. Er war sterbenskrank. Er schleppte sich nur noch dahin. Die Krankheit saß in seiner Brust. Es war die Schwindsucht. Er war nicht stark genug, ihr zu widerstehen. Drüben in Oklahoma haben wir einen Arzt aufgesucht, und der sagte, wenn wir hinauf nach Colorado zögen, könnte er vielleicht Linderung finden und noch eine ganze Zeitlang leben. Aber wir hätten in Colorado nicht leben können. Was sollten wir oben in den Bergen. Da brauchte uns niemand. Und es wäre sehr, sehr schwer gewesen, da oben eine Schenke aufzumachen. Hier unten in der alten Silberstadt Tombstone war das leichter.«
Also – des Geldes willen hatten sie die Gesundheit und das Leben des Bruders aufs Spiel gesetzt.
»Doch, es ist gut, daß er tot ist«, sagte Flegger leise. Plötzlich blitzte es in seinen milchigen Augen auf. »Dennoch, wenn ich den Kerl jemals wiedersehe, der ihn erschossen hat, dann schlage ich ihn tot.«
»Sie werden ihn nicht totschlagen, John Flegger. Das wäre Mord.«
»Mord!« Der Kopf des Salooners flog herum.
»Hat er nicht auch meinen Bruder ermordet?«
»Ja, aber niemand hat ein Recht, eine Schandtat mit einer anderen wettzumachen.«
Da wandte sich der Salooner um und griff nach der Bibel.
»Hier, was steht da!« Er blätterte hastig, mit fliegenden Fingern darin herum. »Hier. Bei Moses steht zu lesen: So einer getötet hat, soll er getötet werden.«
»Ja«, entgegnete der Marshal, »und wenn Sie weiterlesen, werden Sie auch sehen, daß das Recht zu töten nicht des Menschen ist.« Wyatt blickte zu dem Toten hinüber und sagte leise: »Meine Mutter hat uns diese Stelle oft vorgelesen.«
Der Salooner klappte die Bibel zu. »Wollen Sie damit sagen, daß der Bursche nicht an den Galgen soll?«
»Nein, das will ich nicht sagen. Selbstverständlich nicht. Er hat Ihren Bruder erschossen und Doc Holliday lebensgefährlich verletzt. Er kommt an den Galgen. Aber es ist nicht Ihre Sache, ihn niederzustrecken.«
Der Salooner ging mit dem Marshal hinaus in den Flur und berichtete ihm da ganz genau, was sich am Vormittag in der Schenke abgespielt hatte.
Als Wyatt die Schenke verließ, kam ihm plötzlich ein eigenartiger Gedanke.
Rasch lief er zum Russianhouse hinüber und sah kurz in das Zimmer des Georgiers. Als er sah, daß der Freund die Augen geschlossen hatte, schloß er die Tür leise wieder und ging in den Stall, um seinen Falbhengst zu satteln.
Der Diener Sam half ihm dabei.
Wyatt sprengte aus dem Tor und verließ Tombstone in südlicher Richtung. Wahrscheinlich hatte er den Weg zu den Kaktusfeldern vor der Clanton Ranch noch niemals so schnell zurückgelegt wie jetzt.
Als er in den Ranchhof einritt und vor dem Wohnhaus aus dem Sattel sprang, trat oben Jerry Clanton in die Tür.
Einen Augenblick hatte Wyatt geglaubt, den jungen Ike vor sich zu sehen. Aber Ike war doch etwas größer und sehr viel männlicher.
»Wyatt Earp! Was wollen Sie denn hier?« giftete der Bursche den Marshal an.
Wyatt betrat den Vorbau, schob Jerry zur Seite und klopfte an die Tür. Dann öffnete er.
Die alte Frau trat ihm entgegen. »Der Marshal.«
Wyatt begrüßte die alte Frau kurz und fragte: »Ist Ike daheim, Mrs. Clanton?«
»Ja, er ist drüben bei den Corrals.«
»Gut.« Wyatt ging hinaus, um das Haus herum, und sah hinten bei den Corrals den Rancher damit beschäftigt, ein Tor zu reparieren.
Als Ike ihn kommen sah, ließ er die Arbeit liegen und blickte ihm entgegen.
»He, Wyatt, ich hätte um einen Drink gewettet, daß wir uns heute noch einmal sehen. Was gibt es?«
Der Marshal blieb vor ihm stehen und blickte ihm in die Augen.
»Heute abend um acht Uhr treffen sich im Hause der Flanagans die Galgenmänner.«
Er hatte es ganz ruhig, aber sehr ernst gesagt.
In Ikes Gesicht regte sich kein Muskel.
Wyatt wandte sich um und ging in den Hof zurück, zog sich in den Sattel und sprengte mit verhängten Zügeln davon.
*
Es war viertel vor acht. Tiefschwarzer Himmel lag über Tombstone.
Wyatt Earp und Luke Short standen am Ende der Straße, in der Rozy Gingers Bar und schräg gegenüber das Haus der Flanagans lag.
Der Texaner hatte den weißen Hut abgenommen und fuhr sich durch sein volles schwarzes widerspenstiges Haar.
»Da bin ich aber wirklich gespannt«, sagte er halblaut.
»Ja«, entgegnete der Marshal, »ich auch.«
»Wenn er etwas mit der Bande zu tun hat, dann muß er sie warnen! Wenn er nicht selbst hier an der Versammlung teilnehmen wollte.«
»Es ist ja nicht ausgeschlossen, daß er später kommen wollte. Vielleicht um neun oder erst um zehn. Denn als ich auf der Ranch war, hat er keinerlei Vorbereitungen zum Ritt getroffen. Er war eigenhändig damit beschäftigt, ein Corralgatter zu reparieren.«
»Und der Bursche?« forschte der Texaner.
»Der war auch da.«
»Sie haben mit Ike allein gesprochen?«
»Natürlich.«
Die beiden warteten. Luke Short hatte das Haus schon seit halb sieben unter Beobachtung. Er hatte nach Einbruch der Dunkelheit einen querstehenden, windschiefen Bau, der dicht vor den angrenzenden Miner Camps lag, bestiegen und von dort die Straße beobachtet.
Wyatt Earp wußte davon und hatte ihn hier aufgesucht.
Sie konnten die dunkle Straße gut übersehen.
Rechts aus Wongs China Bar fielen Lichtstreifen wie lange Finger über die Straße und tasteten die gegenüberliegenden vorbaulosen Häuser ab.
Oben, fast in der Mitte der Gasse, lag Rozy Gingers Saloon. Das Licht der Schenke fiel bis auf Flanagans Haus hinüber, das einen kleinen Vorbau hatte.
Die Minuten vergingen. Es wurde acht.
Der Texaner zog seine kleine silberne Uhr, die er von seinem Vater geerbt hatte, aus der Tasche.
»He, wenn mein Wecker nicht nach dem Mond geht, dann dürfte es jetzt acht Uhr sein.«
»Wir hatten Doc Hollidays Uhr mitnehmen sollen«, meinte der Marshal. »Die geht immer genau.«
»Ja«, meinte der Texaner. »Die geht so genau, wie ihr Herr schießt. Hoffentlich wird er wieder gesund.«
»Ja, hoffentlich.« Wieder war es eine Weile still.
Nach zehn Minuten vermochte der heißblütige Texaner seine Ungeduld nicht mehr zu verbergen.
»Ich werde einmal nachsehen gehen.«
»Nein, bleiben Sie hier«, entschied der Marshal.
»Aber sie können doch von der Rückseite in das Haus gekommen sein.«
»Nein, das ist ausgeschlossen. Wir sitzen hier unten am Ende der Gasse, die hier ein T bildet; durch die Straße. Wer von Norden, Süden, Westen oder Osten kommt, muß von uns gesehen werden. Sie müssen hier links über die Querstraße oder rechts unten vom Russianhouse herkommen. Oder sie kommen die Gasse herunter.«
»Können sie nicht von oben irgendwie an den Hof heran?«
»Nein, er wird von zwei hohen Hauswänden abgeschlossen. Sie müßten regelrecht ein Loch in die Wände schlagen.«
»Also sitzen wir hier goldrichtig.«
»Ja.«
Die Minuten vergingen.
Immer langsamer krochen sie dahin wie Sandschnecken in den Kaktusfeldern.
Der Texaner nahm seine Uhr wieder aus der Tasche.
»Schon zwanzig nach acht.«
Wyatt blickte die Gasse hinauf. Aus Rozy Gingers Bar kam ein Mann, blieb auf der Straße stehen und ging dann auf das Haus der Flanagans zu.
Er klopfte an die Haustür und wurde eingelassen.
Es dauerte nur eine Minute, da erschien er wieder und ging auf die Bar zu.
Die beiden Männer blickten einander an.
»Nun, was sagen Sie jetzt, Marshal Earp?« meinte der Texaner heiser.
Wyatt wußte, was Luke mit dieser Frage meinte. Er, Wyatt, war bei Ike Clanton gewesen und hatte ihm gesagt, daß sich um acht Uhr die Galgenmänner im Haus der Flanagans treffen wollten. Gehörte Ike wirklich zu den Galgenmännern, dann mußte er sie warnen. Er konnte sie unmöglich der Gefahr aussetzen, von dem Marshal überrascht zu werden.
Woher Wyatt Earp von dem Zusammentreffen der Galgenmänner wußte, war in diesem Zusammenhang zunächst für Ike – wenn er zu der Bande gehörte – unerheblich. Auf jeden Fall würde er sie warnen.
Jetzt war es fünfundzwanzig Minuten nach acht. Und von den Galgenmännern war nichts zu sehen.
»Es ist ausgeschlossen, daß sie schon im Haus sind«, sagte der Texaner. »Ich bin um sechs hiergewesen, um Viertel nach sechs, und seit halb sieben habe ich den Posten hier bezogen.«
»Nein, sie sind nicht in dem Haus«, sagte Wyatt.
»Und?« Der Texaner rieb sich mit dem Handrücken über das Kinn. Es gab ein hartes, kratzendes Geräusch, als ob man über Stahlspäne fahren würde.
Der Marshal stand mit gespreizten Beinen und über der Brust verschränkten Armen da und blickte in die dunkle Gasse. Seine Augen hingen am Eingang von Rozy Gingers Bar.
»Ich weiß es nicht«, sagte er halblaut.
»Wie? Sind Sie etwa noch nicht überzeugt davon, daß Ike der Boß ist?«
Wyatt zog die Schultern hoch und ließ sie wieder sinken.
»Ach, Sie sind nicht davon überzeugt?«
»Es wäre ungeheuerlich.«
Die beiden blieben weitere fünf Minuten und beobachteten die Straße.
Dann wandte sich der Marshal um.
»Kommen Sie.«
Sie schritten die Gasse hinauf, und während Luke Short vor Rozy Gingers Bar stehenblieb, betrat der Marshal die Bar, aber nicht von vorn, sondern auf dem Weg, den Doc Holliday meist benutzt hatte. Nämlich durch die Hintertür. Der Flur war leer. Die Küchentür stand halb offen, und Speisegerüche schlugen ihm entgegen.
Er wollte gerade die Tür zum Schankraum öffnen, als diese aufgestoßen wurde.
Der Mann, der in ihrem Rahmen stand, starrte den Marshal verblüfft an.
Auch die Verblüffung in den Augen des Marshals hätte nicht größer sein können!
Es war Jeremias Clanton. Ikes Vetter.
Wyatt packte ihn am Ärmel und zerrte ihn blitzschnell in den Flur, schlug ihm die linke Hand auf den Mund, zog blitzschnell seinen fünfundvierziger Colt und stieß ihn dem Burschen in die Rippen.
»Du hast die Flanagans gewarnt!«
Der Bursche rührte sich nicht.
Wyatt nahm ihm die Waffen aus den Halftern und schob sie in den eigenen Gurt.
»Komm mit!«
Jerry Clanton war so überrascht, daß er zu keiner Gegenwehr fand.
Wyatt führte ihn in den Hof und zerrte ihn an die Ecke des Hauses.
Luke Short, der vorn an der Straßenecke des Hauses stand, kam auf die beiden zu.
»He, das ist wirklich eine Überraschung.«
Wyatt hatte den Revolver noch in der Hand.
»Du hast die Bande gewarnt!«
Jerry senkte den Kopf.
»Rede!«
Aber Jerry schwieg.
Da holte der Texaner aus, und eine krachende Ohrfeige warf den Burschen bis in den Hof zurück.
»Mach das Maul auf, Junge, sonst schlage ich dir sämtliche Zähne ein.«
Jerry kauerte am Boden und krächzte: »Ja. Ich war es.«
Luke zog die Brauen hoch und wandte sich an Wyatt.
»Tut mir leid, Marshal. Ich weiß, daß Sie das nicht schätzen, aber es kürzt das Verfahren ab, und wir gewinnen Zeit.«
Wyatt blickte auf Jerry Clanton nieder.
»Steh auf!«
Der erhob sich und preßte die Hand auf die getroffene Gesichtsseite. Er hatte das Gefühl, daß der Schlag ihm den Kiefer zerschmettert haben müßte. Aber er war völlig unverletzt.
»Der Trick war gut«, sagte Luke Short. »Es war eine großartige Idee, Marshal. Typisch für Sie. Jetzt wissen wir doch endlich, daß die Clantons zu den Galgenmännern gehören. Und – daß Ike ihr Führer ist.«
Wyatt schoß dem Texaner einen fragenden Blick zu. Dann stieß er dem Burschen den Revolver wieder auf die Brust.
»Was hast du dazu zu sagen, Jerry?«
Der wollte den Kopf senken.
Wyatt verstärkte den Druck des Revolvers und spannte den Hahn. »Mach den Mund auf, Junge. Ich rate dir gut.«
»Nein«, krächzte der Bursche. »Er war es nicht. Er weiß gar nichts davon. Als Sie um das Haus herumgingen zum Corral, oben bei uns auf der Ranch, lief ich durch das Haus und versteckte mich hinten in Phins Zimmer, wo ich hören konnte, was Sie am Corral mit Ike sprachen.«
»Und?«
»Well, dann bin ich hierhergeritten und habe Bescheid gesagt.«
»Wem hast du Bescheid gesagt?« Blitzschnell kam die Frage.
»Den Leuten hier.«
»Lüge nicht, du bist nicht hier bei den Flanagans gewesen.«
»Doch, gerade.«
»Ich habe dir gesagt, du sollst nicht lügen. Du bist zwar jetzt drüben gewesen, aber du hast die Bande viel früher gewarnt, und zwar nicht hier. Bei wem bist du gewesen? Und wer hat die Leute gewarnt?«
»Ich bin ganz einfach oben bei Miller gewesen. Sie wissen doch, wo die Schießerei war?«
»Und?«
»Ich habe da gesagt, daß Wyatt Earp um acht Uhr bei den Flanagans eine Gruppe von Galgenmännern ausheben will.«
»Und weiter?«
»Nichts weiter. Ich habe nichts mit den Leuten zu tun. Ich weiß auch nicht, wer die anderen gewarnt hat und auch nicht, wie es vor sich gegangen ist.«
Das konnte ihm der Marshal nun glauben oder nicht. Jedenfalls schien festzustehen, daß Ike die Graugesichter nicht gewarnt hatte. Und andererseits war es nicht ausgeschlossen, daß er den Burschen in die Stadt geschickt hatte.
Der Missourier war also wieder so klug wie vorher.
Es klang durchaus glaublich, daß Jerry Clanton, der den Marshal ja haßte, nur um diesem zu schaden, in die Stadt geritten war, um die Graugesichter zu warnen. Es konnte sich absolut so abgespielt haben, wie er berichtet hatte.
»Leider Gottes kann es auch ganz genau anders gewesen sein«, sagte der Texaner, packte den Burschen am Ärmel und schob ihn vor sich her auf die Straße. »Jedenfalls kommst du erst einmal ins Jail, Junge. Du läufst uns zu oft vor die Füße.«
Jerry Clanton blieb stehen und blickte den Marshal an.
»Mit welcher Begründung setzen Sie mich fest, Mr. Earp?«
Gelassen entgegnete der Missourier: »Leute, die es mit den Graugesichtern halten, sind gemeingefährlich.«
»Wie lange wollen Sie mich festhalten?«
»Darüber wird der Richter befinden.«
*
Wyatt Earp war ins Russianhouse zurückgekehrt, während Luke Short Jerry Clanton ins Gefängnis brachte.
Vorne in der Halle begegnete der Marshal Nellie Cashman.
»Wollen Sie Ihr Abendbrot einnehmen, Mr. Earp?« fragte sie.
»Gleich. Ich will vorher nur nach Doc Holliday sehen.«
»Ich glaube, er schläft«, sagte die Frau.
Der Marshal ging zum Zimmer des Spielers und öffnete die Tür.
Er warf einen Blick auf das Bett und wollte die Tür wieder schließen.
»Wyatt!« hörte er da die schwache Stimme des Georgiers.
Der Marshal trat ein.
»Ich hasse die Dunkelheit«, sagte der Spieler. »Können Sie nicht ein Licht anzünden?«
»Doch, natürlich.« Wyatt riß ein Zündholz an und hielt es an den Docht der kleinen grünabgeschirmten Kerosinlampe.
Eine geisterhafte Blässe hatte das Gesicht des Gamblers überzogen.
»Wie geht es?« fragte Wyatt vom Fußende des Bettes her.
»Ich weiß es nicht. Ich wollte, es wäre Morgen.«
Es war einen Augenblick still, dann sagte Doc Holliday mit sanfter Stimme: »Es war ein mittelgroßer Kerl. Er hatte ein breitflächiges, narbiges Gesicht und graue Augen. Ich muß ihn an der rechten Hand getroffen haben. Vielleicht nur mit einem harten Querstreifer… An der linken Hand trug er den Ring der Graugesichter…«
Holliday schwieg erschöpft.
Als Wyatt wieder auf der Straße stand, hatte der Wind die Wolkenbank auseinandergerissen und ein silbern leuchtendes Himmelsstück freigefegt.
Langsam ging der Marshal die Gasse zur Allenstreet hinauf, am Office vorbei, in die Dritte Straße, die hinauf zur Fremontstreet führte.
Oben auf dem Hügel des Boot Hill jaulte der Nachtwind und fegte pfeifend durch die breite Straße.
Wie ein weit aufgerissenes Riesenmaul gähnte die Toröffnung des O. K. Corrals.
Wyatt Earp ging auf eine kleine Schenke zu: Millers Bar.
Er wußte nicht, was ihn hergetrieben hatte. Als er einen Blick durch die aufgekratzte Papierbeklebung des Fensters warf, sah er an der Theke nur einen einzigen Mann stehen. Der trug einen Melbahut und gefüttertes Lederzeug. Die linke Hand lag auf der Theke, die rechte war nicht zu sehen.
Wyatt wußte nicht, daß ein Ring an dieser Hand funkelte.
Er trat auf die Tür zu und öffnete sie.
Als er in ihrem Rahmen stand, warf der Mann an der Theke den Kopf herum.
Aschgrau wurde sein Gesicht beim Anblick des Marshals.
Der Mann an der Theke war der Mörder Henry Halman Woodcock.
Wyatt trat heran.
Woodcock starrte vor sich hin. Er hatte jetzt auch die linke Hand von der Thekenkante rutschen lassen. Er konnte es nicht riskieren, eine Hand heraufzunehmen, denn an der linken Hand hatte er den Ring mit dem eingravierten Dreieck und die rechte war verbunden. Er mußte immerhin damit rechnen, daß der Marshal erfahren hatte, daß Doc Holliday ihn an der rechten Hand verletzt hatte.
Den ganzen Tag über hatte der Bandit in einem Versteck, einem Verschlag hinter Websters Boardinghouse, gehockt und war jetzt zum Vorschein gekommen.
Er hatte es nicht gewagt, hinunter in die Gasse zu den Flanagans zu gehen, wo auch er sich um acht Uhr einzufinden hatte. Hier in die kleine Bar war er gekommen, um sich zu betrinken.
Da packte der Marshal plötzlich seine linke Hand und legte sie auf die Theke.
Der Ring war umgedreht. Wyatt wandte die Hand mit der Innenfläche nach oben und sah das eingravierte Dreieck.
»Haben Sie noch irgend etwas zu sagen, Mr. Shaddon?«
Der Kopf des Mörders sank auf die Brust. »Ja, ich habe noch etwas zu sagen, Mr. Earp. Nämlich, daß Sie so oder so ausgerottet werden!«
Wyatt packte ihn und führte ihn hinaus.
Luke Short war nicht im Office.
Als Wyatt den Schlüsselbund zu den Zellen an sich nahm, kam der Texaner herein. Er brachte zwei Männer mit. Die beiden Peons aus dem O. K. Corral: Edward Humpton und Joe Ferkas.
»Ich dachte mir, daß diese beiden Figuren in unserer bunten Sammlung auf keinen Fall fehlen dürften, Marshal!«