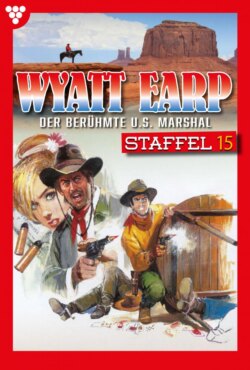Читать книгу Wyatt Earp 15 – Western - William Mark D. - Страница 9
ОглавлениеDer große Fight gegen die Galgenmänner war vorüber. Die Stadt Tombstone, die von der gefährlichen Bande des verräterischen Sheriffs Cas Larkin so lange und so hart bedrängt worden war, konnte wieder aufatmen.
Nachdem sich das Leben in der Westernstadt wieder normalisiert hatte, entschloß sich Wyatt Earp, nach Dodge zurückzureiten.
Luke Short, der viele Monate zusammen mit ihm und dem Georgier Holliday gegen die Bande gekämpft hatte, war längst hinüber nach Texas geritten. Der Mayor John Clum war nicht sehr glücklich gewesen, als der riesige Tex ihm den Sheriffsstern zurückgegeben hatte; denn einen solchen Mann hätte Clum in Tombstone gern ständig behalten.
Am Morgen, an dem der Marshal die Stadt verlassen wollte, stand er unten in Nellie Cashmans Hotel und verabschiedete sich von der dunkeläugigen Hotelinhaberin.
»Werden Sie einmal wieder nach Tombstone kommen?« Die bange Frage kam unsicher von den Lippen der Frau.
Der Missourier lachte jungenhaft.
»Natürlich, Miß Nellie, ich werde bald wiederkommen. Scheint es doch so, daß ich von Tombstone nicht lassen kann.« Und obgleich er es diesmal gar nicht sonderlich ernst gemeint hatte, sollten sich seine Worte schneller erfüllen, als er es an diesem Tag selbst für möglich gehalten hatte.
Er reichte der Frau die Hand, ging dann schnell hinaus, wo der weißhaarige Neger Sam den aufgesattelten Falbhengst schon am Zügel hielt. Wyatt stieg auf, winkte noch einmal kurz und ritt dann die Gasse hinauf zur Mainstreet.
Es war kurz nach neun Uhr am Vormittag.
Wyatt blickte zum Crystal Palace hinüber, hielt einen Augenblick sein Pferd an und blickte die Straße hinunter, wo unten an der Ecke der Sechsten Straße das Haus Doc Hollidays stand.
Ob der Spieler noch schlief?
Wyatt ritt auf die Schenke zu, stieg aus dem Sattel und betrat den Vorbau.
Als er über die bastgeflochtenen Schwingarme der Pendeltür in den großen Schankraum blickte, sah er hinten im anschließenden Spielsalon Doc Holliday sitzen und mit zwei Männern pokern.
Wyatt schob die Pendeltür auseinander, grüßte den Keeper und ging durch zum Spielsalon.
Doc Holliday, der bereits einen Stapel von Dollarstücken vor sich stehen hatte, sah kurz auf.
»Morning, Marshal.«
»Morning, Doc.«
Wyatt blieb neben ihm stehen, sah ihm eine Weile zu, bis der Georgier seine Gedanken mit der Frage unterbrach: »Reiten Sie?« Doc Holliday blickte dabei nicht einmal auf.
»Ja.«
Der Spieler nickte und schnipste ein paar Kartenblätter seinen Partnern zu.
»Nach Dodge?«
Einsilbig entgegnete der Marshal: »Ja.«
Wieder nickte Holliday und meinte: »Eine schöne Stadt, dieses Dodge City. Aber Tombstone ist auch eine schöne Stadt.«
Wyatt zog sich den Hut tiefer in die Stirn und entgegnete:
»Vielleicht sehen wir uns einmal wieder, Doc.«
»Doch, das hoffe ich. War eine interessante Zeit. Grüßen Sie Dodge von mir.«
Wyatt tippte grüßend an den Hutrand und verließ die Schenke. Draußen auf dem Vorbau blieb er einen Augenblick stehen, um die Augen an die blendende Helle der Straße zu gewöhnen.
Da kam oben vom Post Office her ein Junge gelaufen, der ihm eine Depesche reichte.
Wyatt öffnete sie und las:
Jonny Ringo ist in der Stadt. Er hat zwei Dutzend Boys mitgebracht.
Bat Masterson.
Langsam faltete der Marshal das Telegramm zusammen und schob es in die Tasche.
Wie auf ein stummes Kommando war der Ruf aus seiner Stadt erfolgt. Und er kam genau zur richtigen Zeit, denn wäre er auch nur wenige Tage vorher gekommen, so hätte Wyatt Tombstone nicht verlassen können.
Cass Larkin aber war tot. Und der gefährliche Capucine war in das Staatsgefängnis nach Topeka gebracht worden, aus dem es kein Entweichen mehr gab; zusammen mit den anderen Galgenmännern, die man dorthin gebracht hatte, sah er der Gerichtsverhandlung entgegen.
Wyatt ging langsam zu seinem Pferd und zog sich in den Sattel.
Im leichten Trab ritt er zur Fremont Street, stieg vorm Tombstoner Epitaph noch einmal aus dem Sattel und verabschiedete sich von dem grauhaarigen Mayor.
Der alte Pionier drückte dem Marshal kräftig die Hand.
»Alles Gute, Wyatt! Ich hoffe sehr, daß wir uns in diesem Leben noch einmal wiedersehen. Und vor allem, vielen, vielen Dank für alles, was Sie für diese undankbare Stadt getan haben.«
Als Wyatt den Nordrand der Stadt erreicht hatte, hielt er seinen Falben plötzlich noch einmal an, wendete ihn und ritt durch die Northside Street zum Westende der Stadt auf den Stiefelhügel zu.
Er stieg vom Pferd, ging durch die Gräberreihen und blieb vor einem eingesunkenen Grabhügel am Südrand des Friedhofs stehen. Ein kleines, von der Sonne verblichenes Holzkreuz trug die Aufschrift: Morgan Earp, erschossen am 19. März 1882.
Der Missourier stand eine Weile vor dem Grabhügel, hatte den Hut in den Händen und die Augen geschlossen.
Noch einmal zogen die Ereignisse der letzten Jahre an ihm vorüber. Der schwere Fight gegen die Clanton-Gang, Morgans Tod und die Verfolgung seiner Mörder.
Ein leises Geräusch ließ den Missourier herumfahren.
Hinter ihm stand ein Mann, etwa einsfünfundachtzig groß, mit wetterbraunem, hartem Gesicht und opalfarbenen Augen. Er trug einen braunen breitkrempigen Melbahut, eine abgetragene Jacke, ein verwaschenblaues Hemd und eine braune Levishose, die über die Schläfe seiner Stiefel lief. Eine Waffe trug er nicht.
»Hallo, Wyatt.«
»Hallo, Ike.«
Ja, es war Ike Clanton, der ehemalige große Widersacher des Marshals, der Anführer der Rebellencrew, gegen die Wyatt Earp viele Jahre gekämpft hatte. Im Endkampf gegen die Maskenmännerbande hatte dieser gleiche Ike Clanton für die größte Überraschung im Leben des Missouriers gesorgt: er hatte sich gegen den Bravo aus Naco gestellt und dem Marshal also beigestanden.
Wyatt setzte seinen Hut auf und blickte den Rancher forschend an.
Der stand jetzt vor dem Grab seines Bruders Billy und bückte sich, um ein Unkraut auszuziehen, das an den Umrandungssteinen des Grabes wucherte.
Dabei fragte er, ohne den Missourier anzusehen:
»Sie verlassen Tombstone?«
»Ja.«
Der Rancher nickte, wandte sich dann um und verließ den Friedhof langsamen Schrittes.
Wyatt folgte ihm.
Draußen sah er neben seinem Falbhengst den Rappen Ike Clantons stehen.
Wyatt hatte die Linke schon nach dem Sattelhorn ausgestreckt, als er sich noch einmal umwandte.
Ike stand drei Schritte hinter ihm und blickte ihm unverwandt in die Augen.
»Alles Gute, Marshal.«
Langsamen Schrittes kam der Rancher auf den Missourier zu und reichte ihm die Hand.
Einen Herzschlag lang sah der Missourier auf die große, breite schwielige Hand, die so oft den Revolver gegen ihn geführt hatte. Dann schlug er ein.
»Thanks, Ike, und auch alles Gute für Sie.«
Es war ein Augenblick, dessen Bedeutung jeder der beiden Männer begriff. So lange und so erbittert hatten sie gegeneinander gekämpft, und nun endlich schien Friede geschlossen zu sein! Jeder hatte in diesem Kampf einen geliebten Bruder verloren – zwei junge Menschen, deren Gräber auf dem Boot Hill nebeneinander lagen.
Wyatt zog sich in den Sattel und ritt nach Norden.
Als er die Overlandstreet erreicht hatte, blieb er auf einer Hügelkette halten und sah sich noch einmal um. Da unten lag Tombstone, die graubraune Kistenstadt, in der Savanne Arizonas. Still, friedlich und scheinbar völlig bedeutungslos. Nichts an diesem geruhsamen Bilde verriet, daß sich in der Stadt am Fuß der blauen Berge so viele blutige Kämpfe abgespielt hatten.
Plötzlich sah Wyatt unten am Ende der Fünften Straße, die auf die Overlandstreet hinausführte, eine Staubwolke aufsteigen, die sich rasch näherte. In voller Karriere preschte ein Reiter aus der Stadt auf den Hügel zu.
Schon als er auf eine Meile herangekommen war, wußte der Marshal, wer da kam. So ritt nur Doc Holliday! Und so geschwind wie dieses Pferd war nur der schwarze Hengst des Spielers.
Wyatt wartete, bis der Georgier herangekommen war, und blickte ihn dann fragend an. Das immer etwas blaßbraune Gesicht des Gamblers war völlig reglos und gelassen. Die eisblauen Augen, die von einem dichten Wimpernkranz umgeben waren, blickten den Marshal sehr ruhig an.
»Keine Lust mehr am Spieltisch?« forschte der Missourier.
Holliday zog die Schultern hoch und ließ sie wieder fallen.
»Ich weiß nicht. Plötzlich hatte ich das Gefühl, daß Dodge City doch die schönere Stadt ist.«
In den Augenwinkeln des Marshals stand ein winziges Lächeln.
Der Spieler nahm sein goldenes Etui aus der Tasche und zündete sich eine seiner langen russischen Zigaretten an.
»Ja, und da ich ein neidischer Mensch bin, der dem Marshal Earp die Schönheiten und Behaglichkeiten von Dodge nicht allein gönnt, reite ich eben mit. Etwas dagegen?«
Langsam schüttelte der Missourier den Kopf.
»Natürlich nicht, Doc. Wo haben Sie Ihr Gepäck?«
Der Spieler griff mit der Linken in die Innentasche seines schwarzen Jacketts und zog ein Kartenspiel hervor, das er blitzschnell fächerförmig hochhielt.
»Hier.«
Wyatt schüttelte lachend den Kopf und blickte dann nach vorn. »All right, reiten wir.«
Sie ritten eine Weile stumm nebeneinander her, bis der Marshal auf einmal fragte: »Haben Sie Laura Higgins noch gesehen?«
»Nein. Ich wollte sie auch nicht sehen.«
Beide dachten sie an die grünäugige schöne Frau, die dem Gambler seit Jahren von Stadt zu Stadt folgte. Schon so mancher Mann hatte ihn um die Liebe der begehrten Laura Higgins beneidet. Aber Doc Holliday schien keine Augen für sie zu haben. Allerdings schien das eben nur so, denn der Spieler hatte einen Grund, auf diese Liebe zu verzichten…
Die beiden Gefährten hingen ihren Gedanken nach und ritten im leichten Trab nordostwärts davon.
Es mochte kurz vor zehn sein, und sie hatten knapp drei Meilen hinter sich gebracht, als es geschah:
Wyatt, der gerade gedankenverloren in die versteppte Prärie hinausgeblickt hatte, hörte den Hufschlag des Rappen neben sich verstummen, wandte sich um und sah ein paar Yard hinter sich den Rappen des Georgiers reiterlos stehen.
Er sprang sofort ab und sah Doc Holliday am Wegrand liegen. Reglos, langausgestreckt mit dem Gesicht im gelben Sand der Overlandstreet.
Starr vor Schreck verharrte der Missourier sekundenlang auf der Stelle und blickte auf dieses beängstigende Bild.
Völlig lautlos und scheinbar auch grundlos war der Spieler aus dem Sattel gefallen.
Wyatt lief auf ihn zu und wandte ihn auf den Rücken. Hollidays hageres, aristokratisch geschnittenes Gesicht war naß von Schweiß und mit pulverfeinem Flugsand bedeckt.
Wyatt richtete den Oberkörper des Gefährten auf und überlegte verzweifelt, was zu tun war.
Dann ließ er ihn wieder zurück auf die Straße gleiten, öffnete die schillernd grüne Seidenweste des Spielers und lauschte an der linken Brustseite des Reglosen.
Ganz schwach konnte er den Herzschlag noch vernehmen.
Ein Anfall also! Da hatte sie ihn wieder gepackt, die fürchterliche Krankheit, die seit einer Reihe von Jahren in seiner Brust ihr Vernichtungswerk tat.
Wyatt lief zum Pferd des Spielers, nahm die kleine schwarze Krokodiltasche, die Holliday auf allen Ritten mit sich führte, und nahm die Whiskyflasche heraus. Er nahm den Campbecher, füllte ihn zur Hälfte und flößte dem Spieler ein paar Schlucke ein.
Es dauerte dennoch Minuten, ehe Holliday die Augen aufschlug. Wie aus weiter Ferne schienen diese Augen zu kommen und über den Marshal hinwegzublicken. Die Eisesbläue, die sie immer ausgezeichnet hatte, war daraus gewichen und hatte einem kristallfarbenem mattem Ton Platz gemacht.
Wyatt nahm sein Taschentuch hervor und wischte dem Spieler den Sand aus dem immer noch schweißnassen Gesicht. Und sofort sah er neue große Schweißperlen auf der Stirn stehen.
Holliday spürte den Whisky auf seiner Zunge und nickte schwach.
»Richtig. Ich sehe, Sie haben das Rezept nicht vergessen.« Dann griff er mit zitternder Hand nach dem Becher und kippte den Inhalt hinunter.
Und sofort tastete seine Rechte nach dem Hut.
»Reiten wir weiter.«
Wyatt, der den Freund genau kannte, hatte beim Aufstehen nicht geholfen. Aber es schmerzte ihn zu sehen, wie der Georgier all seine Energie zusammennehmen mußte, um auf die Beine zu kommen. Schwer schwankend stand er da und blickte nach vorn.
Wyatt ging auf ihn zu und ergriff seinen linken Arm.
Holliday blieb stehen und wandte den Kopf. Aus tiefen Höhlen schienen seine Augen den Marshal anzublicken.
»Scheint etwas hart gewesen zu sein, diesmal«, kam es durch seine zusammengebissenen Zähne.
»Wir reiten zurück, Doc.«
Holliday schüttelte den Kopf.
»Auf keinen Fall. Ich will Tombstone nicht wiedersehen.«
Gnadenlos schleuderte die Julisonne ihre Vormittagshitze auf die Straße.
Wyatt blickte nach vorn. Bis zur nächsten Stadt waren es noch neun oder gar zehn Meilen.
»Wir müssen zurückreiten, Doc.«
Holliday schüttelte den Kopf. »Nein. Und wenn ich hier auf der Stelle sterben müßte.«
»Warten Sie, da drüben ist eine Feldhütte.« Wyatt führte den Freund auf einen kleinen Holzbau zu.
Ohne Aufforderung folgten ihnen die beiden Pferde.
Während sich die Tiere eng in den Schlagschatten der Hütte preßten, wankte Doc Holliday im engen Innenraum auf die schmale Pritsche zu, ließ sich darauf nieder und schloß die Augen. Die Arme hingen seitlich an der Lagerstatt herunter, und sein Gesicht war von beinerner Blässe überzogen. Hart stachen die Knochen aus der gespannten Haut hervor.
Es schien das Gesicht eines Toten zu sein.
Das Herz krampfte sich dem Marshal in der Brust zusammen bei diesem Anblick.
Als er sich umwandte, um hinauszugehen, bannte ihn die Stimme des Spielers auf der Schwelle.
»Wyatt!«
Der Missourier wandte sich um.
»John?«
»Sie reiten weg?«
»Ja. Nach Tombstone. Ich hole Doc Sommers.«
Mit aller Energie, die noch in seinem schwer angeschlagenen Körper steckte, richtete sich der Georgier auf die Ellbogen auf.
»Auf keinen Fall… ich bitte Sie… auf keinen Fall!«
Wyatt blieb unschlüssig im Türrahmen stehen und blickte vor sich nieder. Was sollte geschehen? Es sah so aus, als würde der Spieler dieses Mal den Anfall nicht überleben. Wenn ihm jemand helfen konnte, so nur ein Arzt.
Aber der Marshal wußte ja, wie schwer es war, Holliday dahin zu bringen, sich helfen zu lassen.
»Warten Sie einen Augenblick, es wird gleich besser.«
Mit zusammengeballten Fäusten blieb Wyatt stehen und starrte auf die staubigen, rohgezimmerten Dielen der Feldhütte.
»Es sind knapp drei Meilen bis Tombstone, Doc. Ich kann mit Sommers noch vor Mittag zurück sein.«
»Nein, das können Sie nicht. Er hat gestern abend bis ein Uhr im Crystal Palace gesessen und getrunken. Er liegt noch im Bett und schläft. Und seine Hände würden zittern. Und außerdem: was sollte er hier? Er kann mir nicht helfen. Er nicht und auch sonst niemand.«
Es war eine Weile still, dann sagte der Mann, der selbst eine erfolgsversprechende Arztlaufbahn in Boston begonnen hatte, ehe er durch diese fürchterliche Krankheit aus der Bahn geschleudert worden war: »Aber Sie müssen weiterreiten, Wyatt.«
»Nein«, entgegnete der Missourier einsilbig.
»Sie müssen! Bat wartet auf Sie.«
Überrascht wandte der Marshal den Kopf.
»Wie kommen Sie darauf?«
»Ich habe gesehen, wie der Clerk aus dem Post Office Ihnen die Depesche gab.«
»Wer sagt Ihnen, daß sie von Bat Masterson kam?«
»Der Clerk«, meinte der Spieler, wobei ein schwaches Lächeln um seine jetzt messerscharf gezeichneten Lippen flog.
Wyatt nahm den Hut ab und wischte sich das Schweißband aus. Die Hitze, die jetzt draußen auf der Straße waberte, und von keinem Luftzug bewegt wurde, schien auch in die Hütte kriechen zu wollen.
»Sie könnten mir einen Gefallen tun. Geben Sie mir die Whisky-Flasche – und nehmen Sie den Rappen bitte mit.«
Bestürzt trat der Missourier näher ans Lager.
»Nein, Doc, wir reiten zusammen weiter, und zwar zurück nach Tombstone.«
Langsam schüttelte Holliday den Kopf. »Geben Sie sich keine Mühe, Marshal. Mich bringt niemand mehr zurück nach Tombstone.«
»Aber Sie werden hier elendiglich in dieser Hütte ver…«
»Verenden, sagen Sie es nur«, beendete der Gambler den Satz des Missouriers. »Ich weiß, irgendwann wird es einmal so ausgehen. Aber jetzt noch nicht.«
Wieder richtete er sich auf die Ellbogen auf; aber die Bewegung kostete ihn so eine ungeheure Anstrengung, daß der Schweiß ihm erneut aus allen Poren brach und sein Gesicht wie mit einer Glasperlenschicht bedeckte.
»Wir reiten gleich weiter.«
Wyatt wußte, daß es sinnlos war, dem Gefährten zu widersprechen. Er kannte seine Einstellung und seinen eisernen Willen.
Holliday trank noch zwei Schlucke Whisky, richtete sich dann auf, nahm eines seiner seidenen Taschentücher hervor und wischte sich durchs Gesicht. Als er den Hut aufsetzte, blickte er durch das glaslose Fenster in die Savanne zu einer riesigen Turmkaktee hinüber, die in einer Entfernung von etwa zwei Meilen einen ihrer Arme mahnend wie einen Zeigefinger in den Himmel streckte.
»Mit der Höllenfahrt war es noch nichts, Wyatt. Sehen Sie zu der Kaktee hinüber. Noch deutet alles auf den Himmel.« Er lachte, zog sich die Samtschleife zurecht, die der Missourier vorhin geöffnet hatte, knöpfte die Weste zu, nahm die goldene Uhr heraus, die der Vater ihm geschenkt hatte, als er den Doktortitel in Baltimore gemacht hatte, und meinte: »He, es wird Zeit, daß wir vorwärtskommen, sonst packt uns die größte Hitze, noch ehe wir den Wald erreichen.«
Der Wald aber lag noch sieben Meilen von der Feldhütte entfernt.
Wyatt half dem Gefährten nicht aufs Pferd, da er ihn genau kannte. Der Doc wollte nicht so elend erscheinen, daß er nicht einmal mehr selbst aufs Pferd steigen könnte.
Aber der Anfall, der ihn vorhin aus dem Sattel geworfen hatte, war fürchterlich gewesen, und Holliday hatte sich noch keineswegs, wie früher meistens schnell von ihm erholt.
Was der Marshal befürchtet hatte, traf ein. Schon nach wenigen Meilen brach dem Spieler der Schweiß wieder aus, und er mußte sich mit beiden Händen ans Sattelhorn krampfen, um nicht vom Pferd zu fallen.
Wyatt hielt sich dicht neben ihm, um ihn notfalls sofort auffangen zu können.
Holliday hatte es längst bemerkt, aber er sagte nichts mehr.
Gnadenlos schleuderte die lodernde Sonnenfackel aus dem tiefblauen Arizonahimmel ihre Glut auf das heiße Land.
Der Marshal hatte fieberhaft überlegt. Jetzt sagte er mit heiserer Stimme:
»Nicht weit von hier ist die Harper-Ranch, Doc.«
Holliday antwortete nicht. Er ließ es geschehen, daß der Missourier die Zügelleine des Rappen ergriff und das Tier von der Straße weg querfeldein auf die schmale Zwillingsspur führte, die von den Wagenreifen der Ranch in das steppige Gras gezogen worden waren.
Es dauerte noch eine unendliche Stunde, bis sie fern am Horizont über der in der Sonnenglut schwimmenden Savanne die Bauten der Ranch auftauchen sahen.
Glanzlos und stumpf waren die Augen des Spielers nach vorn gerichtet. Er schien kaum noch wahrzunehmen, was sich um ihn tat.
Wyatt blieb so dicht neben ihm, daß er nur die Hand auszustrecken brauchte, um ihn notfalls festzuhalten.
Aber der Spieler kippte nicht aus dem Sattel. Seine Hände krampften sich so eisern ums Horn, daß seine Fingerknöchel weiß aus der blaßbraunen Haut hervortraten.
Es war kurz nach Mittag, als sie die Ranch erreichten.
Das Tor stand offen, und Wyatt blickte auf den weiten Hof, über dem die Hitze des Mittags flimmerte.
Ein kalbsgroßer Hund trottete ihnen müde und schweifwedelnd entgegen, blieb einige Yards vor ihnen stehen und schlug dann völlig unerwartet ein infernalisches Gebell an. Ebenso abrupt verstummte das Tier wieder, wandte sich um und trottete auf seine Hütte zu, um darin zu verschwinden.
Drüben am Ranchhaus wurde die Tür geöffnet, und eine junge Frau von höchstens zwanzig Jahren erschien in ihrem Rahmen. Sie war mittelgroß, dunkelhaarig, helläugig und ebenmäßig gewachsen. Sie trug ein himmelblaues, fußlanges Kleid und darüber eine weiße Schürze. Als sie die beiden Männer sah, kam sie ihnen bis an den Rand der breiten Verandatreppe entgegen.
Der Missourier rief ihr zu: »Hallo, Miß. Wäre es vielleicht möglich, ein Quartier bei Ihnen zu bekommen?«
Die Frau warf einen kurzen bezeichnenden Blick zu der im Zenit stehenden Sonne, wurde aber von dem Marshal sofort aufgeklärt.
»Natürlich, es ist noch sehr früh am Tage, aber wir wollen nicht mehr weiter, weil mein Gefährte sich nicht wohl fühlt.«
Sofort veränderte sich das bisher ablehnende Verhalten der Frau. Sie kam in den Hof, trat an das Pferd des Spielers und reichte ihm die Hand.
»Darf ich Ihnen helfen?«
Eine Blutwelle schoß über das blasse Gesicht des Georgiers. Er schüttelte den Kopf.
»Thanks, Madam.« Dann stieg er ab.
Wyatt sah, daß er sich gegen den Pferdeleib lehnen mußte, um nicht zu stürzen. Die Frau, die es natürlich auch sofort gesehen hatte, blickte den Marshal erschrocken an, sagte aber auf einen bittenden Blick von ihm sofort:
»Mein Name ist Suzan Harper. Ich bin die Tochter des Ranchers. Sie haben Glück, Mister. Mein Bruder Clarke ist vor ein paar Tagen nach St. Louis aufgebrochen, so daß seine beiden Zimmer zur Verfügung stehen.«
Doc Holliday stand mit abwesendem Gesicht da und starrte über den Hof.
Wyatt hatte den Hut abgenommen und sagte:
»Mein Name ist Earp. Wir kommen von –«
»Earp?« Die Frau warf den Kopf herum und blickte ihn aus großen himmelblauen Augen forschend an. »Jetzt weiß ich auch, woran Sie mich erinnern. Wir haben einen Mr. Earp gekannt. Vor einigen Jahren. Morgan Earp!«
Ein Schatten flog über das Gesicht des Missouriers.
»Er war mein Bruder.«
»Dann sind Sie Virgil Earp, der Marshal von Tombstone?«
Wyatt schüttelte den Kopf.
»Nein…«
Ehe er noch etwas hinzufügen konnte, stieß die Frau hervor:
»Demnach also wären Sie – Wyatt Earp?«
Der Missourier nickte.
Die Frau wandte den Kopf dem Spieler zu.
»Dann ist dieser Mann Doc Holliday?«
»Ja, wir sind auf dem Weg zurück nach Dodge City.«
Die junge Frau hatte ihre Verblüffung rasch überwunden und fand sich in die Situation. »Kommen Sie bitte, ich führe Sie zu Ihrem Zimmer, Doc«, sagte sie und geleitete den Spieler zur Beruhigung des Marshals nicht etwa zur Treppe, die zum Obergeschoß führte, sondern durch den Korridor in ein Zimmer, das sehr groß war und zwei Fenster hinaus in den schattigen Garten hatte.
Kaum hatte Suzan Harper den Raum verlassen, als der Spieler auch schon auf das Bett niedersank.
Wyatt ging hinaus und sah die Frau am Ende des Korridors stehen.
»Es tut mir leid, Miß Harper, daß ich Ihre Hilfe in Anspruch nehmen muß.«
»Er ist sehr krank, nicht wahr?« sagte die Frau.
»Ja, sehr krank.«
»Ich habe viel von Ihnen gehört, Marshal. Erst vor einigen Tagen kam mein Vater abends aus Gleason und berichtete von Ihrem Kampf gegen die Maskenmännerbande. Wer hätte gedacht, daß Sheriff Larkin der Große Chief war…«
In diesem Augenblick trat ein hochgewachsener, breitschultriger Mann in die Tür des Ranchhauses und blickte fragend auf den Missourier.
Suzan deutete auf den Missourier und sagte:
»Vater, das ist Marshal Earp. Morgans Bruder –«
Das Gesicht des Ranchers hellte sich sofort auf.
Er war ein biederer, bärtiger Mann, der ein Vierteljahrhundert hier auf diesem Stück Erde für den Aufbau seiner großen Viehranch gearbeitet hatte. Während dieser Jahre hatte er gegen manche Banditen und früher auch gegen Indianer zu kämpfen gehabt. Er wußte also einen Mann wie den berühmten Marshal zu schätzen.
Harper trat jetzt auf Earp zu, reichte ihm die Hand und sagte: »Es freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Earp. Vor einigen Jahren haben wir auch Ihren Bruder Morgan kennengelernt.«
Das Mädchen erklärte: »Doc Holliday ist mit dem Marshal gekommen. Er fühlt sich nicht gut. Er ist krank. Ich habe ihm Clarkes Zimmer gegeben.«
Der Rancher nickte sofort. »Es ist gut, Suzan. Kann ich nach dem Doc sehen?«
Der Marshal nickte.
Als der Rancher an die Tür des Spielers klopfte, erhielt er keine Antwort. Vorsichtig öffnete er, um dann die Tür sofort weit aufzustoßen.
»Marshal!« rief er mit dumpfer Stimme.
Wyatt und die Frau kamen sofort herbeigelaufen und sahen das Bild, das den Rancher so erschreckt hatte. Der Georgier saß auf der Kante des Bettes, war schweißüberströmt, und die weiße Hemdbrust war blutdurchtränkt.
Wyatt, der für den Bruchteil einer Sekunde wie gelähmt dagestanden hatte, stürzte dann auf ihn zu und ergriff ihn an der Schulter.
»Doc! Was ist geschehen?«
Holliday hob den Kopf und blickte ihn aus traurigen Augen an.
»Ein Blutsturz…« Er konnte die drei Silben kaum hervorbringen.
»Um Himmels willen«, meinte der Rancher, »was können wir da tun?« Er blckte verzweifelt seine Tochter an.
Wyatt aber sah in die Augen des Freundes.
»Doc, sagen Sie, was wir tun sollen.«
Der Spieler schüttelte den Kopf.
»Nichts. Es ist nichts zu tun. Nichts mehr…«, brach es röchelnd aus seiner Kehle.
»Soll ich Sie auf das Bett zurücklegen?«
»Danke, ja.«
Die Frau half dem Marshal. Sie legten den Kranken zurück und stützten seinen Kopf.
»Möchten Sie irgend etwas haben?« fragte der Rancher, der mit schreckensbleichem Gesicht am Fußende des Bettes stand.
Der Spieler schüttelte den Kopf.
»Thanks, Rancher, nichts.«
Die drei Menschen verließen das Zimmer und standen dann ratlos im Korridor.
»Was soll bloß geschehen?« meinte Harper. »Wir müssen doch irgend etwas unternehmen.«
»Ich werde nach Tombstone reiten und Doc Sommers holen.«
»Nein, lassen Sie nur«, meinte der Rancher. »Ich schicke einen meiner Leute, Fred Coldwell. Er ist ein guter und schneller Reiter. Ich gebe ihm mein bestes Pferd. Er wird den Doc so rasch wie möglich hierher bringen.«
Da öffnete sich hinter den dreien zu ihrer Bestürzung die Tür von Hollidays Kammer.
Mit wachsbleichem, eingesunkenem Gesicht stand der Spieler da, hielt die schwarze Jacke oben am Hals zu und klammerte sich mit der anderen Hand am Türrahmen fest.
»Wyatt, bitte nicht Sommers. Es… hat nicht den geringsten Wert… Er kann nichts tun.«
Holliday wäre sicher zusammengebrochen, wenn der Missourier nicht blitzschnell hinzugesprungen wäre und ihn aufgefangen hätte, um ihn zurück zu seinem Lager zu bringen.
Obgleich der Rancher immer noch glaubte, daß Doc Sommers dem Georgier helfen könnte, respektierte der Marshal den Wunsch des Spielers.
»Lassen Sie nur, Mr. Harper, es hat keinen Zweck. Erstens ist er selbst Arzt und weiß, was noch getan werden kann. Und zweitens ist es sicher besser, wenn wir ihm den Willen lassen…«
Der Abend hatte sich über die Harper-Ranch gesenkt. Noch ließ die Hitze nicht nach. Die steingefügten Sockel der Bauten schleuderten die aufgespeicherte Glut des Tages mit doppelter Wucht zurück.
Der Missourier lehnte auf dem Vorbau an einem Dachpfeiler und blickte sinnend über den Ranchhof, wo jetzt mehrere Cowboys auf staubbedeckten Pferden zurückkamen.
Die Neuigkeit hatte sich rasch herumgesprochen. Der Marshal bemerkte, daß die Weidereiter statt wie sonst den Feierabend lärmend zu begehen, sich auffällig ruhig verhielten.
Die Nacht kam – und sie verging.
Wyatt Earp hatte im Nebenraum geschlafen und immer wieder nach dem Gefährten gesehen.
Die Nacht war still gewesen, aber Holliday hatte sie schlaflos verbracht. Wieder brach ein sonnenüberstrahlter, glühender Julitag an.
Der Marshal stand am Fenster von Hollidays Zimmer und blickte auf den gepflegten Ziergarten hinaus, in dem Suzan Harper bereits mit der Gießkanne beschäftigt war.
Da hörte er hinter sich die Stimme Hollidays:
»Sie müssen weiterreiten, Wyatt.«
Der Marshal wandte sich um und blickte auf das Lager hinüber, wo sich aus dem weißen Linnen das eingefallene Gesicht des Spielers abhob.
»Sie müssen nach Dodge, und zwar heute noch«, kam es unter größten Anstrengungen von den Lippen des Georgiers.
»Nein, Doc, ich werde hierbleiben.«
»Es geht nicht, Sie müssen reiten. Sie wissen, daß es für mich kein guter Gedanke wäre, wenn Sie meinetwegen hierblieben.«
Nach einer Viertelstunde hatte der Marshal nachgegeben und dem todkranken Gefährten versprochen, noch heute weiterzureiten.
»Es ist gut, Doc. Ich werde sehen, was in Dodge los ist. Dann komme ich zurück.«
Kein Muskel im Gesicht des Georgiers bewegte sich.
Wyatt trat an das Lager heran und reichte dem Freund die Hand. Der Spieler legte seine schlanke, nervige Rechte hinein, und Wyatt drückte sie.
»Leben Sie wohl, Doc. Wir sehen uns bald wieder.«
Holliday sagte nichts.
Mit einem unguten Gefühl in der Brust verließ der Marshal den Raum.
Im Korridor stand Suzan Harper und blickte ihn fragend an.
Wyatt sagte halblaut: »Ich muß weiterreiten. Aber ich habe ihm versprochen, daß ich zurückkomme.«
Das Mädchen nickte. »Sie können sich darauf verlassen, Marshal, wir werden für ihn sorgen. Mein Vater hat gesagt, daß außer Ihnen kein Mann so viel und hart gegen die Banditen Arizonas gekämpft hat wie Doc Holliday. Wir haben also in gewisser Hinsicht etwas an ihm gutzumachen.«
Wyatt reichte ihr die Hand.
In dem Augenblick, in dem er aus der Haustür trat, um zum Stall hinüberzugehen, ritten fünf Männer in den Hof.
Voran ritt auf einem gescheckten Pferd ein hochaufgeschossener, breitschultriger Bursche, dessen vierkantiger Schädel halslos auf dem massigen Rumpf zu sitzen schien. Sein Gesicht war von Pockennarben bedeckt, und die schiefergrauen Augen standen weit auseinander. Seine Nase war breitgeschlagen, die Lippen aufgeworfen. Vorstehend und in der Mitte gespalten war das mächtige Kinn. Die Stirn floh unter den Hutrand zurück, und die vorspringenden Backenknochen gaben dem Gesicht etwas Affenartiges. Der graue Hut wurde von einem ledernen Sturmband gehalten, und er war an den Seiten von großen Schweißflecken durchsetzt. Der Mann trug ein schmieriggelbes Halstuch und ein graues Kattunhemd. Um die Hüften hatte er einen Kreuzgurt, in dem zwei große Revolver steckten.
Während seine Kumpane sich wartend im Hintergrund hielten, ritt der Pockennarbige bis auf die Mitte des Hofes, hielt am Brunnen an und blickte zum Bunkhaus hinüber.
Dort waren zwei ältere Cowboys damit beschäftigt, neue Bretter für die Stallboxen zu hobeln.
Der Mann mit dem gelben Halstuch kniff das linke Auge ein, stützte sich mit einem Ellbogen aufs Sattelhorn und rief mit dröhnender Stimme über den Hof:
»He, Kuhtreiber, mein Gaul braucht Wasser! Sieh zu, daß du einen der Eimer da füllst.«
Der Cowboy Jerry Tucker blickte verblüfft drein, wandte dann den Kopf und sah hinüber zum Ranchhaus, wo eben Suzan Harper hinter dem Marshal in der Tür erschien.
»Du brauchst dich nicht erst nach Hilfe umzusehen, Cowpuncher!« belferte der Fremde.
Tucker lief rot an vor Ärger, wandte sich dann ab und ging weiter seiner Arbeit nach.
Da riß der Mann mit dem gelben Halstuch sein Pferd herum und trabte auf die beiden Weidemänner zu. Als er sie erreicht hatte, zog er eine lange Bullpeitsche aus dem Gurt und riß sie hoch.
Klatschend sauste der Hieb auf Tuckers Unterarm nieder.
Der Cowboy legte sofort seine Rechte auf den Revolverknauf.
»Sie müssen den Verstand verloren haben!«
»Reiß die Waffel nicht so auf, Cowboy! Ich weiß, daß ihr allein auf dem Hof seid. Die Crew ist unten am Bighorn River bei der Herde!«
Tuckers Gesicht wurde sofort um einen Schein blasser.
»Banditen also?«
»Hör zu, Brother! Wir sind weder Banditen, noch Leute, die sich von einem dreckigen Kuhtreiber beschimpfen lassen. Los, tränke den Gaul!«
Der Marshal hatte die Veranda verlassen und betrat den Hof.
Suzan Harpers Augen folgten seiner hochaufgerichteten Gestalt.
Mit ruhigem Schritt überquerte er den Platz und blieb neben dem Pferd des rüden Tramps stehen, ohne jedoch dessen vier Begleiter aus dem Auge zu lassen.
Der Mann mit dem gelben Halstuch nahm den Kopf herum und musterte ihn.
»Wer bist du?«
»Ich bin der Mann, der hier die Pferde tränkt.«
»All right. Ich hatte zwar diesen Gauner für diese Arbeit bestimmt, aber dann wirst du das eben machen. Los, voran, ich bin Eile gewohnt.«
»Ich auch!« Wyatt packte das linke Bein des Bravos und schleuderte ihn mit einem gewaltigen Ruck aus dem Sattel.
Der lag am Boden, richtete sich sofort wieder auf und griff nach der Bullpeitsche.
Ein krachender Fausthieb des Marshals schleuderte ihn zurück.
Die vier Begleiter des Tramps, die zu ihren Waffen hatten greifen wollen, hielten in der Bewegung inne und sahen zu ihrer Verblüffung in der linken Hand des vermeintlichen Cowboys einen schweren Revolver mit überlangem, sechskantigem Lauf blinken.
»Laßt die Hände von den Kanonen, Boys. Wir schätzen hier keine Schießereien. Dies nur zu eurer Information.«
Der Mann, der von dem Faustschlag zurückgeschleudert worden war, lag im Sand. Er richtete sich jetzt auf die Ellbogen auf und wischte sich dann mit der linken Hand übers Gesicht. In seinen schiefergrauen Augen blitzte der Zorn.
»Das wirst du bereuen, Cowpuncher!«
Wyatt hatte den Colt mit einem Handsalto ins Halfter zurückfliegen lassen. Er blickte dem Tramp furchtlos entgegen. Der stürmte urplötzlich hoch und sprang auf ihn zu. Wyatt steppte einen Schritt zur Seite, stieß die Linke rammpfahlartig nach vorn und traf den Gegner genau aufs Brustbein. Nach Luft schnappend stand der Tramp da und keuchte:
»Warte, jetzt werde ich dich in den Boden stampfen, elender Kojote!«
Wyatt hob die linke Hand an. »Hör zu, Freundchen, du bist gewarnt. Ich habe dir gesagt, daß wir hier keine Schießereien schätzen. Aber auf Schlägereien sind wir eingestellt. Ich bin auch hierfür vom Boß eingeteilt. Come on!«
Der texanische Bandit Mike Torrey war zu wenig Menschenkenner, als daß er in dem vermeintlichen Cowboy den überlegenen Gegner hätte erkennen können. Er stürmte auf ihn zu, wurde von einem rechten Cross abgefangen, suchte selbst einen linken Heumacher zu landen, fraß dafür aber einen vollen linken Wurfhaken, der ihn genau auf der Herzspitze traf und von den Beinen riß.
Ted Grey, ein untersetzter, breitschultriger Mann, der aus dem mittleren Arkansas stammte und wegen Bandenüberfalls in drei Staaten gesucht wurde, stieß seine rechte Hand zum Revolver. Der links neben ihm haltende Jeff Flegger aus Ohio tat das gleiche. Der lange Jerry Pratt aus Tennessee und Joe Fleshland aus Portland Orregon, folgten nur eine Zehntelsekunde später.
Zu spät aber für alle vier: Wyatt Earp hatte in jeder Hand einen seiner Revolver, und die Hähne waren bereits gespannt.
»Ich habe mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt, Boys: Auch auf Schießereien jeder Art sind wir hier eingestellt. Der zuständige Mann dafür bin ebenfalls ich. Tut mir leid. Hände hoch! Wird’s bald? Langer, nimm deine Flossen in Schulterhöhe, sonst brennt’s!«
Pratt als einziger hatte versucht, seinen Colt zu ziehen.
Der Schuß, der über den Hof brüllte, stieß ihm die Waffe aus dem Halfter und sengte seinen rechten Zeigefinger an.
Torrey, der in diesem Augenblick wieder zu sich gekommen war, schüttelte den Kopf, suchte sich zu erheben, knickte aber wieder auf das linke Knie ein und torkelte zum Brunnen.
Da stand ein Eimer Wasser, in den er den Kopf hineinsteckte. Er schüttelte sich wie ein regennasser Hund, kam prustend zurück, stemmte die Arme in die Hüften, stand breitbeinig da und stieß eine dröhnende Lache aus.
»Cowboy, du bist in Ordnung!« Er schlug Wyatt mit der Rechten auf die Schulter, und mit seinem bellenden Lachen fuhr er fort: »Ich hab’s ja gesagt, hier auf der Ranch machen wir unser Glück. Junge, du bist ein As! Du bist mir hier für zu viele Dinge zuständig. So was wie dich brauche ich auch.«
»Kann ich mir denken«, entgegnete der Marshal schroff. »Jetzt tränkst du deinen Gaul, und auch deine Leute können die Pferde tränken. Und dann nichts wie weiter. Wir haben hier Arbeit.«
Das Lachen fiel aus Torreys Gesicht und schien in seinen gelben, lückenhaften Zahnreihen hängenbleiben zu wollen.
»Nein, nein, so wird das nichts. Für eine Ranch bist du zu schade, und für mich bist du gerade gut genug. Jeder meiner Boys ist eine Kanone für sich. Du fehlst mir in der Serie noch.«
Plötzlich wußte Wyatt, wo er diesen Mann schon gesehen hatte. Es war fast elf Jahre her, als er in Oklahoma City in einer Schenke bei einer Schlägerei den texanischen Rinderdieb und Bandenführer Mike Torrey beobachtet hatte. Seit einiger Zeit hatte sich der Desperado an der Grenze New Mexicos und Arizonas herumgetrieben. Und jetzt, als er gehört hatte, daß die Galgenmännerbande zerschmettert worden war, hatte er den Weg ins südliche Arizona genommen, um hier auf seine Art ein wenig die Nachfolge des grauen Clans anzutreten. Vielleicht war es ja möglich, die Nachwirkung der Angst vor den Geisterreitern noch auszubeuten.
Wyatt stand breitbeinig vor dem Banditen, auch jetzt ohne seine Kumpane aus dem Auge zu lassen. Er hatte die Arme über der Brust verschränkt und das linke Auge etwas eingekniffen.
»Ich habe keine Zeit, mich mit dir zu unterhalten, Torrey. Tränk’ deinen Gaul und zieh ab.«
Der Rinderdieb wich einen Schritt zurück, schob den Kopf nach vorn und preßte die Zähne aufeinander, während er heiser hervorstieß:
»Du kennst mich?«
»Natürlich, wer kennt dich nicht.«
»He, das ist vielleicht nicht gut für dich. Schon mancher Bursche hat es bereuen müssen, daß er mich erkannte.«
»Ja, ich weiß. Zum Beispiel Jonny Chesterfield drüben in Oklahoma City.«
Der Bandit legte den Kopf in einer seltsamen Manier auf die linke Schulter.
»Damned! Mir ist so, als hätte ich dich auch schon gesehen! Was hattest du in Oklahoma zu suchen?«
»Meine Sache. Tu’, was ich dir gesagt habe: Tränk’ deinen Gaul und verschwinde.«
»Ich habe es nicht gern, wenn jemand so mit mir spricht, Cowboy. Deine schnelle Linke in allen Ehren. Du hast mich überrumpelt, nichts weiter. Jetzt bin ich darauf gefaßt. Und weißt du, was ich mit solchen Burschen aufstelle? Ich stampfe sie ungespitzt in den härtesten Boden. Ich glaube, du bist nicht scharf darauf.«
Wyatt wandte sich ab, ging zum Stallhaus hinüber, um sein Pferd zu satteln.
Er hatte das Tor noch nicht erreicht, als ein Revolverschuß aufbrüllte und ihm den linken Stiefelabsatz aufriß. Im Fallwurf wirbelte der Missourier herum und feuerte zwei Schüsse aus seinem Buntline-Colt ab.
Das erste Geschoß stieß dem Tramp die Waffe aus der Hand, und das zweite fegte Pratt, der nach seinem linken Revolver gegriffen hatte, ebenfalls den Colt aus der Faust.
»Jetzt reicht’s, Freunde. Wir haben für derartige Scherze keine Zeit! Entweder verschwindet ihr jetzt, oder es gibt furchtbaren Dampf.«
Torrey stand verblüfft da, hatte die Hand noch vorgestreckt und stierte dem Missourier fassungslos in die Augen.
»He, du bist tatsächlich mehr wert, als meine vier Boys zusammen. So was hab’ ich noch nicht gesehen seit Wes Hardins Zeiten. Junge, ich reite nicht ohne dich.«
Wyatt ließ den Colt ins Halfter zurückfliegen. Er kam jetzt mit raschen Schritten auf Torrey zu.
Der Bandit wich vorsichtshalber zurück, stolperte über einen Eimer am Brunnen und erhob sich wieder. Einlenkend nahm er die Hände hoch.
»Hör zu, Cowboy, es gibt keinen Grund zur Aufregung. Wir reiten ja, aber wir beide müssen noch ein Geschäft miteinander machen. Ich muß dich für mich haben. Und ich lasse es mich etwas kosten.«
Wyatt war jetzt bis auf zwei Schritte an ihn herangekommen, stand hoch aufgerichtet vor ihm und überragte ihn noch fast um Haupteslänge. Er senkte seinen Blick in die Augen des Banditen.
»Hör zu, Torrey. Ich habe bereits zu viel Zeit mit dir verloren. Klettere auf deinen Klepper und verschwinde, und zwar augenblicklich, sonst lernst du mich kennen.«
»He, ich weiß gar nicht, was du willst. Ich bin ein friedlicher Junge und habe dir ein anständiges Angebot zu unterbreiten.«
Wyatt nahm den Hut, legte ihn auf den Brunnenrand, zog seine Weste aus und krempelte die Ärmel hoch.
»Damit wir uns genau verstehen, Mike Torrey, nach dieser Lektion hast du keinerlei Wünsche mehr an mich und wirst überhaupt in den nächsten drei Tagen kaum noch irgendeinen anderen Wunsch haben, als den nach absoluter Ruhe.«
Torrey ging rasch zu seinem Pferd zurück, zog sich in den Sattel und nahm die Zügelleinen auf. In seinem pockennarbigen Gesicht standen hektische Flecken.
»All right, wir gehen, weil wir friedliche Leute sind. Aber wir sehen uns wieder, verlaß dich drauf.«
»Ich möchte es dir nicht raten, Torrey!«
Der Bandit nahm sein Pferd herum.
Pratt, der immer noch auf dem Hof hielt, stieß einen Fluch durch die Zähne. »Es ist so, wie Mike gesagt hat: Wir sehen uns wieder. Und dann hat deine letzte Stunde geschlagen, Cowboy!«
Wyatt zog es vor, dieser massiven Drohung keine Antwort zu widmen.
Er ging, als der letzte Tramp den Hof verlassen hatte, zum Stall hinüber und sattelte seinen Falbhengst auf. Als er sich in den Sattel zog, sah er Suzan Harper im Stalltor auftauchen.
»Es tut mir leid, Mr. Earp, daß Sie hier noch Ärger gehabt haben.«
»Ach, machen Sie sich keine Sorgen darum, Miß. Ich kenne den Halunken. Es ist Mike Torrey, ein Rowdy aus dem oberen Texas. Ich habe ihn in Oklahoma getroffen. Mag der Teufel wissen, was die Banditen hierher nach Arizona gezogen hat. Die meisten verbrennen sich hier doch nur die Finger.«
»Darf ich Ihnen nicht noch etwas mitgeben?« erkundigte sich die Frau.
»Nein, danke, unsere Vorräte waren ohnehin für einen längeren Ritt bestimmt und sind noch aufgefüllt. – Hoffentlich kommt die Bande nicht zurück.«
»Das glaube ich nicht«, meinte die Frau. »Torrey weiß ja, daß unsere Cowboys zu Mittag wieder zurück sein werden. Offenbar hat er sich ja nach allem genau erkundigt. Nein, ich habe keine Angst. Außerdem sind Tucker und Billinger da. Billinger ist ein ausgezeichneter Schütze. Und daß Tucker sich nicht fürchtet, haben Sie ja gesehen. Machen Sie sich nur keine Sorgen, und reiten Sie mit Gott, Mr. Earp.«
Der Marshal zog sich in den Sattel und ritt, nicht eben leichten Herzens, aus dem Ranchtor. Er sah die Banditen weit oben im Westen über eine Hügelkette davonreiten.
Torrey spielte tatsächlich nicht mit der Absicht, jetzt zurückzukehren, obgleich Pratt anderer Ansicht war. Der Bandenführer konnte den anderen jedoch bestimmen, auf die sofortige Rache zu verzichten.
»Hört zu, Leute«, mahnte er. »Wo so ein Kerl ist, gibt’s noch mehr von dieser Sorte, verlaßt euch drauf. Ich kenne das. Ein Rancher, der sich solche Büffel hält, umgibt sich mit einem Dutzend davon, und wir haben die Cowboys ja gesehen. Nein, nein, Boys, die Sache will überlegt sein…«
*
Der Tag war vergangen. Wieder senkte die Nacht ihre schwarzen Tücher über das Land und bettete die Ranch in tiefe Stille.
Der Zustand Doc Hollidays war unverändert. Reglos ruhte er auf seinem Lager, und neben ihm stand noch unberührt das Abendbrot.
Es war kurz nach halb zehn.
Suzan Harper klopfte leise an die Tür, und als sie die schwache Stimme des Kranken hörte, öffnete sie einen Spaltbreit und fragte: »Haben Sie noch einen Wunsch, Doc?«
»Nein«, kam es leise zurück.
»Darf ich einen Augenblick hereinkommen?«
»Bitte.«
Das Mädchen trat ein und blieb am Fenster stehen.
»Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, Doc. Es wird schon alles gut. Ich hatte einen Onkel, der war auch sehr krank und hatte furchtbare Schmerzen in der Brust. Auch einen Blutsturz hatte er schon, und doch hat er sich wieder erholt.«
Der Spieler nickte, und ein schwaches Lächeln flog um seinen Mund. Er wußte genau, daß das Mädchen ihm nur Mut zusprechen wollte. Seinen Zustand kannte er schließlich besser als jeder andere.
Die kleine Suzan Harper hatte unendliches Mitleid mit dem todkranken Mann. Es waren nicht nur die Worte des Vaters gewesen, die in ihr eine große Hochachtung für den Mann aus Georgia hatte aufkommen lassen; sie dachte auch an die Gazetten, in denen sie immer und immer wieder den Namen dieses Mannes gelesen hatte, der mit geradezu fataler Selbstlosigkeit an der Seite des Marshals gegen das Banditenwesen gekämpft hatte.
»Sie brauchen sich wirklich keine Sorgen zu machen, Doc. Sie können bei uns bleiben, so lange Sie wollen. Außerdem hat Mr. Earp gesagt, daß er zurückkommt, um Sie abzuholen. Sie sind gut bei uns aufgehoben und können bleiben, so lange es Ihnen gefällt. Und wenn Sie sich besser fühlen, werden Sie draußen im Garten sitzen. Morgens und nachmittags ist es unter den schattigen Bäumen, die unsere Mutter noch gepflanzt hat, angenehm.«
Sie ahnte sicher nicht, daß ihre Worte dem todkranken Manne wie Honig eingingen.
»Und wenn Sie irgendeinen Wunsch haben, so brauchen Sie nur dort an die Wand zu klopfen. Ich höre es immer, denn ich habe einen leichten Schlaf.«
Sie lachte ihr silberhelles, frisches Lachen und ging hinaus. Dieses Lachen war das letzte, was der kranke Doc Holliday von der lebensvollen Suzan Harper hören sollte.
Das Mädchen ging den Korridor hinunter zur Küche, räumte das Geschirr weg und las noch einmal den Brief, den der Vater am Vormittag bekommen hatte. Es war ein Brief ihres Bruders Clarke aus Gleason.
Er hatte wie immer nur Flausen im Kopf. Clarke war das schwarze Schaf in der Familie und das Schmerzenskind des Ranchers. Der Hof interessierte ihn überhaupt nicht, und ständig hatte er neue Ideen im Kopf, die ihn in den Sattel brachten und der Ranch den Rücken kehren ließen. So hatte er auch jetzt dem Vater wieder sechshundert Dollar abgeluchst, angeblich um einen guten Pferdekauf in St. Louis zu tun. Suzan hingegen wußte genau, daß er dieses Geld, wie auch alles frühere, in irgendeiner der düsteren Schenken Gleasons am grünen Tisch verspielen würde.
Kurz vor halb elf blickte der Vater noch einmal in die Küche und wünschte Suzan eine gute Nacht. Harper hatte bis jetzt mit dem Vormann drüben beim Bunkhaus gestanden und über den Ankauf der Pferde gesprochen. Er hielt immer noch große Stücke auf seinen Sohn.
Jetzt begab er sich oben in seiner Kammer zur Ruhe.
Es waren also zu dieser Stunde nur drei Bewohner im Ranchhaus der Harper-Ranch: Doc Holliday, James Harper und seine Tochter Suzan.
Die hübsche lebensfrohe Suzan ahnte sicher nicht, daß von ihrer letzten Lebensstunde schon siebenundfünfzig Minuten verstrichen waren, als sie die kleine Kerosinlampe vom Tisch nahm und die Küche verließ.
Leise ging sie zu ihrem Zimmer, öffnete die Tür und erschrak bis ins Mark, als sie im schwachen Lichtkreis die Gestalt eines Mannes stehen sah.
Der Revolver in der rechten Faust des Eindringlings erstickte ihr den Schrei in der Kehle.
Dann aber wandte sie sich um und wollte flüchten.
In diesem Augenblick brülle der Revolver in der Faust des Mannes auf. Die Kugel durchschlug hinten links den zweiten und dritten Rippenbogen und bohrte sich genau ins Herz des unglücklichen Mädchens.
Dennoch war Suzan Harper noch nicht sofort tot. Zwei qualvolle Minuten lebte sie noch und verröchelte auf der Schwelle ihres Zimmers ihr Leben in den Armen Doc Hollidays, der sich keuchend herbeigeschleppt hatte, sie hochstützte, aber sofort sah, daß er ihr nicht mehr helfen konnte.
Mit schweißnassem Gesicht lehnte der Georgier im Türrahmen, hatte die Rechte noch um den Oberkörper der Toten geschlungen, als der Rancher die Treppe hinuntergepoltert kam und im Schein der blakenden Kerosinlampe die schreckliche Szene erblickte.
*
Fern oben in Dodge City war Jonny Ringo mit dreiundzwanzig Männern über den alten Chisholmstrail in die Stadt gekommen. Er machte sich im Long Branch Saloon breit und verkündete mit theatralischen Worten, daß er gekommen sei, um das Erbe der Clantons in Kansas anzutreten.
Diese Worte waren natürlich eine Unverschämtheit, denn Jonny Ringo gehörte jahrelang zu den Banditen, die noch schlimmer als die Clanton-Gang gewütet hatten. Er und seine Freunde Peshauer, James Curly Bill, die Flanagans, Pete Spence junior und viele andere hatten dem Marshal jahrelang zu schaffen gemacht. Während die Clantons auf ihr Gebiet im Cochise County in Arizona beschränkt blieben und selten weiter als fünfzig oder hundert Meilen ritten, war Jonny Ringo ein Desperado, der überall auftauchte.
Was er eigentlich in Dodge City wollte, war Bat Materson, der Wyatt Earp auf dem Marshalposten vertrat, so wenig klar wie irgend jemand sonst in Dodge. Höchstwahrscheinlich hatte er nur die Absicht, Unruhe in die Stadt zu bringen und die Leute an den Spieltischen zu erschrecken. Er hatte das früher schon gemacht, um auf diese Weise mit seiner Crew zu billigem Gewinn zu kommen. Denn wer hätte es gewagt, gegen eine so starke Mannschaft aufzumucken, wenn er einmal am Spieltisch verlor? Und Jonny Ringos Leute pflegten zu gewinnen!
Ringo hatte überhaupt nur ein einziges Spiel in seinem Leben verloren – das Spiel mit Doc Holliday. Eigentlich waren es zwei Spiele gewesen. Das erste am filzbezogenen grünen Tisch, und das zweite ging um das Herz der schönen Laura Higgins. Er hatte beide Gänge an den Georgier abgeben müssen und ihm deshalb ewige Rache geschworen.
Bei den erbitterten Fights der Clantons gegen Wyatt Earp in Tombstone hatte Ringo sich immer rechtzeitig davonzumachen verstanden. So war er auch kurz vor dem Kampf im O.K.-Corral und bei den späteren Fights nie in der Stadt gewesen. Irgendwie hatte der Dandy-Schießer ein feines Gespür dafür, wenn es brenzlig wurde.
So wußte er auch jetzt genau, daß Wyatt Earp nicht in der Stadt war, und hatte sich, mit dreiundzwanzig Männern in Dodge City eingefunden, um die Stadt etwas »in Bewegung zu bringen«, wie er es nannte. Dabei wollte er schon seinen Gewinn herausschlagen. Er war kein Mann wie der stolze Ike Clanton, der einen erbitterten Kampf um seine vermeintliche Freiheit geführt hatte. Jonny Ringo war im Grunde seines Wesens ein armseliger Geschäftemacher, ein Strolch, ein Falschspieler, ein Rinderdieb, und das einzige, worauf er sich wirklich verstand, war der Umgang mit seinem Revolver.
Jonny Ringo hatte sich von frühester Jugend an auf die andere Seite des Gesetzes gestellt. Vermutlich stammte er von der Grenze Niederösterreichs und hieß eigentlich Johann Ringold. Bemerkenswert war immerhin, daß es noch niemandem gelungen war, diesen Vagabunden an den Strick zu bringen.
Doc Holliday hatte in ihm nie einen so gefährlichen Gegner sehen können, wie einst in Ike Clanton und in Cass Larkin. Er sah in Ringo nur den Rivalen, der ihn wegen der Frau haßte, die Holliday selbst doch nicht an sich binden wollte. Aus diesem Grunde hatte Holliday ihn in den Revolverkämpfen auch niemals ernstlich verletzt. Obwohl Ringo von den beiden Dodgern Earp und Holliday nicht ernst genommen wurde, war er doch ein äußerst gefährlicher Mann, der genau wußte, daß er mit einer Mannschaft von dreiundzwanzig Reitern im Rücken viel erreichen konnte.
Das Furioso, das Ringo in Dodge losließ, war also entsprechend.
Bat Masterson hatte alle Hände voll zu tun, in den einzelnen Schenken für Ruhe zu sorgen. Vor allem aber hatte sich Ringo selbst mit seinen nächsten Getreuen im Long Branch Saloon breit gemacht und führte dort das große Wort.
Der bullige Bat Masterson stand an diesem Tage im Marshals-Office in der Tür, und hinter ihm lehnte der lange Potts, der gerade knurrte:
»Hol’s der Teufel, wenn bloß der Marshal bald käme!«
»Er wird kommen«, gab Masterson halblaut zurück. »Ich habe ihm eine Depesche geschickt.«
Potts stieß den Chief-Deputy an. »Was? Eine Depesche? Das haben Sie doch noch niemals getan!«
Masterson wandte sich um. Sein Gesicht war jetzt hart geworden.
»Nein, Potts, ich habe es noch niemals getan, aber diesmal ist es bitter ernst. Bisher war es ja hier verhältnismäßig still. Aber die Halunken, die jetzt gekommen sind, sind von anderem Schrot und Korn als Billinger, Flaherty und die Nelsons. Jonny Ringo ist ein gefährlicher Halunke. Und die Kerle, die er um sich geschart hat, gefallen mir absolut nicht. Mir wäre wohler, wenn der Marshal hier wäre.«
*
Etwa um die gleiche Stunde ritt Wyatt Earp noch mehrere hundert Meilen von Dodge City entfernt über die Peloncilo-Mountains an der Grenze Arizonas und New Mexicos entlang. Er wußte nichts von den Dingen, die sich in der vergangenen Nacht unten auf der Harper-Ranch zugetragen hatten.
Sechsundsiebzig Meilen hatte er durch das schwierige Gelände auf einem strapaziösen Ritt hinter sich gebracht, als er am späten Nachmittag die Ortschaft Cielo vor sich auftauchen sah.
Es war eine kleine Stadt am nördlichen Berghang, die menschenleer zu sein schien.
Vor einer staubigen Schenke hockte ein fleischiger Mann in einem Schaukelstuhl und wippte hin und her. Er hatte die Augen geschlossen, und ein erloschener Zigarrenstummel hing in seinem linken Mundwinkel. Sein schwerer Leib quoll über die Hose, und das grüne Hemd stand über der stark behaarten Brust offen.
Wyatt blickte zu ihm hinüber und sah jetzt, daß der Mann auf der linken Hemdseite einen sechszackigen Stern trug. Er war also der Sheriff dieser traurigen Stadt.
Der Missourier wollte weiterreiten.
In diesem Augenblick schlug der Sheriff die Augen auf und sprang hoch. »He, hallo, Mister!«
Wyatt hielt an und stützte sich mit der Linken auf das Hinterteil seines Pferdes.
»Ja, was gibt’s?«
»Wo kommen Sie her?«
»Drüben aus Arizona.«
»Ja, das dachte ich mir schon. Und wo wollen Sie hin?«
»Hinauf nach Kansas.«
Der Sheriff legte seinen Kopf auf die Seite, und das Sonnenlicht verfing sich in seinen rötlichen Bartstoppeln. In seinen tiefbraunen Augen stand ein lauernder Blick.
»Sind Sie vielleicht aus Tombstone gekommen?«
»Ja, ganz richtig.«
Da machte der Dicke ein paar hastige Schritte auf die Straße. »Hören Sie, ich habe eine Nachricht durchbekommen, aber ich weiß nicht, ob sie Sie betrifft. Sie ist für den Marshal Earp.«
Der Missourier war sofort hellwach.
»Ich bin Wyatt Earp.«
»Wie wollen Sie das beweisen?«
Wyatt griff in die Tasche und nahm seine Papiere und seinen Marshalsstern hervor.
Da wurde der schwammige Gesetzesmann von Cielo plötzlich munter.
»Ich habe Ihnen die Nachricht zu überbringen, daß auf der Harper-Ranch etwas geschehen ist. Sie kennen die Leute da doch?«
Wyatt glitt aus dem Sattel, und er spürte, daß ihm das Herz einen Augenblick stehenblieb.
»Was ist passiert?«
»Ein Mord.«
»Ein Mord –?« wiederholte Wyatt tonlos.
»Eine Frau ist getötet worden. Suzan Harper heißt sie.«
»Das ist doch nicht möglich«, entfuhr es dem Marshal.
»Doch, es ist so. Ich habe Ihnen die Nachricht von dem Sheriff von Gleason zu übermitteln. Er hat die Nachricht hierher durchgegeben. Wahrscheinlich auch noch an andere Ortschaften. Scheint so, daß Ihre Reiseroute bekannt war.«
»Ja, Mr. Harper hat sie gekannt«, sagte der Marshal leise. Dann blickte er wieder auf. »Wo ist das Post Office?«
»Post Office? So was haben wir hier nicht, Marshal. Aber wenn Sie hier in meinen Laden kommen wollen, da gibt’s außer Bier auch noch Briefmarken.«
»Ich möchte eine Depesche aufgeben.«
»All right, kann sofort geschehen.« Der Dicke stampfte voran in die Schenke, und jetzt sah der Marshal, daß das staubige Haus des Sheriffs von Cielo gleichzeitig das Post Office, das Sheriffsbureau und eine Bar enthielt.
»Wollen Sie selbst schreiben?« meinte der Dicke.
»Ja, geben Sie her.«
Mit harten steilen Druckbuchstaben schrieb der Marshal eine Depesche nach Dodge City auf. Dann griff er in die Tasche, um zu zahlen.
Aber der dicke Sheriff winkte ab.
»Nichts da. Für Gesetzesmänner ist das kostenlos. Erst recht für Wyatt Earp. War mir eine Ehre, Marshal –«
Der Missourier war schon draußen, zog sich in den Sattel, nahm die Zügelleinen hoch und preschte nach Südwesten davon den Pässen der Peloncilo-Mountains wieder entgegen.
*
In Dodge City war der Teufel los.
Jonny Ringo und seine Männer ließen den Dollar kreisen und nahmen ihn doppelt wieder ein.
Bat Masterson und die fünf Deputies hatten alle Hände voll zu tun, Ruhe in der Stadt zu bewahren. In der Bevölkerung wurden aufmuckende Stimmen laut: Weshalb kommt der Marshal nicht endlich zurück? Weshalb bezahlen wir einen Mann, der sich in anderen Städten mit Banditen herumschlägt?
Daß der Missourier für die Zeit, die er nicht in der Stadt war, überhaupt kein Geld in Empfang genommen hatte und auch niemals welches annehmen würde, wußten die wenigsten Bürger. Und die wenigsten machten sich auch Gedanken darüber, daß ein großer Gesetzesmann nicht irgendwo auf seinen Lorbeeren in einer ruhigen Stadt ausruhen konnte, sondern in diesem Lande, das noch so jung und wild und rauh war, überall für Ordnung zu sorgen hatte, wo es not tat.
Im Arkansas-Saloon und in der Rialto-Bar ging es hoch her, ebenso in Kellys Saloon und in der Alhambra. Am tollsten aber trieben die Ringoleute es im Long Branch Saloon.
Als gegen neun Uhr Jonny Ringo mit theatralischer Geste einen der rotüberzogenen Barhocker nahm und ihn durch die große Fensterscheibe auf den Vorbau schleuderte, daß das Glas klirrend zerbarst, spannte Bat Masterson seine haarige Faust um sein
Sharpsgewehr und ging zur Tür.
Der lange Potts folgte ihm sofort.
»He, Bat, warten Sie, die Sache will überlegt sein. Ringo hat auf einen Pfiff zwei Dutzend Männer hinter sich stehen. Wir sind im Augenblick nur zu dritt.«
Mastersons Kopf flog herum. In seinen hellen Augen stand der Ärger. »Was wollen Sie, Potts? Wyatt Earp und Doc Holliday waren allein gegen eine Übermacht von Galgenmännern. Glauben Sie, daß der Marshal seine Gegner jemals gezählt hat?«
Der lange Potts hätte nun entgegnen können, daß weder er noch der bullige Masterson Wyatt Earp waren, aber er schenkte sich diese Bemerkung, um den Chief-Deputy nicht noch mehr zu vergraulen.
Drüben johlte die Horde auf, als Jonny Ringo mit der Faust aufs Thekenblech geschlagen hatte, eine Flasche nahm, sie aufs Orchestrion schleuderte, daß der Musikkasten sich unversehens in Bewegung setzte und wimmernd den Kansas-Song in die Nacht von Dodge City hinausschrie.
Da ging Bat Masterson los, mit zusammengebissenen Zähnen, beide Fäuste um das Gewehr gepreßt, gefolgt von dem langen Potts und dem blonden Kid Kay.
Ehe sie den Long Branch Saloon erreichten, lief der alte Postmaster an ihnen vorbei und verschwand in der Schenke.
Als Masterson die Pendeltür auseinanderstieß, sah er, wie der Postmaster vor dem langen Ringo stand und ihm eine Depesche überreichte.
Der Schießer knüllte das Blatt zusammen und schob es in die Tasche.
Da tippte der Postmaster ihm auf die Schulter.
»He, Mr. Ringo, Sie sollen das lesen.«
Der Dandy-Schießer blickte sich um und schnaubte den Postmaster an:
»Was fällt dir ein, alter Strolch? Verschwinde!«
»Wie Sie wollen, Mr. Ringo. Aber Sie werden es bereuen.«
Als der Alte sich abgewandt hatte, sah er Bat Masterson in der Tür stehen.
Ringos rechte Hand hatte sich noch um die Depesche geballt. Er nahm sie jetzt heraus, faltete sie auseinander und las im Schein der beiden Lampen, die über der Theke an einem breiten Messingarm schwebten:
An Jonny Ringo, zur Zeit ungebetenerweise in Dodge City.
Ich bin unterwegs!
Wyatt Earp
Der Coltman hatte das Gefühl, daß ihm schwindelte. Er wischte sich mit dem Unterarm über die Stirn und las die Zeilen noch einmal.
Es blieb dabei. Die Depesche war von Wyatt Earp!
Ringo blickte auf und sah über ihren Rand hinweg in das entschlossene Gesicht Bat Mastersons. Auch sah der Schießer das Gewehr in der Hand des bulligen Mannes.
Damned, war es schon soweit?
Ringo nahm den Colt aus dem Halfter und feuerte zwei Schüsse aufs Orchestrion ab, die den Musikkasten augenblicklich verstummen ließen.
Dann hob er die rechte Hand.
»Boys! Ich habe eben eine freundliche Einladung bekommen, nach Garden City hinüber. Ich schätze, ihr habt nichts dagegen, nachdem wir dieses Nest hier abgegrast haben.«
Seine Männer sahen ihn verblüfft an.
»Was soll das heißen, Ringo?« knurrte der vierschrötige Jimmy Tancred. »Ich denke, wir wollen hierbleiben. Es ist doch schön in der Stadt, und die Girls sind noch schöner, am schönsten ist natürlich der Whisky im Verein mit den leichtverdienten Dollars!«
Ringos Gesicht war um einen Schein blasser geworden. Auch schien er plötzlich völlig nüchtern zu sein.
»Halts Maul, Tancred!« herrschte er den Gefährten an. »Los, Leute, holt eure Pferde aus den Corrals, es geht los.«
»Wann?« knurrte Tancred.
»Sofort!«
*
Sechsundsiebzig Meilen hatte der Missourier zurückzulegen, bis er die Harper-Ranch erreichte.
Sengende Sonne lag über dem Land. Es war später Nachmittag, als er die Strecke hinter sich gebracht hatte. In noch größerer Eile als auf dem Herritt hatte er die gewaltige Strecke überwunden.
Als die Ranch endlich vor ihm auftauchte, war der Hof leer.
Wyatt stieg vom Pferd, ging um den Scheunenbau herum und sah auf den Rücken eines Mannes, der vor einem frischaufgeworfenen Grabhügel stand.
Es war der Rancher. Gebeugt und um Jahre gealtert stand er da und blickte auf den Erdhügel nieder, unter dem seine geliebte Tochter Suzan lag.
Wyatt blieb stehen und machte sich erst nach einer Weile bemerkbar.
Der Rancher wandte sich um und blickte verblüfft auf.
»Hell and devils, Wyatt Earp!«
Der Missourier nahm den Hut ab und reichte dem Rancher die Hand.
»Es tut mir unendlich leid, Mr. Harper. Ich habe es gestern nachmittag erfahren, drüben hinter der Grenze in einem kleinen Nest namens Cielo.«
»Was, da waren Sie schon? Lieber Himmel, wie müssen Sie geritten sein. Kommen Sie.«
Als sie zur Veranda hinaufgingen, trat ihnen in der Tür ein junger Mann entgegen.
Er war mittelgroß, schmalschultrig und hatte eine leicht gebeugte Haltung. Sein Gesicht war blaß und hatte schlaffe Züge. Der Schnurrbart war ungepflegt, zu lang und stand dem Burschen überhaupt nicht. Er mochte ungefähr fünfundzwanzig Jahre alt sein und war geckenhaft gekleidet.
Der Rancher blieb stehen und wies auf ihn.
»Das ist mein Sohn.«
Wyatt reichte Clarke Harper die Hand. Es war eine schlaffe feuchte Hand, die sich unwillig in die seine fügte.
Clarke maß den Marshal mit weiten, forschenden Augen.
»Das also ist der große Wyatt Earp«, sagte er, und es schien dem Missourier, daß etwas wie Hohn in diesen Worten mitschwang.
Wyatt ging an Clarke vorbei in den Korridor, durchmaß ihn mit schnellem Schritt und klopfte an die letzte Tür.
»Marshal!« rief ihm der Rancher nach.
Aber Wyatt hatte die Tür schon geöffnet.
Das Zimmer war leer. Das Bett war zurückgeschlagen, und auf dem Nachttisch stand noch die Whiskyflasche und der Kaffeebecher.
Wyatt sah sich um. Der Schrank war leer. Hollidays sämtliche Utensilien waren verschwunden.
Er wandte sich um und ging auf den Rancher zu.
»Wo ist er?«
James Harper zog die Schultern hoch. »Ich weiß es nicht.«
»Was soll das heißen? Sie müssen doch wissen, wo er ist, Mr. Harper. Der Mann ist doch todkrank. Er kann doch nicht einfach aufgestanden und weggegangen sein. Außerdem sind ja alle seine Sachen verschwunden.«
Der Rancher zog die Luft tief ein und sagte dann:
»Als ich vorgestern nacht den Schuß hörte und die Treppe hinunter stürzte, sah ich ihn hier unten neben meiner Tochter knien. Schweißnaß und blutüberströmt.«
»Blutüberströmt?«
»Ja, seine Hände waren blutig, und da, wo er gekniet hatte, war auch ein großer Blutfleck. Ich glaube aber, daß es das Blut von meiner Tochter war.«
»Aber ich versteh das alles nicht«, brach es aus dem Marshal hervor.
»Ich auch nicht. Ich weiß nicht, was geschehen ist, Mr. Earp.«
Wyatt wich zwei Schritte zurück. »Mr. Harper«, kam es ganz leise über seine Lippen, »soll das heißen, daß Sie glauben, Doc Holliday hätte Ihre Tochter getötet?«
Der Rancher senkte den Kopf und schüttelte ihn langsam.
»Nein, Marshal, ich glaube das nicht.«
»Sie nicht – wer denn?«
Harper sah sich um. Hinten in der Tür zum Hof stand der Bursche.
Der Rancher wandte den Kopf. »Der Sheriff glaubt es.«
»Sheriff Hancoc von Gleason?«
Der Rancher nickte.
Wyatt blickte über die Schulter des Ranchers hinweg.
»Und Ihr Sohn glaubt es auch!« sagte er so laut, daß Clarke Harper es hören mußte.
Clarke wandte sich um und verschwand von der Tür.
Wyatt ging mit raschen Schritten an dem Alten vorbei auf die Veranda.
Clarke war verschwunden.
Wyatt sah sich nach allen Seiten um. Aber der Bursche war nirgends mehr zu sehen.
Der Rancher kam langsam heran und blieb hinter dem Marshal stehen. Mit ruhiger Stimme sagte er:
»Mr. Earp, es ist eine furchtbare Sache, aber die Umstände sind so, wie Sheriff Hancoc sie sieht. Nur kann ich es nicht glauben. Es ist doch unvorstellbar. Er lag doch wie ein Toter in seinem Bett.«
»Na und? Er wird aufgesprungen sein, als er den Schuß gehört hat.«
»Ja, das habe ich auch gesagt und gedacht. Aber der Sheriff und mein Sohn und die anderen sagen: Wieso ist er so plötzlich aufgewesen, wenn er vorher todkrank war? Und vor allem: Wie hätte er in den Sattel steigen und davonreiten können?«
Ja, das war allerdings die große Frage. Es wäre noch begreiflich gewesen, daß ihn der Schuß trotz seiner schlechten Verfassung hochgetrieben und an die Seite des Mädchens gebracht hatte, aber daß er die Ranch verlassen hatte, begriff niemand.
»Können Sie mir wenigstens sagen, was geschah, nachdem Sie die Treppe heruntergekommen waren und ihn neben Ihrer Tochter knien sahen?« forschte der Marshal.
»Was soll ich sagen! Ich sah nur, daß meine Tochter da lag und blutete, daß sie verblutete, unter seinen Händen!«
»Und weiter?« Die Augen des Marshals waren forschend auf das Gesicht des Ranchers gerichtet.
Der schlug die Hände zusammen und erklärte mit bebender Stimme:
»Ja, was weiter!«
»Sie sind doch hiergewesen. Was ist weiter passiert, Mr. Harper? Ich bitte Sie, mir das genau zu erklären.«
Harper griff sich an den Kopf. »Ich weiß es nicht. Ich wandte mich um, rannte in den Hof hinaus und schrie: Meine Tochter ist ermordet worden! Boys! Ein Mörder ist im Haus!«
»Und weiter?«
»Dann rannte ich über den Hof zum Bunkhaus, stieß die Tür auf und brüllte dasselbe noch einmal in den Schlafsaal der Cowboys.«
»Und was geschah dann?«
»Dann ging ich mit den Leuten zurück. Bei mir war Joe Farland, der Vormann, und Hanc Porter. Die anderen kamen nach. Als wir in den Korridor kamen, lag Suzan quer über der Schwelle ihres Zimmers mit dem Oberkörper im Flur. Die brennende Kerosinlampe stand neben ihr und…«
Der Rancher brach ab und sah dem Marshal unsicher in die Augen.
»Und Doc Holliday?« forschte Wyatt mit belegter Stimme.
Harper hob die Schultern und ließ sie wieder sinken.
»Er war weg.«
Da griff Wyatt Earp langsam nach der rechten Hand des Viehzüchters. »Aber, Mr. Harper, wollen Sie daraus etwa allen Ernstes eine Täterschaft Hollidays konstruieren? Der Sheriff kann nicht klar bei Verstand gewesen sein, als er das angenommen hat! Doc Holliday wird im Gegenteil dem Mörder gefolgt sein!«
»Aber dann hätte er uns doch irgend etwas hinterlassen können.«
»Vielleicht hat er gar keine Zeit dazu gefunden.«
»Aber niemand versteht das, bei seinem Zustand; er lag doch tagelang nahezu bewegungslos auf seinem Lager, hat kaum etwas zu sich genommen. Wie sollte er plötzlich die Kraft gehabt haben, sich zu erheben, um einem Banditen, einem Mörder zu folgen. Das ist es ja, was niemand begreift.«
Der Rancher begann sich zu ereifern und redete mit lauter Stimme weiter: »Das müssen Sie doch einsehen, Marshal. Ein Mann, der erst hilflos an der Erde liegt, kann doch nicht plötzlich die Kraft haben, sich zu erheben, um in den Sattel zu steigen und einem Verbrecher zu folgen! Das ist doch ein Unding!«
Wyatt Earp schüttelte den Kopf. »Nicht bei Doc Holliday. Ich habe miterlebt, daß er einmal vom Boden aufgestanden ist, und dann drei Männer, die einen seiner Anfälle ausnutzen wollten, um ihn niederzuschmettern, mit tödlich sicheren Schüssen aus den Stiefeln geholt hat. Niemals habe ich in einem einzelnen Menschen so viel Energie gesehen. Ich halte es durchaus für möglich, daß er in dem Augenblick, in dem Sie das Haus verlassen haben, den Mörder noch gesichtet hat und ihm gefolgt ist. Immerhin muß er den Hof überquert haben, um sein Pferd aus dem Stall zu holen. Das wäre Zeit genug für Sie und die Cowboys gewesen, ihn dabei zu beobachten.«
»Es hat ihn aber niemand beobachtet«, knurrte der Rancher.
»Ist das seine Schuld?« versetzte der Marshal rauh, ehe er sich umwandte und mit harten Schritten die Veranda verließ.
Als er sich in den Sattel zog, sah er drüben neben dem steingefügten Küchenbau die Gestalt Clarke Harpers. Der Bursche stand mit gespreizten Beinen da und hatte die Daumen hinter den Waffengurt gehakt. Ein lauernder Blick flog zu dem Marshal hinüber.
Wyatt nahm sein Pferd herum und ritt auf ihn zu.
Clarke hatte keine Chance mehr, auszuweichen. Dicht vor ihm hielt der Missourier den Hengst an und beugte sich zur Seite hinunter.
»Hören Sie zu, Clarke Harper, Sie und Sheriff Hancoc verdächtigen Doc Holliday des Mordes. Ich werde Ihnen beweisen, daß er nichts damit zu tun hat. Und ich fordere Sie auf, mit Ihren Bemerkungen vorsichtiger zu sein. Wenn Sie etwas tun wollen, dann machen Sie sich selbst auf die Fährte des Mörders Ihrer Schwester.«
Wyatt nahm die Zügelleinen auf und preschte davon.
*
Es war am Morgen des nächsten Tages. Der Marshal hatte die Nacht in einer Mulde, die von Mesquitesträuchern umgeben war, verbracht und war früh aufgebrochen.
Lange hatte er sich überlegt, nach welcher Richtung er sich wenden sollte. Nach Süden würde der Mörder schwerlich geflüchtet sein, denn auf der großen Overlandstraße nach Tombstone mußte er damit rechnen, vielen Wagen und Reitern zu begegnen. Auch nach Osten konnte er kaum geritten sein, denn da war das Gebiet des Sheriffs von Gleason und die breite Fahrstraße, die zur Stadt führte. Scharf nach Westen hinüber war das Gebiet der Lonegan-Ranch. Eine Schar von fast dreißig ungebärdigen Cowboys fegte ständig über die Weide, und jedermann sorgte dafür, daß er nichts mit diesen Leuten zu tun bekam. Der Mörder würde sich sicherlich hüten, gerade in dieses Gebiet zu kommen. Blieb also nur noch Norden übrig.
Scharf im Nordwesten lag die Stadt Pearce. Wyatt hatte die Richtung dahin eingeschlagen.
Als im Osten die Sonne ihr erstes orangerotes Licht über den Horizont schickte, ritt der Missourier durch eine Geröllhalde, in der es nicht die mindeste Vegetation gab. Der Wind, der in der Nacht aufgekommen war, hatte jegliche Spuren verwischt.
Es war gegen neun Uhr, als Wyatt plötzlich sein Pferd anhielt und einen weißen Fleck fixierte, der dicht vor dem Gestein an einer engen Passage zu sehen war.
Er sicherte vorsichtig nach allen Seiten, ritt aus der Gesteinskluft heraus und schlug einen großen Halbkreis, um sich zu überzeugen, daß er hier nicht in irgendeine Falle gelockt wurde. Als er nach einer Dreiviertelstunde wußte, daß sich niemand in der Nähe aufhielt, ritt er in die Gesteinsenge zurück und hielt auf den weißen Fleck an der rechten Wegseite zu.
Als er bis auf fünf Yard herangekommen war, sah er, daß es ein Taschentuch war, das da am Boden lag. Er sah noch mehr: das zusammengeknüllte Tuch war voller Blutflecke.
Wyatt stieg aus dem Sattel und machte eine weitere Entdeckung: Es war eines jener feinen seidenen Taschentücher, wie sie Doc Holliday benutzte!
Mit brennenden Augen starrte der Missourier darauf nieder. Die Gedanken jagten einander in seinem Hirn.
Was war geschehen?
War Doc Holliday verletzt worden?
Oder hatte ihn hier ein neuer Anfall gepackt?
Wyatt deckte das Tuch mit Gesteinsstaub zu, zog sich in den Sattel und ritt aus der Geröllhalde auf die offene Savanne hinaus, über der jetzt ein glühendheißer Vormittag hochstieg. Jetzt hatte er die Wahl. Scharf im Norden führte der Weg zu der großen Kelly-Ranch, und hier an der kleinen Gabelung bog die Straße nach Pearce ab.
Der Missourier entschloß sich für den Ritt zur Stadt.
Gegen halb zwölf sah er sie vor sich liegen. Er hielt auf einer kleinen Anhöhe und konnte auf sie hinunterblicken.
Zwei Häuserreihen mit ein paar verstreut dahinter liegenden Hütten und Corrals, das war Pearce. Es machte in der flimmernden Sonnenglut einen trostlosen, verlassenen Eindruck.
Wie Menschen nur auf den Gedanken gekommen sein mochten, hier mitten in die sandige Steppe eine Stadt zu bauen!
Im scharfen Trab hielt der Missourier auf die Häuser zu.
Es war Mittag, als er in die Mainstreet einritt. Die Straße lag wie ausgestorben da. Nur vor einem Haus, an dem in großen Lettern der Name Sunbeam-Bar prangte, standen zwei Pferde mit hängenden Köpfen und eingeknickten Beinen in der grellen Sonne.
Der Missourier stieg aus dem Sattel, brachte sein Pferd in den Schatten einer Häuserenge und betrat den Vorbau.
Ehe er die Tür der Schenke erreichte, hielt er inne und musterte eines der Pferde schärfer.
Wo hatte er das Tier schon gesehen?
Es war kein besonders auffälliges Pferd. Aber die Form seiner Stirnblesse kam ihm bekannt vor. Sie war eigenartig in Halbmondform gebogen und an den Enden ausgefranst. Der Marshal hatte ein ausgeprägtes Erinnerungsvermögen für dergleichen Dinge.
Als er mit der rechten Hand einen der grobgeschnitzten Schwingarme der Schankhaustür aufstieß, wußte er, wo er das Pferd schon gesehen hatte!
Drüben an der Theke lehnten zwei Männer. Einer von ihnen war der Ohio-Man Jeffrey Flegger, einer der Begleiter Mike Torreys.
Neben ihm stand ein schwarzhaariger riesiger Bursche, der mit den Ellbogen auf der Theke lehnte, sein schreiendrotes Hemd über der starkbehaarten Brust offenstehen hatte und im linken Mundwinkel eine lange gebogene Virgina hielt.
Wyatt Earp hatte den Verdacht nicht loswerden können, daß Mike Torrey mit dem Mord auf der Harper-Ranch zu tun hatte. Der Desperado mochte zurückgekommen sein, um sich an den Ranchbewohnern für die erlittene Niederlage zu rächen. Weshalb das Mädchen ermordet worden war, begriff der Marshal zwar nicht, aber immerhin war es möglich, daß sich Torrey oder einer seiner Leute in ihr Zimmer verirrt hatte und von ihr überrascht worden war.
Und da stand nun einer von Torreys Leuten.
Wyatt trat in die Schenke und ging geradewegs auf Flegger zu.
Der wich einen Schritt zurück und stieß unbewußt gegen den Gorillatyp.
Der knurrte: »He, was ist mit dir los, Jeff? Hast du Zwetschgen gefrühstückt?«
Flegger wich einen Schritt von der Theke weg und ließ den Marshal nicht aus den Augen.
»Absolut nicht, Pete!« hechelte er.
Der Rowdy Pete Ryan aus dem fernen Mohave-County verzog das Gesicht zu einem bösen Grinsen.
»Scheint, daß ein alter Bekannter von dir gekommen ist?«
»Yeah«, quetschte Flegger durch die Zähne, »damit hast du nicht ganz unrecht, Pete. Ein Bekannter, der sich dieser Bekanntschaft nicht mehr lange erfreuen wird.«
Wyatt hatte scharf auf ihn zugehalten und blieb jetzt dicht vor ihm stehen.
Flegger konnte es nicht riskieren, noch einen Schritt zurückzuweichen, ohne sich eine schwere Blöße zu geben.
»Was willst du, Harper-Cowboy?« fletschte er Wyatt entgegen.
»Wo ist Mike?« herrschte der Marshal ihn an.
»Mike?« Der Ohio-Man legte den Kopf etwas auf die Seite und stieß eine dümmliche Lache aus. »Was geht das dich an, Cowboy?«
»Eine ganze Menge. Wo ist Mike?«
Jetzt wich Flegger vorsichtshalber doch noch einen halben Schritt zurück und wandte sich an Ryan.
»He, Pete, wie gefällt dir der Bursche? Du wirst doch nicht zulassen, daß er mich an meinem friedlichen Drink hier hindert? Der Kerl hat die Angewohnheit, anderen Leuten auf die Füße zu treten.«
Ryan klemmte die Daumen in die Ausschnitte seiner schmierigen flickenbesetzten Boleroweste und stieß den Unterkiefer vor, während er schnarrend fragte:
»Wer ist der Kerl?«
»Ein dreckiger Kuhtreiber von der Harper-Ranch!« bellte Flegger, jetzt durch den Beistand des Rowdy mutiger geworden.
Aber schon wurde er von einem krachenden Rechtshänder des Marshals getroffen und gegen die Bordwand der Theke geworfen, wo er niederrutschte.
Das war für den Rowdy aus dem Mohave-County ein Signal, sich augenblicklich auf den Missourier zu stürzen.
Wyatt duckte einen rechten Schwinger des Gorillas ab, crouchte unter einer Linken weg und riß dann einen steif angewinkelten Haken nach innen, der auf den kurzen Rippen des Rowdy detonierte.
Pete Ryan schnappte nach Luft wie ein Karpfen, der aufs Trockene geraten war. Der Hieb hatte ihn schwer durchgeschüttelt.
Wyatt hatte sich sofort wieder an Flegger gewandt.
»Steh auf!«
Der Ohio-Man erhob sich langsam, und Wyatt bemerkte, daß er die Rechte in der Nähe seines Revolvers schweben ließ.
»Laß die Hand vom Colt, Tramp, ich warne dich. Und jetzt antworte mir: Wo ist Mike Torrey?«
Aber Flegger hatte es nicht nötig, eine Antwort zu geben, denn Pete Ryan, der Schläger, sah sich in seiner »Berufsehre« offensichtlich derartig gekränkt, daß er sich mit einem heiseren Schrei auf den harten Gegner stürzte, um ihn niederzuwalzen.
Mit einem geschickten Sidestep war Wyatt aus der Sprungrichtung des Rowdy gewichen und fing den anspringenden Mann mit einem schweren rechten Haken ab.
Der Schlag war genau am Kinnwinkel des Gorillas gelandet und ließ den Vorwärtsstürmenden in der Bewegung innehalten. Schwankend stand Ryan da.
»He!« brüllte er dann, wobei er sich wie ein regennasser Hund schüttelte, die haarigen Fäuste ballte, die Zähne fletschte und brüllte: »Jetzt wird’s ernst, Junge!«
Wyatt hatte Flegger im Auge zu behalten. Und genau in dem Augenblick, in dem Ryan den Marshal mit einer Doublette anfiel, stieß der Ohio-Man die rechte Hand zum Revolver, um einen Schuß durch den Halfterboden abzugeben.
Blitzschnell zuckte der linke Stiefel des Marshals hoch und flog unter Ryans rechtes Handgelenk. Da aber war einer der Schläge des Rowdy durch Wyatts Deckung gebrochen und streifte das Jochbein des Marshals.
Mit der Reaktion einer Pantherkatze schmetterte der Marshal einen schweren Rechtshänder nach vorn und traf erneut das Kinn des Gorillas. Wyatt ließ blitzschnell einen linken Haken folgen, der am Wangenknochen des Gorillas explodierte.
Dem Doppelschlag war der Rowdy aus dem Mohave-County nicht gewachsen; er sackte in die Knie und schlug hart zurück gegen die Bordwand der Theke.
Wyatt nahm ihm die Waffen aus den Halftern und schleuderte sie in eine Ecke des Schankraumes.
Der kleine Mann hinter der Theke, der bis jetzt in Deckung gegangen war, erhob sich und wischte sich den Schweiß vom kahlen Schädel.
»Damned, Mister, das war saubere Arbeit. Bis jetzt hat noch niemand Pete Ryan geschafft!«
Jeff Flegger stand wie eine Gipsfigur da und stierte den Marshal aus wäßrigen Augen an.
»Wo ist Mike Torrey?« wiederholte der Marshal seine Frage von vorhin.
Fleggers krächzte: »Ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen!«
»Dann kommst du mit zum Sheriff.«
»Weshalb?« brüllte Flegger erschrocken.
»Weil auf der Harper-Ranch eine Frau ermordet worden ist. Und weil ich Torrey und seine Leute im Verdacht habe, mit diesem Mord in Verbindung zu stehen.«
Ohne ein weiteres Wort packte Wyatt ihn am Kragen und schleppte ihn aus der Schenke.
Zwei Häuser nebenan war das winzige Office von Sheriff Billy Donaldson.
Donaldson war vor neun Jahren in die Stadt gekommen und hatte sich eine Zeitlang als Hilfsarbeiter in allerlei Häusern herumgeschlagen, bis die Bürger den ziemlich schmutzigen und lässigen Mann dadurch loszuwerden trachteten, daß sie ihn zum Sheriff wählten. Donaldson war kein sehr nützlicher Gesetzesmann. Er hockte meist in seinem Office herum, saß in seinem Schaukelstuhl und wurde fetter und fetter.
Als der Marshal jetzt in sein Bureau trat und den Tramp hereinschleppte, blinzelte Donaldson ihm träge und unwillig entgegen.
»Was soll denn das?« knurrte er.
»Sheriff, ich fordere Sie auf, diesen Mann festzunehmen. Er gehört zu Mike Torreys Bande.«
»Mike Torrey?« versetzte der Sheriff, ohne sich jedoch aus seinem Schaukelstuhl zu erheben. »Der soll in der Gegend sein? Habe von ihm gehört, kann mir aber nicht vorstellen, daß er es riskieren sollte, sich in meinem Distrikt sehen zu lassen.«
»Distrikt« war eine Prahlerei, denn er war nichts weiter als ein kleiner Hilfssheriff, dessen Befugnisse auf das Stadtgebiet beschränkt waren. Wyatt überging das jedoch und sagte entschieden:
»Sheriff, sperren Sie diesen Mann ein! Ich kenne seinen Namen nicht genau und bitte Sie, Nachforschungen anzustellen. Er gehört zu den Männern Torreys, und ich habe ihn vor drei Tagen auf der Harper-Ranch gesehen.« Wyatt berichtete kurz, was sich ereignet hatte, und erklärte dann, daß er das Protokoll unterschreiben werde. Inzwischen wolle er sich in der Stadt nach Torrey und den anderen umsehen.
Aber die Nachforschungen des Missouriers blieben erfolglos. Mike Torrey und seine drei anderen Männer waren offensichtlich nicht in der Stadt.
Als der Marshal zum Sheriffs Office zurückkam, war es verschlossen. Der Sheriff war nirgends zu finden. Wyatt hörte, daß er auf eine der Ranches in der Umgebung geritten sei, wo sich ein Diebstahl ereignet hätte. Ob das nun wahr war oder nicht – der Missourier hatte keine Zeit, auf den feisten und wenig dienstfreudigen Gesetzesmann von Pearce zu warten.
Er ging noch einmal in die Schenke und sah, daß der Gorilla damit beschäftigt war, sich voll Whisky laufen zu lassen. Auch eine Manier, seinen Ärger hinunterzuspülen, dachte Wyatt – vielleicht nicht einmal die schlechteste für Kerle dieser Sorte.
Wyatt ging hinaus, und als er an die Häuserenge kam, in der er seinen Falben gelassen hatte, mußte er feststellen, daß das Tier verschwunden war.
Er blickte sich um und sah in einem Torspalt das braune Gesicht eines Jungen.
Wyatt ging auf ihn zu.
Der Junge wich zurück in den Hof.
Als der Marshal das Tor etwas aufstieß, sah er den Kleinen vor sich. Es war ein etwa sechs- oder siebenjähriger Bengel mit erdbraunen nackten Füßen, kurzen Hosen, viel zu großem Hemd und struppigem Blondhaar.
»Na, Jimmy, wie geht’s?«
Der Kleine hatte sofort den ängstlichen Zug aus dem Gesicht verloren und feixte den Marshal aus fröhlichen Augen an.
»Woher wissen Sie, daß ich Jimmy heiße?«
»Ich dachte es mir. Du siehst so aus.«
»Und Sie sehen aus wie ein Staatenreiter«, entfuhr es dem Jungen.
»So?« meinte der Marshal. »Vielleicht kannst du mir dann sagen, wo der Staatenreiter sein Pferd wiederbekommt?«
Der Junge kam langsam heran und flüsterte:
»Mr. Ryan hat es weggenommen.«
»Ryan? Ist das vielleicht der Gorilla drüben in der Schenke?«
Der kleine Bursche nickte heftig. »Ja, als Sie den anderen Mann zum Sheriffs Office geschleppt haben und darin verschwunden waren, kam Mr. Ryan plötzlich aus der Schenke getorkelt, nahm den Hengst und brachte ihn weg.«
»Hast du zufällig gesehen, wohin er ihn gebracht hat?«
»Ja, Mister, sogar genau habe ich es gesehen. Er hat ihn drüben in Butchers Hof gebracht.«
»Wo ist das, hier schräg gegenüber?«
»Ja, es ist da, wo die beiden neuen Bretter im Hoftor eingesetzt worden sind.«
Wyatt streichelte dem Kleinen über seinen struppigen Blondschopf und zwinkerte ihm zu. Dann wandte er sich um, verließ den Hof und sah schräg gegenüber das bezeichnete Tor.
Als er es aufstieß, sah er seinen Hengst drüben vorm Stall stehen. Ohne viel Worte zu verlieren oder sich erst an die Leute des Anwesens zu wenden, zog er das Tier in die Gasse hinaus, stieg in den Sattel und ritt davon.
Es hatte wenig Sinn, sich länger in diesem Pearce aufzuhalten. Torrey war doch nicht hier. Und von Doc Holliday war auch keine Spur zu finden. Aus dem Ohio-Man war kein Wort herauszubringen, da er höchstwahrscheinlich die Rache seines Anführers zu fürchten hatte. Vielleicht wußte dieser Mann auch gar nicht, wo Torrey sich jetzt aufhielt. Wenn der Ohio-Man an dem Mord auf der Harper-Ranch beteiligt war, so saß er jetzt jedenfalls hinter Gittern und war zunächst sicher.
Es galt jetzt, Doc Hollidays Fährte aufzuspüren. Hier in Pearce war er nicht.
Wyatt ritt nach Nordwesten aus der Stadt und hielt wieder auf die Overland zu, die nach Norden führte.
Nur wenige Meilen hinter der Stadt war der Abbieger zur Kelly-Ranch. Ein Doppelbrett, das auf einem Weidepfahl angebracht war, wies zur Ranch hin.
Der Missourier entschloß sich, einen kurzen Besuch dort zu machen, um sich nach Doc Holliday und auch nach Torrey zu erkundigen.
Die Ranch lag fast sieben Meilen von der Overlandstreet entfernt.
Als der Missourier sie erreichte, war es schon Nachmittag. Der Hunger bohrte in seinem Magen, und er nahm sich vor, auf der Ranch irgend etwas zu essen.
Nachmittagsruhe lag über dem riesigen Hof. Auf der Veranda des großen Wohnhauses saß eine alte Frau, die mit einer Näharbeit beschäftigt war. Sie war das einzig lebende Wesen, das der Missourier sichten konnte.
Er stieg im Schatten des Vordaches vom Pferd, blieb vor der Veranda stehen und nahm den Hut vom Kopf.
»Hallo, Madam. Ich wollte mich nach einem Gefährten erkundigen, der vielleicht hier auf dem Hof gewesen ist…?«
Die Frau unterbrach ihn schroff. »Hier ist niemand gewesen!«
»Es ist ein Mann etwa von meiner Größe, aber sehr viel schlanker, und er trägt einen schwarzen Anzug…«
Die Frau schüttelte den Kopf und blickte über den Rand ihrer dickglasigen Brille in das tiefbraune Gesicht des Mannes.
»Hier ist niemand gewesen!«
»Er reitet einen schwarzen Hengst und…«
»Nein, es ist niemand hier gewesen!« versetzte sie gallig.
Und dann erkundigte sich der Missourier nach Mike Torrey.
Aber auch er war nicht auf der Kelly-Ranch gewesen.
»Mr. Kelly ist nicht zufällig auf dem Hof?« fragte der Marshal noch.
Die Frau schüttelte nur den Kopf.
Als Wyatt sich umwandte, sah er im Abdrehen hinter einem der Fenster den Kopf eines bärtigen Mannes. Da er es sich nicht leisten konnte, auf irgendeinen Hinweis zu verzichten, blieb er noch einmal stehen und wandte sich um.
»Madam, mein Name ist Earp. Ich komme aus Tombstone und bin mit meinem Gefährten auf dem Weg zurück nach Dodge City gewesen, als…«
Da stand die Frau auf. »Ich habe all Ihre Fragen beantwortet, Mister. Es ist nicht nötig, daß Sie mir irgendeine Lüge auftischen.«
»Tut mir leid, Madam; aber Sie haben mir eine Lüge aufgetischt.«
Flammende Zornesröte überlief das blasse Gesicht der Frau.
»Was fällt Ihnen ein!« rief sie kreischend.
»Mr. Kelly ist auf der Ranch. Er steht da drüben im Zimmer. Und ich hätte gern mit ihm gesprochen.«
Da wurde das Fenster mit einem harten Ruck hochgeschoben, und der krause Schädel des bärtigen Mannes kam zum Vorschein.
»Was wollen Sie?«
»Sind Sie Mr. Kelly?«
»Ja, ich bin Kelly. Und ich bin krank. Lassen Sie mich zufrieden, sonst rufe ich meine Leute.«
»Ich habe nur eine Frage an Sie, Mr. Kelly. Mein Name ist Earp, ich bin…«
»Diesen Schwindel haben Sie schon meiner Schwester aufgetischt. Es ist nicht nötig, daß Sie auch noch mich damit behelligen, Mann! Sehen Sie zu, daß Sie verschwinden, oder ich rufe die Boys!«
Es war gar nicht notwendig, sie zu rufen, die Boys kamen schon. Drei von ihnen tauchten plötzlich in der Bunkhaustür auf, schlenderten über den Hof und blieben hinter Wyatt stehen. Zwei andere kamen aus dem Schatten des Scheunenbaus und pflanzten sich seitlich neben dem Marshal auf.
Der Missourier blickte sich um und sah einen nach dem anderen an. Es waren harte und verwegene Gesichter, in die er da blickte, und er wußte, daß er keine Chance bei ihnen gehabt hätte, selbst wenn er ihnen hätte sagen können, er sei Abraham Lincoln in Person. Langsam ging er zu seinem Pferd und zog sich in den Sattel.
Da brüllte einer der Cowboys hinter ihm her:
»Und sieh zu, daß du Billy the Kid begegnest, Wyatt Earp! Es könnte sein, daß er den wirklichen Wyatt Earp kennt und dir von ihm einen Gruß bestellen will!«
Diesen Worten folgte die bellende höhnische Lache der anderen.
Wyatt ritt aus dem Hof und hielt nach Norden auf die Overlandstreet zu.
Es war gegen halb sechs, als er am Straßenrand vor einer riesigen, zweiarmigen Turmkaktee inmitten zahlreicher Hufspuren, vom Sand halb verschüttet, den weißen Zipfel eines Tuches fand. Als er es hervorzog, hielt er wieder eines der Taschentücher Doc Holliday in der Hand, das ebenfalls blutbefleckt war. Er ließ es in den Sand fallen und schüttete es zu.
Sorgfältig prüfte er die Hufspuren um die Kaktee. Einen der Abdrücke erkannte er ganz einwandfrei als den des schwarzen Hengstes von Holliday. Vor Wochen hatten sie oben in den Dragoon-Mountains einen Hinterhuf dieses Pferdes beschlagen lassen und ihm die Hornkerbe neu ausschneiden müssen. Dieser Abdruck war jetzt ganz deutlich an mehreren Stellen im Sand der Savanne zu erkennen. Aber die Spuren des Hengstes vermischten sich mit denen eines anderen Tieres.
Die Spuren mochten etwa einen Tag alt sein. Vielleicht auch eine Nacht. Das war schwer zu sagen, da in der letzten Nacht eine merkliche Kühle mit großer Feuchtigkeit niedergegangen war, die die Spuren oft so erhielt, daß sich auch ein erfahrener Westläufer um die Länge einer ganzen Nacht irren konnte.
Entweder also war Doc Holliday gestern abend hier vorübergekommen, oder am frühen Morgen.
Wyatt folgte der Fährte und stellte fest, daß sie sich hinauf nach Norden über die Overlandstreet zog. Und zwar hatten beide Reiter den Weg hier zurückgelegt. Höchstwahrscheinlich natürlich hintereinander. Das konnte bedeuten, daß Doc Holliday bei einem Gefecht verwundet worden war, worauf ja auch die blutbefleckten Taschentücher hinwiesen, und daß der andere hier vor ihm geritten war.
Der katzenzähe Mann aus Georgia war also auf der Fährte seines Widersachers geblieben. Holliday mußte sich in einer scheußlichen Verfassung befinden. Höchstwahrscheinlich hatte er den Anfall noch keineswegs überstanden gehabt, als er in den Sattel gestiegen war, um dem Mörder der Suzan Harper zu folgen. Und jetzt war er hier mit dem Mörder selbst oder aber einem seiner Leute zusammengestoßen.
Die Besorgnis des Marshals um den Freund wurde von Stunde zu Stunde größer.
Als sich der Abend über das Land breitete, machte der Marshal in einer Bodensenke halt, zündete aus gesammelten Holzstücken ein Feuer an und hängte den kleinen Kupferkessel an dem zusammenklappbaren Dreieck darüber.
Bald zog würziger Kaffeeduft vom Feuer. Das Getränk belebte den Westmann und verhalf ihm zusammen mit den kräftigen Broten und dem geräucherten Stück Fleisch zu neuen Kräften.
Er packte seine Utensilien zusammen, stieg in den Sattel und ritt weiter.
An einem Creek machte er nach mehreren Stunden wieder Halt und gönnte dem Hengst etwas Weidezeit im Ufergras. Dann ging’s weiter.
Die Nacht war hereingebrochen. Im schwachen Schein der Sterne konnte der Missourier die Fährte nur noch mühsam verfolgen. Gegen elf Uhr gab er es auf und machte unweit von der Overlandstreet Rast.
Die Anstrengung des weiten Rittes hatte selbst dem so eisenharten Mann aus Missouri so sehr zugesetzt, daß er bis in den hellen Morgen hineinschlief. Als er die Augen aufschlug, sah er drüben auf der Overlandstreet in kaum hundert Yard Entfernung einen Reiter, der auf seinen Lagerplatz zuhielt.
Es war ein mittelgroßer schmalschultriger Mensch mit langem hagerem Gesicht und grünen Augen. Unter der breiten Krempe seines durchschwitzten grauen Hutes blickte rotes Haar hervor. Sein kragenloses graues Kattunhemd war vorn auf der Brust und unter den Armen stark durchschwitzt. Unter dem Gurt hatte er an einem Riemen im offenen Lederschuh einen schweren Navy-Colt hängen, dessen Kolben mit Perlmutter beschlagen waren.
Er ritt einen abgetriebenen Rotfuchs, dessen Körper von dunklen Schweißstellen bedeckt war, der aber eine gewisse Rasse verriet; Wyatt kannte diese Pferdeart genau und wußte, daß sie ausdauernde Läufer und hervorragende Kletterer waren. Für die Wüste jedoch waren sie ungeeignet.
Der Reiter kam bis auf fünfzehn Yard heran und hielt sein Pferd dann an. Wyatt konnte seine Augen jetzt deutlich erkennen. Sie waren von jenem blassen Hellgrün, das an die Farbe von Weintrauben erinnert. Sein Gesicht war über und über mit Sommersprossen bedeckt.
Wyatt hatte sich auf die Ellbogen aufgerichtet und blickte zu dem Reiter hinüber.
»Ist es gestattet, näher zu kommen?« rief der andere.
»Natürlich«, entgegnete der Missourier, während er sich erhob.
Der andere kam näher, stieg aus dem Sattel und blieb breitbeinig stehen. Er hatte etwas Ausdrucksloses in seinem Gesicht.
»Schätze, daß Sie keinen Morgenkaffee für einen durstigen Mann übrig haben?«
»Irrtum«, entgegnete der Marshal. Nach einer kurzen oberflächlichen Prüfung des anderen nahm er das Dreibein vom Sattel, stellte es auf und suchte unter den Büschen etwas Holz zusammen. Dann nahm er seine große Campflasche und goß Wasser in den Kupferkessel.
Der andere schaute zu. »Bei uns daheim in Irland machen das die Schäfer auf den Feldern auch nicht anders. – Mein Name ist übrigens McElroy.«
»Earp«, stellte sich der Marshal vor.
McElroy nahm sein Tabakszeug hervor und drehte sich eine Zigarette. Mit einem Mesquitezweig nahm er sich Feuer aus der Glut. Dann ließ er sich nieder und nahm einen Becher Kaffee und auch ein Stück Brot.
Nach einer Viertelstunde packte der Missourier sein Campgerät zusammen und zurrte es hinterm Sattel fest.
McElroy war ebenfalls aufgestanden und zu seinem Pferd gegangen. Als Wyatt sich in den Sattel zog, meinte der Ire:
»Sie reiten nach Norden?«
»Ja.«
»Kann ich ein Stück mitkommen?«
»Meinethalben.«
Der Missourier, der seit fast anderthalb Jahrzehnten durch dieses Land gezogen war, ritt am liebsten allein; es sei denn Doc Holliday hätte ihn begleitet. Aber er mochte dem Iren die Bitte auch nicht abschlagen. Stumm trottete der Mann auf dem Rotfuchs, der sich inzwischen an einem winzigen Wasserlauf wieder etwas erholt hatte, neben ihm her.
Gegen Mittag erreichten sie eine verlassene Pferdewechselstation, die vor einem Jahrzehnt einer Overlandlinie zu den Dragoon-Mountains gedient hatte. Sie machten kurz Rast.
McElroy, der an dem Creek hinter dem Stationshaus eine Weile das Wasser beobachtet hatte, fing mit geschickter Hand ohne Angel zwei Fische aus dem Bach, die über dem Feuer gebraten wurden.
Dave McElroy war vor neunzehn Jahren mit seinen Eltern von Irland herüber in die Vereinigten Staaten gekommen. Die Familie hatte sich in Virginia festgesetzt, und der Vater, der eine Schusterei betrieb, hatte sich mehr schlecht als recht durchs Leben schlagen müssen. Die sieben Geschwister, die alle jünger waren als Dave, hatten den Eltern das Los nicht erleichtern können. Dave McElroy trieb sich jetzt schon eine ganze Weile herum. Zunächst war er oben in Illinois gewesen, war dann über Nebraska nach Kansas gekommen, nach Oklahoma hinuntergeritten und hatte schließlich New Mexico durchquert.
Er war ein Tramp. Fünfmal hatte er wegen Diebstahls in den Gefängnissen verschiedener Westernstädte gesessen und war immer wieder mit einem blauen Auge davongekommen. Es waren immer kleine, wertlose Dinge gewesen, die er gestohlen hatte. Einmal eine Kanne mit Milch, dann eine Wurst, dann Tabak und dann wieder Brot, ein Hufeisenrohling, ein paar Patronen, ein altes Messer und dergleichen mehr.
Seit den frühen Morgenstunden dieses Tages aber war Dave McElroy auf größere Beute aus. Er war nicht mehr der kleine Dieb, der es auf Messer, Brot und harmlose Dinge absah; ihn interessierte diesmal ein Pferd. Das Pferd seines Begleiters!
Noch nie hatte McElroy ein so wertvolles Tier gesehen, wie den Falbhengst des Missouriers. Der Ire hatte beschlossen, es an sich zu bringen – um jeden Preis.
Er wußte nicht, daß er es hier mit dem berühmten Gesetzesmann Wyatt Earp zu tun hatte. Dem Namen hatte er entweder keine Bedeutung beigemessen, oder da hatte ihn das Pferd schon so beeindruckt, daß er ihn gar nicht richtig mitbekommen hatte. Jedenfalls war Dave McElroy fest entschlossen, den Falben an sich zu bringen.
Seit dem Frühstück, das der Marshal mit ihm geteilt hatte, sann er ununterbrochen auf eine Möglichkeit, den anderen niederzuschlagen. Daß er ihn dabei umbringen konnte, hatte er in seinen Plan mit einbezogen, ja, Dave McElroy war sogar entschlossen, zu töten.
Nicht etwa, daß er ein so großer Pferdenarr gewesen wäre, der nicht weiterziehen konnte, ohne in den Besitz des Tieres zu kommen. O nein, der Ire wollte das Pferd nur an sich bringen, um es auf dem schnellsten Wege in bare Münze umzutauschen. Er wußte genau, daß er für diesen Hengst eine große Stange Dollars einstreichen konnte.
Wyatt seinerseits kam gar nicht auf den Gedanken, daß der so ausdruckslose, einsilbig wirkende Mann derartige Gedanken hegen könnte. Wyatt war zu sehr von dem Gedanken an Doc Holliday erfüllt, als daß er sich auch noch Gedanken über den Iren hätte machen können.
Doc Hollidays Zustand war bei seinem Wegritt von der Harper-Ranch so schlecht gewesen, daß sich Wyatt jetzt unschwer vorstellen konnte, wie elend es dem Gambler gehen mußte. Hinter jeder Wegbiegung, die einen Blick nach vorn freigab, atmete der Marshal auf, wenn er nirgends einen dunklen Fleck auf der Straße oder an ihrem Rand entdeckte. Er hätte sich nicht gewundert, den Georgier irgendwo tot vorzufinden.
Als Wyatt das eiserne Dreibein zusammenschob und sich umwandte, um es hinterm Sattel aufzuschnallen, handelte McElroy.
Er hechtete vorwärts und ließ ein schweres Holzstück auf den Schädel des Missouriers niedersausen.
Schwergetroffen torkelte Wyatt nach vorn gegen den Pferdekörper, riß sich aber im Unterbewußtsein auf dem linken Bein herum, und der große Buntline Revolver brüllte auf.
Zwei Schüsse fauchten dem Iren entgegen.
Wyatt Earp brach zusammen, rutschte unter dem Pferdekörper hinweg und blieb lang ausgestreckt am Boden liegen.
McElroy war von beiden Kugeln getroffen worden. Das erste Geschoß hatte ihm den rechten Oberarm verletzt und eine gewaltige Fleischwunde gezogen; die zweite Kugel hatte sengend seinen Wangenknochen gestreift, und auch die Ohrmuschel blutete.
Fast ohnmächtig vor Schmerz stand der Verbrecher da, preßte die Rechte über den schmerzenden Oberarm, riß ein Stück aus seinem Hemd und drückte es darauf. Dann torkelte er vorwärts und starrte in das regungslose Gesicht des Mannes, den er überfallen hatte. Am Boden lag der große Revolver. Er bückte sich, hob ihn auf und schob ihn in den eigenen Gurt. Dann riß er dem Überfallenen auch den anderen Revolver weg, griff in Wyatts Taschen, räumte sie aus – und plötzlich fand er den großen Marshalsstern. Lange starrte er entgeistert darauf, ehe er ihn ebenfalls in seine Taschen schob.
Nachdem er den Missourier ausgeraubt hatte, schwang er sich in den Sattel des Falbhengstes, ritt zu seinem Pferd, nahm den Zügel auf, so daß es hinterher trabte, und preschte südwestwärts davon.
Der trommelnde Hufschlag, der durch den Boden dröhnte, riß den Missourier aus seiner tiefen Betäubung. Er richtete sich auf die Ellbogen auf, schüttelte den Kopf, wischte sich mit der Linken durchs Gesicht und wandte sich um.
Am Boden kniend, starrte er durch das trockene Mesquitegestrüpp und sah in der Ferne die Staubwolke, die von den beiden Pferden hochgewirbelt wurde. Ein bitteres Lachen brach von seinen Lippen.
Jetzt kauerte er hier an dem winzigen, halbausgetrockneten Creek mitten in der Steppe, und da flog ein Räuber mit seinem Pferd, seinen Waffen und allem was er besaß, davon.
Wyatt machte sich jetzt die bittersten Vorwürfe, daß er dem Fremden nicht mehr Aufmerksamkeit gewidmet hatte. Sicher wäre ihm dann dessen Absicht nicht entgangen. Denn der Ire konnte ja nicht urplötzlich auf den Gedanken gekommen sein, ihn niederzuschlagen; den Plan mußte er schon länger gefaßt haben, vielleicht schon von der ersten Minute an. Hätte die Sorge um Doc Holliday den Marshal nicht so sehr beschäftigt, so würde es dem Banditen sicherlich schwer geworden sein, ihn so zu überrumpeln.
Als Wyatt sich umwandte, sah er auf einem der hellen Holzstücke neben dem Feuer zwei große Blutflecke.
Also mußte er den anderen getroffen haben!
Er richtete sich auf, ging zum Creek hinunter und warf sich ein paar Hände Wasser ins Gesicht, rieb sich den Kopf mit Wasser ab und hielt ihn dann in den Creek.
Etwas erfrischt richtete er sich auf und ging ein paar Schritte vorwärts.
Da, wieder ein Blutstropfen im hellen Sand!
Der Missourier sah sich noch einmal auf dem Lagerplatz um, blickte zum Himmel hinauf und beobachtete den Stand der Sonne.
Nein, es hatte keinen Zweck, jetzt loszumarschieren. Er hatte weder eine Campflasche noch sonst irgend etwas bei sich, worin er Wasser hätte mitführen können. Also mußte er bleiben, bis die größte Hitze des Tages vorüber war, um erst bei beginnender Dunkelheit loszumarschieren.
Wie weit war es bis nach Pearce?
Das war doch eine ganz enorme Strecke. Bis zur Kelly-Ranch war es nicht ganz so weit. Aber was sollte er dort?
Im Schneckentempo krochen die Minuten dahin, und nur unendlich langsam wurde es Nachmittag. Die Hitze schien drückender und sengender zu werden. Wyatt, der sich hinter die Mesquitesträucher verkrochen hatte, fand auch dort keinen Schutz mehr und sah sich gezwungen, in den Creek hinunterzusteigen. Er hatte die Stiefel ausgezogen und legte sich in das Bachbett. Die Fluten des kleinen Gewässers waren aber auch nicht sonderlich kühl; aber es war hier angenehmer als oben in der brütenden Hitze.
Als es endlich Abend wurde, richtete sich der Missourier auf und machte sich auf den Weg. Er hatte absichtlich nicht allzuviel getrunken, da er aus Erfahrung wußte, daß man dann noch viel schneller ermüdete.
Als die Nacht hereinbrach, hatte er schon ein gutes Stück zwischen sich und den Lagerplatz gebracht. Er war so lange wie möglich der Hufspur des Banditen gefolgt und hatte sich so davon überzeugt, daß der den Weg genau zurückgeritten war.
Gegen halb neun verlor er in der Dunkelheit die Fährte und konnte sich nur noch an den Sternen orientieren. Er mußte genau nach Südwesten hinüber halten.
Immer wieder verlor er die Overlandstreet, die in der Dunkelheit von der sie umgebenen Savanne nicht zu unterscheiden war, und suchte sie wieder zu gewinnen, um nicht durch den schweren knöcheltiefen Sand waten zu müssen.
Gegen eins machte er eine kurze Rast auf einem Hügel und setzte seinen Weg nach einer halben Stunde fort.
Als der Morgen graute, sah er in der Ferne das hügelige Land vor sich, an dessen Ende die Kelly-Ranch lag.
Dennoch gelang es ihm nicht, die Ranch so früh zu erreichen, wie er es sich vorgenommen hatte. Das kam daher, weil er mehrmals glaubte, irgendwo in der Nähe der Overlandstreet die Spur des Banditen wieder entdeckt zu haben, die er in der Nacht verloren hatte. Aber der Räuber Dave McElroy hatte die Overlandstreet längst verlassen.
So wurde es halb zehn am Vormittag, ehe der Marshal den Ranchhof mit schmerzendem Schädel, durstig und müde erreichte.
Oben auf der Veranda saß wieder die Frau, die auch heute mit einer Näharbeit beschäftigt war.
Als sie den Fremden plötzlich vor sich stehen sah, stieß sie einen heiseren Schrei aus, ließ ihre Näharbeit fallen und flüchtete ins Haus.
Wyatt wandte sich um und trottete auf den Brunnen zu.
Wie überall, standen auch hier mehrere Eimer neben dem holzgefaßten Brunnenrand. Er nahm einen auf, hängte ihn in den Windenhaken und ließ die Winde hinunter.
Als der Eimerboden die Wasseroberfläche berührte, hörte der Missourier einen Schritt hinter sich. Er wandte sich um und sah den bärtigen Mann kommen, mit dem er gestern gesprochen hatte.
»He, was ist das denn!« schrie der.
»Hallo, Mr. Kelly«, hörte Wyatt sich selbst mit einer völlig fremden Stimme sagen. »Ich bin unterwegs überfallen worden. Gestatten Sie, daß ich ein paar Schlucke Wasser nehme?«
Da stampfte Kelly auf ihn zu, stieß die Fäuste in die Hüften, blieb breitbeinig vor ihm stehen und belferte:
»Verdammter Tramp! Habe ich dich nicht gestern schon vom Hof gejagt, elender Halunke? Scher dich zum Teufel!«
Über das dunkle Gesicht des Missouriers flog ein Schatten. Seine Augen verdüsterten sich, und zwischen seinen Brauen stand plötzlich eine tiefe Falte.
»Mr. Kelly, es ist in diesem Lande nicht üblich, daß man einem Fremden, der um einen Schluck Wasser bittet, das Tor weist.«
»Was hier üblich ist oder nicht, geht dich nichts an. Du hast mich nicht zu belehren, Bandit! Scher dich zum Teufel, oder ich hetz die Hunde auf dich!«
Der Missourier warf noch einen Blick über den Brunnen zu der kühlschimmernden Wasserfläche hinunter, schluckte dann trocken, wandte sich ab und ging mit harten, schweren Schritten davon. Er wußte genau, daß es eine Qual war, jetzt in den Mittag hineinzugehen, ohne sich durch einen Schluck gestärkt zu haben.
Aber um nichts in der Welt hätte er diesen brutalen Menschen noch einmal bitten mögen, ihm doch Wasser zu geben.
Als er das Ranchtor verlassen hatte, bog er nach Südwesten ab, um über die Zwillingsspur der Wagenräder auf die Overlandstraße zurückzukommen.
Er hatte vielleicht hundert Schritt gemacht, als er einen Reiter von Osten heranpreschen sah.
Wyatt erkannte zu seiner Verwunderung, daß es eine junge Frau war. Er blickte nicht auf, sondern ging weiter.
Die Frau hielt auf ihn zu und blieb kurz vor ihm auf dem Weg stehen.
Wyatt wollte ihr ausweichen und überschritt den Wegrain, sah aber, daß die Frau das Pferd herumnahm, um ihm den Weg zu versperren.
»Warten Sie!« hörte sie eine energische Stimme, und als er aufblickte, sah er in die Mündung eines Revolvers.
Er blickte noch weiter nach oben und sah in ein lichtbraunes, seltsam mandelförmiggeschnittenes Augenpaar, das von dichten Wimpern besetzt und von schöngeschnittenen Brauen überdacht war. Die Frau hatte ein ovalgeschnittenes, sehr hübsches Gesicht, eine feine Nase und volle, wohlgeformte Lippen. Tiefschwarzes Haar fiel in weiten Locken um dieses Gesichtsoval. Sie trug einen flachkronigen schwarzen Hut mit silberner Borte, ein blütenweißes Hemd, eine schwarze enganliegende Levishose, die in roten, texanisch abgesteppten Stiefeln steckte. Um ihre Hüften hatte sie einen patronenbesetzten Waffengurt mit zwei zweiundzwanziger Revolvern. Und im Scabbard an der rechten Seite des Schimmels steckte sogar ein kurzläufiges Henrygewehr.
Dies war die Minute, in der der Marshal Wyatt Earp zum erstenmal in das Gesicht Ann Kellys (Ann Ireen Kelly, 1864 – 1926 Besitzerin der großen Kelly-Ranch) blickte.
Sicher hätte er sich in diesem Moment nicht träumen lassen, welch eine große Rolle diese Frau während vieler Jahre in seinem Leben spielen würde.
Sie war nicht nur schön, sie war auch sehr anziehend, und offenbar war sie sich ihrer Wirkung durchaus bewußt. Interessiert beobachtete sie den hochgewachsenen Mann mit dem tiefbraunem Gesicht und den dunkelblauen Augen, die jetzt mit einer Mischung von Ärger und Belustigung auf ihr ruhten. Sie sah seine breiten Schultern, seine schmalen Hüften, seine kantigen braunen Hände und das blauschwarze Haar, das unter dem staubigen Hut hervorblickte.
»Wer sind Sie?« fragte das Mädchen.
Wyatt antwortete nicht. Er sah sie nur an.
Sie sah aber auch, daß seine beiden Revolverhalfter leer waren, und er einen stark mitgenommenen Eindruck machte.
»Ich habe gefragt, wer Sie sind!«
Ihr Tonfall gefiel ihm nicht.
»Ich wüßte nicht, weshalb ich Ihnen auf diese Frage eine Antwort geben sollte, Miß. Geben Sie den Weg frei.«
Da spannte die Frau blitzschnell den Hahn des Revolvers.
»Sie befinden sich hier auf meiner Weide, Mister. Ich habe das Recht zu fragen, wer Sie sind und was Sie hier wollen.«
Eine gewisse Belustigung prägte sich auf seinem Gesicht aus, und leichter Spott lag um seine Lippen.
»All right. Wenn es so ist – mein Name ist Earp. Ich bin gestern mittag überfallen worden und habe auf der Ranch versucht, einen Schluck Wasser zu bekommen.«
»Sie haben – versucht?« Erschrocken öffneten sich die Lippen der Frau, wobei der Marshal ihre blendendweißen, ebenmäßig gewachsenen Zähne sah, die wie eine schimmernde Perlenschnur hervorblitzten. »Soll das etwa heißen, daß man Ihnen kein Wasser gegeben hat?«
»Ja, das soll es heißen. Und nun lassen Sie mich vorbei. Ich habe kein Interesse, mich mit noch mehr Mitgliedern dieser gastfreundlichen Viehranch zu unterhalten.«
Da glitt die Frau aus dem Sattel und ging mit dem Revolver auf ihn zu. Zwei Schritt vor ihm blieb sie stehen. »Hören Sie, Mr. Kirb, oder wie Sie heißen mögen. Ich bin Ann Kelly. Die Ranch gehört mir. Und ich will nicht, daß jemand so von ihr spricht, wie Sie es tun.«
Der Missourier schob die Hände in die Hüften und sog die Luft in seinen mächtigen Brustkasten. Er überragte die immerhin recht hoch gewachsene Frau um mehr als Haupteslänge und senkte seinen Blick jetzt in ihre Augen.
»Miß Kelly, ich bedaure, mich nicht in dem Zustand zu befinden, mit Ihnen hier eine längere Unterhaltung zu pflegen. Bitte, geben Sie den Weg frei und nehmen Sie den Revolver weg, sonst werde ich ärgerlich.«
»Was bilden Sie sich ein!« fauchte die Frau.
Da schoß die Linke des Marshals plötzlich nach vorn und spannte sich um ihr Handgelenk.
Ann Kelly stieß einen Schmerzensschrei aus, dessen sie sich augenblicklich schämte. Der Revolver entglitt ihrer Hand.
Wyatt schob die Waffe mit dem Fuß zur Seite, gab das Handgelenk der Frau frei und schüttelte den Kopf.
»Leute gibt’s, man soll es nicht für möglich halten! Leben Sie wohl, Miß Kelly.«
Da ergriff sie ihn am Arm und zog ihn mit aller Gewalt zu sich herum.
Eine Ohrfeige brannte im Gesicht des Mannes.
Der Zorn stieg glühendheiß in der Brust des Marshals hoch.
»Hören Sie, Miß, Sie machen es mir verdammt schwer, weiterhin höflich zu bleiben. Sehen Sie zu, daß Sie auf Ihren Gaul kommen, sonst kassieren Sie auch noch eine Ohrfeige.«
Die Frau sah ihn aus blitzenden Augen an.
»So können Sie mit mir nicht reden, Stranger, merken Sie sich das!« Sie stellte sich breitbeinig und bebend vor Zorn vor ihn hin.
Da ergriff er sie an den Oberarmen und drehte die Frau um hundertachtzig Grad herum. »So, und nun steigen Sie gefälligst auf Ihr Spielzeugpferd und sehen Sie zu, daß Sie weiterkommen.«
Er selbst ging vorwärts.
Die Frau sah hinter ihm her.
Ganz sicher wäre alles ganz anders gekommen, wenn die stolze Ann Ireen Kelly jetzt schweigend auf ihr Pferd gestiegen wäre, um davonzureiten. Aber das tat sie nicht. Sie schrie hinter dem Marshal her: »Tramp!«
Der Mann hatte einige Schritte getan, blieb dann stehen und wandte sich ganz langsam um.
Der Blick aus seinen Augen drang der Frau unter die Haut.
Und von dieser Sekunde an war das Herz der herrischen, millionenschweren und doch so unseligen Ann Kelly verloren.
Aber sie war sich dessen noch keineswegs bewußt.
Wyatt blickte sie nur an und wandte sich dann wieder ab.
Die Frau stand wie festgenagelt da und sah hinter ihm her. Und dann rannte sie plötzlich los, überholte ihn, blieb vor ihm stehen und sah ihn trotzig an. Doch sagte sie mit völlig veränderter Stimme:
»Es tut mir leid, Mister. Ich habe es nicht so gemeint. Ich habe mich nur geärgert, weil Sie nicht gegrüßt haben und weil Sie nicht taten, was ich verlangt habe. Ich bitte Sie um Entschuldigung.«
Der Missourier schüttelte lächelnd den Kopf. »All right, Miß. Ist schon gut. Leben Sie wohl.«
»Nein, warten Sie. Sie haben gesagt, daß Sie auf meinem Hof um Wasser gefragt und keines bekommen haben.«
»Auf Ihrem Hof?«
»Ja, das sagte ich Ihnen doch schon. Die Ranch gehört mir. Als mein Vater vor sieben Jahren starb, vererbte er mir den Hof.«
»Und wer ist der Bursche mit dem Backenbart?«
»Ein Neffe von mir.«
»Und die alte Dame?«
»Es ist seine Schwester. Der Hof aber gehört mir. Bitte, kommen Sie mit.«
Wyatt blickte zum Ranchhof zurück und schüttelte dann den Kopf.
»Nein, nein, vielen Dank, ich habe genug von den Kellys.«
Eine dunkle Röte überzog das Gesicht der Frau. Jähzornig erklärte sie: »Sie wollen mich also beleidigen.«
Der Marshal schüttelte den Kopf. »Sie sind eine merkwürdige Frau, Miß Kelly. Ich bin seit gestern abend unterwegs und komme auf die Ranch, um nach Wasser zu fragen. Ich werde weggeschickt. Glauben Sie im Ernst, daß ich den Weg noch einmal zurückmachen möchte?«
»Ich werde die Leute, die Sie weggeschickt haben, zur Rechenschaft ziehen.«
»Kein Interesse, Madam. Lassen Sie mich nur meines Weges ziehen. Es ist ja nicht mehr weit.«
»Nicht mehr weit? Sie wollen doch wohl nach Pearce?«
»Ja.«
»Das ist noch ein ganzes Stück. Und wenn Sie wirklich seit gestern abend unterwegs sind, dann werden Sie die Stadt nicht mehr erreichen.«
»Da täuschen Sie sich. Ich bin an ganz andere Strapazen gewöhnt, wie es sich für einen Tramp gehört. Und jetzt leben Sie wohl.«
»Hören Sie«, sagte die Frau, »ich bin gestern einem Mann begegnet, der sich in einer noch scheußlicheren Verfassung befand. Er war zu stolz, Wasser von mir zu nehmen. Und dann sah ich ihn oberhalb von der Turmkakteengruppe da drüben aus dem Sattel fallen.«
Der Marshal kam sofort zurück.
»Was sagen Sie da? Wie sah der Mann aus? War er groß, schlank, trug er einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd, eine grüne Weste?«
»Sie kennen ihn?« entfuhr es der jungen Frau.
»Und ob ich ihn kenne. Es ist Doc Holliday!«
»Wer –?« Ann Kelly wich einen Schritt zurück. »Doc Holliday? Der berühmte Doc Holliday?«
»Ja. Ich bin zusammen mit ihm aus Tombstone gekommen. Auf der Harper-Ranch…«
»Sie sind mit ihm gekommen?« Die Augen des Mädchens wurden groß und rund wie Kinderaugen. »Soll das etwa heißen – daß Sie Wyatt Earp sind?«
»Ja, das soll es heißen, und es ist traurig, daß es so ist.«
Ann Kelly schlug die Hände zusammen.
»Allmächtiger! Wyatt Earp!« Und dann strahlte sie den Marshal an. »Wie ich mich freue, Sie zu treffen.« Sie streckte ihm die Hand entgegen.
Wohl oder übel drückte Wyatt sie.
»Wie ging’s dem Doc?«
»Ich sagte es Ihnen ja, es ging ihm schlecht. Und ich wollte ihm helfen. Ich hatte Wasser bei mir. Aber er wollte keines haben. Außerdem schien er es eilig zu haben. Dann sah ich, wie er bei den Turmkakteen aus dem Sattel glitt. Ich ritt hinter ihm her, aber er hatte sich schon wieder erhoben, klopfte sich den Staub aus dem Anzug und ritt weiter. Ich hielt ihn für einen Verrückten. Er sah aus wie der Tod. Aber er ritt wie der Teufel. In voller Karriere preschte er nordwärts über die Overlandstreet davon. Wenn ich geahnt hätte, daß das Doc Holliday war, hätte ich doch anders mit ihm gesprochen. Ich hätte zumindest versucht, ihn zu überreden…«
Der Marshal winkte ab. »Sie hätten versuchen können, was Sie wollen, Sie hätten ihn nie überredet.«
Er hatte die Augen zusammengekniffen und blinzelte in das flimmernde Braungelb der Savanne hinaus.
»Ich bin seiner Spur gefolgt, weil es ihm so elend geht. Er ist hinter dem Mörder Suzan Harpers her.«
»Es ist schrecklich, was auf der Harper-Ranch geschehen ist! Ich habe es gehört«, sagte Ann. Aber ihre Gedanken waren weniger bei dem, was sie sagte, als bei dem, was sie sah. Der hochgewachsene Mann aus Missouri beeindruckte sie zutiefst. Und jetzt wußte sie, daß er sie schon in der ersten Minute, in der sie in sein Gesicht gesehen hatte, beeindruckt hatte. Und daß es der unbeugsame Stolz in seinen Augen war, der sie so gereizt hatte.
Nur bruchstückweise erfuhr sie, was dem Marshal unterwegs geschehen war.
Da legte sie ihre schlanke Hand auf seinen sonnverbrannten Unterarm.
»Bitte, Mr. Earp, Sie müssen mit mir kommen. Ich werde Ihnen ein gutes Pferd geben. Waffen und Proviant, damit Sie Doc Holliday folgen können.«
Diese Worte waren es, die den Missourier bewegten, mit ihr zurückzukommen. Schweigend gingen sie nebeneinander zur Ranch.
Als sie durchs Tor kamen, blickte die Frau oben auf der Veranda verblüfft auf, erhob sich und kam ihnen entgegen.
»Aber Ann«, meinte sie, »du bringst diesen Mann wieder mit?«
»Ja, Mary, ich bringe ihn mit«, sagte die Rancherin mit schroffer Stimme.
»Wo ist Gilbert?«
Der bärtige Mann trat aus der Tür.
»Hier bin ich, Ann. Hast du einen Wunsch?«
»Ja, ich habe einen Wunsch. Geh in die Küche und sieh zu, daß sofort ein anständiges Mittagessen für diesen Gentlemen gemacht wird. Und dann gehst du hinüber in den Corral und holst dein Pferd. Außerdem wünsche ich, daß er ein Gewehr und einen Revolver bekommt. Vorwärts!«
»Selbstverständlich, Ann«, beeilte sich der Mann zu sagen und machte sich auf den Weg.
Anderthalb Stunden später saß der Missourier im Sattel eines Fuchswallachs, der zwar nicht mit seinem Falben zu vergleichen war, aber doch ein recht gutes Pferd war. Er hatte eine Remingtonbüchse im Scabbard und einen Frontier-Revolver rechts im Halfter stecken. Proviant hatte er abgelehnt.
»Vielen Dank, Miß Kelly, ich werde schnell in Pearce sein und mir dort alles weitere beschaffen. Sie bekommen das Pferd, das Gewehr und den Revolver auf dem schnellsten Weg zurück. Ich danke Ihnen für alles.«
Sie stand oben auf der Veranda an einen der Dachpfeiler gelehnt und blickte ihn aus heißen Augen an.
»Soll das heißen, daß Sie nicht zurückkommen werden?«
»Wenn ich es ermöglichen kann, komme ich selbst, um Ihnen nochmals meinen Dank abzustatten. Aber wenn es nicht geht, muß ich einen Boten schicken.« Er reichte ihr die Hand.
Sie ließ die seine nicht los und blickte unverwandt in seine Augen. »Ich wünsche, daß Sie wiederkommen, Wyatt«, sagte sie mit weicher dunkler Stimme.
»Ich werde es versuchen«, entgegnete Wyatt, tippte grüßend an den
Hutrand und verließ die Ranch.
Später hat der Missourier den Weg mit Ann Kelly zurück zu ihrer Ranch oft bereut. Aber er hatte sich ja in einer Lage befunden, in der er auf das Angebot der Rancherin kaum verzichten konnte. Das Pferd ermöglichte es ihm, rasch nach Pearce zu kommen, wohin sich McElroy höchstwahrscheinlich gewandt hatte. Außerdem war in Pearce der Sheriff. Wyatt mußte zusehen, daß er so rasch wie möglich wieder in den Besitz seines Eigentums kam, um der Spur Doc Hollidays mit verdoppelter Eile folgen zu können. Die Sorge um den Freund hatte ja im Grunde alles verschuldet, was sich ereignet hatte.
Es würde ihm nicht ein zweites Mal passieren, daß ihn ein Tramp so plump überrumpeln könnte!
*
Es war Nachmittag, als er die Stadt erreichte. Das Sheriffs Office war geschlossen, und vor der Sunbeam-Bar stand kein Pferd.
Wyatt ging in die Gasse, in der er schon einmal seinen Falben gesucht hatte.
»Hallo, Mr. Staatenreiter!«
Der Marshal blickte sich um und sah drüben in dem Torspalt den Kopf des struppigen Jungen.
»Hallo, Jim.«
Der Kleine streckte den Kopf etwas weiter vor und feixte: »Suchen Sie wieder Ihr Pferd?«
»Erraten, Jimmy. Hast du es vielleicht gesehen?«
Der Kleine nickte.
Da ging der Marshal auf ihn zu. »Na, schwindelst du auch nicht?«
»Nein, ich habe es gesehen, es steht drüben in Betmans Mietstall.«
Wyatt griff in den Gurt, mußte aber feststellen, daß er nicht eine einzige Münze bei sich hatte.
»Tut mir leid, Jim, ich hätte dir neulich schon gerne einen Cent geschenkt. Aber heute habe ich nicht einmal einen bei mir.«
»Macht nichts, Staatenreiter«, feixte der Kleine.
Der Marshal ging auf den bezeichneten Mietstall zu. Als er das Tor öffnete, kam ihm ein krummbeiniger Mann entgegen, der eine große grüne Schürze trug und eine Schmiedezange in der Hand hatte.
»Was wollen Sie?«
»Ich wollte mich nach dem Falbhengst erkundigen, der bei Ihnen abgestellt worden ist.«
»Abgestellt?« Der Mann musterte ihn mit scheelem Blick. »Was soll das heißen? Wir haben den Gaul gekauft.«
»Gekauft? Interessant.«
»Was meinen Sie…?«
»Das Pferd gehört mir. Ich bin unterwegs überfallen und beraubt worden. Der Mann, der Ihnen das Tier verkauft hat, ist ein Pferdedieb.«
»Reden Sie keinen Unsinn. Der Bursche war in Ordnung. Ich kenne ihn. Er ist schon seit Jahren hier.«
»Das glauben Sie selbst nicht. Es ist ein irischer Tramp. Er ist noch niemals hier in der Gegend gewesen.«
»Scheren Sie sich zum Teufel, Mensch!«
»Nicht so hastig. Ich mache Sie darauf aufmerksam, daß Sie Diebesgut gekauft haben. Das Pferd gehört mir. Ich komme mit dem Sheriff zurück.«
»Strengen Sie sich nur nicht an!« rief da von der Haustür her eine quäkende Stimme.
Der Marshal wandte den Kopf und sah den feisten Sheriff oben stehen. Er hatte den Hut tief im Genick, eine dicke Zigarre im Mundwinkel und ein Glas in der Hand.
»Hallo, Sheriff, gut, daß Sie da sind. Ich muß mit Ihnen sprechen.«
»Lassen Sie mich zufrieden. Sie sind mir schon einmal auf die Nerven gefallen. Gehen Sie zum Teufel.«
Wyatt trat nahe an die Treppe heran und blickte zu dem Fettwanst auf.
»Ich hoffe doch, dem Gefangenen geht’s gut im Jail, Sheriff?« fragte er ahnungsvoll.
»Tut mir leid, der Bursche hat sich selbständig gemacht. Er ist über mich hergefallen und hat sich auf und davongemacht.«
Eine dunkle Welle des Zorns stieg in dem Marshal auf. Er wandte sich ab und verließ den Hof.
Draußen stand der Junge.
»Hast du vielleicht auch den Mann gesehen, der den Falben hergebracht hat, Jimmy?«
»Natürlich habe ich ihn gesehen.«
»Weißt du, wo er hingegangen ist?«
»Aber ja, in die Sunbeam-Bar! Da steht er mit Pete Ryan und pokert an der Theke.«
»Junge, wenn das wahr ist, bekommst du einen Dollar von mir.«
»Einen Dollar? Von einem Staatenreiter? Den würde ich mir ewig aufheben.«
Wyatt ging mit raschen Schritten zur Mainstreet zurück, betrat die Stepwalks, und als er den Schwingarm der Sunbeam-Bar aufstieß, sah er die beiden tatsächlich an der Theke stehen. Links stand der Gorillamann und rechts der Ire.
Wyatt blieb in der Tür stehen.
Ryan hatte ihn sofort gesehen und krächzte:
»Damned!«
Der Ire jedoch hatte noch nichts bemerkt, denn er blickte in sein Kartenspiel. Erst als er in das Gesicht seines Partners sah, merkte er, daß etwas los sein mußte.
Gegen die blendende Helle, die von der Straße hereinkam, erkannte er die riesige Gestalt des Missouriers.
Der Ire war einen Augenblick wie gelähmt vor Schreck, stieß dann die Rechte zum Revolver.
Da aber brüllte der Frontier-Colt in der Faust des Marshals auf.
Eine blutige Furche zog sich über den rechten Handrücken des Iren.
»Nicht doch, nicht doch«, krächzte der Wirt hinter der Theke, »Mister, Sie bringen eine Menge Unruhe in mein Haus. Tragen Sie Ihre Streitigkeiten mit diesen Leuten bitte auf der Straße aus. Ich habe viertausend Dollar für mein Inventar bezahlt!«
»Schnauze!« herrschte Ryan den Keeper durch den Mundwinkel an.
Wyatt kam mit harten Schritten näher.
»Komm mit, McElroy!«
Der Ire machte drei Schritte vorwärts.
Da setzte sich auch Pete Ryan in Bewegung.
»Augenblick, Brother, ich glaube, wir beide haben auch noch ein Wörtchen miteinander zu reden.
»Bleib’ wo du bist, Ryan«, befahl ihm der Marshal. »Ich habe es jetzt nur mit diesem Pferdedieb hier zu tun.«
Der Ire war wachsbleich geworden.
Aber Ryan wollte seine persönliche Rache an dem Fremden kühlen und kam herangestampft.
Wyatt, der sah, daß jetzt in die Augen des Iren ein tückischer Blick trat, riß den linken Fuß hoch, stieß Ryan zurück und hieb den heranhechtenden McElroy mit einem krachenden rechten Haken auf die staubigen Fußbodendielen.
Ryan wagte nicht mehr zum Revolver zu greifen.
Wyatt packte den betäubten Iren am Kragen und zerrte ihn rückwärts gehend zur Tür. Erst als er den Vorbau erreicht hatte, ließ er den Colt ins Halfter fliegen und schleppte den Iren auf die Straße.
Er wollte zum Sheriffs Office. In diesem Augenblick kam aus der Gassenenge Sheriff Donaldson, gefolgt von dem Stallbesitzer.
Der Sheriff hatte zwei Revolver in den Händen.
Wyatt war davon überzeugt, daß der feiste Mann es nicht wagen würde, zu schießen.
Dennoch war die Lage denkbar unangenehm, zumal jetzt noch andere Männer auf die Straße kamen. Und zu allem Übel gesellte sich auch der Gorilla Pete Ryan zu ihnen.
»Macht ihn doch fertig, den verdammten Tramp!« brüllte er.
»Ruhe!« schrie der Sheriff im höchsten Diskant. »Die Sache entscheide ich allein!«
»Er ist ein Pferdedieb!« belferte der Ire, der wieder zu sich gekommen war. »Er hat mir das Pferd gestohlen, und mich überfallen. Ich konnte ihm gerade noch entfliehen.«
»So ist das also«, meinte der einfältige Sheriff. »Dann werde ich…«
»Reden Sie doch keinen Unsinn, Donaldson«, schnitt der Marshal dem lappigen Sheriff die Rede ab. »Sie wissen selbst, daß ich mit dem Falbhengst in die Stadt gekommen bin. Wie kann ich ihn diesem Manne da gestohlen haben, den ich erst einen Tag später weit oben im Norden von hier traf?«
»Das ist es ja eben«, brüllte der Ire geistesgegenwärtig. »Er hat mich vorher überfallen und mir das Pferd gestohlen. Ich war auf seiner Fährte, wir haben uns nicht im Norden getroffen, sondern weit im Süden von hier!«
Das war eine Infamie ohnegleichen.
»Aufhängen!« schrie Ryan.
»Jawohl, aufhängen!« brüllte jetzt auch der Ire, und hektische Flecken brannten auf seinen Wangen. Er wußte genau, daß es nun um Kopf und Kragen ging. Und zwar, wenn es ihm nicht gelang, den Fremden in die Schlinge zu zerren, um seinen eigenen Kopf!
»Aufhängen!« brüllten jetzt auch die anderen Männer.
Da röhrte ein Gewehrschuß über die Straße.
Die Menge flog auseinander. Wyatt blickte sich um. Quer über die Straße hielt eine ganze Reihe von Cowboys, die ihre Gewehre in Händen hatten. Vor ihnen auf einem weißen Pferd hielt Ann Kelly. Sie hatte die noch rauchende Büchse in der Hand.
»Sheriff«, rief sie mit schneidender Stimme, »ich habe das Gefühl, daß Sie amtsmüde sind. Wissen Sie, wer der Mann ist, mit dem Sie da sprechen?«
»Das weiß ich nicht, Miß Kelly. Aber das ist auch völlig uninteressant. Der Mann ist ein Pferdedieb!«
»Sie sind ein Trottel, Donaldson!« herrschte ihn die Rancherin an. »Dieser Mann ist Wyatt Earp!«
Der Name fuhr den Menschen auf der Straße ins Mark. Augenblicklich war die Mainstreet frei. Nur der Sheriff, Ryan und der Ire standen noch vor dem Marshal.
»Wyatt Earp?« brach es von den Lippen des Iren.
»Ja«, entgegnete der Marshal, »ich habe dir meinen Namen genannt, Bandit, aber das hat dich nicht davon abgehalten, mich zu überfallen, niederzuschlagen, mein Pferd, meine Waffen und all mein anderes Eigentum zu stehlen.«
Ann Kelly hatte ihre Waffe in den Scabbard geschoben und stützte beide Hände aufs Sattelhorn. »Sheriff, ich wünsche, daß das Pferd des Marshals augenblicklich herbeigeschafft wird. Ebenso alles andere, was ihm gehört. Und ferner wünsche ich, daß dieser Mann da aufgeknüpft wird.« Sie deutete mit dem ausgestreckten Arm auf den Iren.
McElroy wurde kreidebleich. Plötzlich klammerte er beide Hände um den rechten Unterarm des Marshals.
»Mr. Earp, ich bitte Sie um Vergebung! Ich flehe Sie an. Sie können doch nicht zulassen, daß ich aufgeknüpft werde!«
»So?« fragte der Marshal. »Kann ich das nicht? Sie aber haben zugelassen, daß ich ohne jede Waffe, ohne ein Pferd und ohne eine Wasserflasche oben in der Savanne liegen bleiben mußte.«
»Ich flehe Sie an!« McElroy brach in die Knie und faltete die Hände. »Marshal, ich flehe Sie an, Sie können mich nicht verderben lassen!«
Wyatt winkte ab. »Sheriff, wo ist mein Pferd?«
Der Mietstallbesitzer hatte sich schon davongemacht und kam eben aus der Gasse zurück. Er hatte das Pferd – und auch alles andere, was dem Marshal abgenommen worden war.
McElroy war so raffiniert gewesen, alles gleich in Geld umzusetzen. Allerdings war er auch dumm genug gewesen, hier gleich am Ort seinen Fischzug zu feiern, anstatt sich aus dem Staub zu machen.
Wyatt stieg in den Sattel.
McElroy brüllte: »Marshal!«
Wyatt blickte über die linke Schulter zurück.
»Lassen Sie die feige Ratte laufen, Sheriff.«
Donaldson nickte heftig. »Natürlich, Marshal, wie Sie befehlen!«
McElroy rannte davon, holte seinen Rotfuchs aus dem Mietstall und floh trotz seiner Verletzungen sofort aus der Stadt.
Wyatt sah den kleinen Jimmy drüben an der Gassenecke lehnen, ritt auf ihn zu, schnipste ihm einen Dollar hinüber und rief: »Komm, bring den Fuchswallach her. Miß Kelly wird ihn mit zurück zur Ranch nehmen.«
Der Junge lief davon und holte das Pferd.
Wyatt hielt jetzt neben der Frau.
Sie blickte ihn unverwandt aus ihren bernsteinfarbenen Augen an.
»Wann kommen Sie zurück, Marshal?«
»Ich weiß es nicht. Leben Sie wohl, Miß Kelly.« Er nahm sein Pferd herum und preschte durch die Gasse davon.
*
Nacht über der Harper-Ranch.
Oben in seiner Kammer stand der Rancher am offenen Fenster und blickte auf den Garten hinaus. Wie in den letzten Nächten so fand er auch in dieser Nacht keinen Schlaf.
Da unten war der Garten, den seine Tochter in langen Jahren angelegt und gepflegt hatte. Und nun lag sie selbst wenige Yards davon entfernt unter einem frischen Erdhügel. Ganze achtzehn Jahre alt, war sie noch vor der Blüte ihres Lebens von einer Mörderkugel hinweggerafft worden.
Es wollte und wollte nicht in seinen Bauernschädel! Nie würde er es begreifen können.
Im Haus war alles still.
Die erloschene Zigarre zwischen den Lippen, so starrte er hinaus in die Nacht.
Plötzlich sah er vom Weg her einen Reiter kommen, der sich der Rückfront des Hauses näherte.
Der Rancher kniff das linke Auge ein, um den Mann erkennen zu können.
Der hielt plötzlich an. Gegen den hellen Boden konnte Harper erkennen, daß er die Arme hob.
Und plötzlich brüllte ein Gewehrschuß auf.
Dicht neben dem Kopf des Ranchers schlug die Kugel in das Rahmenholz. Gleich darauf peitschte ein zweiter Schuß auf, und Harper, der zurückweichen wollte, wurde oben rechts in der Brust schwer getroffen.
Noch im Zurückweichen traf ihn die dritte Kugel des Mörders an der Herzspitze und tötete ihn. Schwer war James Harper auf die Dielen aufgeschlagen.
Es dauerte Minuten, bis Schritte im Hausgang zu hören waren. Es war sein Sohn Clarke, der die Treppe hinaufstürmte, gefolgt von dem Vormann und zwei Cowboys. Sie stießen die Tür auf.
Clarke blieb wie gebannt auf der Schwelle stehen.
»Vater!« entrang es sich heiser seiner Brust. Dann brach er neben dem Toten in die Knie, stieß einen gellenden Fluch aus und schlug die Hände vors Gesicht.
Der vierschrötige Vormann stand wie gelähmt da und hatte beide Hände um die Ölkanne der Kerosinlampe gepreßt.
Die anderen Cowboys, die jetzt die Treppe heraufkamen, blickten in stummer Verzweiflung über die Schultern des Vormannes auf die makabre Szene.
Ein zweites Mal hatte der Tod auf der Harper-Ranch zugeschlagen!
Clarke Harper hockte bis zum Morgengrauen unten in der großen Küche und starrte wortlos durchs Fenster. Am Tisch saßen der Vormann und drei Cowboys, die den jungen Mann nach diesem furchtbaren Ereignis nicht hatten allein lassen wollen.
In der Morgenfrühe trugen sie den Boß hinaus und betteten ihn neben seine Tochter in die Erde seines Hofes.
Clarke Harper zog sich gegen sieben Uhr in den Sattel und verließ, gefolgt von dem Vormann und zwei Cowboys, den Ranchhof, um nach Gleason hinüberzureiten.
Als Sheriff Hancoc die neue Schreckensnachricht erfuhr, griff er sich in den Nacken und stieß einen lästerlichen Fluch durch die Zähne.
»Doc Holliday! Hol’s der Teufel. Dieser Mensch rottet die ganze Familie aus! Clarke, Sie werden sich in acht nehmen müssen. Am besten bleiben Sie erst einmal in der Stadt, bis wir den Kerl gefaßt haben.«
Aber Clarke Harper schüttelte den Kopf.
»Nein, Sheriff, das werde ich nicht. Ich bin schließlich kein Feigling. Ich werde im Gegenteil zurückkehren auf die Ranch und auf ihn warten. Und ich sage Ihnen: Wehe, wenn er kommt! Ich werde die Mörder meines Vaters und meiner Schwester auseinandernehmen. Das schwöre ich Ihnen.«
Mit finsterem Gesicht zog er sich in den Sattel und ritt zur Ranch zurück.
Sheriff Hancoc überlegte, was den Georgier dazu veranlaßt haben könnte, die Familie so schwer zu treffen.
*
Wyatt Earp war von Pearce aus nach Norden geritten.
Fünf Meilen südöstlich von der Stadt Cochise traf er einen alten Trader, den er nach Doc Holliday und auch nach Mike Torrey fragte.
Als der Alte die Beschreibung Torreys hörte, nickte er.
»Ja, mir scheint, daß ich den Jungen gesehen habe. Und zwar gestern oben in der Stadt. Es war an der Bahn, wo die Rinderpferch steht. Da wird Vieh verladen. Ich meine, ich hätte ihn da irgendwo am Gatter lehnen sehen, kann mich aber auch irren…«
Wyatt beschrieb ihm das Gesicht noch einmal.
Der Alte nickte wieder. »Ja, ich weiß es jetzt ganz bestimmt. Das ist der Bursche gewesen. So ein Gesicht vergißt man schließlich nicht so leicht.«
Der Missourier bedankte sich, schenkte dem Alten eine seiner schwarzen Zigarren und machte sich auf den Weg nach Cochise.
Die Stadt lag damals an der Bahnstrecke, die von Lordsburg hinauf nach Tucson führte. Heute führt die Hauptbahnstrecke und vor allem die Highway einige Meilen weiter nördlich an der längst bedeutungslos gewordenen Stadt vorbei.
Damals aber war Cochise, das an den Namen des großen Apachenhäuptling erinnern sollte, der so viele heldenhafte Versuche unternommen hatte, sein Volk mit der weißen Rasse zu verbünden, eine bedeutende Stadt.
Es war zu Beginn der Achtziger Jahre noch eine kleine schäbige graubraune Kistenholzstadt gewesen – wie all die anderen auch in diesem Territorium. Was es jedoch von ihnen unterschied, war eben die Tatsache, daß die Bahn durch Cochise führte.
Es war kurz vor Abend, als der Missourier die Corrals an der Verladestelle erreichte. Er ließ sein Pferd in einem nahen Mietstall, drückte dem Negerpeon, der ihn zähnefletschend anblickte, einen Vierteldollar in die ebenholzfarbene Hand und konnte sicher sein, daß der schwarze Mann das kostbare Pferd gut hüten würde.
Der Marshal ging zu den Corrals hinüber, die dicht am Bahngelände lagen.
Viele Männer waren damit beschäftigt, Rinder in die Holzgatter zu treiben und andere herauszulassen. Das ging offenbar nur mit Hilfe wüster Schreie ab.
Der Missourier schob sich durch die Menschen, die an den Gattern lehnten, um dem Treiben zuzusehen.
Plötzlich blieb er stehen und fixierte einen Mann, der auf dem obersten Gatterbrett saß und die Arbeit der Cowboys beobachtete.
Kein Zweifel, es war Jeff Flegger, der Torrey-Man, den Wyatt Earp unten in Pearce ins Jail gebracht hatte!
Wyatt sah sich erst vorsichtig nach allen Seiten um, ehe er sich näherte, da er annahm, daß sich noch andere von Torreys Männern hier in der Nähe aufhielten.
Aber er wollte es auch nicht riskieren, selbst überrascht zu werden, deshalb ging er rasch auf Flegger zu, packte ihn plötzlich am Fuß und zerrte ihn vom Gatter.
Sie standen mitten im Gewimmel voreinander.
Fleggers Gesicht war leichenblaß geworden.
»Wo ist Torrey?« Heiser und halblaut brach die Frage über die Lippen des Marshals.
Der Ohio-Man schluckte schwer.
»Ich weiß es nicht, Mister. Ich kann es Ihnen nicht sagen.«
»Du bist aus dem Jail von Pearce nicht allein herausgekommen. Wer hat dir herausgeholfen?«
»Well, wenn Sie es unbedingt wissen müssen: ein paar von den Boys.«
»Wer?«
»Flashland war da und ein anderer Freund von mir.«
»Flashland ist einer der Männer von Mike Torrey, nicht wahr?«
»Nun ja, er war bei den Boys, die mit uns im Hof der Harper-Ranch waren.«
Wyatt spannte seine Rechte um den Oberarm des Tramps.
»Hör genau zu, Bandit, auf der Harper-Ranch ist eine Frau erschossen worden. Und die Leute halten meinen Gefährten für den Mörder. Ich bin aber der Überzeugung, daß der Mord auf euer Konto geht. Und so lange ich Torrey nicht habe, stehst du mir für ihn.«
Fleggers Gesicht wurde noch blasser.
»Aber das ist doch… Sie können mich doch nicht für einen Mord verantwortlich machen, den ein anderer begangen hat?«
»Du gehörst zu Torreys Leuten. Wer sagt mir, daß du es nicht gewesen bist, der Suzan Harper ermordet hat! Ich werde dafür sorgen, daß du an den Strick kommst, Bursche.«
Wyatt packte ihn und schleppte ihn vorwärts.
Plötzlich wurde ihnen der Weg versperrt.
Ein baumlanger Mensch stand zwischen den Gatterreihen, breitbeinig, die Hände in die Hüften gestützt. Seine grauen Augen ruhten stechend auf dem Gesicht des Marshals.
»Augenblick, Stranger. Wohin willst du mit meinem Freund Flegger?«
»Aus dem Weg!« herrschte ihn der Marshal an.
Aber der Mann wich nicht von der Stelle.
»Mein Name ist Collins. Ich werde nicht dulden, daß du meinen Freund zu einer Partie einlädst, die ihm nicht behagt. Laß ihn los!«
Wyatt ging weiter und stieß Flegger vor sich her.
Als sie Collins erreicht hatten, griff der blitzschnell zum Messer.
Wyatt schleuderte Flegger gegen das Gatter und hechtete Collins entgegen.
Der hatte das Messer zum Stoß hochgerissen.
Aber Wyatt wuchtete ihm einen Moment, bevor er zustoßen konnte, einen linken Haken in die rechte Achselhöhle.
Collins ließ das Messer fallen.
Gedankenschnell folgte dem linken Haken ein rechter. Collins schwankte durch ein offenstehendes Gattertor und stürzte in den Staub.
Wyatt hatte Flegger, der sich gerade davonstehlen wollte, gepackt und schob ihn vorwärts. Aber damit hatte er Collins noch nicht abgeschüttelt.
Der war sofort wieder hinter ihm und packte ihn am Kragen.
Wyatt riß Flegger herum, der es gar nicht wagte, sich noch zu wehren, und stieß Collins mit einem Fußtritt von sich.
»Sieh zu, Collins, daß du nach Hause kommst, sonst kannst du heute dein Abendbrot nicht mehr in den eigenen Zähnen beißen.«
Der baumlange Collins kam wieder hoch und keuchte heran.
»Damned, ich werde es dir zeigen!«
Einer der Männer, der mit schaukelnden Beinen auf den Gatterstangen gesessen hatte, um der Auseinandersetzung zuzusehen, brüllte plötzlich los: »Gib’s ihm, Hal! Schlag ihn zusammen!«
Wyatt wußte, daß er jetzt handeln mußte, wenn er nicht seinen eigenen Untergang riskieren wollte.
Er hämmerte Collins eine fürchterliche Rechte entgegen, die den Mann hart auf der Kinnspitze traf und von den Beinen warf.
Wyatt wandte sich um, packte Flegger, der sich erneut hatte davonstehlen wollen, und schleppte ihn aus den Corrals heraus.
Mehrere Männer folgten ihnen im Abstand von etwa fünfzehn Yard. Flegger sah sich immer wieder nach ihnen um.
Plötzlich brüllte er: »Los, Boys, drauf, macht ihn fertig!«
Wyatt schleuderte ihn von sich, daß er gegen einen Wagen prallte, und hatte gleich darauf den Revolver in der Hand. Bisher hatte er es vermieden, in der Corralenge zur Waffe zu greifen. Nun aber hatte er keine andere Chance mehr. Der schwere Buntline Special in seiner Linken funkelte in der Sonne.
»Stehenbleiben, Leute. Ich habe diesen Mann festgenommen, weil er im Verdacht steht, auf der Harper-Ranch unten bei Gleason einen Mord verübt zu haben.«
»Schwindel!« brüllte Flegger. »Der Halunke ärgert sich nur über einen Spielverlust, den ich ihm beigebracht habe!«
Die Männer rührten sich nicht vom Fleck.
Wyatt ließ den Colt mit einem Salto zurück ins Halfter fliegen, ging auf Flegger zu, packte ihn am Kragen und ging mit ihm weiter der Mainstreet entgegen.
Die Männer kamen aber jetzt rasch näher.
Wyatt trat auf den ersten Vorbau, schob Flegger vor sich her und sah dann drüben im Tor des Mietstalls den Neger stehen.
»Wo ist das Sheriffs Office, Sam?« rief er dem Schwarzen zu.
Der deutete quer über die Straße.
»Da drüben das Steinhaus, Mister –«
Wyatt hielt darauf zu.
In dem Augenblick, in dem er die Tür dieses Hauses öffnete, brüllte ihm ein Schuß entgegen.
Nur um Haaresbreite vermochte er der Kugel zu entgehen, duckte sich nieder, stieß den eigenen Colt feuernd vor und sah hinten in der Tür die lange Gestalt des Tennessee-Mannes Jerry Pratt, der schon auf der Harper-Ranch gegen ihn aufgetreten war.
Zur namenlosen Verwunderung des Marshals trug der Bravo auf der linken Brustseite einen Stern.
Das Geschoß des Marshals hatte den rechten Oberarm Pratts sengend gestreift.
Jetzt schleuderte Wyatt Flegger ins Office, federte hoch, sprang in den Raum und stieß die Tür mit dem Fuß hinter sich zu.
»Laß den Colt fallen, Bandit!«
»Was fällt dir ein, Mensch! Wie redest du mit mir? Mein Name ist Pratt. Ich bin der Sheriff von Cochise.«
»Einen prächtigen Sheriff hat sich Cochise ausgesucht! Wo ist Mike Torrey, Halunke?«
»Ich weiß nicht, was du redest, Kuhtreiber. Ich habe das Gefühl, daß du geistesgestört bist. Ich werde jetzt meine Deputies holen und dich da drüben in eines der Löcher werfen lassen.«
Wyatt hatte Flegger scharf im Auge behalten, als er jetzt auf den langen Tennessee-Mann zuging.
»Ich habe das Gefühl, Brother, daß ich dir etwas sagen muß, um weitere Mißverständnisse auszuschalten. Mein Name ist Earp. Wyatt Earp. Ich denke nicht daran…«
Pratt war einen Schritt zurückgewichen. »Wyatt Earp?« entfuhr es ihm.
Auch Flegger hatte sich gegen den Schreibtisch zurückgezogen. »Das ist nicht wahr!« krächzte er. »Laß dich nicht bluffen, Jerry. Er will uns nur in die Enge treiben.«
»Ich weiß nicht«, meinte Pratt, ohne die Zähne auseinanderzunehmen. »Ich denke daran, wie er mit der Faust und dem Revolver umzugehen versteht. Ich habe bis heute noch keinen Kuhtreiber gesehen, der sich so darauf versteht.«
»Wo ist Mike Torrey?« wiederholte Wyatt Earp.
Pratt hob die Hände und schüttelte den Kopf.
»Ich weiß es nicht. Ich habe ihn unten bei Gleason getroffen und wußte nicht, wer er war. Ich begleitete ihn auf die Harper-Ranch, weil er dort angeblich Pferde kaufen wollte. Und über Sie habe ich mich geärgert, weil Sie sich so aufspielten.«
Ein böses Lächeln zuckte um die Mundwinkel des Marshals.
»Das hast du dir nicht schlecht ausgedacht, Pratt. Aber das wird dir nichts helfen. Wenn du wirklich der Sheriff von Cochise bist, so hast du dieses Amt verspielt. Du gehörst zu der Bande Mike Torreys.«
Da riskierte der Tennessee-Mann einen Ausfall, warf sich nach rechts und riß den Revolver hoch.
Zweimal brüllte der schwere Buntline-Revolver auf. Jeremias Pratt wurde mit einem doppelten Steckschuß in der rechten Hüfte gegen den Gewehrschrank geschleudert.
Durch den beißenden Pulverdampf stürmte der Marshal auf ihn zu, riß ihm die Waffe weg, zog ihm die zweite aus dem Halfter, packte ihn am Kragen und schleppte ihn in eine der Zellen hinüber.
Auch Flegger wurde eingesperrt.
Als Wyatt sich umwandte, wurde die Tür geöffnet, und ein Mann trat herein. Er war etwa fünfundvierzig, trug einen martialischen Schnauzbart und blickte den Marshal verblüfft an.
»He, was gibt’s hier…« Er brach jäh ab, riß die Augen weit auf und brüllte: »Wyatt Earp! Heavens, Marshal, ich hätte nie gedacht, daß ich Sie noch einmal wiedersehen würde.«
Wyatt kniff das linke Auge ein und meinte dann:
»Joe Walker?«
Der Deputy nickte. »Ja, es freut mich, Marshal, daß Sie sich meiner erinnern. Es ist schon lange her, daß wir beide uns in Wichita begegnet sind. Ich war damals, als Sie Ihre große Laufbahn begannen, ein kleiner Police-Man – und habe es, wie Sie sehen, kaum weitergebracht. Ich bin der Deputy eines ziemlich eigenartigen Sheriffs…«
Wieder brach er ab und sah seinen »Boß« drüben blutend in der Zelle kauern. »Was ist denn mit ihm los?«
Wyatt klärte Walker kurz auf.
Der nickte knurrend. »So habe ich es mir ungefähr vorgestellt. Der saubere Pratt gefiel mir schon lange nicht. Mag der Teufel wissen, wie es ihm gelungen ist, hier den Stern zu bekommen. Ich habe ihn längst im Verdacht, daß er zu einer Bande gehört. Hier geschieht zu viel in der Stadt, was er deckt.«
Aus Jerry Pratt und Jeff Flegger war nichts über den Verbleib Torreys herauszubekommen.
Flegger schwor, daß sowohl er als auch Pratt nicht wieder auf die Harper-Ranch zurückgekehrt seien, sondern sich schon anderthalb Meilen später von Torrey getrennt hätten. Flegger gab weiter zu, daß Harper mit Torrey seit langem befreundet sei, aber immer wieder Streit mit ihm bekommen hätte. Als Sheriff von Cochise war es ihm möglich gewesen, Torrey manchen Dienst zu erweisen. Immer wieder hatte er die Stadt verlassen, um mit Torrey und den anderen durch die Gegend zu streunen.
Das war alles, was Wyatt Earp aus dem Ohio-Man herauspressen konnte.
Jerry Pratt, der von einem Quaksalber verbunden worden war, redete kein Wort, sondern blickte nur finster drein.
Der Abend hatte sich über die Stadt gesenkt. Wyatt suchte Schenke für Schenke ab, konnte aber nirgends eine Spur von Torrey und den anderen entdecken. Überall beschrieb er den Leuten auch das Äußere Doc Hollidays in der Hoffnung, daß vielleicht einer den Spieler gesehen habe. Aber da er nirgends etwas hörte, kam er schließlich zu der Überzeugung, daß Doc Holliday Cochise gar nicht erreicht hatte; denn ein so auffällig gekleideter Mann wie der Spieler hätte doch auffallen müssen.
Hatte aber der Trader, den der Marshal unterwegs getroffen hatte, nicht behauptet, daß Torrey in der Stadt gewesen wäre? Also war der Bandit hiergewesen und wieder verschwunden? Oder der Trader hatte sich geirrt.
Vielleicht hatte Torrey den Gegner auch früh genug entdeckt und sich deshalb aus dem Staub gemacht. Immerhin waren noch zwei seiner Leute bei ihm. Wie Wyatt von Flegger erfahren hatte, handelte es sich da um den Oregon-Man Joe Flashland und Theodore Grey aus Arkansas.
Wieder stand der Marshal vor einem Nichts.
Wo mochte Doc Holliday sein?
Wenn Ann Kelly die Wahrheit gesagt hatte, dann ging es dem Georgier immer noch schlecht, und der Ritt mußte ihm scheußlich zu schaffen gemacht haben. Aber mit eiserner Energie hatte er ihn fortgesetzt. War er wieder aus dem Sattel gestürzt, um vielleicht irgendwo zwischen Pearce und dem Plateau im Steingeröll liegenzubleiben?
Heiß stieg es dem Marshal in die Brust.
Seine Stirn war schweißnaß. Immer noch lag die glühende Hitze des Tages zwischen den Häusern.
Er ging in den Mietstall zurück, holte seinen Falben, zahlte, zog sich in den Sattel und ritt aus der Stadt.
Doc Holliday hatte also Cochise nicht erreicht. Irgendwo zwischen hier und dem fernen Pearce mußte sein Weg zu Ende gewesen sein.
Natürlich gab es auch noch die Möglichkeit, daß er auf der Strecke abgebogen war.
Wyatt wußte, daß es vielleicht besser gewesen wäre, in der Stadt zu bleiben, in der Torrey eigentlich stecken mußte, und doch ritt er aus einem unbewußten Gefühl heraus weiter. Er folgte dem gleichen Mahner in seiner Brust, der ihn schon so oft vor einer Gefahr gewarnt und auf den richtigen Weg gewiesen hatte. So ritt der Marshal durch die sternenhelle Nacht der Savanne nach Süden.
*
Schwelende Sonnenglut lastete auf der Steppe, als er am frühen Nachmittag des darauffolgenden Tages nach vielerlei Umwegen westlich von der Kelly-Ranch auf Pearce zuhielt.
Der Cowboy Charlie Ripman sah ihn von einer Anhöhe aus eine Talsenke passieren, wischte sich durch das verschwitzte Gesicht, stieg dann hinunter, schwang sich auf den Rücken seiner braunen Stute und galoppierte zur Ranch.
Ann Kelly, die ihn kommen sah, zog die Brauen ärgerlich zusammen. »Weshalb kommen Sie schon jetzt zurück, Ripman? Sie wissen genau, daß ich es nicht leiden kann, wenn einer meiner Leute tagsüber seinen Posten verläßt. Was wollen Sie?«
»Madam, da unten in der Talsohle habe ich einen Mann auf einem Falben gesehen, der eine fatale Ähnlichkeit mit Wyatt Earp hat.«
Flammende Röte übergoß das Gesicht der Frau, und die Falten des Unmuts waren sofort daraus gewichen.
»Mein Pferd!« rief sie.
Ripman rannte zum Corral, holte ihren Schimmel, sattelte ihn auf und brachte ihn in den Hof.
Ann Kelly sprang auf das Pferd und Ritt zwischen Scheune und Küchenhaus hindurch auf die Savanne hinaus.
Der Missourier sah die Staubfahne, die von einem Hügelkamm hinunter der Talsenke entgegenkam, schon von weitem. Er hielt sein Pferd an, und als er den Schimmel der Rancherin erkannte, verfinsterte sich sein Gesicht.
»Auch das noch«, brummte er, stieg aber aus dem Sattel und blickte der Frau entgegen.
Ann Kelly war von dem schnellen Ritt durch den Mittag glühend erhitzt, glitt aus dem Sattel und blieb vor dem Mann stehen. Wortlos blickte sie in seine Augen.
»Wyatt«, sagte sie endlich.
Der Marshal sah sie unbehaglich an.
»Ich bin auf dem Weg nach Pearce. Ich habe Doc Holliday noch nicht gefunden.«
Da stieß die Frau durch die Zähne: »Doc Holliday? Er ist längst tot.«
Der Missourier hatte das Gefühl, als habe eine Eishand nach seinem Herzen gegriffen.
»Woher wissen Sie das?« kam es rostig aus seiner Kehle.
»Ich weiß es. Kommen Sie mit auf die Ranch!«
Da spannte die Linke des Marshals sich um eines ihrer schmalen Handgelenke.
»Hören Sie, Ann, ich kann Ihnen nicht glauben.«
»Dann lassen Sie es.« Sie machte sich von ihm los.
»Weshalb soll ich mit auf die Ranch kommen?«
»Weil es sinnlos ist, daß Sie einen Phantom nachjagen. Ich gebe zu, daß wir ihn nicht gefunden haben. Aber er kann nicht weit gekommen sein. Er wird irgendwo oben in den Steinen vorm Plateau liegen. Wenn Sie wollen, setze ich meine Leute alle in die Sättel und lasse ihn suchen.«
Wyatt zog den Hut tiefer in die Stirn, ging zu seinem Pferd und stieg in den Sattel.
»So long, Miß Kelly. Ich muß weiter.«
Er nahm die Zügelleinen auf und ritt im scharfen Trab davon.
Mit glänzenden Augen sah die Frau hinter ihm her; in ihrem Herzen brannte die Leidenschaft, die sie nicht zu beherrschen verstand.
Als der Marshal in der Ferne endlich Pearce vor sich auftauchen sah, hatte er einen strapaziösen Ritt hinter sich. Ermattet und durstig stieg er vor Longs Eck-Saloon vom Pferd, führte den Falben in den Schatten des Hofes und betrat die Schenke.
Der Wirt blickte ihm mit zusammengekniffenen Augen entgegen.
»Hallo, kennen wir uns nicht?«
»Möglich«, entgegnete der Marshal. »Kann ich etwas zu essen bekommen?«
»Natürlich. Soll es ein saftiges Steak sein?«
»Ja, bitte. Und wenn es geht, einen Kaffee ohne Milch.«
Nachdem der Missourier sich gestärkt hatte, fühlte er sich schon wesentlich wohler. Er zahlte die Zeche, verließ das Haus, nahm den Falben am Zügel und suchte die Mainstreet nach einem Mietstall ab.
Als er endlich einen gefunden hatte, kam ihm ein gebeugter weißhaariger Mann entgegen.
»Kann ich mein Pferd bei Ihnen unterstellen, Mister?«
»Natürlich können Sie das.«
»Es ist mir in dieser Stadt zweimal gestohlen worden.«
»Ich weiß, Marshal«, meinte der Alte und gab damit zu erkennen, daß er von der Sache wußte. »Sie können sich auf mich verlassen. Der Hengst ist bei mir absolut sicher. Und wenn Sie noch etwas sehen wollen, dann kommen Sie mal mit.«
Er führte den Marshal ins Stallhaus. Das erste, was der Missourier sah, war ein schwarzes edelgebautes Pferd, das in einer der vordersten Boxen stand.
Es war der Rapphengst des Georgiers!
Der Anblick des Pferdes hatte dem Marshal fast den Atem verschlagen.
»Wo ist der Mann, der dieses Pferd gebracht hat?«
»Das kann ich Ihnen leider nicht sagen.«
»Wer war es?«
»Ein Mann, dem es ganz sicher nicht gehört.«
»Sprechen Sie weiter, Mister«, drängte der Marshal den Mietstallinhaber.
»Well, es war ein untersetzter Bursche von vielleicht dreißig Jahren. Er hatte einen massigen Schädel, krauses Blondhaar und eine stumpfe Nase.«
»Kannten Sie ihn?«
»Nein. Er trug Cowboytracht, schien mir aber viel eher ein Bandit zu sein. Er war unrasiert und wirkte reichlich abgerissen.«
»Weshalb haben Sie mir dieses Pferd gezeigt?« forschte der Marshal.
Um die faltigen Mundwinkel des Alten flog ein Lächeln.
»Ich dachte mir, daß es Sie vielleicht interessiert.«
In den Augen des Gesetzesmannes schien plötzlich Eis zu stehen, mit heiserer Stimme forderte er:
»Sagen Sie mir die Wahrheit!«
»Well, ich sage Ihnen ja, daß Sie sich auf mich verlassen können. Ich bin ein wachsamer Mensch, und so habe ich mir erlaubt, die Satteltaschen des Hengstes zu durchsuchen. Da habe ich dann allerlei Dinge gefunden, die nicht zu diesem Strolch paßten, der das Pferd hier untergestellt hat.«
»Was zum Beispiel?«
»Das zum Beispiel.« Der Alte ging auf einen großen Gerätekasten zu, hob den Deckel, nahm eine kleine Arzneiflasche hervor und hielt sie dem Marshal hin. Dann bückte er sich wieder und holte zwei dünne Bücher, die in einer fremden Sprache gedruckt waren. Anschließend brachte er ein zusammengefaltetes Blatt, auf dem etwas in lateinischer Schrift geschrieben stand. »Wollen Sie mir sagen, was ein Cowboy mit diesen Dingen tun soll?«
»Das Pferd gehört Doc Holliday«, brach es rauh von den Lippen des Marshals.
»Ich habe es mir gedacht«, entgegnete der Alte, »und aus diesem Grunde habe ich auch den Sheriff verständigt.«
Wyatt griff sich an den Kopf.
»Auch das noch! Donaldson steht nicht auf meiner Seite.«
»Kann sein. Aber es war meine Pflicht, ihn darauf aufmerksam zu machen, daß irgendein Satteltramp das Pferd Doc Hollidays hier abgestellt hat.«
»Well, Sie haben es gut gemeint. Vielen Dank. Jetzt tun Sie mir einen Gefallen, Mister, und nehmen Sie den Hengst da weg. Sicher haben Sie einen Platz, wo ihn nicht jeder sofort findet.«
»Natürlich habe ich das. Ich werde ihn hinten in dem kleinen Stall am Scheunenanbau unterbringen, wo ihn so leicht niemand sucht.«
Der Marshal hatte das Gefühl, daß seine Glieder bleischwer waren, als er das Mietstallanwesen durch die kleine Pforte zur hinteren Gasse hin verließ.
Was war mit Doc Holliday geschehen? Und wer war der Mann, der sein Pferd hier untergestellt hatte?
Wyatt hatte die Gasse durchmessen und sah vorne in der Mündung zur Querstraße einen Mann vor sich, der eine untersetzte breite Gestalt hatte, krauses Haar und eine eingeschlagene Sattelnase. Sein Gesicht war unrasiert, und er wirkte ziemlich abgerissen.
Wyatt blieb stehen und fixierte ihn scharf.
Der Mann lachte dümmlich und zeigte dabei, daß ihm die Schneidezähne im Oberkiefer fehlten.
Wyatt ging bis auf drei Yard an ihn heran.
»Was gibt’s zu lachen, Mister?«
»Suchen Sie ein Pferd, Mister?«
»Ja, weshalb nicht.«
»Was wollen Sie ausgeben?«
»Kommt darauf an, wie der Gaul aussieht.«
»Erste Klasse. Ein Rapphengst, sogar indianische Schule.«
»Aus welcher Gegend stammt er?«
»Aus Prescott. Ich habe ihn selbst da gekauft und vierhundertzwanzig Bucks dafür gegeben. Aber ich bin in einer kleinen Klemme und gebe ihn für zweihundert ab.«
»Kein schlechtes Geschäft«, meinte der Marshal. Und plötzlich funkelte in seiner Faust der sechskantige Revolver. »Nimm die Hände hoch, Pferdedieb.«
Der andere schluckte schwer. »Sind Sie verrückt…?«
»Mein Name ist Earp. Und der Mann, dem dieses Pferd gehört, heißt Holliday. Und wenn du mir jetzt nicht augenblicklich sagst, wo er ist, jage ich dir das ganze Magazin in den Leib!«
Der Mann war leichenblaß geworden. »Wyatt Earp sind Sie?«
»Ja, Amigo, du hast Pech gehabt. Und jetzt mach den Mund auf!«
»Ich wußte nicht, daß es sein Pferd ist. Ich habe es gefunden.«
»Gefunden?« brach es wild aus der Kehle des Missouriers. Dann ließ er den Colt ins Halfter zurückfliegen, packte den Mann am Kragen und preßte ihn gegen die Hauswand. »Wo willst du es gefunden haben?«
»Einige Meilen östlich von hier an einem Mesquitegestrüpp.«
»Da hast du es also gefunden? Und den Reiter hast du zufällig nirgends gesehen?«
»Nein.«
»Komm mit, Brother!«
»Wohin?«
»Das werde ich dir schon zeigen.«
Wyatt schleppte ihn hinauf zur Mainstreet und brachte ihn ins Sheriffs Office.
Der alte Donaldson blickte mürrisch auf, als er den Störenfried erkannte.
»Ah, Mr. Earp, Sie sind wieder in der Stadt – und gleich haben Sie einen Kunden für mich.«
»Tut mir leid, wenn ich Ihnen Arbeit bringe, Sheriff, aber es geht nicht anders. Dieser Mann hat Doc Hollidays Pferd hier in einem Mietstall untergestellt; er wollte es mir verkaufen.«
»Doc Hollidays Pferd?«
»Ja.« Wyatt öffnete eine Zelle und stieß den Burschen hinein. »Man sollte dich sofort hängen, Amigo! Aber du sollst eine Chance bekommen.«
Da machte der Mann zwei Schritte nach vorn und keuchte:
»Marshal, ich schwöre Ihnen, ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Wenn Sie wollen, führe ich Sie an die Stelle, wo ich das Pferd gefunden habe.«
Der Sheriff im Hintergrund kicherte hämisch.
»Ja, lassen Sie sich nur von dem Strolch hinführen. Der wird Sie in eine neue Falle locken.«
»Hören Sie nicht auf ihn, Marshal. Ich führe Sie hin. Mein Name ist Tom Leaven. Ich habe bis vor einer Woche bei Ann Kelly gearbeitet, die mich aber hinausgeworfen hat, weil ich ihren verrückten Neffen geschlagen habe. Ich irre seitdem hier durch die Gegend und suche einen neuen Job. Und plötzlich sah ich das Pferd an den Mesquitesträuchern stehen.«
Wyatt musterte ihn einige Sekunden forschend, packte ihn dann am Arm und zerrte ihn aus der Zelle heraus.
»All right, Leaven. Sie kommen mit.«
Der abgerissen wirkende Cowboy folgte dem Marshal auf den Vorbau.
Sie gingen zum Mietstall hinunter und holten die Pferde. Leaven hatte seinen eigenen Grauen natürlich auch da abgegeben. Er mußte jetzt den schwarzen Hengst des Spielers, den er zu Geld hatte machen wollen, an der Zügelleine hinter sich herführen.
Als Wyatt das Tor des Mietstalls hinter sich hatte, sah er sich urplötzlich mehreren Reitern gegenüber, die offensichtlich auf ihn gewartet hatten. Sie versperrten die Straße. Es waren Clarke Harper, sein Vormann Farland und drei andere Cowboys von der Harper-Ranch.
Wyatt blickte den Burschen ins Gesicht.
Clarke stieß den Kopf nach vorn wie ein Raubvogel und schrie.
»Mörder!«
Wyatt stützte sich mit beiden Händen aufs Sattelhorn und blickte unverwandt in das bleiche Gesicht des Rancherssohnes.
Der kläffte wieder los: »Mörder! Erst meine Schwester und dann meinen Vater!«
Wyatt legte den Kopf etwas auf die Seite und kniff beide Augen ein. »Was reden Sie da, Mann?«
Vormann Farland brachte sein Pferd neben das des erregten Burschen.
»In der vergangenen Nacht ist der Rancher erschossen worden«, brach es dumpf aus der Kehle des betagten Cowboys.
»Das kann doch nicht wahr sein!«
»Und ob es wahr ist!« schrie
Clarke gallig. »Und den Mörder kennen wir genau!«
Wyatt nahm die Zügelleinen auf und trieb seinen Hengst vorwärts.
Clarke Harper war so verblüfft, daß er zu keiner Handlung fähig war.
Wyatt Eap und der ihm dichtauf folgende Tom Leaven hatten bereits die Gruppe passiert, als Clarke noch einmal gellend brüllte: »Mörder!«
Die Cowboys blickten hinter den beiden her, die rasch aus der Mainstreet hinausritten.
Es war dunkel geworden in der Savanne, und Wyatt traute dem Burschen, der jetzt an seiner Seite ritt, nicht über den Weg.
»Ich mache Sie darauf aufmerksam, Leaven, daß ich Sie sofort niederschießen werde, wenn ich merke, daß Sie einen Verrat planen.«
Schweigend ritt der Cowboy neben ihm her, und Wyatt merkte bald, daß er ihn scharf nach Nordosten hinüberführte.
Es war kurz vor Mitternacht, als sie in unübersichtliches, buschbesetztes und hügeliges Gelände kamen.
»Reiten Sie voran, Leaven«, forderte der Marshal den Cowboy auf.
Der Mann trottete mit seinem Grauen voran. Immer noch hatte er den Rappen des Georgiers an der Zügelleine.
Es ging durch eine Bodensenke, die sich langsam anhob und auf ein dunkles Gebüsch zulief.
Wyatt hielt den Falben an.
»Warten Sie!«
Er brachte sein Pferd neben Leaven.
Der deutete nach vorn. »Da ist das Gestrüpp, Marshal.«
Wyatt ritt aus der Mulde hinaus auf den Hügelrand und versuchte von dort das Gelände zu überblicken. Im fahlen Mondschein konnte er die Büsche deutlich sehen. Es waren trockene Mesquitestauden, die hier über ein Gelände von mehreren hundert Quadratyard wucherten.
»Reiten Sie langsam weiter, Leaven«, forderte Wyatt den Cowboy auf.
Der setzte sich unten auf der Talsenke wieder in Bewegung.
Als sie das Gestrüpp erreicht hatten, ritt Wyatt zu ihm hinunter.
»Wo hat der Hengst gestanden?«
»Es muß hier drüben gewesen sein«, meinte der Mann. »Ich kam vom Longfellow-Creek und bin hier herüber geritten, weil ich nach Pearce wollte.«
»Wenn Sie vom Longfellow-Creek kamen, sind Sie nicht hier vorbeigekommen!« herrschte der Marshal den Cowboy an.
»Ich bin auch nicht hier vorübergekommen, sondern ich war oben auf der Straße; aber ich habe das Pferd von dort aus sehen können.«
Sie ritten langsam weiter, und als sie die nächste Hügelkette hinter sich hatten, sahen sie in einer dunklen, langgestreckten Mulde, ebenfalls umgeben von zahlreichen Sträuchern, eine Blockhütte.
Wyatt blickte forschend zu dem Bau hinüber.
»Was ist das?«
»Ich glaube, das ist ein Vorwerk von den Harpers.«
»Sind wir denn hier auf dem Boden der Harper-Ranch?«
»Ja, es muß gerade die Grenze sein.«
Wyatt stieg vom Pferd.
Auch der Cowboy rutschte aus dem Sattel.
Wyatt drückte ihm seine Zügelleinen in die Hand.
»Hören Sie genau zu, Leaven. Sie haben eine Chance, ich habe es Ihnen gesagt. Sie bleiben jetzt mit den Pferden hier und warten. Wenn Sie auf einen dunklen Gedanken kommen, sind Sie verloren.« Er zog die Winchester aus dem Scabbard und lud sie lautlos durch. »Ich kann Sie auf meinem Weg zu der Hütte beobachten. Wenn Sie den Platz verlassen, schieße ich Sie nieder. Sie können sich darauf verlassen, daß ich Sie noch auf hundert Yard aus dem Sattel hole.«
Die Distanz zur Hütte hinüber aber betrug allenfalls ein Viertel dieser Strecke.
Wyatt duckte sich tief an den Boden nieder und schlich vorwärts.
Mit weit aufgerissenen Augen blickte Tom Leaven hinter ihm her. Er vermochte es nicht zu fassen, daß ein Mensch sich so lautlos vorwärtsbewegen konnte.
Im vorsichtigen Bogen näherte sich der Missourier der Seitenflanke des Blockhauses.
Das flachgestreckte Weidehaus der Harper-Ranch lag dunkel und verlassen da.
Doch war es dem Missourier, als stünde die Tür einen winzigen Spaltbreit offen. Zwar war das im Mondschatten nicht deutlich zu erkennen, aber er war sich dessen beinahe sicher.
An der Tatsache wäre noch nichts Besonderes gewesen, wenn Wyatt nicht genau gewußt hätte, daß es eine alte Regel aller Cowboys war, nachts niemals die Türen aufstehen zu lassen. Mit Fenstern war das schon eine andere Sache. Und wenn die Hütte im Augenblick überhaupt unbewohnt war, wären erst recht alle Türen und Fenster geschlossen gewesen.
Wyatt bewegte sich unendlich langsam vorwärts. Er hatte sich der Hütte bis auf zehn Yard genähert, als ihm plötzlich ein Revolverschuß entgegenfauchte.
Die Mündungsflamme zuckte orangerot im Türspalt hoch.
Der Marshal hatte sich flach an den Boden gelegt – und lauschte verwundert dem peitschenden Knall der Waffe nach.
Unter Hunderten von Waffen hätte er diesen Revolver noch nach einem halben Jahrhundert an seinem Klang wiedererkannt. Es war einer der beiden vernickelten mit Elfenbein beschlagenen Sixguns des Georgiers!
»Doc!« brüllte Wyatt, ohne sich jedoch zu erheben, da er nicht wissen konnte, wer die Waffe des Spielers da führte.
Augenblicklich kam die Antwort aus der Hütte zurück.
»Wyatt –«
Erschüttert vernahm der Marshal die beiden Laute, die aus brüchiger, matter Kehle an sein Ohr drangen.
Es war, wenn auch stark mitgenommen, unverkennbar die Stimme Doc Hollidays!
Wyatt richtete sich auf und lief auf die Hütte zu.
Als er die Tür aufstieß, sah er im schwachen Mondschein eine Gestalt vorn in der Ecke kauern.
»Tut mir leid, wenn ich mich zur Begrüßung nicht erheben kann«, kam ihm jetzt die Stimme des Spielers matt entgegen.
Als Wyatt die Tür voll aufgerissen hatte, sah er im fahlen Mondlicht, das sich in die ganze Länge der Blockhütte ergoß, an der Rückwand einen Mann kauern, der wie ein sprungbereites Tier da hockte.
Mike Torrey.
Aus funkelnden Augen starrte ihm der Bandit entgegen.
Eine blecherne Lache brach von den Lippen des Spielers.
»Ja, habe mir kein sonderlich angenehmes Quartier ausgesucht – ging aber nicht anders.«
»Sind Sie verletzt, Doc?« Wyatt kniete neben ihm nieder.
Holliday hob die Rechte, in der er den Revolver hielt, in Richtung auf Torrey zu.
»Nein, nein, aber Vorsicht, wir müssen unseren Freund da gut im Auge behalten. Er wollte mich durch die Landschaft spazierenführen.«
Wyatt hörte an der Stimme, daß sich Doc Holliday todelend fühlen mußte.
»Aber es war halb so schlimm. Ich habe einige seiner Wege abgekürzt und dann beschlossen, hierher zu kriechen. Haben Sie meinen Gaul gefunden?«
»Ja, auf einem Umweg. Ein anderer hat ihn gefunden und brachte ihn nach Pearce. Da hab’ ich ihn dann entdeckt.«
»Na sehen Sie, ich wußte doch, daß er Sie hierherführen würde. Ich hätte nicht mehr länger durch diese Sahara reiten können. Deshalb ließ ich den Gaul an den Sträuchern stehen, so daß man ihn von der Straße aus sehen mußte…«
Und dann berichtete der Spieler, was er seit dem Schuß auf Suzan Harper erlebt hatte.
Er hatte das dumpfe Geräusch des Knalls bis in sein Zimmer gehört, war sofort hochgefahren und hatte seinen Waffengurt umgeschnallt, um hinauszustürzen. Da hatte er die Frau in der Tür liegen sehen und sie aufrichten wollen. In diesem Augenblick war der Rancher die Treppe herunter gekommen.
Als Harper den Flur verlassen hatte, um in den Hof hinauszuschreien, hatte Holliday am Ende des Korridors unter der Treppe, die nach oben führte, ein Geräusch vernommen und sah einen Mann durch das hochgeschobene Fenster hinaus in den Garten steigen.
Holliday folgte ihm sofort und sah, daß der andere den Garten rasch durchmaß und hinten von einem zweiten Mann erwartet wurde, der offensichtlich zwei Pferde bereitgehalten hatte.
Die brennende Situation hatte dem Spieler sofort ein gut Teil seiner alten Energie zurückgegeben. Und wie es bei seiner seltsamen Krankheit öfter geschah, so hatte er sich plötzlich wieder ziemlich kräftig gefühlt, war rasch in seine Kleider geschlüpft und hatte das Haus auf dem gleichen Weg verlassen wie der Mörder.
Dann war er aber um das Ranchhaus herumgelaufen zum Stallhaus hinüber, um sein Pferd aufzusatteln. Augenblicklich war er am Garten vorbei nach Nordwesten davongeritten, der Richtung folgend, die die beiden Banditen eingeschlagen hatten.
Sehr bald tauchten die beiden vor ihm in der Ferne auf. Im schwachen Mondschein konnte er sie deutlich erkennen. Und als er dann näher kam, mußte er zu seinem Leidwesen feststellen, daß sie sich trennten. Einer von ihnen ritt scharf nach Westen hinüber, während der andere den nördlichen Kurs beibehielt.
Da Holliday nur einem folgen konnte, entschloß er sich für den Mann, der nach Norden ritt, also offensichtlich die offene Savanne suchte, während der andere auf Gleason zuhielt.
Der Ritt führte, nach anfänglich geradem Kurs, vielfach im Zickzack, das Holliday aber schon bald abschnitt. So kam er dem Banditen näher und näher.
»Sind Sie etwa bis nach Cochise hinaufgeritten?« unterbrach Wyatt den Bericht des Freundes.
»Nein, nicht ganz, so dumm war ich nicht. Unser Freund kam auf den Gedanken zurückzureiten, wobei er wieder einen riesigen Bogen schlug, den ich ihm erneut abschnitt, um ihm endlich hier in der Nähe so dicht auf die Fersen zu kommen, daß er aufgeben mußte. Ich habe sein Pferd mit einem Streifschuß der Winchester getroffen. Da wurde er abgeschleudert, fiel aus dem Sattel, und ich war bei ihm. Ich habe ihn dann hierher in dieses Präriehotel dirigiert, und da logiert er noch.«
Das also war seine Geschichte.
»War ziemlich ungemütlich hier, gebe ich zu«, meinte der Georgier, den das Auftauchen des Freundes wieder etwas erfrischt zu haben schien. »Ab und zu durfte er mal hinaus an die frische Sommerluft, um irgendwelche kleineren und größeren Geschäfte zu erledigen. Aber aus den Augen ließen wir einander nie; wie zwei treue, anhängliche Freunde.«
Wyatt blickte sich nach Leaven um und winkte ihn heran.
»Holen Sie die Whiskyflasche aus meiner Satteltasche, Tom.«
Der Cowboy holte die Flasche und reichte sie dem Georgier.
Der nahm einen tiefen Schluck und sog die Luft dann in die schmerzenden Lungen.
»So, jetzt ist mir schon bedeutend wohler.«
Wyatt ließ ihm auch von seinem Proviant bringen.
Während sich der Spieler stärkte, beschäftigte sich der Marshal mit Torrey. Er holte ihn aus der Hütte, fesselte ihm die Hände auf den Rücken und band seine Füße derart, daß der Bandit keine großen Schritte machen konnte.
»Du hast Suzan Harper ermordet!«
»Nein!« stieß Torrey durch die Zähne. »Ich war es nicht!«
»Natürlich willst du jetzt die Schuld auf einen Kumpanen abwälzen. Aber das gelingt dir nicht. Du hast sie erschossen. Und für ihn bleibt ja noch genug: er hat den alten Harper ermordet.«
Holliday hob den Kopf.
»Was sagen Sie da?«
Wyatt berichtete, was er in der Stadt erfahren hatte.
Holliday fuhr sich mit seiner schlanken, nervigen Hand durch sein volles Haar, nahm dann den Hut, setzte ihn auf und erhob sich. Schwankend stand er vor der Hütte.
»Ich glaube, wir reiten zur Ranch hinüber.«
»Wie weit ist das von hier?«
Holliday hob die Schultern und ließ sie wieder fallen.
»Keine Ahnung. Ich habe den ganzen Tag darauf gewartet, daß einer der Cowboys auftauchte. Aber wie die Dinge nun liegen, kann ich ja nur dankbar sein, daß das nicht geschah.«
Holliday stieg auf seinen Rappen, und Tom Leaven mußte Torrey auf sein Pferd nehmen.
Torreys eigener Gaul war nach dem Streifschuß, den ihm der Georgier beigebracht hatte, in wilder Panik geflüchtet.
Im fahlen Mondschein setzte sich der kleine Treck in Bewegung.
Wyatt, der neben Leaven hielt, packte Torrey an der Schulter und zerrte ihn zu sich herum.
»Hör zu, Bandit, du kennst den Weg. Du wirst uns hinführen!«
»Meinetwegen«, krächzte der Rinderdieb und deutete mit dem Kopf nach vorn. »Es ist nicht weit, höchstens drei Meilen…«
Als sie die Ranch erreichten, lag der Hof im tiefen Dunkel da.
Der kalbsgroße Hund verließ wieder seine Hütte, kam in gewohnter Weise heran, blieb stehen, kläffte die Reiter an, machte kehrt und kroch wieder in seinen Bau.
Wyatt hielt auf das Ranchhaus zu.
Drüben im Bunkhaus wurde die Tür geöffnet, und einige Cowboys kamen halb angezogen heraus, aber sie hatten die Gewehre in den Fäusten.
Wyatt ritt auf sie zu und hielt vor ihnen an.
Billinger und Tucker erkannten ihn sofort.
»Es ist Wyatt Earp!«
»Doc Holliday ist auch bei ihnen!« rief ein anderer.
Der Spieler hatte sich inzwischen am Treppengeländer auf den Vorbau geschleppt, stützte sich an einen Dachpfeiler und torkelte auf die Tür zu. Schwankend ging er durch den Flur, stützte sich einmal rechts an der Wand, dann wieder links, blieb hinten am Fenster stehen, das in den Garten führte, und starrte hinüber auf die Rückwand des angrenzenden Scheunenbaues, wo im Mondlicht die beiden Gräber lagen.
Er wischte sich durchs Gesicht, wandte sich um und ging auf das Zimmer zu, in dem er bis vor kurzem gelegen hatte. Todesmatt ließ er sich auf das Lager niederfallen.
Wyatt Earp war inzwischen draußen vom Pferd gestiegen und trat auf Tucker zu. Der senkte sein Gewehr.
Wyatt berichtete ihm, was sich ereignet hatte.
Der Cowboy sah sich nach Billinger und den anderen um.
»He, Boys, ich weiß nicht, es ist etwas dran, was der Marshal sagt. Und Torrey haben wir ja sicher. Jetzt fehlt der andere noch.«
»Den finden wir auch noch«, meinte der Marshal, »verlaßt euch drauf. Ich glaube, es dürfte gut sein, wenn wir alle jetzt erst einmal schlafen.«
Die Cowboys waren damit einverstanden. Tucker und Billinger beschlossen, die Nachtwache zu übernehmen.
Leaven blickte dem Marshal entgegen. Er stand vor den Pferden und hatte die rechte Hand um Torreys Oberarm gepreßt.
Wyatt schob dem einstigen Kelly-Cowboy den Colt ins Halfter zurück, den er ihm abgenommen hatte, und blinzelte ihm zu.
»Sie werden auf Torrey aufpassen.«
»In Ordnung, Marshal.«
Wyatt brachte die Pferde in den Corral, sattelte sie ab und ging dann ins Haus.
Als er die Zimmertür Doc Hollidays öffnete, war der Spieler in tiefen Schlaf gefallen.
Wyatt blieb vorn im Küchenraum und legte sich auf die hölzerne Bank nieder. Die scharfen Ritte der vergangenen Tage hatten auch seine Kräfte völlig aufgezehrt. Er fiel sofort in einen tiefen, traumlosen Schlaf.
*
Als der neue Tag mit silbergrauem Licht im Osten über den Horizont kroch, schlug der Missourier die Augen auf. Vor ihm auf der Fensterbank saß eine große weiße Katze, die ihn aus blinzelnden Augen anzwinkerte.
Wyatt richtete sich auf, strich sich das Haar aus dem Gesicht, nahm seinen Hut und trat in den Korridor.
Im Haus herrschte Kirchhofsstille.
Wyatt durchmaß den Gang und blieb vor der Tür Doc Hollidays stehen.
Als er sie einen winzigen Spalt öffnete, sah er, daß der Spieler mit offenen Augen auf seinem Lager ruhte. Wyatt trat ein.
Holliday stützte sich auf die Ellbogen.
Es schien dem Marshal, daß in seinen Augen wieder eine Spur von jenem Glanz lag, der sonst immer in ihnen gelegen hatte. Sollte er den furchtbaren Anfall und die schweren Strapazen tatsächlich noch einmal überstehen können?
»Mir ist da noch etwas eingefallen«, meinte Holliday halblaut. »Der Bursche, der aus dem Fenster sprang, war nicht so groß wie Torrey, und außerdem kann er der Mordschütze nicht gewesen sein. Zumindest nicht der Mann, der Suzan Harper ermordet hat. Torrey war der Partner, der am Gartenzaun mit den Pferden stand.«
»Noch weniger kann Torrey den Rancher ermordet haben«, gab Wyatt zu bedenken, »denn zu dieser Zeit war er doch schon in Ihrer Gewalt.«
Der Spieler nickte. »Ja. Auch wenn das alles nicht so wäre, könnte er Suzan Harper doch nicht getötet haben.«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Weil er zwei fünfundvierziger Colts im Halfter hat.«
»Und…?«
»Der Colt, mit dem Suzan getötet wurde, hatte nicht das Kaliber fünfundvierzig; es war ein kleiner achtunddreißiger Revolver, mit dem hohlen Klang, wie sie die Remingtonschießeisen aufweisen.«
Der Marshal wußte, daß er sich da auf das geübte und scharfe Ohr des Georgiers verlassen konnte.
»Das heißt also, daß der Mann, der Suzan Harper erschossen hat, einen achtunddreißiger Revolver tragen muß.«
»Ja, zumindest hat er eine solche Waffe zu dem tödlichen Schuß benutzt.«
»Aber der Rancher ist mit einem Gewehr erschossen worden. Die Männer sagen, daß der Schütze am Ende des kleinen Gartens gestanden haben muß und ihn oben am Fenster höchstwahrscheinlich entdeckt hat. Es ist Nacht gewesen. Aber der Rancher trug ein weißes Hemd, und so konnte man ihn natürlich über die kurze Distanz hin deutlich sehen.«
Holliday rieb über sein unrasiertes Kinn und richtete sich dann weiter auf.
»Ich habe da eine ganz eigenartige Idee gehabt, als ich vor zwei Stunden aufwachte. Ich mußte nämlich plötzlich an den…«
Draußen im Hausgang waren Stimmen laut geworden.
Wyatt ging zur Tür, öffnete sie und sah vor der offenen Tür zum Hof die Gestalt eines Mannes.
Clarke Harper!
Als der Rancherssohn den Marshal im Korridor entdeckte, erschrak er, stampfte dann aber brüllend auf ihn zu.
»Wyatt Earp! Was fällt Ihnen ein? Was suchen Sie in meinem Haus? Sind Sie verrückt geworden? Das ist ja wohl der Gipfel! Ich habe Sie im dringenden Verdacht, daß Sie meinen Vater erschossen haben, und Sie wagen es, unser Haus noch zu betreten! Und Ihr Freund Holliday hat meine Schwester ermordet –«
Vom Wäscheraum her, dessen Tür offenstand, fiel das Tageslicht in den Korridor und hatte die Gestalt des jungen Mannes erfaßt.
Wyatt blickte in das blasse, etwas aufgedunsene, schlaffe Gesicht, sah die hängenden Schultern Clarkes, die weichlichen kurzen Finger und hinter der rechten Hand im offenen Lederschuh einen schmalen, mit Hirschhorn besetzten Revolverknauf.
Mit raschen Schritten ging Wyatt auf den Mann zu, ergriff seinen rechten Arm mit der Linken, zog ihn hoch, schnappte mit der Rechten zu und hatte den Hirschhorncolt in der Hand.
Es war ein achtunddreißiger Remington-Revolver!
Wyatt bohrte den Blick in die Augen des Burschen.
Der wich zwei Schritte zurück, stolperte über einen Brennholzkasten und suchte sich an der Wand aufzurichten.
Wyatt nagelte ihn mit eisigem Blick an der Stelle fest.
In der Hoftür erschien Joe Farland, der Vormann, gefolgt von zwei anderen Cowboys. Verblüfft blieben die drei Männer stehen, als sie ihren neuen Boß auf der Holzkiste sitzen sahen.
Wyatt wußte, daß er alles auf eine Karte setzte, als er mit lauter Stimme erklärte:
»Clarke Harper, ich klage Sie des Mordes an Ihrer Schwester Suzan und an Ihrem Vater James Harper an.«
Lähmende Stille herrschte in dem großen Korridor.
Der Rancherssohn hatte den Atem angehalten. Seine Augen schienen aus ihren Höhlen treten zu wollen.
Plötzlich aber sprang er hoch, riß ein Messer aus einer versteckten Knietasche und schleuderte es vorwärts.
Die Waffe sirrte über den abgeduckten Kopf des Marshals weg und blieb federnd hinten im Fensterrahmen stecken.
Wyatt sprang vorwärts, packte Clarke, schleuderte ihn gegen die Wand und hielt ihm den Revolver entgegen. Dann aber ließ er die Waffe in den Lederschuh zurückfliegen und versetzte dem wieder vorwärtsstürmenden Burschen eine so derbe Ohrfeige, daß er erneut gegen den Brennholzkasten stolperte und zu Boden fiel.
Wyatt blickte über ihn hinweg in die Augen des Vormanns.
»Sie haben gehört, Cowboy, was ich gesagt habe. Und Sie haben erlebt, was dann geschah. Dieser Mann da ist der Mörder des Ranchers Harper und seiner Tochter Suzan.«
Joe Farland konnte es kaum fassen. Clarke hatte nach dem Tod des Vaters so viel Trauer und Entsetzen gespielt… und doch, die Cowboys trauten dem Burschen eine solche Tat zu. Der Vormann wandte sich um, um mit den anderen in den Hof hinauszugehen.
Wyatt fesselte Clarke Harper die Hände auf dem Rücken zusammen und zerrte ihn am Kragen hoch. »Kommen Sie, wir reiten nach Gleason!«
Als der Marshal sich dann noch einmal umblickte, sah er hinten im Türspalt Doc Holliday stehen. Leise klirrten seine Worte in den Hausgang:
»Das war es, was ich Ihnen gerade sagen wollte, Marshal.«
*
Clarke Harper gestand in Gleason vor Sheriff Hancoc, Richter Nelson und sieben Geschworenen den Mord an seiner Schwester Suzan und an seinem Vater James. Den Grund zu seiner furchtbaren Tat wollte er nicht angeben.
Aber die Menschen in Gleason und in der ganzen Umgegend wußten, weshalb er es getan hatte. Er hatte immer einen tiefen Haß auf die Schwester empfunden, die in den Augen des Vaters mehr galt als der Sohn. Und als Clarke sie getötet hatte, hatte er auch den Vater aus dem Wege geschafft, um uneingeschränkter Herr der Ranch zu sein.
Damit hatte er nicht nur zwei Familienmitglieder ausgelöscht, sondern sein eigenes Leben verwirkt und die Familie Harper vernichtet.
Wyatt Earp und Doc Holliday blieben noch eine volle Woche auf der Ranch. Ein entfernter Onkel der Harpers hatte sich eingefunden und mehr mißmutig als froh den großen Betrieb übernommen. Sofort hatte er dafür gesorgt, daß es vor allem Doc Holliday an nichts fehlte. Die beiden waren sofort von ihm eingeladen worden, so lange zu bleiben, wie es ihnen gefiel.
Der Marshal hatte in Gleason erfahren, daß Jonny Ringo Dodge City verlassen hatte. Als er mit der Nachricht zurück auf die Ranch kam, fand er Doc Holliday im Garten unter den schattenspendenden Bäumen auf der Bank, genau auf dem Platz, den die tote Suzan Harper ihm damals empfohlen hatte.
Der Georgier blickte dem Marshal schwach lächelnd entgegen.
Wyatt freute sich, den Freund wieder draußen zu finden, und ließ sich neben ihm nieder.
Holliday blickte über den kleinen Holzzaun hinaus in die Prärie.
»Sie werden trotzdem allein reiten müssen, Marshal.«
Wyatt nahm den Kopf herum und blickte ihn forschend an.
Immer noch war das hagere Gesicht des Georgiers von dem schweren Anfall gezeichnet. Er war sehr schmal und blaß geworden, und sicher würde es lange dauern, bis er sich wieder soweit erholt hatte, daß er zu seiner alten Elastizität zurückfand. Wenn überhaupt…
»Was haben Sie vor?« fragte Wyatt.
»Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich nicht doch heim zu Judy nach Valdosta fahren soll. Aber das ist kein Trail für mich. Ich werde hinauf nach Colorado reiten. In die Berge.«
Wyatt, der natürlich gern mit ihm nach Dodge zurück geritten wäre, war auch so zufrieden. Denn er wußte ja, daß Doc Holliday immer gern in den Bergen gewesen war und vielleicht dort wieder Erholung finden würde.
Ein paar Tage später war es soweit. Die beiden saßen in den Sätteln und reichten einander die Hände.
»So long, Marshal.«
»So long, Doc –«