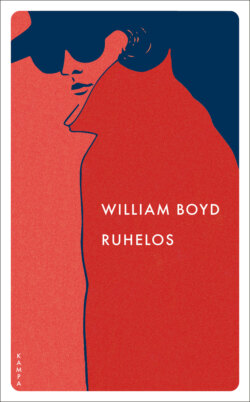Читать книгу Ruhelos - William Boyd - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 Bitte nicht nackt
ОглавлениеIch wachte zu früh auf, verstört und wütend über meinen üblichen Traum – den Traum, in dem ich tot bin und zuschaue, wie Jochen ohne mich zurechtkommt, meist ohne Probleme und quietschvergnügt. Diese Träume stellten sich ein, als er zu sprechen begann, und ich hasse mein Unterbewusstsein dafür, dass es mir diese Angst, diese abartige Neurose immer mal wieder vor Augen führt. Warum träume ich meinen eigenen Tod? Von Jochens Tod träume ich nie, ich denke nur manchmal daran, selten, eine Sekunde oder zwei, bis ich den Gedanken erschrocken verscheuche. Ich bin fast sicher, dass jedem solche Gedanken kommen, bei Menschen, die man liebt. Das ist die düstere Kehrseite dessen, dass man jemanden wirklich liebt: Man ist gezwungen, sich ein Leben ohne ihn vorzustellen, man muss sich diesen Schrecken, diesen Horror für einen kurzen Moment ausmalen, muss kurz durchs Schlüsselloch schauen, in die große Leere, das große Nichts dahinter. Wir können nicht anders – zumindest ich nicht, und voller Schuldbewusstsein sage ich mir, dass es allen so geht, dass es eine sehr menschliche Reaktion ist. Und ich hoffe, dass ich recht habe.
Ich kroch aus dem Bett und tapste in sein Zimmer hinüber, um zu sehen, was er trieb. Er saß im Bett und malte in seinem Malbuch, Buntstifte und Wachsstifte um sich verstreut.
Ich gab ihm einen Kuss und fragte, was er da male.
»Einen Sonnenuntergang«, sagte er und zeigte mir das Bild voller flammender Gelb- und Orangetöne, die durch blutig düsteres Purpur und Grau begrenzt waren.
»Ein bisschen traurig«, sagte ich, weil ich noch unter dem Eindruck meines Traums stand.
»Nein, ist es nicht, es soll schön aussehen.«
»Was möchtest du zum Frühstück?«, fragte ich.
»Knusprig gebratenen Speck, bitte.«
Ich öffnete für Hamid – heute trug er nicht die neue Lederjacke, nur seine schwarzen Jeans und ein weißes kurzärmliges Hemd und wirkte wie aus dem Ei gepellt, wie ein Pilot. Normalerweise hätte ich ihn damit aufgezogen, aber nach meinem Fauxpas vom Vortag und weil Ludger hinter mir in der Küche war, war es wohl besser, einfach nur nett und freundlich zu sein.
»Hallo, Hamid! Was für ein schöner Morgen!«, rief ich mit allem Frohsinn, den ich aufzubieten hatte.
»Die Sonne scheint wieder«, sagte er mit Grabesstimme.
»So ist es. So ist es.«
Ich drehte mich um und winkte ihn herein. Ludger saß am Küchentisch, in T-Shirt und Shorts, und löffelte seine Cornflakes. Ich ahnte, was in Hamid vorging – sein künstliches Lächeln, sein steifes Benehmen –, aber in Ludgers Gegenwart konnte ich ihm den Unterschied zwischen Schein und Sein nicht erklären, also beschränkte ich mich darauf, die beiden einander vorzustellen.
»Hamid, das ist Ludger, ein Freund von mir aus Deutschland. Ludger – Hamid.«
Am Vortag hatte ich es nicht getan. Ich war zur Haustür hinuntergegangen, hatte Ludger heraufgeholt, im Wohnzimmer abgesetzt und – unter einigen Schwierigkeiten – mit Hamid weitergearbeitet. Als die Stunde zu Ende und Hamid weg war, ging ich zu Ludger – er lag auf dem Sofa und schlief.
Jetzt streckte Ludger die Faust in die Höhe und sagte »Allahu akbar«.
»Sie erinnern sich doch an Ludger?«, sagte ich munter. »Er kam gestern, während unserer Stunde.«
Hamids Gesicht zeigte keine Regung. »Nett, Sie kennenzulernen«, sagte er.
»Wollen wir nach hinten gehen?«, fragte ich.
»Ja. Bitte nach Ihnen, Ruth.«
Ich führte ihn ins Arbeitszimmer. Er war ganz anders als sonst. Er wirkte ernst, fast gequält in gewisser Weise. Ich stellte fest, dass er seinen Bart gestutzt hatte – das machte ihn jünger.
»So«, sagte ich, noch immer im Ton falscher Jovialität, und setzte mich an meinen Schreibtisch. »Wollen wir doch mal sehen, was die Ambersons heute treiben.«
Er ignorierte es. »Dieser Ludger«, sagte er, »ist er der Vater von Jochen?«
»Nein, guter Gott, nein! Wie kommen Sie darauf? Nein – er ist der Bruder von Jochens Vater, der jüngere Bruder von Karl-Heinz. Nein, nein, absolut nicht.« Ich lachte nervös und stellte fest, dass ich sechsmal verneint hatte. Stärker hätte man ein Nein nicht unterstreichen können.
Hamid versuchte vergeblich, seine Erleichterung zu verbergen. Sein Grinsen wirkte fast idiotisch.
»Oh. Schon gut. Nein, ich dachte …« Er hob die Hände. »Verzeihen Sie, ich sollte nicht solche Verschlüsse ziehen.«
»Rückschlüsse.«
»Rückschlüsse. Also: Er ist Jochens Onkel.«
Das stimmte, aber ich musste zugeben, dass ich Ludger Kleist noch nie so gesehen hatte (er war nicht im Geringsten onkelhaft – allein die Verbindung »Onkel« und »Ludger« löste bei mir Grusel aus), und tatsächlich hatte ich ihn auch Jochen als »Freund aus Deutschland« vorgestellt, und bisher hatten sie sich nicht näher kennenlernen können, weil Jochen zu einem Kindergeburtstag gegangen war. Ludger sagte, er wolle »ein Pub« besuchen, und als er am Abend zurückkam, war Jochen schon im Bett. Die Onkelbeziehung musste also warten.
Ludger schlief auf einer Luftmatratze in dem Zimmer, das wir als Esszimmer bezeichneten – zu Ehren der einzigen Dinnerparty, die ich seit meinem Einzug gegeben hatte. Es war, zumindest theoretisch, das Zimmer, in dem ich meine Dissertation schrieb. Auf dem ovalen Tisch stapelten sich Bücher, Notizen und die Entwürfe meiner verschiedenen Kapitel. Entgegen den staubigen Tatsachen hielt ich an dem Glauben fest, dass dies das Zimmer war, in dem ich an meiner Dissertation arbeitete – schon sein Vorhandensein, seine Bestimmung und seine Aufteilung schienen meinem Wunschdenken Realität zu verleihen, oder wenigstens ein bisschen: Dies war der Schauplatz meiner geruhsam-wissenschaftlichen Existenz – mein verworren-chaotisches Alltagsleben nahm die übrige Wohnung ein. Das Esszimmer war meine diskrete kleine Zelle des geistigen Beharrens. Doch mit wenigen Handgriffen zerstreute ich diese Illusion: Wir schoben den Tisch an die Wand; wir legten Ludgers Luftmatratze auf den Teppich, und aus dem Esszimmer war wieder ein Gästezimmer geworden – eins, in dem sich Ludger sehr wohlfühlte, wie er behauptete.
»Wenn du wüsstest, wo ich schon überall geschlafen habe«, sagte er und zog das rechte Augenlid nach unten. »Mein Gott, Ruth, für mich ist das hier das Ritz.« Und dann stieß er einen dieser schrillen Lacher aus, die ich besser kannte, als mir lieb war.
Wir, Hamid und ich, wandten uns den Ambersons zu. Die Familie will in die Ferien fahren, nach Dorset, doch Keith Amberson kann das Auto nicht starten. Jede Menge Verben im Conditional Perfect. Ich hörte Ludger durch die Wohnung laufen.
»Bleibt Ludger lange?«, fragte Hamid. Offenbar hatten wir beide nur Ludger im Sinn.
»Ich glaube nicht«, erwiderte ich, wobei mir einfiel, dass ich ihn noch gar nicht gefragt hatte.
»Sie sagten, Sie hätten ihn für tot gehalten. War es ein Unfall?«
Ich beschloss, ihm die Wahrheit zu sagen. »Man hatte mir gesagt, er sei von der westdeutschen Polizei erschossen worden. Aber das war offensichtlich nicht der Fall.«
»Von der Polizei erschossen? Ist er ein Verbrecher?«
»Sagen wir, ein Radikaler. Eine Art Anarchist.«
»Und warum ist er dann hier?«
»In ein paar Tagen wird er weg sein«, log ich.
»Ist es wegen Jochens Vater?«
»Sie haben aber viele Fragen, Hamid.«
»Entschuldigung.«
»Ja – ich glaube, ich lasse ihn für ein paar Tage bei mir wohnen, weil er der Bruder von Jochens Vater ist … Aber wollen wir nicht lieber weitermachen? Also: Will Keith get his car fixed? What should Keith have done?«
»Sind Sie immer noch in Jochens Vater verliebt?«
Ich starrte ihn verdattert an. Hamids braune Augen waren auf mich gerichtet, bohrend, intensiv.
»Nein«, sagte ich. »Natürlich nicht. Ich habe ihn vor fast zwei Jahren verlassen. Deshalb bin ich mit Jochen nach Oxford zurückgezogen.«
»Gut«, sagte er, sichtlich erleichtert. »Ich musste es nur wissen.«
»Warum?«
»Weil ich Sie gern zum Essen einladen würde. In ein Restaurant.«
Veronica war bereit, Jochen zum Abendbrot mit nach Hause zu nehmen, und ich fuhr nach Middle Ashton hinaus, um mit meiner Mutter zu reden. Als ich dort ankam, kniete sie im Garten und schnitt den Rasen mit der Gartenschere. Rasenmäher lehnte sie ab; Rasenmäher verabscheute sie; Rasenmäher seien der Tod des englischen Gartens, wie er sich über Jahrhunderte gehalten habe, behauptete sie; Capability Brown und Gilbert White hätten keine Rasenmäher gebraucht; in einem echten englischen Garten dürfe das Gras nur von Schafen abgeweidet oder mit der Sense gemäht werden – und da sie keine Sense besaß oder nicht benutzen konnte, machte es ihr nichts aus, alle zwei Wochen mit der Gartenschere auf den Knien herumzukriechen. Der moderne englische Rasen sei ein abscheulicher Anachronismus, gestreiftes, geschorenes Gras eine grässliche moderne Erfindung – und so weiter und so fort. Ich kannte diese Reden schon und hütete mich, zu widersprechen (doch sie fand nichts dabei, mit dem Auto zum Einkaufen zu fahren, obwohl Capability Brown oder Gilbert White anno dazumal ganz sicher eine Kutsche benutzt hatten). Folglich war ihr Rasen struppig und zerzaust, voller Gänseblümchen und anderem Unkraut – und genau so muss ein Cottage-Rasen aussehen, hätte sie verkündet, hätte ich ihr Gelegenheit dazu gegeben.
»Wie geht’s deinem Rücken?«, fragte ich.
»Heute schon ein bisschen besser«, antwortete sie. »Trotzdem wollte ich dich bitten, mich nachher zum Pub zu schieben.«
Wir setzten uns in die Küche, wo sie mir ein Glas Wein und sich selbst Apfelsaft eingoss. Sie trank nicht, meine Mutter. Ich hatte sie nie auch nur an einem Sherry nippen sehen.
»Rauchen wir eine«, sagte sie, also zündeten wir eine Zigarette an, pafften vor uns hin, redeten über Nebensächliches und schoben die große Aussprache vor uns her, die, wie wir beide wussten, in der Luft lag.
»Hast du dich ein bisschen entspannt?«, fragte sie. »Ich konnte sehen, wie nervös du warst. Warum sagst du mir nicht, was los ist? Liegt es an Jochen?«
»Nein, an dir, zum Teufel noch mal. An dir und an ›Eva Delektorskaja‹. Mir ist das alles schleierhaft. Überleg doch mal, wie das bei mir ankommt, so völlig aus dem Nichts, ohne dass ich je davon geahnt hätte. Ich bin total fertig.«
Sie zuckte die Schultern. »Das war zu erwarten. Es ist ein Schock, ich weiß. An deiner Stelle wäre ich auch ein bisschen schockiert, ein bisschen verstört.« Ihr Blick kam mir seltsam vor; kalt, analytisch, als wäre ich jemand, den sie gerade kennenlernt. »Du glaubst mir nicht so richtig, oder?«, sagte sie. »Du denkst, ich hab nicht alle Tassen im Schrank.«
»Natürlich glaube ich dir. Was denn sonst? Es ist nur so schwer, das zu verkraften – alles auf einmal. Dass nun alles ganz anders ist, alles, was ich mein Leben lang geglaubt habe, soll plötzlich nicht mehr wahr sein.« Ich zögerte kurz und gab mir einen Ruck. »Na los, sag etwas auf Russisch!«
Sie sprach zwei Minuten lang Russisch, wurde dabei immer wütender und stieß den Finger in meine Richtung.
Ich war wie vor den Kopf geschlagen – es war wie eine Besessenheit, ein Reden in Zungen. Mir blieb die Luft weg.
»Mein Gott«, rief ich. »Wovon hast du denn geredet?«
»Von der Enttäuschung, die mir meine Tochter bereitet. Meine Tochter, die eine intelligente und eigensinnige junge Frau ist und die, hätte sie nur ein bisschen mehr ihrer beträchtlichen Geisteskraft darauf verwendet, logisch über das nachzudenken, was ich ihr erzählt habe, in etwa dreißig Sekunden begriffen hätte, dass ich ihr niemals solche üblen Streiche spielen würde. So, nun weißt du’s.«
Ich trank meinen Wein aus.
»Wie also ging es weiter?«, fragte ich. »Bist du nach Belgien gegangen? Warum heißt du ›Sally‹ Gilmartin? Was ist aus meinem Großvater Sergej geworden und meiner Stiefgroßmutter Irène?«
Sie stand auf, ein wenig triumphierend, hatte ich den Eindruck, und ging zur Tür.
»Immer der Reihe nach. Du wirst es schon erfahren. Du bekommst Antwort auf alle Fragen, die dir nur einfallen. Ich will nur, dass du meine Geschichte sorgfältig liest – gebrauch deinen Verstand. Deinen scharfen Verstand. Auch ich habe Fragen an dich. Jede Menge Fragen. Es gibt Sachen, von denen ich selber nicht weiß, ob ich sie verstehe …« Dieser Gedanke schien sie zu beunruhigen. Sie ging mit finsterer Miene hinaus. Ich goss mir Wein nach, dann dachte ich ans Blasröhrchen – Vorsicht. Meine Mutter kam mit einem neuen Hefter herein, den sie mir gab. Mich packte eine innere Wut, weil ich wusste, dass sie es absichtlich tat – mir ihre Geschichte in Raten zu liefern wie eine TV-Serie. Sie wollte mich bei der Stange halten, ihre Enthüllungen hinauszögern, damit die ganze Wirkung nicht mit einem Mal verpuffte. Statt des großen Erdbebens eine Serie kleiner Erschütterungen – das wollte sie. Um mich auf Trab zu halten.
»Warum gibst du mir nicht den ganzen Kram auf einmal?«, sagte ich gereizter, als ich wollte.
»Ich arbeite noch dran«, erwiderte sie ungerührt, »mache ständig kleine Änderungen. Es soll so gut werden wie nur möglich.«
»Wann hast du das alles geschrieben?«
»In den letzten zwei Jahren. Du siehst ja, dass ich laufend ergänze und streiche und umschreibe, damit alles klar und deutlich wird. Ich möchte, dass es stimmig wirkt. Bring es in Ordnung, wenn du willst – du kannst viel besser schreiben als ich.«
Sie presste meinen Arm, aber mit Gefühl – um mich zu trösten, vermutlich: Meine Mutter mochte körperliche Kontakte nicht sonderlich, daher fiel es schwer, ihre seltenen Affektbezeugungen zu deuten.
»Schau nicht so verdattert«, sagte sie. »Jeder hat seine Geheimnisse. Keiner weiß auch nur annähernd über den anderen Bescheid, egal wie nahe oder vertraut sie sich sind. Ich bin sicher, du hast Geheimnisse vor mir. Hunderte, Tausende. Fass dich an die eigene Nase – das mit Jochen hast du mir monatelang verschwiegen.« Sie streckte die Hand aus und strich mir übers Haar – was sehr ungewöhnlich war. »Mehr hab ich nicht im Sinn, Ruth, glaub mir. Ich will dir nur meine Geheimnisse anvertrauen. Du wirst verstehen, warum ich so lange damit warten musste.«
»Wusste Dad Bescheid?«
Sie zögerte. »Nein. Er wusste nichts.«
Ich dachte eine Weile darüber nach, über meine Eltern und wie ich sie immer gesehen hatte. Kannst du alles vergessen, sagte ich mir.
»Hat er nichts geahnt?«, fragte ich. »Nicht das Geringste?«
»Ich glaube nicht. Wir waren sehr glücklich, das ist alles, was zählt.«
»Warum hast du dann beschlossen, mir das alles zu erzählen? Mir deine Geheimnisse anzuvertrauen, so ganz aus heiterem Himmel?«
Sie seufzte, schaute umher, wedelte fahrig mit den Händen, fuhr sich durchs Haar, trommelte mit den Fingern auf den Tisch.
»Weil«, sagte sie schließlich, »weil ich glaube, dass jemand versucht, mich umzubringen.«
Ich fuhr nach Hause, nachdenklich, langsam, vorsichtig. Jetzt war ich wohl ein wenig klüger, aber langsam machte mir die Paranoia meiner Mutter mehr zu schaffen als die Tatsache ihres seltsamen Doppellebens. Sally Gilmartin war – und daran musste ich mich erst noch gewöhnen – Eva Delektorskaja. Aber warum sollte jemand versuchen, eine sechsundsechzigjährige Frau und Großmutter, die in einem abgelegenen Dorf in Oxfordshire wohnte, umzubringen? Die Sache mit Eva Delektorskaja ging ja noch an, dachte ich, aber die Mordgeschichte ließ sich schon viel schwerer verdauen.
Ich holte Jochen bei Veronica ab, und wir liefen durch Summertown zur Moreton Road. Der Sommerabend war schwül, die Blätter an den Bäumen wirkten müde und schlaff. Seit drei Wochen hochsommerliche Hitze, dabei hatte der Sommer gerade erst angefangen. Jochen war es zu heiß, also zog ich ihm das T-Shirt aus, und wir liefen Hand in Hand, ohne zu reden, jeder in seine Gedanken vertieft.
Am Tor fragte er: »Ist Ludger noch da?«
»Ja. Er bleibt ein paar Tage.«
»Ist Ludger mein Daddy?«
»Um Gottes willen, nein. Ganz bestimmt nicht. Ich sagte dir doch – dein Vater heißt Karl-Heinz. Ludger ist sein Bruder.«
»Oh.«
»Warum hast du geglaubt, er könnte dein Vater sein?«
»Er ist aus Deutschland. Und du hast gesagt, ich bin in Deutschland geboren.«
»Das stimmt auch.«
Ich hockte mich hin und schaute ihm in die Augen, nahm ihn bei den Händen.
»Er ist nicht dein Vater. Ich würde dich niemals belügen, mein Schatz. Dir sage ich immer die Wahrheit.«
Er wirkte zufrieden.
»Komm, drück mich«, sagte ich, und er legte die Arme um meinen Hals und küsste mich auf die Wange. Ich nahm ihn auf den Arm und trug ihn bis zu unserer Treppe und dann die Treppe hinauf. Als ich ihn absetzte, sah ich Ludger durch die Glastür der Küche. Er kam aus dem Badezimmer und lief durch den Korridor auf uns zu, Richtung Esszimmer. Er war nackt.
»Bleib hier«, sagte ich zu Jochen und lief schnell durch die Küche, um Ludger abzufangen. Ludger rubbelte sich das Haar mit einem Handtuch und summte vor sich hin, während er auf mich zulief, sein Schwanz pendelte dabei hin und her.
»Ludger.«
»Oh«, sagte er. »Hi, Ruth.« Und ließ sich Zeit mit dem Bedecken seiner Blöße.
»Würdest du das unterlassen, Ludger? Bitte nicht in meinem Haus.«
»Sorry. Ich dachte, du wärst weg.«
»Es kommen Schüler an die Tür, zu allen Zeiten. Sie können hineinsehen. Das ist eine Glastür.«
Er reagierte mit seinem dreckigen Grinsen. »Wär doch eine nette Überraschung. Aber dich stört’s nicht.«
»Doch, es stört mich. Bitte lauf nicht nackt herum.« Ich machte kehrt und holte Jochen herein.
»Entschuldige, Ruth«, rief er mir weinerlich nach. Er konnte sich denken, dass ich stocksauer war. »Ich hab mir nichts dabei gedacht, ich war doch Pornodarsteller. Aber ich laufe nicht mehr nackt herum. Versprochen.«