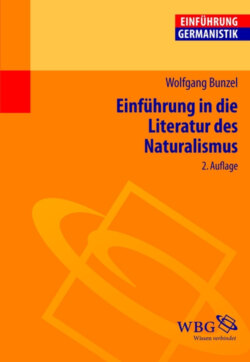Читать книгу Einführung in die Literatur des Naturalismus - Wolfgang Bunzel - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Status und Eigenart der Diskursformation ‚Naturalismus‘
ОглавлениеNaturalismus als Diskursformation
Der Naturalismus lässt sich am besten als eigenständige Diskursformation innerhalb eines größeren literaturgeschichtlichen Epochenzusammenhangs begreifen. Dieser wiederum ergibt sich vornehmlich dadurch, dass die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts in ästhetischer Hinsicht von einem dominierenden Kunstprogramm, nämlich dem des Realismus, geprägt wird. Im Zentrum des realistischen Literaturverständnisses steht dabei ein programmatischer Wirklichkeitsbezug, der zu einem nicht geringen Grad aus der Erschöpfung idealistischer Denksysteme resultiert. So hatte Theodor Fontane schon 1853 in seinem Aufsatz Unsere lyrische und epische Poesie seit 1848 konstatiert, dass „die Welt […] des Spekulierens müde“ (Fontane 1969, Bd. 1, 236) sei. Doch auch das Konzept einer ‚operativen Literatur‘, wie es von den politisch engagierten Schriftstellern des Vormärz entwickelt worden war, hatte unter den veränderten Bedingungen des späten 19. Jahrhunderts seine Strahlkraft eingebüßt. Die Hoffnungen auf nationale Einigung und Demokratisierung, die sich an die Revolutionen der Jahre 1848/49 knüpften, waren unerfüllt geblieben, so dass nach der Jahrhundertmitte in den deutschsprachigen Ländern eine doppelte Ernüchterung eintrat. Als Alternative zur stark an der Vergangenheit orientierten und deshalb zunehmend als realitätsfremd empfundenen Dichtung der Goethezeit und zur deutlich wirkungsästhetisch geprägten, ihren Autonomiestatus bereitwillig opfernden Literatur des Vormärz gleichermaßen bot sich ein Schreibmodell an, das Kunst wieder auf das Ziel der Mimesis zu verpflichten und literarische Kommunikation damit – wie Richard Georg Spiller von Hauenschild unter dem Pseudonym Max Waldau in seinem Aufsatz Neuere epische Dichtung (1854) formulierte – auf den „Boden der Tatsachen“ (Plumpe 1985, 33) zurückzuholen suchte. Auf diese Weise schien ein ästhetischer Neuanfang jenseits der eingeschliffenen Pathosgesten – seien es die der Klassik, der Romantik oder der politischen Dichtung – möglich. Die Definition von Realismus, die Theodor Fontane gibt, gilt letztlich auch für die naturalistischen Autoren noch:
Der Realismus will nicht die bloße Sinnenwelt und nichts als diese; er will am allerwenigsten das bloß Handgreifliche, aber er will das Wahre. Er schließt nichts aus als die Lüge, das Forcierte, das Nebelhafte, das Abgestorbene – vier Dinge, mit denen wir glauben, eine ganze Literaturepoche bezeichnet zu haben. (Fontane 1969, Bd. 1, 240)
Naturalismus und Poetischer Realismus
In der Abgrenzung, die Fontane ergänzend vornimmt, wird dann aber auch schon jene Akzentverlagerung sichtbar, die den Naturalismus als Radikalisierung des Poetischen Realismus erscheinen lässt: „Vor allen Dingen verstehen wir nicht darunter das nackte Wiedergeben alltäglichen Lebens, am wenigsten seines Elends und seiner Schattenseiten.“ (Fontane 1969, Bd. 1, 240) Genau dies aber wurde zur Zielperspektive der nachfolgenden Generation von Autoren.
Widerstand gegen die Gründerzeitliteratur
Im Gefolge der skizzierten ästhetischen Neuorientierung entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunächst eine in sich relativ homogene literarische Strömung, deren Vertreter (Gottfried Keller, Adalbert Stifter, Theodor Storm, Theodor Fontane, Wilhelm Raabe, Marie von Ebner-Eschenbach) zwar kaum über den Bereich des deutschen Sprachraums hinaus ausstrahlten, die aber doch Werke von beachtlichem künstlerischen Rang hervorbrachten. Allerdings gelang es – im Gegensatz beispielsweise zur Romantik – dem Realismus in Deutschland nicht, eine zweite Generation jüngerer Autoren ästhetisch zu sozialisieren und so den Fortbestand dieser Bewegung bei Konstanz ihrer Leitprinzipien zu sichern. Stattdessen kam es nach dem Krieg gegen Frankreich (1870/71) und der unmittelbar darauf erfolgten Reichsgründung zu einer ungeahnten Epigonalisierung der literarischen Produktion mit dem Ergebnis, dass der Realismus Konkurrenz erhielt von einer unverhohlen rückwärtsgewandten Strömung, die sich ästhetisch an längst überholte Muster der als Blütezeit deutscher Kultur verstandenen Klassik und Romantik anlehnte. Dieses zeitlich im Wesentlichen auf die siebziger und frühen achtziger Jahre beschränkte Phänomen wird – mit Bezug auf einen wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Periodisierungsterminus – gemeinhin als Literatur der Gründerzeit bezeichnet. Der Poetische Realismus sah sich dadurch in ein Rückzugsgefecht verwickelt und vermochte sich auf breiter Ebene nicht mehr nennenswert weiterzuentwickeln. Lediglich Autoren mit einem ausgeprägten Individualstil wie Storm, Fontane oder Raabe gelang es, weiterhin bemerkenswerte Texte im Rahmen dieses Paradigmas vorzulegen, während die literarische Produktion der poetae minores vielfach in einem festen Repertoire von Themen, Motiven und Gestaltungsformen erstarrte. Im Gefolge der genannten Entwicklung schwand die Anziehungskraft des realistischen Kunstprogramms für die nachwachsenden Schriftsteller, die sich nun weniger an dessen Fortführung als vielmehr an der Auseinandersetzung mit den Vertretern der Gründerzeitliteratur interessiert zeigten. Der Widerstand gegen deren Kunstverständnis jedenfalls wurde zum eigentlichen Initialimpuls für die Herausbildung der naturalistischen Bewegung.
Aus dem Umstand heraus, dass die Vertreter der jüngeren Generation wesentliche Ziele des Realismus auch weiter teilten, sich aber von den ab den siebziger Jahren dominierenden Autoren (zu ihnen gehören Paul Heyse, Friedrich Bodenstedt, Emanuel Geibel, aber auch Friedrich Spielhagen oder Gustav Freytag) und Texten in z.T. scharfer Form abzugrenzen versuchten, erklärt sich das für den deutschen Naturalismus bezeichnende Phänomen forcierter rhetorischer Revolte bei gleichzeitiger – mindestens partieller – Übernahme der vorgefundenen künstlerischen Normen. Allerdings sollte dies nicht – wie häufig in der Forschungsliteratur geschehen – als Beleg für die Unentschiedenheit des deutschen Naturalismus in künstlerischer Hinsicht genommen werden. Vielmehr waren es die spannungsreichen literarischen Rahmenbedingungen, die ein solch ambivalentes Reaktionsmuster begünstigten.
Verabschiedung zentraler Prämissen realistischer Ästhetik
Dass der Naturalismus als eigenständige Diskursformation anzusehen ist, zeigt sich u.a. daran, dass er zentrale Prämissen realistischer Ästhetik mehr oder weniger deutlich verabschiedete. Der Philosoph Wilhelm Traugott Krug beispielsweise hatte in seinem für das Allgemeine Handwörterbuch der philosophischen Wissenschaften nebst ihrer Literatur und Geschichte (1832) geschriebenen Artikel „Ästhetischer Realismus“ vom Künstler noch gefordert, „daß er […] auf der einen Seite […] ein höheres Ziel vor Augen habe als der bloße Naturkopist, daß er aber auf der anderen Seite auch die Gesetzmäßigkeit der Natur überhaupt […] in seinen Erzeugnissen beobachte, damit seine Kunst nicht zur Unnatur werde“ (Plumpe 1985, 70), und die Literatur des Realismus war ihm darin gefolgt. Das Programm des Poetischen Realismus erscheint insofern als ästhetische Kompromissformel zwischen wirklichkeitsferner Idealität und exakter Imitation der Natur; man hat im Hinblick darauf deshalb verschiedentlich von ‚Real-Idealismus‘ gesprochen. Mit einer solchen Funktionsbestimmung der Kunst sind freilich die Grenzen einer realistischen Ästhetik klar markiert. Naturnachahmung im Verständnis des Naturalismus aber besteht nicht mehr darin, – wie Friedrich Theodor Vischer es in seiner Ästhetik als Norm aufstellt – „die Erscheinung, welche die Natur geschaffen […] auf ihre Reinheit zurück[zu]führen und so gereinigt in einem idealen vom Geistesleben erfüllten Scheinbilde [zu] wiederholen, in der Ausführung des inneren Bildes aber das Vorbild mit der Bestimmtheit seiner Formen und der Wärme seiner Lebendigkeit nacheifernd fest im Auge [zu] behalten“ (Vischer 1922, 97). Ein literarisches Verfahren wie es die Naturalisten entwickelt haben, das auf eine „Reinigung“ bzw. Verklärung des Dargestellten verzichtet und beim Prozess der Nachahmung bis hin zur „Kopie“ der Natur geht, verlässt deshalb den Geltungsbereich eines Poetischen Realismus erkennbar. Erst die damit verbundene ästhetische Grenzüberschreitung gestattet es im Übrigen, den Naturalismus als eigenständige Diskursformation zu begreifen, die einesteils das realistische Paradigma radikalisierend weiterführt und es andernteils – mindestens partiell – hinter sich lässt, weil insbesondere die vom ‚konsequenten‘ Naturalismus betriebene literarische Mimikry sprachlich vorgefundener Realität zu einer Entsemantisierung des Zeichenmaterials führt, die eine Brücke schlägt zu den Verfahrensweisen des Ästhetizismus im Rahmen der klassischen Moderne.
Unterschiede zwischen Realismus und Naturalismus zeigen sich nicht zuletzt an unscheinbaren Aspekten und vermeintlich geringfügigen Details. Zwei willkürlich herausgegriffene Beispiele mögen dies illustrieren helfen. So bleibt etwa „das Naturverständnis des bürgerlichen Romans“ im Poetischen Realismus letztlich eines „der Idylle […], das idyllische Landschaftsbild […] erfüllt dort die Sehnsucht des bürgerlichen Menschen nach dem Glücke der Natürlichkeit“ (Ueding 1977, 294). Aber auch der auf den ersten Blick erstaunlich wirkende Umstand, dass im Realismus nach wie vor eine beträchtliche Anzahl von Kunstmärchen entsteht und dass realistische Texte noch in weit höherem Maß, als man vermuten mag, phantastische Elemente aufweisen, belegt eindeutig, wie sehr der Poetische Realismus weiterhin dem herkömmlichen Spektrum literarischer Formen und Motive verhaftet ist. Derartige Kontinuitäten zu den vorhergehenden literarischen Diskursformationen Klassik und Romantik sowie zum philosophischen Leitkonzept des Idealismus aber brechen mit Einsetzen des Naturalismus ab, der sich entscheidend dadurch auszeichnet, dass er das bis dahin geltende zentrale ästhetische Prinzip der Verklärung endgültig verabschiedet. Im Grunde zieht er damit die Konsequenzen aus der Erkenntnis, dass „die Realisten ihr ureigenes Postulat der Nähe zur Wirklichkeit […] mittels Verklärung ihrer […] Um- und Mitwelt geradewegs wieder unterlaufen“ (Römhild 2005, 178) haben. Der Naturalismus versucht also,
[…] den programmatischen Anspruch des Realismus zu erneuern, ohne dessen idealistisches Voraussetzungsystem übernehmen zu müssen. An seine Stelle tritt eine emphatische Anerkenntnis der ‚modernen‘ Wirklichkeit einer industriell, natur- und ingenieurwissenschaftlich geprägten Kultur, die zwar überboten werden soll, als Ausgangspunkt aber nicht mehr bestritten werden kann. (Schneider 2005, 7)
Ambivalente Selbstverortung des Naturalismus
Die Doppelstrategie im Umgang mit der Vorgängerbewegung führt indes zu einer stellenweise unklaren Selbstverortung, die den Naturalismus zwischen bewusster Anknüpfung an das Bestehende und radikalem Bruch mit der Tradition oszillieren lässt. Deutlichster Indikator für die Unsicherheiten bei der Zuordnung ist die schwankende Benennung des eigenen Kunstprogramms durch die betreffenden Autoren selbst: „Es dominiert der Begriff ‚Realismus‘. Der Begriff ‚Naturalismus‘ wird aber auch benutzt, manchmal als Synonym für ‚Realismus‘, manchmal als Verschärfung und Zuspitzung des ‚Realismus‘. Er ist der von Emile Zola […] übernommene und durch ihn sanktionierte Begriff.“ (Meyer 2000, 28) Michael Georg Conrad jedenfalls, der Gründer und Herausgeber der ersten naturalistischen Zeitschrift Die Gesellschaft, kam der an ihn herangetragenen Forderung, „die Fahne des Naturalismus sans phrase […] zu entrollen und auf das Titelblatt zu schreiben ‚Organ für Naturalismus‘“, nicht nach; genau wie er lehnte auch sein Berater Wolfgang Kirchbach eine Untertitelung des Blattes mit der Bezeichnung „Zeitschrift für naturalistische Literatur und Kritik“ (Conrad 1902, 45) ab. Stattdessen wurde das Periodikum „Realistische Wochenschrift für Litteratur, Kunst und Leben“ genannt. Noch das von den Brüdern Hart herausgegebene Kritische Jahrbuch (1889/90) führt den Nebentitel „Beiträge zur Charakterisitik der zeitgenössischen Literatur sowie zur Verständigung über den modernen Realismus“ und vermeidet gezielt die Reizvokabel ‚Naturalismus‘. Wie diese Belege verdeutlichen, hatte die Handhabung der Terminologie in den meisten Fällen auch eine strategische Komponente. Und hier bot der weitgehend synonyme Gebrauch der beiden Bezeichnungen ‚Realismus‘ und ‚Naturalismus‘ große Vorteile, weil er – je nach Bedarf – eine Ankoppelung an unterschiedlich akzentuierte künstlerische Paradigmen gestattete. Was aus heutiger Sicht leicht den Eindruck von Unentschiedenheit erweckt, war unter den Bedingungen literarischer Öffentlichkeit im späten 19. Jahrhundert deshalb durchaus eine kluge Verwirrtaktik, die dazu beitrug, dass das ästhetische Programm der naturalistischen Bewegung vom Publikum leichter akzeptiert werden konnte.
Der Naturalismus und die „Entbindung der Moderne“
Das Anknüpfen an und teilweise Weiterführen von künstlerischen Konzepten des Realismus hat für die Literaturgeschichtsschreibung zur Folge, dass der Naturalismus unterschiedlichen Epochenkonzepten zugerechnet werden kann. Einerseits – von seiner Herkunft her – gehört er fraglos zur Diskursformation ‚Realismus‘, deren letzte, radikalisierte Phase er bildet. Andererseits läutet er die sog. Klassische Moderne um 1900 ein, die sämtliche Avantgarden des frühen 20. Jahrhunderts übergreift und – je nach Definition – 1918/19 oder auch erst 1933 endet. In dieser Perspektive erscheint der Naturalismus als – wenn auch verhaltener – Neuanfang, als Geburtsphase, die eine entscheidende Rolle bei der „Entbindung der Moderne“ (Bahr 1968, 87) spielt. Letztlich wird wohl nur eine solche stereoskopische Perspektive dem Naturalismus gerecht, weil sie die historische Scharnierfunktion dieser Bewegung erkennbar werden lässt, die eine ‚konventionelle‘, immer noch an den ästhetischen Paradigmen des 19. Jahrhunderts ausgerichtete und mit Relikten idealistischer Kunstauffassung operierende Ästhetik mit einer wissenschaftlich inspirierten Verfahrenslogik und einer bislang nicht dagewesenen Art des Umgangs mit dem Medium Sprache auf eine Weise verbindet, wie sie einzig in der Klassischen Moderne denkbar ist, und damit präzise die Nahtstelle zwischen der ersten und der zweiten Phase der Makroperiode Moderne markiert. Auch in literatursoziologischer Hinsicht zeigt sich diese Zwischenstellung. So kennt der Realismus im Unterschied zum Naturalismus weder ausgeprägte Gruppenbildungsphänomene noch eine erkennbare regionale Zentrenbildung.
Stereotypisierung des Naturalismus als Übergangsphase
Auf Grund seiner Doppelgestalt wurde der Naturalismus nicht nur in der Forschung, sondern auch von den Zeitgenossen häufig als bloße – wenn auch für die weitere Entwicklung der Kunst notwendige – Übergangsphase verstanden. Dieses Deutungsmuster bildete sich bereits Mitte der achtziger Jahre heraus. So charakterisiert Klaus Hermann in seiner Schrift Der Naturalismus und die Gesellschaft die Gegenwart als ästhetische „Puppenzeit“ (Hermann 1886, 5), in der sich Kommendes erst vorbereite, und erklärt: „Der Weg führt von überwundenen Idealen der alten Zeit […] zum Naturalismus und von da zu neuen Idealen.“ (Hermann 1886, 46) Und Hermann Bahr zeigt sich überzeugt: „Der Naturalismus ist entweder eine Pause zur Erholung der alten Kunst; oder er ist eine Pause zur Erholung der neuen: jedenfalls ist er Zwischenakt.“ (Bahr 1968, 88) Dies hat verschiedentlich zur ästhetischen Geringschätzung des naturalistischen Kunstprogramms geführt: Indem das ihr auf Grund der Temporalität der Moderne eigene Element des Transitorischen in der Sekundärliteratur meist eine negative Bewertung erfuhr, wurde die naturalistische Bewegung kurzerhand als Ganzes zur literarisch unergiebigen Interregnumsperiode erklärt. Die gegenwärtige Forschungslage ist ein zumindest mittelbares Ergebnis dieser verengten Sichtweise.