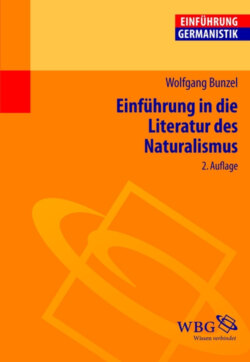Читать книгу Einführung in die Literatur des Naturalismus - Wolfgang Bunzel - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Forschungsbericht
ОглавлениеSelbsthistorisierung des Naturalismus
Erste Ansätze, den Naturalismus kulturgeschichtlich zu verorten, gab es bereits um die Jahrhundertwende. Interessanterweise waren es die Naturalisten selbst, die sich – nachdem nach- und gegennaturalistische Strömungen ästhetisch die Oberhand gewonnen hatten – um eine Historisierung der von ihnen selbst maßgeblich geprägten Phase der Literaturgeschichte bemühten. Freilich geschah das nicht in wissenschaftlicher Form, vielmehr nutzten die meisten Autoren autobiographische Textsorten, um persönliche Erinnerungen mit einer generellen Einschätzung der jüngeren Kulturentwicklung zu verknüpfen. Der erste monographisch angelegte Überblick über Programm und Personen des deutschen Naturalismus trägt den Titel Das jüngste Deutschland (1900) und stammt von Adalbert von Hanstein. Zwei Jahre darauf folgten die Erinnerungen zur Geschichte der Moderne von Michael Georg Conrad und der dreiteilige Aufsatz Die Anfänge der neuen deutschen Literaturbewegung. Persönliche Erinnerungen von Johannes Schlaf, ein Jahr später Heinrich Harts umfangreiche Artikelreihe Die Literatur-Bewegung von 1880–1900. Nach persönlichen Erlebnissen. Im Grunde liegen von fast allen namhaften und auch einigen heute kaum noch bekannten Schriftstellern des Naturalismus Lebensrückblicke vor, die mehr oder weniger ausführlich auf die naturalistische Bewegung eingehen.
Alle diese Texte sind autobiographischer Erlebnisbericht und subjektive Literaturgeschichte in einem. Sie sollen einerseits den Naturalismus als Kunstprogramm historisieren, andererseits aber auch das Bewusstsein für seine kulturelle Initiatorfunktion wachhalten und so dafür sorgen, dass die von ihm entbundenen ästhetischen Impulse weiterhin fruchtbar bleiben. Zu keinem Zeitpunkt ging es dabei um eine Abrechnung, wie sie seinerzeit etwa Heinrich Heine mit seiner Schrift Die romantische Schule (1836) vorgenommen hat. Diesem positiven Verhältnis zur eigenen Epoche ist es in erster Linie zuzuschreiben, dass man sich niemals von den eigenen Anfängen zu distanzieren brauchte und sich auch nach der Ablösung durch andere ästhetische Tendenzen der naturalistischen Bewegung noch zugehörig fühlen konnte. Eine derartige Verbundenheit wiederum erzeugte allererst das Ethos, mithilfe eines Rückblicks das Lebensgefühl einer Generation der Nachwelt anschaulich und mehr oder weniger treu vermitteln zu wollen.
Anfänge der Naturalismusforschung
Bei den ersten wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit dem Naturalismus beschäftigen, handelt es sich meist um Dissertationen; nicht wenige davon untersuchen den Einfluss der naturalistischen Ästhetik auf einzelne Autorpersönlichkeiten. In den zwanziger Jahren dann lag schon eine beträchtliche Anzahl von Titeln zum Thema vor, doch erfuhr die Auseinandersetzung mit Texten des Naturalismus erst in der folgenden Dekade eine markante Intensivierung. Zwischen 1930 und 1940 jedenfalls kamen nicht nur zahlreiche monographische Untersuchungen heraus, es entstanden auch diverse literaturgeschichtliche Darstellungen, die sich mit der Literatur der achtziger und neunziger Jahre des zurückliegenden Jahrhunderts beschäftigten. Das sprunghaft ansteigende Interesse hängt dabei erkennbar mit den ideologischen Rahmenbedingungen zusammen, fand doch mit der ‚Machtergreifung‘ der Nationalsozialisten eine verstärkte Zuwendung zu solchen Phasen der kulturellen Entwicklung statt, die im Sinne historischer Legitimierung als Vorgängerbewegungen deutbar waren. Der Naturalismus erschien in diesem Zusammenhang als Forschungsgebiet besonders attraktiv, weil seine Zielsetzungen ‚völkisch‘ akzentuiert und seine naturwissenschaftlich-medizinische Themenwahl als aktuell bedeutsamer historischer Diskurs um Rassenhygiene und Volksgesundheit verstanden werden konnten. Nach und nach geriet die Forschung der dreissiger Jahre in das Fahrwasser rassenbiologischer Deutungsmuster. Dem leistete zum einen die Milieutheorie der Naturalisten Vorschub, die von der gleichgeschalteten Wissenschaft im ‚Dritten Reich‘ zu Propagandazwecken ausgeschlachtet wurde, zum anderen hatten sich aber auch einige Autoren (Johannes Schlaf, Max Halbe, Julius Hart, aber auch Gerhart Hauptmann) im Lauf der Zeit ‚völkischem‘ Gedankengut und irrationalistischen Denkstrukturen soweit geöffnet, dass sie als Sympathisanten der Nationalsozialisten gelten konnten. Gleichwohl sind nur wenige Texte der Sekundärliteratur aus dem genannten Zeitraum wirklich tendenziös zu nennen. Offenbar entlasteten ideologisch mit den Theoremen des Nationalsozialismus kompatibel wirkende Themenstellungen auch vom Erwartungsdruck der Partei und boten Nischen für gediegene philologische Arbeit. Zusammenfassend gesagt: Obwohl die meisten der im Zeitraum von etwa 1910 bis 1940 entstandenen Studien positivistisch angelegt und mehr durch ihre Quellennähe als durch die Entwicklung eigenständiger Fragestellungen gekennzeichnet sind, gibt es darunter doch einige materialreiche Untersuchungen, auf die heute noch mit Gewinn zurückgegriffen werden kann.
Korrumpierung des Forschungsfeldes durch den Nationalsozialismus
Nach dem Zweiten Weltkrieg dauerte es zunächst geraume Zeit, bis der Naturalismus wieder ins Blickfeld der Germanistik geriet, was sicher mit der partiellen Korrumpierung des Forschungsfeldes durch den Nationalsozialismus zusammenhängt. Während sich im nichtdeutschen Ausland entsprechende Untersuchungen bereits zu Beginn der fünfziger Jahre wieder nachweisen lassen, entstanden im deutschen Sprachraum bis zum Ende dieses Jahrzehnts lediglich einige Laufbahnschriften. Eine Pionierrolle bei der Wiederentdeckung des Naturalismus spielte die von Erich Ruprecht zusammengestellte Quellensammlung Literarische Manifeste des Naturalismus 1880–1892 (1962), die erstmals wichtige Programmschriften und Aufsätze wieder zugänglich machte und so eine solide Grundlage für die weitere Forschung schuf. Verstärkt wurde ihre Wirkung noch durch die im selben Jahr erschienene Anthologie Dramen des Naturalismus, mit der Artur Müller und Hellmut Schlien eine – wenn auch schmale – Auswahl literarischer Texte vorlegten.
Hochkonjunktur der Forschung
Eine überaus lebhafte Konjunktur erlebte der Naturalismus als Forschungsgegenstand dann ab der zweiten Hälfte der sechziger Jahre, als sich – angestoßen von der Studentenbewegung – an den Universitäten eine kritisch-materialistisch ausgerichtete Literaturwissenschaft zu etablieren begann. Im Zuge der Politisierung der Literatur und des daraus resultierenden Interesses an solchen Phasen der Kulturgeschichte, die sich durch eine ‚gesellschaftsbezogene‘ Kunst auszeichnen, wurde die naturalistische Bewegung zu einem bevorzugten Explorationsfeld. Was die 68er-Generation daran interessierte, waren mehrere Aspekte: die erklärte Frontstellung zur klassisch-romantischen Kunst und die gleichzeitige Hochschätzung der bisher unterschätzten obrigkeitskritischen Gruppierungen Sturm und Drang und Junges Deutschland, die Zuwendung zu niederen sozialen Schichten und Personen des vierten Standes, die Thematisierung zuvor tabuisierter Begleiterscheinungen der Modernisierung wie soziale Verelendung, Alkoholismus und Prostitution und nicht zuletzt auch die Verbindungen der naturalistischen Schriftsteller zur – von 1878 bis 1890 verbotenen – sozialdemokratischen Partei. Kurz: Die Texte des Naturalismus schienen den historischen Beleg einer dezidiert sozialkritischen Literatur zu liefern, wie man sie selbst anstrebte. Die meisten Wissenschaftler teilten die Ansicht des naturalistischen Theoretikers Leo Berg, der sich davon überzeugt zeigte: „Der Naturalismus, sofern er als Prinzip des Milieus sich darstellt, ist nichts anderes als eine Kritik der bestehenden Gesellschaft.“ (Berg 1892, 52) Zugleich war man im Selbstverständnis mit den naturalistischen Autoren verbunden, sah man sich doch wie sie als „Rebellen und Neuerer“ (Arent [Hrsg.] 1885, III).
Es erschienen nun die ersten umfassenden Überblicksdarstellungen und zahlreiche wertvolle monographische Arbeiten. Hervorzuheben sind hier – neben den ungedruckten Dissertationen von Rüdiger Bernhardt (1968), Siegwart Berthold (1967), Robert A. Burns (1978), Sigfrid Hoefert (1962), Horst Meixner (1961), Helmut Praschek (1957) und Gerd Voswinkel (1970) – vor allem Roy C. Cowens (1973), Günter Mahals (1975, 21990) und Hanno Möbius‘ (1982) Epochenbände, die Textanthologien Naturalismus 1885–1899. Dramen, Lyrik, Prosa (2 Bde., 1970), Deutsches Theater des Naturalismus (1972), Theorie des Naturalismus (1973), Prosa des Naturalismus (1973), Einakter des Naturalismus (1973), Naturalismus (1975) und Dramen des deutschen Naturalismus von Hauptmann bis Schönherr (1981), der Sammelband Naturalismus. Bürgerliche Dichtung und soziales Engagement (1974), die thematisch ausgerichteten Untersuchungen von Klaus-Michael Bogdal (1978), Manfred Brauneck (1974), Katharina Günther (1972), Sigfrid Hoefert (1968), Jutta Kolkenbrock-Netz (1981), Heinz Linduschka (1978), John Osborne (1971) und Jürgen Schutte (1976) sowie die autorzentrierten Studien von Pierre Angel (1966), Gerhard Schulz (1974), Heinz-Georg Brands (1978), Hanno Möbius (1980), Helmut Scheuer (1971) und Peter Sprengel (1984).
Stagnation seit Ende der achtziger Jahre
Bald schon ebbte die Konjunktur des Naturalismus aber wieder ab. Nachdem in den achtziger Jahren immerhin noch einige wichtige Publikationen erschienen – darunter eine modifizierte und erweiterte Version der Quellensammlung mit Programmschriften aus dem Jahr 1962 in der Reihe „Manifeste und Dokumente zur deutschen Literatur“ (1987), ein Themenheft der Zeitschrift Der Deutschunterricht (1988), ein Band mit Interpretationen zu Dramen des Naturalismus (1988) und die Dissertationen von Barbara Voigt (1983) und Barbara J. Wrasidlo (1986) –, sind seitdem monographische Arbeiten nachgerade selten geworden. Aus den vergangenen 15 Jahren datieren lediglich vier größere Studien von Bedeutung, nämlich die Untersuchungen von Dieter Kafitz (1992), Günter Helmes (1995), Raleigh Whitinger (1997) und Lothar L. Schneider (2005), wobei die Habilitationsschrift von Helmes bis heute ungedruckt geblieben ist. Es gibt vielfältige Gründe dafür, dass das Interesse an der Literatur des Naturalismus merklich nachgelassen hat. Zunächst wäre hier der nachhaltige Ansehensverlust sozial und politisch engagierter Literatur zu nennen, der im Übrigen mit einschneidenden methodischen Paradigmenwechseln in der Literaturwissenschaft einherging. So beschäftigten sich sowohl die vornehmlich diskursanalytisch ausgerichteten Arbeiten der achtziger als auch die Textanalysen im Umfeld des Dekonstruktivismus zu Beginn der neunziger Jahre fast ausschließlich mit ästhetisch sehr komplexen Texten namhafter Autoren. Der Umstand, dass von den Schriftstellern des Naturalismus im Grunde nur Gerhart Hauptmann und – mit Einschränkungen – allenfalls noch das Autorengespann Arno Holz und Johannes Schlaf als kanonisiert gelten kann und insgesamt nur sehr wenige Werke aus diesem Zeitraum als gültige literarische Zeugnisse angesehen werden (mehr noch: kaum eines davon hat es geschafft, das Ghetto des schulischen Deutschunterrichts bzw. der universitären Germanistik zu verlassen), hat diese Strömung denn auch mehr und mehr an den Rand des Forschungsinteresses rücken lassen. Im Gegenzug erlebte vor allem die Forschung zur Literatur der ‚Wiener Moderne‘ einen gewaltigen und noch immer anhaltenden Aufschwung, so dass der Naturalismus als erste Phase der Klassischen Moderne mittlerweile eindeutig im Schatten der zweiten steht, die freilich nachhaltig von ihrer Vorgängerbewegung profitiert hat. Die gegenwärtige Situation zeichnet sich aber noch durch ein weiteres merkwürdiges Missverhältnis aus: Während der Naturalismus nach wie vor einen festen und unangefochtenen Platz in den schulischen Lehrplänen hat und auch bei Studenten ein äußerst beliebtes Thema für mündliche und schriftliche Abschlussprüfungen darstellt, kümmert sich die Literaturwissenschaft kaum mehr um diesen Gegenstand, ja man kann geradezu sagen, dass studentische bzw. curriculare Vorlieben hier in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis zur akademischen Forschungspraxis stehen. Ob die mancherorts zu beobachtenden Ansätze einer Rephilologisierung des Faches diesbezüglich eine Trendumkehr einleiten, bleibt abzuwarten.