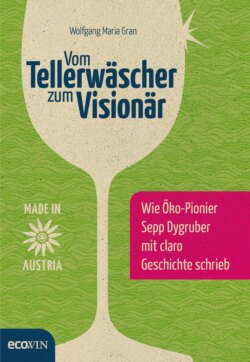Читать книгу Vom Tellerwäscher zum Visionär - Wolfgang Gran - Страница 6
NICHTS IST CLARO – ALLES CLARO
ОглавлениеGerade erst hatte der kleine Außenseiter im Ring ein wenig zu tänzeln begonnen; sich nicht respektlos, aber doch ganz schön frech in den Kampf eingebracht; erste leichte Körpertreffer bei den Gegnern gelandet, auch wenn diese eher als lästig, denn als schmerzhaft empfunden wurden. Aber es reichte immerhin, um zu bemerken, dass es da plötzlich jemanden gab, der zuvor nicht da gewesen war.
Und dann kam, für die ausgefuchsten Profis im Ring vorhersehbar, für den frechen Jungen aber wie aus dem Nichts, diese Gerade. Exakt auf die Kinnspitze. Die Sterne, nach denen er gegriffen hatte, tanzten nun vor seinen Augen, ehe es tiefschwarz wurde und der harte Aufprall auf den Brettern erfolgte. Ein Aufprall, der einerseits so richtig schmerzhaft war, der andererseits aber auch naive Träume aus dem brummenden Schädel beutelte und den ungetrübten Blick auf eine knallharte Realität frei machte.
Genau so erging es an einem Februartag des Jahres 2008 dem jungen Salzburger Unternehmer Josef Dygruber, der sich, nach seinem Abgang als Verkaufsleiter in der Österreich-Filiale des damals noch nicht mit der englischen Firma Reckitt fusionierten deutschen Waschmittelkonzerns Benckiser, 13 Jahre zuvor mit der Marke claro selbstständig gemacht hatte. Während ein großer Teil der Konsumenten damals noch Geschirrspülpulver verwendete, setzte der zu diesem Zeitpunkt erst 27-Jährige auf die kurz zuvor auf den Markt gekommenen Tabs und sah darin seine Chance, mit einer eigenen Marke in den Ring zu steigen. Einen Ring, den er zwar schon ganz gut kannte, aber bis dato nur von der relativ sicheren Seite aus, von der aus er den Kampf der langjährigen Profis zwar erste Reihe fußfrei mitverfolgt hatte, aber nur als Mitglied des Betreuerstabes. Jetzt wollte er nicht mehr nur gute Ratschläge erteilen, sondern selbst mitfighten.
Diese Profis, das waren im deutschsprachigen Raum Dygrubers ehemaliger Arbeitgeber Reckitt Benckiser mit der Marke Finish, die damals hierzulande noch Calgonit hieß, und die Henkel AG mit der Marke Somat. Beide beschäftigen Zehntausende Mitarbeiter und erwirtschaften Umsätze im deutlich zweistelligen Milliardenbereich. Dem gegenüber stand claro, das nach den ersten 13 Betriebsjahren mit drei Dutzend Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 15,8 Millionen Euro generierte. Außerhalb des deutschen Sprachraums, wo Dygruber schon einige Jahre nach der Firmengründung ebenfalls erste Gehversuche wagte, kamen mit multinationalen Konzernen wie Procter & Gamble mit der Marke Fairy oder Unilever mit Sun Giganten als Mitbewerber dazu, deren Jahresumsätze sich aktuell im Bereich von 50 Milliarden Euro bewegen.
Da piepste also gewissermaßen eine Micky Maus rotzfrech eine Elefantenherde an.
Blaue Augen hatte sich Dygruber schon in den Anfangsjahren immer wieder einmal geholt, aber mit dem Niederschlag im Februar 2008 drohte ein schwerer K. o. Ausgeführt wurde dieser Treffer von der deutschen Stiftung Warentest, der 1964 in Berlin gegründeten gemeinnützigen Verbraucherorganisation, die Waren und Dienstleistungen aus allen möglichen Bereichen vergleichend unter die Lupe nimmt. Ihr Urteil kann ein Unternehmen in hellem Glanz erstrahlen lassen, aber auch in ernsthafte Schwierigkeiten bringen. Weit mehr als 6000 verschiedene Tests, vom Schokoriegel bis zur Sicherheit von Fußballstadien, machten die Prüfer dieser Stiftung von ihrer Gründung bis heute; in diesem Februar 2008 veröffentlichten sie ihren Testbericht über Geschirrspültabs.
Josef Dygruber und sein Chemiker und technischer Leiter Erich Fabianitsch, die das Unternehmen 1995 aus dem Boden gestampft hatten, waren mit ihren claro-Tabs erstmals dabei und eigentlich guter Dinge. In Österreich hatte man es bei den großen Handelshäusern nach etlichen Anläufen in die Regale geschafft, in Deutschland war kurz vor dem großen Testbericht ein spektakulärer Deal mit der Drogeriemarktkette dm gelungen. Außerdem hatte man als erster und bis zu diesem Zeitpunkt einziger Anbieter auf dem Markt die Tabs in wasserlöslicher Folie verpackt und damit aus ökologischer Sicht einen gewaltigen Pionierschritt getan.
Doch statt sich dafür bei Stiftung Warentest einen Ritterschlag abzuholen, schritten die Österreicher schnurstracks ihrer eigenen Hinrichtung entgegen. In der Regel werden die Headlines ja den strahlenden Siegern gewidmet, aber diesmal gehörte alle Aufmerksamkeit in fetten Lettern dem Newcomer: »Nichts ist Claro« lautete das vernichtende Urteil der Tester schon im Titel, und im Text kam es noch viel dicker. Da war von »Totalausfall« und »teurem Flop« die Rede, und wenn man bei so vielen schallenden Ohrfeigen überhaupt noch in der Lage ist, die schmerzlichste zu definieren, dann war das in diesem Moment wohl das Desaster mit der vermeintlichen Trumpfkarte, der wasserlöslichen Folie. Der Test der Lagerfähigkeit der Geschirrspültabletten fand nämlich bei hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit statt, und da hatte man bei claro die hygroskopischen Eigenschaften der neuen Folie für einen Test unter solchen Bedingungen nicht ausreichend bedacht. Jedenfalls blieben von den brandneuen, innovativen 7-in-1-Tabs, mit denen man die übermächtigen Konkurrenten vor sich hertreiben wollte, nur noch »1-in-1-Knödel« übrig, weil die Folie alle Feuchtigkeit gebunden und die Tabs in undefinierte Klumpen verwandelt hatte.
Und damit hieß es für die Österreicher: Nicht genügend. Setzen.
Da saßen sie nun völlig zerknirscht in der kleinen Firma in Mondsee, Josef Dygruber und sein Chemiker Erich Fabianitsch, und fühlten sich auch wie Schüler, die zwar brav gelernt hatten, aber trotzdem mit einem Fünfer nach Hause gekommen waren: »Es war mit Sicherheit die schwärzeste Stunde«, sagt Dygruber heute. Eine Stunde, in der er fast froh war, dass sein Kollege aus dem Labor, der mit ihm einst bei Benckiser gearbeitet und dort die Entwicklungsabteilung geleitet hatte, noch eine Spur geknickter wirkte als er selbst: »So konnte ich ihn ein wenig aufrichten, ihm Hoffnung machen und Mut zusprechen – und das hat wiederum auch mir geholfen, nach diesem Niederschlag wieder aufzustehen.«
Denn natürlich kam auch beim Firmenchef dieser erste Reflex hoch, dass man Opfer einer großen Ungerechtigkeit geworden wäre und die Tester auch andere Möglichkeiten gehabt hätten, als eine Headline wie die scharfe Klinge einer Guillotine auf jemanden herabsausen zu lassen, der zu dieser Zeit gerade einmal 0,4 Prozent Marktanteil in Deutschland hatte: »Das wurde ja auch im Internet veröffentlicht, und da war es dann noch sehr, sehr lange so, dass du ›claro‹ eingegeben hast und sofort auf ›Nichts ist Claro‹ gestoßen bist. Hilfreich war das nicht«, erinnert sich Dygruber.
Aber es reichte auch nicht für einen finalen K. o., denn noch mit dem niederschmetternden Testergebnis vor Augen gab der claro-Chef seinem Chemiker Fabianitsch ein Versprechen: »Ich weiß, was du kannst, ich glaube fest an uns und sage dir: So etwas wird uns nie wieder passieren. Und auch wenn es eine Weile dauern wird, sage ich dir schon heute: Eines Tages werden wir Testsieger sein.« Als ihn der väterliche Freund daraufhin einen Träumer nannte, kam das bei Josef Dygruber quasi als Arbeitsauftrag an. Denn wer, wenn nicht der Chef selbst, sollte kühne Träume entwickeln und deren Umsetzung vorantreiben.
Zugute kam ihm dabei eine Fähigkeit, die unter anderem den durchschnittlichen vom außergewöhnlichen Unternehmer unterscheidet: Niederlagen und Rückschläge nicht lange zu beklagen und die Schuld im Außen zu suchen, sondern unverzüglich und ohne Umwege in die schonungslose Selbstanalyse zu gehen. Dabei gingen dem Salzburger gleich mehrere Lichter auf. Das Test-Desaster mit der wasserlöslichen Folie hatte ihm zwar in der Bewertung das Genick gebrochen, Dygruber musste sich aber auch andere, zunächst schwer verdauliche Faktoren eingestehen: »Unser Produkt war zwar von der Reinigungsleistung her gut, aber in Bereichen wie Glanztrocknung oder Belagsbildung, also in vielem, das von einem Multi-Tab verlangt wurde, waren wir noch meilenweit von den großen Mitbewerbern entfernt. Das mussten wir uns damals, zähneknirschend, aber doch, eingestehen.«
Zwei entscheidende Erkenntnisse nahm der Selfmade- Unternehmer aus diesen stockfinsteren Stunden mit: dass die Performance seines Produktes noch lange nicht dort war, wo sie zu sein hatte, um mehr als eine Sternschnuppe zu werden. Und dass er sich schleunigst mit den Regeln des Spiels vertraut machen musste, nach denen die Großen der Branche spielten, denn das Blauäugige hatte er nun im übertragenen wie wörtlichen Sinn hinter sich gebracht. Selbstverständlich saßen nämlich zum Beispiel Vertreter der großen Konkurrenten in jenem Fachbeirat von Stiftung Warentest, der unter anderem bei der Auswahl von Testkriterien beratend tätig ist. Und der Unterschied, ob man aus der Ferne ein Liedlein nachpfeifen konnte, oder selbst in irgendeiner Form dort präsent war, wo die Musik spielte, war Josef Dygruber nun überaus schmerzlich bewusst geworden: »Dabei ging es überhaupt nicht um Beeinflussung, sondern darum, besser und schneller informiert zu sein und auf manche Dinge reagieren zu können, bevor man eine böse Überraschung erlebt.«
Ihm wurde nun auch nachträglich klar, dass die zunächst schmeichelhafte Einladung zum Essen ins noble Salzburger Schloss Aigen, die der damalige Boss eines Mitbewerbers ausgesprochen hatte, nicht der unbestreitbaren Tatsache geschuldet war, dass Dygruber ein interessanter und sympathischer Gesprächspartner war. Sondern dass es hier in erster Linie um den Versuch gegangen war, in vermeintlich jovialer Atmosphäre mehr über das Innenleben und die Pläne einer kleinen Firma zu erfahren, die mit dem 7-in-1-Tab soeben dem 5-in-1-Modell eines Großkonzerns frech aufgefahren war.
Kurz: Der letzte Platz bei Stiftung Warentest animierte Josef Dygruber zu einer längst notwendigen Aufholjagd in Menschenkenntnis, Business-Regelkunde, vor allem aber zu einer deutlichen Schärfung der Zielperspektiven für seine eigene Marke. Mit diesem Fünfer im Zeugnis büffelte er von dieser Stunde an wie ein Besessener, um claro vom Sitzenbleiber zum Musterschüler zu machen. Denn da verstand Josef Dygruber überhaupt keinen Spaß. Diese Marke war für ihn im wirtschaftlichen Sinn wie ein Kind, für dessen Wohlergehen er sich verantwortlich fühlte. Und dieses Kind war mit 13 Jahren, wenn man so will, mitten in der Pubertät, von außen als »Totalversager« abgestempelt worden. Das konnte Josef Dygruber so auf keinen Fall stehen lassen.
Zeitensprung: Am 24. Oktober 2019 bestieg der claro-Chef in Salzburg ein Flugzeug, um mit seinen Chemikern am Kongress der SEPAWA in Berlin teilzunehmen, der 1954 in Ludwigshafen am Rhein gegründeten Vereinigung der Seifensieder, Parfümeure und Waschmittelfachleute. Hier trifft sich jedes Jahr alles, was in diesem Metier Rang und Namen hat. Aber leicht nervös war Dygruber aus einem anderen Grund. Wieder einmal stand nämlich das Jahreszeugnis der Warentester an, und nach der Landung steuerte er deshalb unverzüglich noch am Flughafen den nächsten Zeitungskiosk an, um das neue Magazin von Stiftung Warentest zu erwerben. Erwartungsvoll blätterte er sich bis zu Seite 63 durch, und da stand es dann in fetten Lettern:
»Alles Claro.«
Was Josef Dygruber seinem inzwischen bereits in Rente gegangenen Chemiker Erich Fabianitsch im Februar 2008 mehr aus Verzweiflung und Mitgefühl, denn aus Überzeugung versprochen hatte, war nun tatsächlich wahr geworden. claro war Testsieger bei Stiftung Warentest, und wo noch elf Jahre zuvor »Flop« und »Totalversager« gestanden war, konnte man nun lesen: »Sauber spülen und zugleich die Umwelt schonen – das ermöglicht nur eins der 19 getesteten Pulver und Tabs. Sein Name: Claro Classic.« Eine riesige Schmach war nicht nur getilgt, sondern in einen Triumph umgewandelt. Der Verspottete aus der Eselsbank war zum gefeierten Klassenprimus mutiert.
Der Kiosk-Betreiber staunte nicht schlecht, als ihm der Kunde aus Österreich gleich noch zwei Magazine abkaufte und ihn dann auch noch bat, ein Handyfoto zu schießen. Diesen Moment wollte der claro-Gründer einfach für alle Zeiten festhalten, und zwar diesmal nicht als Vermarktungsgenie in eigener Sache. Das war jetzt eine echte Herzensangelegenheit. Das »Kind« war nicht nur auf ganzer Linie rehabilitiert, es hatte all jene hinter sich gelassen, die es ein paar Jahre davor noch gehänselt und geringschätzig belächelt hatten. Den Auftrag für den später im deutschen Fernsehen gesendeten Werbespot mit der Botschaft, dass Deutschlands beste Geschirrspültabs aus Österreich kommen, hatte er in diesem Moment noch nicht im Kopf. Später aber bereitete ihm dieser umso größeres Vergnügen.
Und noch bevor der glückstrahlende Dygruber an diesem 24. Oktober 2019 in der Messehalle die nicht enden wollenden Gratulationen von Kollegen und Rohstofflieferanten entgegennahm, tippte er rasch eine Nachricht an seinen Mann der ersten Stunde, Chemiker Fabianitsch, ins Telefon, der kurz davor seinen 70. Geburtstag gefeiert hatte: »Lieber Erich, fast hätte ich dein Geburtstagsgeschenk vergessen. Wir haben gewonnen!«, schrieb er dem Weggefährten, mit dem er diesen beglückenden Augenblick teilen wollte. Denn Menschen, die treu und loyal an seiner Seite stehen und so hart für seine Träume zu arbeiten bereit sind wie er selbst, vergisst der claro-Gründer nie: »Erich hat für mich immer einen fixen Platz, auch wenn er inzwischen nicht mehr dabei ist. Aber er hat mit mir diese Firma aufgebaut, und wir haben gemeinsam die Basis für Erfolge gelegt.«
Was war aber nun in diesen elf Jahren geschehen, die zwischen der bittersten Niederlage und dem größten Triumph der Marke claro und ihres Begründers lagen?
Technische Entwicklung? Natürlich, denn Geschirrspültabs waren im Unterschied zur Gründungszeit der kleinen Firma mittlerweile längst Standard geworden, und wer da mit der Performance in allen dafür wichtigen Segmenten nicht mithalten konnte, stand von vornherein auf verlorenem Posten. Und eine deutlichere Aufforderung, sich auch im Labor um die noch vorhandenen Schwachstellen zu kümmern, als den letzten Platz im Test von Stiftung Warentest hätte es auch nicht geben können. Dieses Nachsitzen absolvierte man bei claro aber mit maximaler Ernsthaftigkeit, und die Schwächen waren bald ausgemerzt.
Unternehmerische Entwicklung? Gewiss, denn Josef Dygruber machte bei den Fehleranalysen nicht nur nicht halt bei sich selbst, sondern er widmete sich diesem Punkt stets mit der allergrößten Aufmerksamkeit. Er lernte in einem mühsamen Prozess, nicht mehr alles in die eigenen Hände zu nehmen, sondern auch zu delegieren. Er ging dazu über, nicht jeden anstehenden Entwicklungsprozess im stillen Kämmerlein in nur einem, nämlich dem eigenen Kopf durchzuspielen, sondern sich an markanten Punkten, die wichtige strategische Entscheidungen erforderten, den Rat eines kleinen, aber umso feineren Kreises an Beratern einzuholen. Er erweiterte auf diese Art also auch das Spektrum der Perspektiven, denn ausschließlich die eigene hatte ihn nicht nur schon relativ früh ein respektables Stück weit auf die Straße des Erfolges, sondern auch auf so manchen Holzweg geführt. Und er absolvierte als bereits gestandener Unternehmer nebenher ein Masterstudium, um sich nachträglich mit dem theoretischen Unterfutter für seine Tätigkeit als Firmenchef und Markengründer auszustatten.
All das passierte, und all das war wichtig und notwendig. Aber letzten Endes waren zwei Faktoren die entscheidenden, die sogar in Zusammenhang miteinander standen. War es Dygruber speziell in der schwierigen Anfangszeit, in der er einerseits belächelt, zur selben Zeit aber auch bereits mit harten Bandagen bekämpft worden war, noch wichtig gewesen, es als furchtloser David den Goliaths der Branche zu zeigen, relativierte sich dieses Spielfeld zunehmend. Er hatte nie verstanden, wieso der eine oder andere Großkonzern Energie darauf verwenden konnte, einen so überschaubar kleinen Mitstreiter auch noch abseits der Handelsregale zu bekämpfen. Aber ihm wurde mit der Zeit auch bewusst, dass er, um ein guter David zu sein, gar keinen Goliath als Feindbild brauchte. Kurz: Josef Dygruber lenkte seine ganze Energie und Kreativität weg von diversen Scharmützeln hin zur eigenen Marke, die immer etwas ganz Besonderes werden sollte, es objektivierbar aber erst durch den Prozess wurde, der nach dieser Schmach im Jahr 2008 in Gang gesetzt wurde.
Ein wichtiger Teil dieses Prozesses war, dass sich claro nicht nur hinsichtlich der Verpackung als »grünes« Produkt präsentierte. Ein ökologischer Vorreiter zu werden, der Innovationen nicht nur hervorbringen, sondern mit diesen auch Produktgeschichte schreiben und, um sie quasi allgemeingültig zu machen, das Marktumfeld verändern konnte, wurde zu einer zentralen Zielvorgabe der Marke – parallel zur Auflage, bei den Basics im Spitzenfeld zu performen.
»Grün. Aber gründlich« war ein Werbeslogan für das Außen, der aber nun im Inneren als Firmenphilosophie in einer Weise verankert wurde, die viel mehr war als ein wohlklingendes und nützliches Öko-Mascherl. Es wurde zur Seele des kleinen David, der zwar immer noch mit den Goliaths im Ring stand, für sich aber die Regeln des Kampfes geändert hatte. Einfach nur größer werden zu wollen, war ja als Ziel recht und schön gewesen, aber wofür? Damit man den Riesen statt bis zu den Zehennägeln bis zu den Knöcheln geht? Also besann man sich bei claro der Vorteile des Kleinseins – kurze Entscheidungswege, kreative Freiheit und rasche Reaktionsgeschwindigkeit, und all das gebündelt, um die Kernkompetenz zu stärken. Womit man sich von den großen Mitbewerbern abheben, gleichzeitig ein eigenes Spielfeld eröffnen und dabei ja trotzdem auch den einen oder anderen Meter wachsen konnte.
Ein junger Mann mit riesigen Ambitionen, aber noch kleiner Erfahrung im großen Spiel der Kräfte, war nur teiltrainiert in den Ring gestürmt, in dem in jeder Ecke eine Überraschung lauerte, und wollte sich entschlossen, aber ungestüm durchboxen. Es brauchte viele Jahre in der Lebens- und Unternehmerschule, um zu erkennen, dass ein gezielter, richtig gesetzter Treffer mehr brachte als all das aufgeregte Fuchteln. Diesen Treffer hatte Josef Dygruber nun kurz vor seinem 25-jährigen Firmenjubiläum im Jahr 2020 angebracht.
Dazu brauchte es einen langen Atem und eine ganz spezielle Persönlichkeit. Wie und woraus sich diese entwickelte, welche Hürden es von »Nichts ist Claro« bis zu «Alles Claro« zu überwinden gab, darüber geben die folgenden Kapitel Aufschluss. Denn auch wenn die Geschichte des Josef Dygruber nicht in einer goldenen Wiege ihren Anfang nahm, begann vieles, was später folgte, in der Abgeschiedenheit des kleinen Salzburger Dorfes Adnet.