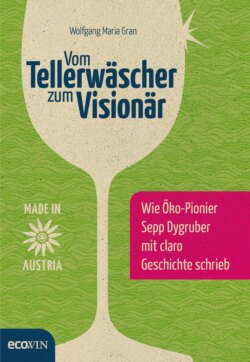Читать книгу Vom Tellerwäscher zum Visionär - Wolfgang Gran - Страница 7
WENIG GELD, VIEL NATUR
ОглавлениеBei aller Liebe zu diesen reizenden Tierchen steht eines fest: Laubfrosch und Sumpfkehlchen allein hätten den Bekanntheitsgrad dieses 3600-Einwohner-Dorfes im Bezirk Hallein im Bundesland Salzburg höchstwahrscheinlich innerhalb der Ortsgrenzen gehalten. Denn der keltische Name Atanate, übersetzt »Sumpf«, verrät schon, warum sich oben erwähnte Tiere bis heute so gern im Moos der kleinen Gemeinde aufhalten. Dass das Dorf Adnet aber weit über die Grenzen Österreichs hinaus ein Begriff ist, liegt am »roten Gold«, das hier schon seit der Zeit der Römer abgebaut wird – dem Adneter Marmor, der nach den strengen Gesetzen der Mineralogie aber eigentlich lediglich ein bunter, sehr gut polierfähiger Kalkstein ist, aber aus historischen Gründen Marmor heißen darf.
Wie würde das auch klingen, wenn etwa die Mariensäule in München oder das Grabmal von Kaiser Friedrich III. im Wiener Stephansdom plötzlich nicht mehr aus Adneter Marmor sein dürften? Oder gar die 24 Säulen im Parlamentsgebäude in Wien? Knollenkalk-Säulenhalle? Das ginge ja gar nicht – und wäre auch überhaupt nicht nötig, weil dieses wunderschön marmorierte Gestein aus den Adneter Steinbrüchen aussieht wie Marmor, sich anfühlt wie Marmor und, wenn man so will, eine etablierte Marke ist. Da kann irgendein gestrenger Gesteinsprofessor schon einmal ein Auge zudrücken.
Aber lassen wir die mineralogischen Spitzfindigkeiten und bleiben bei den 24 Säulen für das Parlamentsgebäude in der österreichischen Bundeshauptstadt. Die bestehen aus dem sogenannten »Rotgrau Schnöll« von den Adneter Marmor-Steinbrüchen. Einer der Arbeiter, die damals um 1870 damit beschäftigt waren, das tonnenschwere Gestein abzubauen und dann mit Pferdegespannen zum Bahnhof Hallein zu bringen, von wo es mit der Eisenbahn nach Wien verfrachtet wurde, hieß Kaspar Seywald und war der Urgroßvater von Josef Dygruber. Der saß ziemlich genau 100 Jahre später mit Kaspar Seywald Junior, seinem Opa, in der Wandschützenhütte oberhalb der Kirchenbruchwand und lauschte als Fünfjähriger mit gespitzten Ohren den Geschichten aus dieser fernen Zeit. Aber dazu später.
Anfang der 1960er-Jahre kam ein junger Mann namens Josef Dygruber aus St. Martin am Tennengebirge nach Adnet, weil er dort bei einem Baustoffhändler Arbeit fand und mit einem Lkw Ziegel und Kohlen ausfuhr. Als eines von sieben Kindern einer Bauernfamilie, die finanziell hart zu kämpfen hatte, war er schon sehr früh ins Arbeitsleben geschubst worden: »Ich war 14 und hatte meinen letzten Schultag«, erinnert sich der Vater des claro-Gründers, »und gleich am nächsten Tag habe ich bei einem Bauern auf einer Alm zu arbeiten begonnen.« Das Frühstück am Morgen seiner Abreise war die letzte Begegnung mit seiner Familie für zwei Jahre, denn so lange durfte er nicht mehr nach Hause fahren. Dort oben auf der Alm, wo sein Arbeitgeber neben der Landwirtschaft auch eine kleine Pension betrieb, wurden Arbeitszeitregelungen, wie sie unten im Tal galten, vom Winde verweht, und der Bub hatte eine Sieben-Tage-Woche. 52 Wochen lang. Und dann gleich noch einmal so lang.
Aber daheim linderte ein Esser weniger den Trennungsschmerz, und oben auf der Alm lernte ein junger Bursche auf die rustikale Art, dass man sich nicht beklagt, sondern zupackt, wenn man Arbeit gefunden hat. Statt am Sonntag heim zur Familie zu dürfen, wurde er nach dem Kirchgang eingeteilt, Speiseeis zu rühren, damit die zahlenden Gäste am Nachmittag etwas Süßes zu schlecken hatten. Und wenn er heute, als 82-jähriger Mann, erzählt, dass ihm das eigentlich gar nichts ausgemacht hätte, weil er dabei ohnehin heimlich auch das eine oder andere Löffelchen stibitzt hatte, bleibt einem zunächst einmal der Mund offen, wie man gnadenlose Ausbeutung in der Retrospektive fast schon romantisch verklären kann.
Doch man darf dabei nicht vergessen, dass das in einer Zeit passierte, in der speziell in ländlichen Regionen die Herren-Knecht-Mentalität längst nicht ausgestorben war und Josef Dygruber mit seinen erst 14 Jahren glauben musste, dass die Arbeitswelt eben so aussah. Und auch, wenn sich später die Arbeitsumstände ändern, wirkt eine derartige Prägung lang, manchmal ein Leben lang nach. Sie gebiert dann oft besonders fleißige Menschen, die aber gründlich gelernt haben, die eigene Befindlichkeit hintanzustellen.
Als Dygruber nach Adnet kam, lernte er dort 1964 die Bauerntochter Johanna Seywald kennen, und spätestens nach einer gemeinsamen Schlittenfahrt war für ihn klar, wohin die Reise mit der feschen jungen Dame gehen sollte. Die hätte hingegen lieber noch ein Weilchen gewartet mit dem Heiraten, weil sie sich mit 22 Jahren dafür zu jung fühlte und noch eine Menge Träume im Kopf hatte. Aber der Brautwerber hatte offenbar ziemlich gute Argumente, und so sausten Hanni und Sepp nicht lange nach der rasanten Schlittenfahrt auch in den Hafen der Ehe. Schon 1965 begann das Paar mit dem gemeinsamen Hausbau, und am 27. November 1967 kam im alten Bürgerspital in Hallein mit Sohn Josef ein zusätzlicher »Reisebegleiter« für das junge Paar dazu.
Drei Jahre blieb Johanna beim Buben daheim, aber weil die Eheleute für den Hausbau jeden Schilling brauchten, ging sie danach wieder arbeiten. Mittlerweile waren beide Eltern in der Papierfabrik Hallein beschäftigt, und sie teilten sich ihre Schichten so ein, dass immer einer von ihnen beim kleinen Josef war. Das klappte meist reibungslos, aber nicht immer, denn es galt ja, logistisch eine Stunde zu überbrücken, in der die eine schon weg und der andere noch nicht da war von der Arbeit. Und so sah die Mutter eines Abends, als sie sich dem Haus näherte, den Buben mit nassgeweinten Augen am Fenster – er war noch einmal wach geworden und hatte seine Eltern gesucht. Ein Moment, der ihr noch ein halbes Jahrhundert später immer wieder einen Stich versetzt, wenn die Rede darauf kommt: »Ich habe gespürt, dass das nicht gut ist – und das alles nur wegen des blöden Geldes. Aber als er gemerkt hat, wie nah mir das geht, hat er sofort gesagt: ›Mama, sei nicht traurig, ich pack’ das schon.‹«
Eine aus heutiger Sicht für Josef Dygruber typische, aber damals bemerkenswerte Reaktion, denn verstanden hatte es der Bub damals noch nicht, warum andere Mütter bei ihren Kindern waren, seine Mama aber immer wieder wegmusste. Aber Josef war ein Kind, das, wie es Johanna Dygruber ausdrückt, stets »gut zu haben« war. Freundlich, fröhlich, ohne Eklats. Woran sein Vater aber auch einen großen Anteil hatte, denn der übernahm eine für einen Mann in der damaligen Zeit noch nicht so selbstverständliche Rolle – die des Papas, der viel Zeit für das Kind hat. Er nahm mit dem Buben Gedichte auf Kassettenrekorder auf, die der für die Schule lernen musste, und übte sie mit ihm, er lernte und spielte mit seinem Sohn, genoss aber auch etwas, für das es diesen Begriff damals noch nicht gab: das gemeinsame Chillen. Dabei verschwanden eines Tages im Advent sämtliche für Weihnachten gedachten Kekse, weil während des gemeinsamen Couch-Kuschelns einmal der große und einmal der kleine Josef in die nicht gut genug versteckten Dosen nachfassen ging.
Josef Dygruber erlebte eine Kindheit, die trotz deren beruflicher Absenzen von viel Zuwendung beider Elternteile geprägt war, was gewiss auch damit zu tun hatte, dass er ein Einzelkind blieb: »Ein zweites wäre unter diesen Umständen nicht gegangen, da wäre es aus gewesen«, bringt der Vater die finanzielle und organisatorische Gratwanderung dieser Jahre drastisch auf den Punkt. Eine Kindheit, die aber auch davon bestimmt war, dass jeder Schilling vor dem Ausgeben zwei- bis dreimal umgedreht wurde, auch wenn speziell die Mutter im Rahmen der Möglichkeiten großzügig war: »Die Mama hat immer gesagt, lieber einmal etwas G’scheites kaufen, als dreimal einen billigen Blödsinn«, erinnert sich Dygruber. Und da war es gut, dass diesen Part die Mutter überhatte, denn mit dem Vater wäre es wahrscheinlich genau umgekehrt gelaufen.
Die Dygrubers waren nicht arm, aber der Gürtel war eng geschnallt. Sie waren nicht geizig, aber notgedrungen sparsam. Und dem Buben fehlte es an nichts, aber das verhinderte nicht das damals wehmütige Schielen auf andere, die im Vergleich zu ihm mit Geschenken regelrecht überschüttet wurden. Er sagt heute aus voller Überzeugung, dass die Art, wie er aufgewachsen war, die bessere Lebensschule gewesen sei, dass er von seinen Eltern viel Wichtigeres mitbekommen hätte als materielle Güter, nämlich moralische Unterstützung in allen Lebensbereichen und einen stabilen Wertekatalog. Dem Kind konnte sich das in der Form noch nicht erschließen, und deshalb sah es sich doch in manchen Situationen im Vergleich zu anderen ein wenig leid.
Aber eben nur ein wenig, denn im engen Rahmen der bescheidenen Möglichkeiten taten die Eltern alles, um ihrem Sohn nicht nur Werte für später, sondern auch Wertigkeiten für das gerade aktuelle Jetzt bereitzustellen. So hatte Josef schon mit zwölf Jahren eine Skitouren-Ausrüstung und erklomm mit den Eltern den Schlenken, den Hausberg in Adnet. Und mit 14 konnte er mit eigenem Surfbrett auf dem Wiestalstausee bei günstigen Winden die Mädchen beeindrucken. Solche Dinge bescherten ihm damals, oberflächlich betrachtet, nicht zu verachtende Punktesiege bei Gleichaltrigen. In den tieferen Schichten aber sorgte das auch für eine starke Verwurzelung mit seiner Heimat, weil all das in der prächtigen Natur rund um Adnet stattfand. Und heute als über 50-Jähriger weiß Josef Dygruber, dass es auch diese Erlebnisse waren, die ihn dazu brachten, sein Heimatdorf nie zu verlassen.
Denn schon in seiner Kindheit war dieser Bub auch mit Dingen nachhaltig zu beeindrucken, die rein gar nichts mit Materiellem zu tun hatten, und da kommt wieder der eingangs erwähnte Großvater Kaspar Seywald ins Spiel. Der hatte es sich zur Angewohnheit gemacht, den kleinen Sepp nach dem Kindergarten und später der Volksschule auf seinem Puch-VS-50-D-Moped zur Wandschützenhütte mitzunehmen. Er war Obmann dieses traditionsreichen Böllerschützenvereins und kümmerte sich um die Hütte, die als Heimstätte diente.
Ist das Böllerschießen heute nur noch Brauchtum an den sogenannten Prangertagen wie etwa Fronleichnam, war es früher ab Mitte des 18. Jahrhunderts ein Wetterschießen, um Hagelwolken zu vertreiben. Und das passierte auf dieser Felswand hoch über Adnet, woher sich auch der Vereinsname ableitet. Mit dem Großvater in diese Hütte mitzufahren, war für den jungen Sepp ein Kindheitshighlight. Dort oben tat sich nicht nur ein Blick auf, der das Dorf unten im Tal wie ein kleines Lego-Bauwerk erscheinen ließ, sondern da war alles voller Geschichten und Geheimnisse. Stundenlang konnte der Bub die an die Hüttenwand gehefteten Partezettel verstorbener Mitglieder studieren und dem Opa Löcher in den Bauch fragen, wer diese Männer gewesen waren und was sie in ihren Leben getan hatten.
Und wenn der Großvater die Falltür im Boden öffnete, um aus dem Erdkeller Apfelsaft für den Enkel zu holen, war das für den Buben ein ums andere Mal ein besonderes Erlebnis: »Du trinkst nichts anderes als Saft, aber in diesem Moment ist das für ein Kind der weltbeste Apfelsaft«, gerät Dygruber auch noch als gestandener Mann und Firmenchef ins Schwärmen. Es waren für ihn damals wohl die Momente, in denen seine Fantasie unbegrenzten Auslauf hatte, und als der Opa eines Tages sagte: »Komm mit, jetzt wirst du verewigt«, und in einen Marmor-Findling ritzte: »JD 1973«, hatte der damals knapp Sechsjährige das Gefühl, eine kleine Berühmtheit zu sein, der gerade ein Denkmal gesetzt worden war.
Für eine Berühmtheit hielt er übrigens auch den Großvater, denn oben in der Wandschützenhütte verkehrte das eine oder andere Mal auch Alt-Landeshauptmann Wilfried Haslauer, und eines Tages kam sogar jemand von Radio Salzburg, um anlässlich eines Jubiläums den Opa zu interviewen. Und dabei zeigte sich, wie sehr der kleine Mann alles rund um diese Hütte und die spannenden Geschichten der Schützen in sich aufgesogen hatte. Als der Journalist fragte, wann der Wandschützenverein gegründet worden war und der Großvater kurz zögerte, schoss es aus dem Kind heraus: »1745«.
Die Bergtouren, das Schwimmen und Surfen im Wiestalstausee, die Erlebnisse mit dem Großvater auf der Hütte, die mit ausgedehnten Streifzügen durch den Wald verbunden waren – all diese prächtigen Kulissen der Natur bescherten dem heranwachsenden Josef Dygruber Kindheits- und Jugenderlebnisse, über die er noch heute gerne spricht: »Kindheit, das war für mich eine Herkunft, das war für mich auch die Natur, die mich umgibt, und da war es schon ganz gut, dass ich materiell nicht überhäuft worden bin, weil ich meine Bezugspunkte so in den Erinnerungen daran habe, was ich als Kind erlebt habe.«
Aber ein Dorfleben hat ja beileibe nicht nur Idylle zu bieten. Hier ist nicht nur Nähe zu spüren, sondern auch Enge. Hier wird nicht nur angeregt geplaudert, sondern auch missgünstig getratscht. Und hier kann man vertraute Abläufe auch als eintönige Routine empfinden. Es können ganz schön die Funken spritzen, wenn die Macht des Beharrens auf die Macht der Bewegung trifft in so einem überschaubaren Miteinander.
Und wenn dann einer ausschert aus dem gewohnten Trott wie Josef Dygruber, hält sich die Zahl jener in engen Grenzen, die nach dem überraschenden Ausstieg aus einem programmierten Lebensweg als biederer Angestellter zum mutigen Schritt in eine neue Richtung als risikobereiter Unternehmer gratulieren: »Als er mit claro angefangen hat, haben die Leute schon überwiegend gesagt: Das wird er nicht schaffen«, erzählt sein Vater: »Sogar die von der Bank, in der er am Anfang gearbeitet hat.«
Zumal das ja einer tat, den man bis dahin nicht einmal ansatzweise als revolutionären Charakter, als wilden, unkonventionellen Hasardeur wahrgenommen hatte. Josef Dygruber bezeichnet Handlungen als Kindheits- und Jugendstreiche, die bei jedem etwas aufmüpfigeren Heranwachsenden als Bewerbungen für ein Extra-Sternderl in Betragen durchgehen würden. Eine nicht gegessene Jause im Schnee vergraben, ein scheues Busserl im Kindergarten für den Schwarm Gertraud, später einmal ohne Führerschein mit dem Moped fahren und dann beim Gendarmen auch noch sofort zugeben, dass man keinen hat: Mit so einem »Sündenregister« hätte er bei der Raiffeisenbank große Karriere gemacht, wenn er denn dabeigeblieben wäre und nicht diese Idee mit den Geschirrspültabs entwickelt hätte.
Dieses Wagnis riskierte aber auch einer, dem die Ambivalenz seines kleinen, feinen Bezugs- und Rückzugspunktes Adnet früh bewusst wurde. Wobei es dabei gar nicht so sehr um dieses Dorf im Speziellen ging, sondern um ein strukturelles Phänomen von Gemeinschaften dieser Ausprägung: »Ich habe zunehmend bemerkt, dass ich eigentlich immer derselbe geblieben bin, aber meine Umgebung sich verändert hat – je nachdem, was ich gerade getan habe.« Was für andere um ihn herum durchaus beglückender Lebensinhalt sein konnte, nämlich das Wiederholen festgelegter Rituale in einer immer gleichen Schleife, hätte ihm das Gefühl gegeben, sich mit etwas bescheiden zu müssen. Es hätte seine Kreativität und seinen Entdeckergeist in Ketten gelegt, und damit hätte er möglicherweise funktionieren, aber niemals sinnerfüllt leben können.
Als er in der ersten Klasse der Handelsakademie die Schule schmeißen wollte, nahm ihn sich sein Vater zur Brust und sagte: »Mach das weiter, schau, dass du die Matura schaffst, weil ohne die bist du ein Leben lang der Depp.« Wäre das damals von der Mutter gekommen, wer weiß, wie er reagiert hätte, denn von ihr hätte er so einen Ordnungsruf erwartet. Aber ausgerechnet vom Vater? Von diesem fleißigen, aber passiv so vieles erduldenden Mann, der nun plötzlich auf eine Art initiativ wurde, die jeden Widerspruch im Keim erstickte und den jungen Mann zum Nachdenken brachte. Es war dies ein ganz entscheidender Impuls für Josef Dygrubers später so oft gezeigte Fähigkeit, niemals aufzugeben.
Und als ihm später einmal in der Schule in Rechnungswesen ein »Nicht genügend« drohte, er dann aber bei der alles entscheidenden Schularbeit ein »Sehr gut« schrieb, sagte der Professor: »Und jetzt zum Dygruber: Bei dem weiß der Gegner nie, woran er ist.« Der gute Mann konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen, wie sehr er mit dieser Aussage, was seines Schülers Hartnäckigkeit und Kampfgeist betraf, ins Schwarze getroffen hatte.
Denn viel später, als das Unternehmen claro begann, bekam natürlich auch der Gründer mit, wie viele auch, aber bei Weitem nicht nur in seiner Heimatgemeinde die Sache argwöhnisch beurteilten und im Geiste bereits die Sanduhr umgedreht hatten, um zu sehen, wann seine Zeit wieder ablaufen würde. Diese Menschen waren für ihn nicht Gegner ad personam, aber Gegner in ihrer Geisteshaltung, einer – trotz in der Regel in diesen ländlichen Regionen politisch stockschwarzen Gesinnung – im Prinzip ziemlich unternehmerfeindlichen Haltung: »In den USA applaudiert man dir, wenn du etwas probierst, stempelt dich nicht ab, wenn du scheiterst, und gratuliert dir, wenn du aufstehst und es wieder versuchst. Bei uns glaubt man zuerst nicht, dass du es schaffst, und du bist für alle Zeiten als Pleitier punziert, wenn es einmal schiefgeht. Wenn es aber gut geht, wird dir nicht neidlos gratuliert, sondern gefragt: Wie ist denn das zugegangen? Als ob da noch etwas dahinterstecken müsste, das nicht in Ordnung ist«, sagt Dygruber.
Ihm macht das nichts, und schon gar nicht kann es ihm die Freude an seinem Leben in dieser wunderschönen kleinen Gemeinde nehmen. Im Gegenteil: »Ich spüre Adnet so stark, das erdet mich, gibt mir neue Kraft, und hier relativiert sich so vieles, was außerhalb dieses Bezugspunktes so schwierig erscheint.« Aber auf eines kann man sich verlassen, und da weiß man im Unterschied zur Diagnose des Rechnungswesen-Lehrers bei Josef Dygruber sehr genau, woran man ist: Er vergisst nie, wer loyal und verlässlich ist, wer ihm den Rücken zukehrt, wenn er eine Hand brauchen würde – und vor allem nicht, wer zunächst einmal wartet, woher der Wind weht und dem sein Verhalten anpasst.
Denn es ist auf diesem langen Weg vom neugierigen Buben in der Wandschützenhütte zum erfolgreichen Firmenchef etwas passiert, das auch seiner Mutter aufgefallen ist: »Er hat viel gelernt, unter anderem, auch einmal hart zu sein. Das ist wichtig, denn er ist von seinem Naturell her so ein weicher, gutmütiger Kerl – und es ist schön, dass er das privat geblieben ist, aber im Geschäft musst du auch anders können, sonst wirst du ausgenützt.«
Manchmal, wenn sie durch den Ort geht, wird Johanna Dygruber gefragt: »Und, wie geht’s deinem claro?« Auch wenn so eine Frage mit Sicherheit nicht böse gemeint ist, ist sie in ihrer Wortwahl demaskierend. Eine Mutter fragt man nach dem Befinden des Sohnes und nennt ihn bei seinem Namen, nicht nach der Firma. Geschäftlich hat Josef Dygruber nichts dagegen, wenn man ihn mit der Marke identifiziert. Daheim, dort, wo seine Seele zur Ruhe kommt, wo er ausschließlich Mensch sein will, wäre er halt schon gern der Sepp. Weil er hier auch nie etwas anderes war und sein will als das. Alles claro?