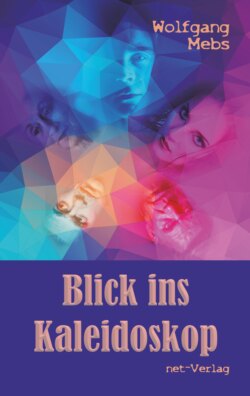Читать книгу Blick ins Kaleidoskop - Wolfgang Mebs - Страница 6
Kapitel 1
ОглавлениеKarl Richter hasst es aufzustehen. Er weiß nicht wozu. Wie jeden Morgen liegt er wach da, fühlt sich aber eher gerädert als erholt. Die Sonne scheint grell und schickt einige aggressive Strahlen zwischen den nicht ganz zugezogenen Vorhängen hindurch in sein Zimmer, direkt bis an den Rand seines Bettes. Karl hasst den Morgen, diese ewig wiederkehrende Verpflichtung, etwas mit dem Tag anzufangen, sich seiner Existenz würdig zu erweisen, ein Tagwerk zu verrichten und zu beweisen, dass er nicht nur dahinvegetiert.
Carpe diem! Wie er diesen Spruch hasst, den Wahlspruch der Tatkräftigen und Erfolgreichen, der in ihm augenblicklich Magengeschwüre hervorruft und für den er nichts anderes übrighat als ätzenden Zynismus, als höhnische Verachtung für den unbeirrbaren und nicht zu kurierenden Glauben, dass die menschliche Existenz irgendeinen Sinn mache oder man ihr durch irgendeine Tätigkeit Sinn verleihen könne.
Carpe diem? Und dann in irgendeiner Fabrik stumpfsinnig einem Fließband dienen? Kleinen Prinzen und Prinzessinnen Mathe, Mitgefühl oder Kultur zu vermitteln? Wie Sisyphos Kriminalität in Gossen und Palästen bekämpfen? Oder wie er Bilder zu malen, die auf rasant sinkendes Interesse stoßen und ohnehin niemals mehr als eine ausgesucht begrenzte Fangemeinde hatten? Die das ganze Scheißige dieser Welt großflächig anprangern, ohne auf nennenswerte Resonanz zu stoßen und schon gar nicht ein einziges Jota bewirken?
Nein, nach all den Jahren ist ihm nichts geblieben als, wie er es selber gerne nennt, goethescher Lebensekel.
Einst glaubte er, ein Lebenswerk schaffen zu können, etwas, das bliebe und das es wert sei zu bleiben.
Aber im Gegensatz zu Goethe ist ihm allein der Ekel geblieben. Seine Erfolglosigkeit hat ihm deutlich gemacht, dass er nicht dazu in der Lage ist, und seine Lebenserfahrung hat ihn gelehrt, dass das auch gar nicht möglich ist, und dass alle, die auf Goethe oder andere verweisen, um ihn zu widerlegen, sich weigern, der Wahrheit ins Auge zu blicken.
Was war denn von Goethe geblieben? Wie viele Menschen lesen ihn? Wie viele verstehen ihn? Wie viele eifern ihm nach? Welchen Einfluss hat er denn gehabt auf das Weltgeschehen? Wäre heute irgendetwas anders, hätte er nicht gelebt? Hätte er den Prometheus, den Werther, den Faust nicht geschrieben?
Wie üblich liegt er schon eine Stunde wach und versucht, die verwaschenen Erinnerungen an seine Albträume zu verdrängen, die ihn immer wieder heimsuchen und oft noch Stunden des Wachseins bedrängen. Graue Visionen eines wie filzbespannten, sich endlos windenden Etwas, durch das er in atemberaubendem Tempo schießt, mal hierhin, mal dahin geschleudert; die faserige Hülle, die mit Widerhaken-bewerten Tentakeln an seinem Fleisch reißt, weich und biegsam und doch unerbittlich, und der Schlauch, der immer schmaler wird, der sich allmählich immer enger um ihn legt und ihn schließlich zu ersticken droht.
Allein das unterbewusste Ankämpfen gegen den Schlaf, das unbedingte Aufwachenwollen erlöst ihn von der nächtlichen Tortur.
Doch auch tagsüber können ihn plötzlich Traumfetzen überfallen, wie der Flashback eines Süchtigen oder ein enervierendes, nicht zu eliminierendes Pop-up beim Surfen. Wenn er unter der Dusche steht und die Augen schließt, weil ihm das Wasser über sein Gesicht läuft, kann ihn unvermittelt dieses beängstigende, klaustrophobische Gefühl umklammern, oder wenn er in seinen Kaffee starrt, an nichts Besonderes denkend, ist es blitzartig da. Eine ätherische Schwingung, ein sensorischer Impuls, den er nur schwer, wenn überhaupt, hätte beschreiben können, so bedrohlich wie unfassbar, unkontrollierbar, eindeutig imaginär und doch absolut real; ein filziges Kribbeln auf der Haut wie von Abermillionen Spinnenbeinen, als würde er von etwas berührt, das sanft daherkommt und im selben Moment grenzenlosen Ekel hervorruft. Dann schüttelt er sich mehrmals, unwillkürlich, konvulsiv, als könne er die Hülle abschütteln, aber wie ein Krake, eine Schlingpflanze, eine ihn langsam, aber umso sicherer verschlingende Frucht aus einem Gemälde von Hieronymus Bosch nimmt sie ihm den Atem.
Linderung verschaffen ihm dann nur seine imaginären Dialoge. Gespräche über Gott und die Welt und die großen und kleinen Probleme, Kalamitäten, Katastrophen, die Tragödien der Zeitläufte. Genau genommen sind es keine Dialoge, sondern endlose Monologe, in denen er die Argumente seiner Widersacher zerpflückt, unwiderlegbar, überzeugend und alle Diskutanten immer wieder verblüffend ob ihrer geist- und kenntnisreichen Ausführungen und ihrer eloquenten Diktion.
Natürlich gewinnt er jeden Disput, ist aber Realist genug, seine eigene Fantasie als solche zu erkennen. Zwar kann er jeden an die Wand reden, aber die wenigsten überzeugen. Borniertheit, Dogmatismus, schlichte Beschränktheit und generell mangelnde Einsichtsfähigkeit sind nun mal weitaus verbreiteter als intellektuelle Brillanz.
Und so liegt er auf dem Rücken und doziert an die Decke über die griechische Finanzkrise, über die wachsende Unfähigkeit des internationalen Bankensystems, seine inhärenten Widersprüche weg zu ideologisieren, und die endlose Schleife immer neuer Versuche, das Gesetz der fallenden Profitraten zu widerlegen; über das schlichte, mantraartig repetierte Gedankengut neoliberaler Ökonomen und ihre intellektuellen Kapriolen, mit denen sie die immer neuen und immer schneller platzenden Finanzblasen und das offenkundige Versagen ihrer Theorie zu kaschieren suchen; über die Zwänge, denen Broker rund um den Globus ausgesetzt sind, nicht von ihnen geschaffen, sondern ausgeliefert, fälschlicherweise zu Hauptschuldigen erkoren, in Wirklichkeit ebenso kleine Rädchen im kapitalistischen Getriebe wie alle anderen bis hin zum Burger-Flipper und zur Call-Center-Nervensäge, die genauso funktionieren und die große Maschine am Laufen halten und sich in Wirklichkeit einzig darüber ärgern, dass sie für weniger Geld malochen; über die grenzenlos begrenzte Weltsicht rechter Demagogen von Höcke über Söder bis Trump, deren einziges Fundament dumpfer Hass ist und tiefsitzende Ängste, und die bereit sind, jeden Obdach- und Arbeitslosen, jeden Gestrauchelten, jeden Flüchtling, jeden Toten für ihre freiheits- und demokratiefeindlichen Ziele zu instrumentalisieren; über Wissenschaftler und Professoren, die in ihren Elfenbeintürmen vor ihren bornierten akademischen Spiegeln sitzen und nicht mal ihren eigenen Teller vom einen bis zum anderen Rand überblicken; über die Beschränktheit linker Schwätzer, die zwar alles ökonomisch-analytische Handwerkszeug zur Verfügung hätten, aber unfähig sind, über die Limitierung ihres ökonomischen Ansatzes hinauszublicken und die Schwächlichkeit ihrer Weltsicht durch die offenkundig notwendigen Erweiterungen kulturell-psychologischer Narrative zu ergänzen und erst so zu wirklicher Einsicht und adäquaten Lösungen zu gelangen. Ideologisch bornierte Geisteszwerge, einer wie der andere.
Nein, es gibt keinen Grund aufzustehen und diesem universellen Elend ins Auge zu blicken. Außer dem, einfach weiterzumachen, wenn schon nicht erfolgreich, dann wenigstens hartnäckig, mit dem festen Glauben an die eigene, tiefere Erkenntnis, in der Hoffnung, wenigstens das eine oder andere offene Ohr zu finden, dem einen oder anderen wachen Geist Nahrung zu sein, kein gefeierter Philosoph, sondern fleischgewordenes Menetekel.
Karl betrachtet sich als apokalyptischen Fußgänger. Seine Reden sind keine Posaunen, die Mauern der Ignoranz bleiben so fest gefügt wie immer, der Mörtel der Dummheit und Arroganz hält die potemkinschen Ziegel zusammen. Aber wenigstens will er nicht stumm bleiben, sondern der Welt seine Wut entgegenschreien, und, wenn es auch meist taube Ohren sind, so ist er lieber ein lächerlicher Rufer in geistiger Wüstenei, als sich mit einem Strick davonzustehlen, lieber Don Quijote als unbeachteter Märtyrer.
Dass ihm gerade der Geburtstag seines Sohnes einfällt, macht es auch nicht leichter. Er wird den ganzen Tag mit sich kämpfen, verlieren und an seiner Schwäche leiden und verzweifeln. Natürlich müsste er anrufen, will er anrufen, aber wahrscheinlich wird es so laufen wie in den letzten Jahren immer wieder: Er wird sich einfach nicht durchringen. Er hat ihm schon lange keine Geschenke mehr gemacht, weil er nicht wirklich weiß, womit er ihm eine Freude machen könnte. Nicht, dass Jonas keine Interessen hätte. Karl kennt sie einfach nicht. Zu lange sind sie sich schon entfremdet. Er scheitert jedes Jahr auf Neue schon daran, dass er nicht einmal weiß, wie er das Gespräch beginnen sollte. Genau genommen sind sie sich nie nahe gewesen, hatte stets Sprachlosigkeit geherrscht.
Karl verkriecht sich wieder unter seine Decke.
Julia Krause wacht wie immer viel zu früh auf nach so einer Nacht. Sie hatte endlos getanzt, zu viele Caipirinhas, zu wenig Wasser.
Wie üblich war sie zunächst wie ein Stein ins Bett und in einen komatösen Schlaf gefallen, der aber nur kurz währte. Sie wälzt sich hin und her, um kurzfristig durch wirre Traumbilder zu irren. Selbst wenn sie sich bemüht, fällt es ihr schwer, sich zu erinnern; zu verworren ist das, was durch ihr Gehirn spukt. Sie ist überzeugt, dass niemand so assoziativ träumt wie sie, so zusammenhanglos, ein Sammelsurium szenischer Darstellungen, von Stillleben, eine endlose Kette eingefrorener Momente, deren Verbindung allein ihr Unterbewusstsein zu entschlüsseln vermag.
Gefragt, was sie geträumt hat, kann sie nie eine Geschichte beziehungsweise Erinnerungsfetzen daran erwähnen, wie es ihre Freunde können. Ihr bleiben nur diese nebulösen Polaroid-Fotos.
Eines hat sie plötzlich wieder vor Augen, als sie im Badezimmer steht und darauf wartet, dass sich die beiden Kopfschmerztabletten auflösen. Allerdings ist es nicht schwer, sich daran zu erinnern. Es ist eines der wenigen, sich ständig wiederholenden Bilder, ein in dunklen Brauntönen und mysteriösem Licht gehaltenes Gemälde, auf dem sie in einem großen, weiten, strahlenden Bett liegt, mit Maja an ihrer Brust und düster dreinblickenden Putten, die im Zwielicht auf den fein ziselierten Bettpfosten sitzen, und einem ziegengehörnten Faun, der durch die halb zugezogenen Vorhänge blickt. Ein Bild, so düster, so strahlend, wie Caravaggio es gemalt hätte.
Erinnerungsfetzen fliegen vorbei, während sie sich einen starken Kaffee macht. Sie war auf einem Ehemaligentreffen gewesen – fünfzehn Jahre Abitur. Alte Geschichten aufwärmen, weißt du noch, wie …, und der Dingens, wie hieß er noch, ist natürlich nicht gekommen, der Langweiler.
Lisa hatte von ihrem Haus im Grünen geschwärmt und ihren zwei Kindern und wie toll es ist, zu Hause zu arbeiten und zu übersetzen.
Mo war bei H&M hängen geblieben und jammerte über ihren Stress als Filialleiterin.
Anika versauerte in einem Call-Center und einer jetzt schon langweiligen Ehe, und beide beneideten Julia um ihre Unabhängigkeit. Worin sie die zwei in ihrer bereits von ein paar Drinks befeuerten Euphorie nach Kräften bestärkte. Einem Single stehen alle Wege offen. Und alle Männer. Ihre prekäre finanzielle Lage hatte sie unerwähnt gelassen und stattdessen eine Runde Cocktails spendiert.
Irgendein halbgarer Typ hatte sich dann an sie rangewanzt. Was hatte sie zu ihm gesagt? Jedenfalls war er kurz davor, ihr eine zu scheuern. Was hatte sie eigentlich gesagt?
Ihr Kater verweigert eine Antwort.
Sie geht mit dem Becher Kaffee unter die Dusche. Heißes Wasser von außen, heißes Koffein von innen, das bringt sie wieder zurück ins Leben. Und am Schluss ein eiskalter Schock.
Weniger erfreulich ist, was ihr wiederangelaufener Kreislauf und die damit verbundene neue Gehirnaktivität hervorruft. »SCHEISSE!« Ein Blick aufs Handy. Zu spät. »SCHEISSE, SCHEISSE, SCHEISSE!« Somit ist sie wieder einen Job los. Das hatte ihr Markstein unmissverständlich klargemacht, als sie das letzte Mal zu spät gekommen war.
Julia setzt sich nackt, wie sie ist, auf die zweieinhalb Quadratmeter, die ihr Mietvertrag einen Balkon nennt. Jetzt braucht der Spanner von Gegenüber nicht mal ein Fernglas. Es ist ihr egal. Egal. Das Wort geistert durch ihren immer noch benommenen Kopf. Spanner, Chefs, schwanzstolze Männer. Egal. Das war’s.
Der Typ hatte irgendetwas Anzüglichangeberisches zu ihr gesagt.
»Hör zu, du Karikatur. Wer so daherfaselt wie du, der hat …« Was in der Hose? Was hatte sie nur gesagt? Alle hatten gelacht. Vor allem Lena mit ihrer Lache, die man noch drei Straßen weiter hören kann. Egal. Sie ist eben direkt.
Julia gießt sich noch einen Kaffee ein und macht den Fehler, sich in ihrer Küche umzusehen: tagealtes, mit Tomatensoße verkrustetes Geschirr, in der Spüle eine aufgetaute Packung Tiefkühlfisch – wollte sie gestern Nacht noch etwas essen? – überall verstreute Plastiktüten, leere Bierflaschen, eine Packung Milch unter dem Tisch, ein Stapel Wäsche auf dem Stuhl, vor ihr ein voller Aschenbecher.
Sie schüttelt sich und geht schnell wieder hinaus. Wo bekommt sie jetzt einen neuen Job her? Ihr Geld reicht sicher noch für die nächste Miete, vielleicht auch zwei. Wenn sie weniger ausgibt. Egal. Alles egal.
Sie kann Lena anrufen. Irgendwas, wo sie nebenher kellnern kann, weiß Lena immer. Vielleicht sollte sie auch einfach mal ihr Studium beenden. Oder es wieder mal mit einer Reportage versuchen.
Eine Zeit lang war es ganz gut gelaufen. Als sie zum ersten Mal Kontakt mit dem Radiosender hatte, war sie mit Begeisterung an ihre erste eigenständige Reportage herangegangen. Ihr Bericht über alte Künstlerinnen in ihrer Stadt, ihre Lebensgeschichten voller Mut und Kraft und Geschlechterkampf war ein voller Erfolg gewesen. Und sie war drangeblieben, hatte ihr Thema gefunden. Frauengeschichten. Außerdem verstand sie es hervorragend, Themen für das Radio zu gestalten.
Und dann die Arbeit im Tonstudio. Sie war ganz in ihrer Arbeit aufgegangen. Und Thomas hatte sie dort kennengelernt. Thomas, der so romantische Visionen für sie beide ersonnen hatte. Ersponnen. An die sie eine kurze Zeit fast selbst geglaubt hätte. Kurz. Egal.
Als die Sender dann anfingen zu sparen und es nicht mehr so einfach lief, hatte sie einfach aufgehört, Reportagen zu machen, hatte ihr ganzes Equipment eingemottet und wollte doch erst mal ihr Studium beenden. Den Vorsatz hat sie immer noch. Hin und wieder. Egal.
Abrupt steht sie auf. Bevor sich fatalistische Trägheit in ihr breitmachen kann, muss sie irgendwas unternehmen. Sie ruft Lena an, aber die geht nicht dran. Mit wem kann sie sich verabreden? Sie kennt die halbe Stadt. Zumindest auf Facebook.
Sie tigert auf und ab. Unschlüssig. Trinkt noch einen Kaffee. Der Kopfschmerz lässt nicht nach. Bronx. Klar!
Vielleicht sollte sie in seinem Bistro auch etwas frühstücken. Obwohl ihr Magen ihr immer noch signalisiert, dass er mit dem Alkohol nicht ganz fertig ist.
Sie zündet sich eine Zigarette an, wirft einen Stapel schmutziger Wäsche von ihrem Sofa und legt sich hin. Die Récamiere mit dem verrückten kunterbunten Blumenmuster, die ihr Lars geschenkt hat. Lars, der so unglaublich verliebt in sie war, sie mit Geschenken überhäufte, zu vielen Geschenken. Der sie zu ersticken drohte. Dem sie schließlich eine Trennungspostkarte schickte. Kurz, direkt und eindeutig.
»Lars, ich bin schwanger.«
Er blickte sie verdutzt an. »Was?« Dann, strahlend: »Na, großartig!«
»Wie bitte? Was ist daran großartig?«
»…«, aber immer noch strahlend.
»Siehst du.«
Plötzlich sah er ernst aus. »Willst du mich heiraten?«
»Was??? Bist du völlig verrückt geworden? Lars, ich werde dieses Kind nicht bekommen!«
Sie überlegt, ob sie nicht doch etwas essen sollte. Aber im Kühlschrank stehen nur ein Dutzend Joghurts. Von dem Gedanken an Caipirinha mit Erdbeerjoghurt wird ihr übel. Sie braucht frische Luft. Sie geht zum Fenster, öffnet es, aber die Luft ist lauwarm, gesättigt von den Abgasen der Autos, die unentwegt die dreispurige Ringstraße auf- und abfahren.
Der motorisierte Lärm weckt den Kater wieder auf. Jetzt treffen sich auf dem Mittelstreifen auch noch zwei Straßenbahnen, deren Geratter sie auch bei geschlossenen Doppelglasfenstern noch hören kann. Aus dem Döner und dem China-Take-away dringt ihr selbst am Morgen schon der Geruch von zu lang erhitztem Fett und verbranntem Tierkadaver entgegen. Ein Müllwagen ergänzt den Cocktail mit Quietschen und Rumpeln, Verfall und Verwesung.
Sie knallt das Fenster zu und sieht unschlüssig hinaus. Dreht sich um und macht den Fernseher an. Zappt durch die Programme. Frühstücksfernsehen für Gelangweilte. Comics für vernachlässigte Kinder. Doku-Soap-Wiederholungen für Debile. Nachrichten für Apokalyptiker.
Sie stellt den Ton ab, geht zu ihrem Computer und öffnet ihr Facebook-Account. Fünfundvierzig Nachrichten seit gestern Abend. Mehr nicht? Kneipenbilder, Pizzabilder, betrunkene Grimassen, halbverständliche, von Rechtschreibfehlern übersäte besoffene Texte.
Julia überlegt, noch eine Tablette zu nehmen. Ihr Kater ist ein Tiger. Ein Königstiger.
Punkt sechs. Der Wecker klingelt. Peter Müller stellt ihn ab, legt sich zurück.
6:05 Uhr: Der zweite Wecker klingelt. Peter wirft die Decke zurück, hälftig, schwingt die Beine aus dem Bett, die Füße schlüpfen in die rechtwinklig drapierten Pantoffeln. Er trinkt das bereitstehende Glas Wasser in einem Zug aus, steht auf.
6:08 Uhr: Die Blase entleert, steht er unter der Dusche, dann Morgentoilette.
6:22 Uhr: Die Zeitschaltuhr arbeitet pünktlich; eine Tasse Kaffee, nicht zu stark, eine Scheibe Toastbrot, Becel, Marmelade, ein Joghurt.
6:50 Uhr: den restlichen Kaffee in die Thermoskanne, Pausenbrot, Apfel, eine Flasche Mineralwasser, still.
6:57 Uhr: Schuhe, Jacke, Türe zweimal verriegeln.
7:14 Uhr: in der Straßenbahn. Neben ihm, auf der anderen Seite des Ganges, wie immer, der junge Mann mit dem Bürstenschnitt, diesmal gegen die Fahrtrichtung. Die Korpulente ihm gegenüber. An der Kirchstraße steigt die große, schlanke Brünette ein. Und eine Frau, die er noch nie gesehen hat. Eine zierliche, kleine Gestalt, nicht viel mehr als ein Meter sechzig, mit asiatischen Augen, dunklem Teint.
Pete
Pete fiel sie sofort auf, als sie einstieg. Eine Asiatin, wahrscheinlich aber eher Mischling. Ihr Gesicht war nicht so flach und ihre Augen nicht so schmal, wie er sie aus seiner Zeit in Vietnam und Kambodscha kannte. Sie war klein und wirkte zerbrechlich, aber das konnte ihn nicht täuschen. Sie bewegte sich flink und geschmeidig, und unter ihrer engen Jeans und der grünen Seidenbluse war sie mit Sicherheit durchtrainiert. Vielleicht eine Turnerin oder Tänzerin. Oder sie trat in irgendeinem Zirkus auf, als Schlangenfrau.
Sie setzte sich ihm schräg gegenüber, und so hatte er Zeit, sie zu beobachten. Sie hielt ihren Kopf schüchtern geneigt, aber er hatte den Eindruck, sie beobachte ständig ihre Umgebung. Wahrscheinlich hatte die Kleine Angst, angesprochen zu werden.
Was Pete dennoch in Erwägung zog. Er war ein guter Beschützer. Ein stilles Wasser, da war er sich sicher. Eigentlich war sie nicht seine Kragenweite. Aber neuerdings hatte er eine gewisse Schwäche für solche Frauen. Unprätentiös, unverwöhnt, vielleicht ein schlafender Vulkan. Von den sogenannten Klassefrauen, langbeinig, vollbusig, mit wehenden Haaren und stolzem Blick, hatte er erst einmal genug. War auch schon viel zu lange her, dass er mal gelandet war. Aber wenn …
Eigentlich kam er gut bei Frauen an. Leider dauerte es meist ziemlich lange, bis sie seine geballte Maskulinität erkannten.
Er wartete auf Augenkontakt, aber ihr Blick blieb nicht an ihm hängen. Er wirkte eher unscheinbar, unauffällig, und das musste er auch.
Nicht beachtet zu werden hatte eindeutige Nachteile, wenn es um Frauen ging, war aber ein unbezahlbarer Vorteil in seinem Metier. James Bond-Typen fielen jedem sofort auf. An James Bond-Typen erinnerte sich jeder. Schlecht fürs Geschäft.
Er überlegte, sie in die Alte Fähre einzuladen, einen Tisch am Panoramafenster zu reservieren mit Blick auf den Fluss. Obwohl er sich das eigentlich nicht leisten konnte. So gefährlich seine Fälle oft waren, so wenig sprang dabei heraus. Deswegen waren die Klassefrauen auch immer so schnell wieder weg.
Als der Platz neben ihr frei wurde, wollte er sich gerade zu ihr setzen, woraufhin sie aufstand und hastig die Bahn verließ. Er sah noch, wie sie sich umschaute, als wüsste sie nicht wohin.
Er verfluchte seine alte Rostlaube von Alpha, die er dringend aus der Werkstatt holen musste, und blieb sitzen.
Mit zwei Minuten Verspätung am Marktplatz. Deshalb etwas schnelleren Schrittes Richtung Mühlenstraße.
7:45 Uhr: Morgengruß an den Pförtner. »Wie geht’s?«
»Es läuft.«
»Und wie läuft’s?«
»Es geht.«
7:46 Uhr: im Aufzug in den vierten Stock. Aus dem Fenster auf die belebte Straße blickend, die zweite Tasse Kaffee.
Punkt 8: erste Akte öffnen.
Am Vortag hat er bereits die neuen Fälle sortiert, nach Schadensfallkategorien. 1. von Kindern verursachte Schäden, 2. von Erwachsenen verursachte Schäden, 3. von Tieren verursachte Schäden; A) Sachschäden, B) Personenschäden; Vermögensschäden fielen nicht in seinen Bereich; a) klare Fälle, b) dubiose Fälle, c) offensichtlicher Betrugsversuch.
Brillen. Es ist schon erstaunlich, wie häufig sich Leute auf Brillen setzen, um ihren Verwandten oder Freunden zu einem neuen Gestell zu verhelfen. Oder Lampen. Wieso fegen Kinder so häufig die Nachttischlampe von selbigem? Ist aber natürlich kaum nachzuweisen. Aber so einfach kommen die Leute bei ihm nicht durch. Erst mal nachfragen, den Vorgang genauer schildern. Wiedervorlage. In akkuraten Buchstaben, gleichmäßig gradliniger Schrift.
Die hat seine Deutschlehrerin immer gelobt. Der einzige Anlass, zu dem er öffentlich gelobt wurde. Allerdings auch selten getadelt.
Eigentlich wurde er nie erwähnt, wenn Klassenarbeiten zurückgegeben wurden. Er lag stets im Mittelfeld. In allen Fächern. Außer Sport. Da reichte es nur für eine Vier. Nicht weil er zu dick oder schwächlich gewesen wäre. Ihm fehlte nur jedweder Ehrgeiz, besonders schnell zu laufen oder möglichst weit zu springen. Hoch schon mal gar nicht.
Er beteiligte sich auch nie am Unterricht. Selbst nach einer der seltenen Aufforderungen durch einen der penetranteren oder nicht ständig monologisierenden Lehrer antwortete er leise und einsilbig. Und so fiel er eigentlich keinem auf.
Bei einem Wiedersehenstreffen seiner alten Klasse würde sich keiner an ihn erinnern. Vielleicht hat es das ja schon gegeben, und er war einfach nicht eingeladen worden. Wer? Peter Müller?
9 Uhr. Er gießt sich ein Glas Wasser ein, legt die Beine auf den Schreibtisch und sieht in die Ferne.
Pete
Pete Phillip saß an seinem Schreibtisch wie immer, den Stuhl zurückgelehnt, die Augen geschlossen, die Füße auf der Tischplatte. Akten musste er dafür nicht zur Seite schieben. Wie üblich hatte er wenige Fälle. Dabei hielt er sich nicht mal für schlecht. Es gab zwei oder drei Detektive in der Stadt, die ihm nicht das Wasser reichen konnten. Die Kippe, filterlos, wippte im Mundwinkel. Da betrat eine Blondine sein muffig-schummriges Kellerbüro. Ihr Schlafzimmerblick traf ihn mitten in die Lenden. Langsam, sehr langsam schwebte ihr wogender Busen auf ihn zu. Sie schwob sozusagen. Langsam, bis zu seinem Schreibtisch.
»Sie sind Pete? Pete Phillip?«, fragte eine rauchzarte Stimme, aus Lippen, die mehr als Liebesgeflüster versprachen.
Er riss seinen Blick aus ihrem großzügigen Dekolleté und versank in schillernd grünen Augen. Ein Raubtier. Pete revidierte augenblicklich seine Haltung zu Klassefrauen.
Er zündete die Zigarette an, ohne ihren Blick loszulassen. Rauchkringel erhoben sich. Er nickte.
»Ich brauche Ihre Hilfe«, hauchte sie.
Das heftige Klopfen dagegen war kaum zu überhören und eindeutig unerotisch. Pete war noch gar nicht richtig in die Wirklichkeit zurückgekehrt, hatte nicht einmal reagieren können, da stand der Klopfer auch schon im Zimmer und betrachtete zunächst ihn, dann das eher an die Abstellkammer eines drittklassigen Trödlers als an eine Detektei erinnernde Büro. Immerhin standen auch ein paar unbeschriftete Ordner herum. Das mittlerweile angewiderte Gesicht seines Besuchers wandte sich ihm zu, taxierte ihn abschätzig.
»Sind Sie Phillip?«
Pete suchte sein Feuerzeug. Vergeblich. »Höchstpersönlich. Was kann ich für Sie tun?«
»Sie suchen also Leute.«
»Unter anderem.«
»Und – finden Sie die auch?« Sein Ton war schneidig wie ein Fleischermesser von Zwilling.
Er war, was man einen Betonkopf nannte. Ein fast rechteckiger Schädel. Weiße, ins leicht gräuliche gehende Gesichtsfassade. Den spärlichen Haarkranz um seine glänzende Kopfhaut hätte er auch noch abrasieren können. Viel zu kleine Ohren. Ebenfalls kleine, kalte, fast brauenlose Augen, winterfarben. Kräftiges, leicht vorstehendes Kinn. Schraubstockgebiss.
Pete mochte keine Betonköpfe. Er mochte gar keinen Beton. Und der Typ sah aus wie jemand, der auch imstande wäre, ihm einen solchen Klotz ans Bein zu binden, von der Brücke zu werfen und elend ersaufen zu lassen. Wenn ihm danach wäre.
Pete hoffte, ihm bisher keinen Anlass dazu gegeben zu haben. »Und Sie suchen jemanden?«
Der Betonkopf schien zu einem Entschluss gekommen zu sein. Er setzte sich. Trotzdem war er immer noch zwei Köpfe größer als Pete.
»Meine Frau. Finden Sie sie! Was verlangen Sie?«
Wie es aussah, hatte Pete nicht einmal die Möglichkeit den Auftrag abzulehnen.
»Und warum ich? Warum gehen Sie nicht zur Polizei?«
»Das braucht Sie nicht zu interessieren. Sie ist abgehauen. Warum, geht Sie ebenfalls nichts an. Finden Sie sie einfach!«
»Nun, es könnte aber bei meinen Ermittlungen durchaus hilfreich sein«, sagte er vorsichtig, »wenn ich ein wenig mehr wüsste.«
Die spärlichen Augenbrauen trafen sich im spitzen Winkel. Offensichtlich mochte er keinen Widerspruch. Je länger er ihn betrachtete, desto mehr kam Pete zu der Überzeugung, der Betonkopf gleiche eher einer Abrissbirne. Wer sich mit ihm anlegte, konnte nur Schaden erleiden.
»Genügt es Ihnen, dass sie schon mal Probleme mit der Polizei hatte?«
Eigentlich nicht. Also verlegte sich Pete auf eine andere Taktik.
»Und was soll geschehen, wenn ich sie gefunden habe?«
Wieder sah die Antwort finster aus. »Sind Sie schwer von Begriff? Zurückbringen, was sonst?«
Den Rest erledige ich, fügte Pete in Gedanken hinzu. Es entstand eine beidseitig nachdenkliche Pause.
»Sagen Sie mir einfach, was Sie kosten!«
»Finde ich Ihre Frau in der Stadt oder muss ich dazu nach Australien?« Das schien Pete annähernd weit genug weg von der Abrissbirne.
»Reden Sie keinen Scheiß! Ich zahle Ihnen mehr als das Übliche, wenn Sie keine weiteren Fragen stellen.«
Allmählich wurde Pete neugierig. Außerdem konnte er einen neuen Fall wirklich gut gebrauchen, und der hier schien interessanter zu sein, als stundenlang läufige Ehefrauen oder Gatten mit Samenstau zu beobachten.
»Dann zweihundert am Tag plus Spesen. Aber ich brauche schon einen Anhaltspunkt. Irgendwo muss ich schließlich anfangen.«
»Sie stammt aus Thailand.«
Mein Gott, was für ein haarsträubender Unsinn! Mirko. Wieso er? Hab ihn seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen, geschweige denn an ihn gedacht. Und der würde doch nicht freiwillig in ein Flugzeug steigen. Das Gespräch gestern über unsere Schulfreunde, deshalb wahrscheinlich. Bestimmt seit zehn, fünfzehn Jahren nicht, mindestens. Ob ich ihn über Stay Friends finden würde? Was haben wir geknutscht! Zum ersten Mal eine Woche von zu Hause weg und die ganze Clique dabei, außer Petra, aus der Parallelklasse. Aber wieso schlaf ich ausgerechnet mit dem? Gut, wir sind mal zusammen »gegangen« – erste zaghafte Erkundungen, vorsichtig tastende Hände, mein Gott. Und Robert sitzt nebenan und hört zu. So ein Quatsch, Freud hätte sich totgelacht. Robert völlig ungerührt in seinem schnieken Morgenmantel, wie immer makellos gepflegt. Damit könnte man, ohne schief angesehen zu werden, morgens Brötchen holen.
Hannah Kuhn dreht sich auf die andere Seite und sinnt den noch nicht ganz flüchtigen Traumbildern nach. Sie braucht immer ein paar Momente, bis ihr wirklich klar ist, was Traum, was Wirklichkeit ist, dass sie im eigenen Bett liegt und nicht in einem anderen, an einem Strand, auf einer Party oder an ganz unsinnigen Orten. Sie staunt wie immer und amüsiert sich über ihre eigene schlaftrunkene Fantasie. Manches ist geradezu lachhaft und hätte gut in eine Komödie gepasst, von Woody Allen etwa, oder ist so comichaft wie aus den Pixar-Studios, so abgedreht wie ein Film von Monty Python.
Manches wirkt auch leicht bedrohlich, verunsichernd, ohne aber jemals in Schreckensbilder abzudriften. Hirngespinste voller surrealer Szenerien, anachronistischer Begegnungen, bizarrer Zufälle und allen Naturgesetzen hohnlachender Ereignisse.
Wie immer hat auch dieser Traum etwas mit Reisen zu tun. Ständig ist sie irgendwie und irgendwo unterwegs, in bekannten Städten und unbekannten Landstrichen, zu Fuß oder mit dem Flugzeug, mal steht sie auf der Brücke eines Ozeanriesen, mal lenkt sie einen Schwertransporter, mal streift sie alleine durch die Atacama-Wüste, dann wieder stürzt sie sich mit einer völlig unbekannten Reisegruppe ins Pariser Nachtleben.
Zunächst scheint alles normal zu sein, ganz banale, alltägliche Situationen; dann aber verändert sich permanent alles.
Sie will irgendwohin, sie kennt den Weg, fährt mit der U-Bahn, doch als sie die Treppen hochsteigt und ins Freie tritt, sieht sie nicht einen großen, weiten Platz vor sich, den sie hätte überqueren müssen, sondern eine schmale, enge Gasse zwischen endlos hohen Wolkenkratzern. Als sie sich umdreht, ist die U-Bahn plötzlich verschwunden, und die Straße hat sich in einen silbernen Fluss verwandelt. Sie weiß, sie muss unbedingt hinüber. Passanten wie Scherenschnitte fragen sie, warum sie nicht einfach die Brücke nimmt, aber als sie die wie aus dem Nichts gläserne Gestalt annehmende Brücke hinaufeilt, werden ihre Schritte immer langsamer und mühseliger, weil die Rampe steiler und steiler wird und sich schließlich unüberwindlich vor ihr auftürmt.
Jemand ruft sie. Ein Männergesicht taucht auf, ein breiter Schädel mit schmalem Kinn und seltsam tief liegenden Augen. Er sieht auf seine Uhr, die wie von Dalí gemalt von seinem Handgelenk tropft. Sie will zu diesem Mann, ihn fragen, wie viel Zeit sie noch hat, aber plötzlich kommt eine Menschenmenge auf sie zu, drängt sie zurück, wogt schließlich über sie hinweg. Sie liegt auf dem Boden, aber niemand tritt auf sie, niemand verletzt sie, sie spürt keine Angst, die Menge scheint zu fliegen, zu schweben, zu fließen, sie versucht vergeblich, sich zu erheben, aus der Flut der Leiber aufzutauchen. Ein harter Cut, wie im Film, und sie sitzt im Flugzeug mit Mirko.
Mirko, Petra, Wilfried, Lisa, Franziska, was wohl aus ihnen geworden ist in der Zwischenzeit? Ob sie glücklich sind – oder wenigsten zufrieden? Lisa ist bestimmt längst eine erfolgreiche Architektin. Die wusste immer genau, was sie wollte, und hat es auch durchgesetzt. Wie tough sie war, in der Mensa. Futtert ihre Nudeln und erzählt mir im Plauderton, dass sie sich von ihrem Freund getrennt hat, weil der auf Familie besteht, und zwar nicht erst in ein paar Jahren, weil er Kinder will und eine Frau, die sich um sie kümmert. Lisa in ihrer verwaschenen blauen Latzhose. Dieser Spießer, hatte sie gelacht, dabei war sie doch so verliebt gewesen – vorher.
Sie blickt zur Seite. Robert schläft noch tief, atmet und schnarcht gleichmäßig. Sein kindliches Schnorcheln, das sie einmal so liebenswert fand, ist einem leisen, aber regelmäßigen Sägen gewichen.
Vorsichtig schlüpft sie aus dem Bett, zur Schlafzimmertür hinaus und die Treppe hinunter. In der Küche wartet sie, den Kopf an die stahlkühle Tür ihres Gefrierschranks gelehnt, auf heißes Wasser. Ihre Küche ist ein durchgestyltes, hippes Arrangement aus Stahlträgern, gefärbtem Glas und Plastikfurnieren. Sie hätte lieber Holz gehabt, das sich lebendig anfühlt, Wärme ausstrahlt, das sie gerne berührt.
»Das ist altmodisch«, hatte Robert beschieden. »Und bieder.«
So war es bei fast allem. Robert hatte einen Innenarchitekten engagiert, natürlich den angesagtesten. Sie hatten nicht wirklich darüber diskutiert.
Hannah, noch ganz im siebten Himmel, sah alles mit Roberts Augen, und der war begeistert von dem vielen Glas und Stahl.
Heute hat sie sich damit eher abgefunden als daran gewöhnt.
Mit einer großen Keramiktasse voll Tee, die sie damals in der Provence gekauft hatten, geht sie auf die Terrasse hinaus und blickt, noch immer schlaftrunken, über ihren endlosen Garten hinweg in den allmählich sich aufhellenden Himmel. Sie geht langsam den sich windenden Pfad entlang, vorbei an den Hügeln voller Steingewächse, den Hyazinthenbeeten, den Fliederbüschen, den kunstvoll geschnittenen Buchsbäumen, dem Teich voller Rohrkolben und Lotusstauden. Die meisten Pflanzen haben bereits ihr Sommerkleid abgelegt.
Sie schließt die Augen und saugt die Luft ein, findet aber nicht den besänftigenden, gelassenen Duft. Hannah streicht mit dem Finger über den winzigen Sprung ihrer Teetasse.
Hier werden wir glücklich sein, Hannah. Ist es nicht wunderschön. Genau wie du es dir gewünscht hast. Austoben könnte ich mich hier, hast du gesagt, einen Garten anlegen nach meinen Vorstellungen. Nach meinen Vorstellungen, klar. Du selbst hast für »Grünzeug« wenig übrig; Kulisse, nichts weiter, aber präsentiert hast du den Garten immer, als wärest du höchstpersönlich der Landschaftsgärtner.
Im Garten austoben – und sonst? Mein Gott, ist das lange her, dass ich etwas geschrieben habe; meine Notizen verstauben so langsam. Wahrscheinlich hat schon längst jemand anders eine Dissertation darüber geschrieben. – Ich muss den Gärtner anrufen – und ein paar Rosen schneiden für die Deko heute Abend. Obwohl, das soll Kathrin machen. Ist ohnehin nicht mein Empfang. Reine Staffage. »Frauen sind der Spiegel, der es den Männern ermöglicht, sich selbst in doppelter Größe zu sehen«.
Hannah lacht still in sich hinein und fragt sich, warum sie Woolfs Bücher so lange nicht in der Hand hatte, so lange nicht mehr gelesen hat. Zwanzig Jahre? Dreißig? Viel zu lange.
Sie war mal eine sehr gute Schülerin und noch bessere Studentin. Und für Professor Westheim war sie mehr als nur eine studentische Hilfskraft. Sie teilten die Begeisterung für Virginia Woolf, vor allem für Mrs. Dalloway und The Lighthouse. Als Hannah die ersten Gedanken äußerte zu einer Dissertation, hatte Professor Westheim sie sofort unterstützt. Sie war eine Feministin der ersten Stunde.
»Die rosa Laibchen habe ich schon im Kinderwagen gehasst«, sagte sie gerne scherzhaft. Hannah liebte Woolfs Schreibstil, wollte ihn näher analysieren.
»Ich möchte beweisen, dass der Bewusstseinsstrom eine spezifisch weibliche Art ist zu schreiben, dieser innerliche Stil, der Emotionen viel Raum lässt, intuitiv, nicht rationalanalytisch.«
»Vergessen Sie nicht, dass es nicht Frauen waren, die ihn erfunden und verwendet haben, weder damals noch heute. Und ich rede nicht nur von Joyce.«
»Ich weiß, aber welche Frau konnte damals als Schriftstellerin reüssieren? Und Joyce war ohnehin latent homosexuell. Außerdem verwenden die meisten männlichen Autoren den Bewusstseinsstrom nicht konsequent. Und könnte man nicht sagen, dass sie damit ein wenig ihre weiblichen Anteile offenbaren? Ich glaube, Woolf hat recht, wenn sie sagt, nur eine androgyne Seele könne ein literarisches Genie sein, so wie Shakespeare oder Joyce.«
»Nun, so sehr ich Virginia Woolf schätze, aber da bin ich persönlich ganz anderer Meinung, oder wollen Sie beweisen, dass auch Goethe und Hemingway androgyne Charaktere waren? Hören Sie, Frau Kämper, ich fand ihre Magisterarbeit wirklich lesenswert und sehr originell, und ich würde mich freuen, ihre Doktormutter zu sein, aber Sie wählen da einen sehr gefährlichen Ansatz. Sie könnten allzu leicht selbst in Geschlechterklischees verfallen.«
All diese Klischees. Ja, Klischees, aber nicht ohne wahren Kern. Man muss sich nur genau umsehen, genau zuhören. Als wäre es so einfach. Nicht alles ist gelernt. Robert ist nicht mal von einem Mann erzogen worden, jedenfalls nicht, nachdem er drei war. Rational bis auf die Knochen.
Sie hört ihren Wecker klingeln und erschrickt. Sie ist früher aufgestanden und hat vergessen, ihn auszustellen. Roberts Wecker wird erst in zwanzig Minuten klingeln, wenn sie geduscht und angekleidet in der Küche steht und sein Frühstück bereitet. Er mag es nicht, sie morgens ungekämmt und im Bademantel zu sehen, wenn sie ihm mit nackten Füßen den Kaffee eingießt. Ihre Füße hat er nie gemocht. Robert steht eher auf Negligés und Schlafzimmerblicke. Stand – was sie betrifft.
Sie verlässt die Terrasse, um den Kaffee aufzusetzen.
Paul Winter erwacht langsam aus einem traumlosen Schlaf. Auf der Seite liegend, schaut er blinzelnd über das frische Grün der Wiesen, Tautropfen sitzen wie funkelnde Elfen auf den Grasspitzen, der Waldrand wird gesäumt von feinem Morgendunst, die Schwäne dümpeln träge auf dem noch im Halbdunkel liegenden See. Paul liebt diese Stimmung, die melancholisch erwartungsvolle Stille des Stadtwalds.
Noch stört ihn niemand.
Vorsichtig richtet er sich in seinem verschlissenen Schlafsack auf und lehnt sich an einen Baumstamm. Es dauert eine Weile, bis sich der rheumatische Schmerz in allen Gelenken löst. Er nimmt einen langen Zug aus der Wasserflasche, gegen den Nachdurst. Er schließt die Augen und lauscht in die Stille. Er vermisst die Vogeluhr, die um diese Jahreszeit weitgehend verstummt ist, den zarten, variantenreichen Singsang der Rotkehlchen, der allmählich von den Strophen der zahlreicheren Amseln und Drosseln übertönt wird, bis die Zaunkönige und Kohlmeisen wach werden, und zum Schluss die Imitatoren der Lüfte, die Stare.
Auch kann er sie gut beobachten von seiner versteckten Warte aus, am Rande eines Weißdorngebüschs. Seit er im Stadtwald lebt, hat er ein besonderes Verhältnis zu Vögeln entwickelt, den einzigen Lebewesen, die ihn in seiner Existenz einfach akzeptieren, sich hin und wieder ein paar Brotkrumen von ihm holen und mit ihrem Gesang daran erinnern, dass es auch schöne Dinge auf der Welt gibt.
Manchmal liegt er einfach da, mit geschlossenen Augen, und lauscht, entrückt von allem, von seiner Vergangenheit, der Gegenwart und der so unsicheren wie gewissen Zukunft. Aber wie alles im Leben ist auch das nicht von Dauer, denn zum einen ist, was sich so fröhlich anhört, in Wirklichkeit Überlebenskampf, das ewig neue Streiten um ein Revier, um einen Platz im Universum, den auch er einmal hatte, und zum anderen währt es nur eine relativ begrenzte Zeit, und dann wird es stiller im Park, dann bleibt nur noch das zänkische Schnattern der Enten und gelegentliche Fauchen der Schwäne.
Stattdessen summt er selbst – die Szene am Bach aus der Pastorale. Sie erleichtert ihm, die ersten Momente des Tages zu ertragen, hilft, die Verkrampfungen der Nacht zu lösen.
Es dauert eine Weile, bis das Leben in seine Knochen und Muskeln zurückkehrt. Seine Glieder schmerzen, als er zuerst kniet und sich dann ächzend am Baumstamm abstützend erhebt. Es wird immer mühseliger. Er braucht eine halbe Stunde, um Müdigkeit und Schwäche abzuschütteln wie ein aus dem Winter erwachender Bär, der nicht weiß, ob er den nächsten Schlaf überlebt.
Das dumpfe Hämmern in seinem Kopf lässt nach, nicht aber der undefinierbare Schmerz in seinem Inneren, an den er sich eigentlich gewöhnt hat, den er einfach als naturgegeben hinnehmen will wie eine zu lange Nase oder abstehende Ohren, der einfach immer da ist, in letzter Zeit aber heftiger wird, drängender, aufdringlicher.
Er geht ein paar Meter das Gebüsch entlang, um sich zu entleeren, schleicht dann zum See, wäscht sich und putzt sich die Zähne. Paul ist immer noch darauf bedacht, nicht völlig zu verrotten. Er legt immer noch Wert auf sein Äußeres, so paradox das jenen erscheinen mag, deren bürgerliches Leben nicht in Ruinen liegt, die seine abgerissene Erscheinung und seine verschlissene Kleidung mit Verwahrlosung gleichsetzen. Aber sie ist sauber, so wie er, soweit das möglich ist.
Das erbettelte Geld gibt er auch für den Waschsalon aus und für die Dusche in der Sporthochschule. Man kennt ihn dort. Jeder weiß, dass er nicht zum Badminton oder Squash kommt, da genügt ein Blick, aber sie weisen ihn auch nicht mehr ab wie zu Beginn, als er jedem erklären musste, dass auch ein Obdachloser den Wunsch nach warmem Wasser und Seife verspürt.
Paul bindet die Plastikplane von den Zweigen, faltet sie zusammen und versteckt sie unter Büschen und Laub. Dann schützt er seinen Schlafplatz mit ein paar Ästen und Zweigen vor neugierigen Blicken und geht den Hügel hinauf zur einer Parkbank mit Blick über den See, die Kastanienallee, die Wiesen mit ihren Eichen, Linden und Ahornbäumen, vor langer Zeit einmal gepflanzt als Kulisse für hochherrschaftliche Spaziergänge. Heute darf auch jemand wie er sich an ihrem Anblick erfreuen.
Hier verbringt er die erste Stunde des Tages. Er betrachtet alles lange und intensiv. Da sind die Kastanien auf ihren kräftigen, gefurchten Stämmen, mit dem ausladenden Astwerk und seinem üppigen Laub; Blatt an Blatt wie zahllose Hände, die sich übereinanderlegen.
Eine Zeit lang hat er sich drei Kastanien in den Schlafsack gelegt, aber der Zauber hat nicht gewirkt. Er hat doch immer wieder Erkältungen bekommen.
Da sind die nicht minder imposanten Eichen, der heilige Lebensbaum aus mächtigem Holz, die dagegen fast durchsichtigen Linden, der Ahorn auf seinem eigentlich zu schmalen Stamm, und doch wehrhaft gegen böse Geister und Hexen. Ein mythisches Potpourri.
Das Ende des Sommers deutet sich an. Das Grün der Blätter ist nicht mehr so intensiv, Erste rollen sich bereits ein wenig ein an den Rändern, und bald schon wird der Herbst die Palette hervorholen, sodass sich Paul nicht sattsehen kann an Rot und Gelb und Gold.
Der See füllt sich mit Enten, stattlichen Kanadagänsen und kieksenden Blesshühnern. Aber nichts verschönt ihm den Morgen so sehr wie der Anblick der Schwäne, die im Morgennebel mit gefiederten Segeln über dem See schweben. Zwei erheben sich wassertretend und flügelschlagend in die Luft und landen direkt wieder am anderen Ufer.
Paul schüttelt den Kopf und lacht. »Jaja, euch hat man auch die Flügel gestutzt. Ihr kommt hier auch nicht weg.« Er trinkt etwas Wasser, öffnet sein Taschenmesser und entkernt einen schon etwas weichen Apfel, dessen Saft das harte Brot kaubar macht. Immerhin, das geht nach wie vor ganz gut. Er hat erst sechs Zähne verloren.
»So, Herr Winter, das war’s schon. Alles bestens«, sagte Dr. Hausner. »Frau Gieser wird Ihnen noch die Zähne polieren.« Er besprach sich kurz mit seiner Sprechstundenhilfe. »Und, wo geht’s hin in den Urlaub?«
»Wir fahren nach Holland, nach Efteling. Wegen Melanie. Als wir mal übers Wochenende hingefahren sind, war Melanie so was von begeistert. Die wollte gar nicht mehr weg.«
»Efteling, das kenn’ ich. Wir waren auch schon mal da, als unsere Söhne noch kleiner waren. Ich bin zwar nicht so für Freizeitparks zu haben, aber da die Jungs den ganzen Tag unterwegs waren, hatten wir endlich auch einmal Zeit für uns.«
»Ja, darauf freuen wir uns auch schon. Und ich freue mich darauf, endlich mal Zeit für meine Tochter zu haben. Ich seh’ sie ja praktisch gar nicht aufwachsen. Letztes Jahr hab’ ich gar keinen Urlaub gehabt.«
Dr. Hausner sah Paul einen Moment lang an. »Ich bin zwar nicht Ihr Hausarzt, aber Sie sollten wirklich mehr auf sich achten. Dass Sie nachts dauernd mit den Zähnen knirschen, kommt nicht von ungefähr!«
»Ich weiß, ich weiß. Das sagt meine Frau auch immer. Aber das sagt sich so einfach. Das wissen Sie doch auch, schließlich sind Sie ja auch selbständig. Und zu Ihnen kommen die Patienten von alleine. Ich muss mich ständig um neue Aufträge bemühen. Aber natürlich haben Sie recht.
Melanie sagte letztens, es hat mich fast umgehauen: ›Papa, sagt denen doch einfach, sie sollen hierhin kommen, dann können wir zusammen auf den Spielplatz gehen. Dann kannst du reden und reden, und ich kann spielen.‹«
Dr. Hausner lacht. »Ja, die Kleinen. Wie einfach die Welt doch sein kann.«
»Tja. Das wünsche ich mir auch manchmal.«