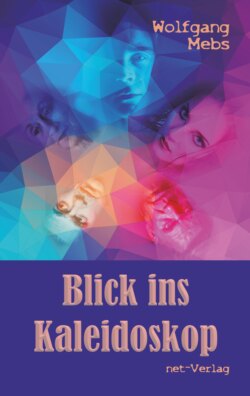Читать книгу Blick ins Kaleidoskop - Wolfgang Mebs - Страница 7
Kapitel 2
ОглавлениеZu seiner eigenen Überraschung verspürt Karl ungewöhnlichen Frühstückshunger, aber wie üblich ist der Kühlschrank leer. Er schlurft Richtung Kochnische, um sich einen Kaffee zu brauen, und das muss man wörtlich nehmen. Er verabscheut Filter und jedwede Art von Apparatur, Pads sind ihm ein Gräuel, auch wenn er zugeben muss, dass der Kapitalismus zum einen mal wieder seinen grenzenlosen Einfallsreichtum unter Beweis gestellt und zum anderen erneut bewiesen hat, dass der mündige Konsument ein Hirngespinst ist, dem man nur etwas schön verpackt und mit viel neumodischem Schnickschnack präsentieren muss, und schon ist er bereit, das Fünffache zu zahlen.
Karl schüttet Bohnen in die Mühle, und während er kurbelt und dem Knacken und Knirschen des Mahlwerks zuhört, führt er diesen Konsumidioten vor Augen, dass sie Wucherpreise für Kaffeeportiönchen bezahlen, aber gleichzeitig einer debilen Geiz-ist-geil-Mentalität frönen und sich über die sündhaften Preise in Bioläden echauffieren. Schwachsinn, dein Name ist Mensch.
»Schmeiß doch mal diese dämliche Kaffeemühle weg und kauf dir eine vernünftige elektrische oder gleich Pulverkaffee!«
»Mein lieber Vater«, erwiderte Karl, »erstens ist dies ein Meisterwerk einfachsten und ästhetisch dennoch ansprechenden Designs auf der einen und höchster mechanischer Funktionalität auf der anderen Seite. Zweitens ist Pulverkaffee zweitklassig und deshalb nichts für meinen Gaumen. Drittens hat, wie du dich sicher erinnerst, Oma diese Mühle schon zu schätzen gewusst und verkörpert daher den kleinen erinnerungs- und erhaltenswerten Teil unserer Familiengeschichte.«
»Mach doch, was du willst, aber red’ nicht so geschwollen mit mir!«
»Ist doch schön, überhaupt mal wieder miteinander zu reden.«
Karl wird nicht zum ersten Mal, aber unverändert schmerzhaft bewusst, wie sehr sich seine Familiengeschichte wiederholt.
Es gab Zeiten, da fand er solche Theorien lächerlich, da glaubte er noch an Wandel zum Guten, zum Besseren; an Lernen, Erfahrung und Veränderung. Aber warum war es Karl dann mit Jonas so ergangen wie seinem Vater mit ihm? Auch er konnte mit seinem Sohn nichts anfangen.
Karls Vater hatte nach eigenem Bekunden alles richtig gemacht und ein erfolgreiches Leben hinter sich. Nach dem Krieg begann er als kleiner Sachbearbeiter in einer Versicherung, immerhin hatte er 1938 eine kaufmännische Lehre begonnen. Er hatte sich »hochgearbeitet« und es »in den Außendienst geschafft«. Seine Erfolge waren abzulesen an immer größeren Autos, einer geräumigeren Wohnung und »Muttis Traum«, einer mit allen damaligen Schikanen ausgestatteten Einbauküche, und natürlich dem alljährlichen Urlaub an der Adria. Protzte er vor anderen mit PS und Hubraum und sie mit Spülmaschine und Abzugshaube, so war das Autopacken ihr gemeinsames Vergnügen, wenn sie sich mehrfach bestätigten, dass die Müllers gelb vor Neid hinter der Gardine standen und ihnen zusahen.
Während anfangs Karl der Gardine die Zunge rausstreckte, waren ihm später seine Eltern nur noch peinlich, weshalb er sie sich einfach wegdachte.
Auto, Wohnung, Urlaub – und er durfte aufs Gymnasium. Das war im Grunde auch alles, was er von seinem Vater wahrgenommen hatte. Ansonsten war er ständig unterwegs oder abgespannt, hatte entweder keine Gelegenheit, gerade jetzt nicht die Zeit oder schlicht keine Lust, sich mit Karl zu beschäftigen.
Zu einem Freund hatte Karl einmal gesagt, wenn er eine Biografie schriebe, würde er seinen Vater nicht erwähnen. Nicht, weil er ihn nicht mochte oder ihm seine fehlende Zuwendung und Zuneigung vorwerfe. Nein. Er spielte einfach keine Rolle. Allenfalls als Abschreckung. Wieder und wieder versuchte er Karl in langen Monologen – dies waren die einzigen Gelegenheiten, zu denen sein Vater längere Äußerungen an ihn richtete – davon zu überzeugen, ebenfalls in die Versicherungsbranche einzusteigen; wenn es weiterhin in der Schule so schlecht liefe, könnte er immer noch eine Lehre machen, sich hocharbeiten und so weiter.
Bei einem dieser »Gespräche«, Karl hätte nicht mehr sagen können, wann genau, nahm sein Leben eine entscheidende Wende. Er wusste, was er auf keinen Fall werden wollte.
Ob Jonas das auch über ihn sagt? Er will es sich nicht vorstellen, aber kann es anders sein? Ständig leidet er unter der Distanz, wünscht sich, je länger die Sprachlosigkeit zwischen ihnen herrscht, es möge anders sein. Mal rechtfertigt er sich, mal wirft er Jonas vor, uneinsichtig und halsstarrig zu sein, mal kasteit er sich selbst ob seiner eigenen emotionalen Unzulänglichkeiten.
Nie hat er ein Vater werden wollen wie sein eigener, und genau genommen hat er sich einen Sohn gewünscht, nur um zu beweisen, dass es anders sein kann, verständnisvoller, liebevoller. Als Marga schwanger war, sah er bereits die strahlenden Augen seines Sohnes, wenn er mit ihm spielte und tobte und ihm die Welt erklärte. Aber als es dann so weit war, stellte er fest, dass er mit einem ständig schreienden und scheißenden Bündel nichts anfangen konnte, im Gegenteil. Er vertröstete sich auf später, wenn Jonas würde laufen und reden und lesen und verstehen können, dann würde alles anders werden.
Aber als Jonas dann laufen und reden und lesen und verstehen konnte, stellte Karl fest, dass ihm seine Staffelei wichtiger war, als gegen einen Plastikball zu treten, dass er sich auf Vernissagen wohler fühlte als bei dem Versuch, Jonas’ ständiges Geplapper zu ertragen und seine völlig abwegigen Fragen zu beantworten, dass ihm seine künstlerische Krise noch mehr zu schaffen machte als der komplett sinnlose Versuch, einem renitenten Pubertierenden, der aus lauter Trotz zum Popper wurde und die künstlerischen und politischen Ansichten seines Vaters lächerlich, naiv und überholt fand, Paroli zu bieten.
Und jetzt kann er sich nicht einmal ein Bild von Jonas machen, weil er ihn seit viereinhalb Jahren nicht mehr gesehen hat.
Karl schnüffelt am Pulver, schüttet es in einen kleinen Topf, der mittlerweile die Farbe verkochten Kaffees angenommen hat, fügt drei Tassen Wasser und drei Löffel Zucker hinzu, lässt alles aufkochen und sucht vergeblich eine saubere Tasse.
Er findet zumindest eine ohne Bodensatz, gießt ein und setzt sich in den einzigen Sessel, eingerahmt von Bücherstapeln.
Seine zwei Zimmer möbliert zu nennen wäre ein für Karl unüblicher Euphemismus. Ein Herd, bei dem nur noch zwei Platten funktionieren, ein brummender Kühlschrank, dessen Abwärmegitter alle paar Minuten heftig rappelt, ein Bett mit durchhängender Matratze, ein klappriger Tisch mit ebensolchen Stühlen – zwei an der Zahl – ein Barhocker mit aufgeplatztem Sitzpolster und ein riesiger Ohrensessel, den er in einer kurzen besseren Zeit bei einem Antiquitätenhändler erstanden hatte. Und Regale an allen Wänden, bis unter die Decke, vollgestopft mit Büchern.
Weitere Bücher stapeln sich davor, neben dem Bett, um den Sessel herum, auf den Fensterbrettern – die chaotischste Bücherei des Universums, in der er aber zur Verwunderung seiner mittlerweile nur noch seltenen Besucher jederzeit genau das Buch findet, das er sucht.
Karl liest alles, einfach alles, was ihm in die Hände fällt. Und so ist auch sein Weltbild. Allumfassend. Es ist das Ergebnis seiner zahllosen Studien, auch wenn er eigentlich in Philosophie immatrikuliert war und dort auch sein Examen versuchte. Dummerweise war er wie bei den meisten auf Ablehnung und Unverständnis gestoßen, da das, was er als einen innovativen, ja genialen universellen Ansatz betrachtete, von seinen Dozenten und Professoren als unausgegorenes Sammelsurium mehr oder weniger skurriler Ideen, halbverdauter Erkenntnisfetzen und gedanklicher Salti mortali bezeichnet – und bewertet wurde.
»Das Problem ist doch«, sagte Karl, »dass alles auf einem ziemlich oberflächlichen Niveau bleibt. Die meisten Menschen und eigentlich auch die meisten Philosophen streben ein klares, ein eindeutiges Weltbild an, ein System, das die Welt kategorisiert. Sie wollen verzweifelt an einer Illusion festhalten. All diese Versuche, die Welt in Schubladen zu pressen, sie eindeutig und überschaubar zu machen, um sich letztlich in Sicherheit wiegen zu können, müssen scheitern. Ich sage dir auch warum. Weil es keine Theorie gibt, die die Vielgestaltigkeit der Welt auf einen Nenner bringen kann, die alle Phänomene innerhalb eines statischen Gedankengebäudes hinreichend erklären kann.«
»Na ja«, wendete Frank ein. »Man kann aber auch schlecht an alles gleichzeitig glauben.«
»Wieso nicht? Im Gegenteil! Ich behaupte, dass man als ernsthafter Philosoph nur Eklektizist sein kann. Ich lehne jeden totalitären Anspruch ab, erst recht den von Welterklärungstheorien. Ein rationaler Mensch muss grundsätzlich alles infrage stellen und alles für möglich halten. Deshalb bin ich katholischer Zen-Buddhist, sunnitischer Indianer, ein konservativer Anarcho, ein radikaler Spießer, existenzialistischer Hegelianer, metaphysischer Empiriker, hoffnungstrunkener Apokalyptiker und ein völlig durchschnittliches Genie, im Sinne Goethes und Schillers wohlbemerkt.
Und darauf läuft mein Ansatz hinaus: Alles ist wahr und wieder nicht wahr, aber nicht als Gegenteil von wahr, sondern als symbiotische Ergänzung. Deshalb meine Hauptthese: Der einzige Sinn der Existenz liegt im Losgelöstsein von Sinn, das heißt in der Erkenntnis, dass alles sinnlos ist, weil nichts genuin Sinn macht. Was aber nicht zu existentialistischer Verzweiflung oder zu Verantwortungslosigkeit führt. Im Gegenteil, diese Erkenntnis heißt, stets in jedem einzelnen Moment, bei jeder einzelnen Handlung die volle persönliche Verantwortung übernehmen zu müssen, eine Verantwortung, die wir zuallererst vor uns selbst haben. Wir müssen unser eigener Ankläger, Verteidiger und Richter sein. Und gerade deshalb befreit uns diese Erkenntnis von allen irdischen Zwängen und gibt uns den Raum, alle unsere Handlungen mit dem zu füllen, was ich den ›ad hoc-Sinn‹ nenne. Hier und jetzt, hinc et nunc.«
»Könnte ziemlich anstrengend werden.«
»Was hätten wir sonst vom Leben zu erwarten?«
Was für ein Morgen. Jetzt beginnt auch noch sein Magen zu knurren. Er überlegt, wie er an ein Frühstück kommen kann. Viele Möglichkeiten gibt es da nicht. Das »Coffee-Shock«, aber nur, wenn Alina da ist, die, warum auch immer, einen Narren an ihm gefressen hat und ihm nicht nur extragroße Portionen serviert, sondern hin und wieder auf die Rechnung verzichtet, oder in Bronx’ Diner, bei dem verrückten Ami, der einmal eines seiner Bilder in Zahlung genommen hat, statt immer wieder anzuschreiben.
Und natürlich Frank, einer der wenigen Menschen, nein, wenn er ehrlich ist, mittlerweile der Einzige, der ihn nicht nur mit stoischer Ruhe erträgt, sondern sich sogar mit ihm auseinandersetzt, mit dem er endlos diskutieren kann, der genau so belesen ist und eine noch umfangreichere Bibliothek besitzt, und der darüber hinaus nach wie vor großzügige Joints dreht – und aus demselben Grunde stets über einen gutgefüllten Kühlschrank verfügt.
Doch dafür ist es noch zu früh. Frank steht selten vor zwölf auf. Frank ist Nachtmensch.
Und der einzige Kritiker, den Karl erträgt.
Karl hatte ihm den Verriss seiner Ausstellung in der Lokalzeitung vorgelesen.
»Na ja, Karl, das eine oder andere kann ich ja mittlerweile durchaus nachvollziehen. Zum Beispiel Frösche. Aber wieso Frösche? Kannst du nicht einfachere Symbole wählen?«
Karl sah ihn erbost an.
»Halt, warte, warte! Einfach nicht im Sinne von simpel, sondern einfacher zu verstehen. Ohne dich persönlich jahrelang zu kennen.«
»Haha, sehr feinsinnig … Joyce hat über Finnegan’s Wake gesagt: Ich habe ein Leben lang gebraucht, diesen Roman zu schreiben, und ich erwarte von meinen Lesern, dass sie sich ein Leben lang mit diesem Werk beschäftigen, um es zu verstehen. Welch ein mutiges Statement!
Aber so weit will ich ja gar nicht gehen. Ich bin weder so mutig noch so vermessen. Aber, verdammt noch mal, wem denken zu anstrengend ist, der soll RTL gucken.«
»Gut, akzeptiert, aber, meine Güte, Karl, was glaubst du denn, wie viele Leute die mystische Bedeutung von Fröschen kennen oder gar deine persönliche Interpretation derselben?«
»Joyce hat eben nicht für den Pöbel geschrieben, und ich male nicht für ihn.«
»Hältst du mich auch für Pöbel, weil ich nichts wusste über Frösche als mythische Verkörperung der persönlichen Wandlungsfähigkeit? Dass Frösche sexuell zweideutig sind oder was der Frosch bei den Ägyptern bedeutete? Und vor allem, dass du sie als letzten Hoffnungsschimmer der Menschheit betrachtest? Nur weil man Symbole verwendet, die Allgemeingut geworden sind, ist man doch nicht oberflächlich und banal.«
»Aber mit diesen Symbolen kannst du doch nicht Neues sagen, Frank. Du kannst dich nur wiederholen, du bist gefangen in der Bezugswelt dieser Metaphern. Du erzeugst keinen neuen Gedanken, keine neuen Zusammenhänge, nur endlose Wiederholungen. Klar, dann gucken die Leute hin, sehen, was sie kennen, glauben zu verstehen und Schluss, oder? Reflexion? Fehlanzeige.«
Frank deutete auf ein Bild, das er Karl zuliebe noch nicht abgehangen hatte.
»Weißt du, Karl, mit deinen Bildern habe ich dasselbe Problem wie mit deiner ganzen Philosophie. Ich weiß immer noch nicht, an was du wirklich glaubst. Gibt es irgendeinen Philosophen, irgendeinen Denker, irgendeine Theorie, der du mal zustimmen würdest? Du sagst zwar immer: Seht euch meine Werke an, und ihr seht, was ich denke, aber du packst in deine Theorie genauso wie in deine Bilder ständig alles, aber auch wirklich alles rein, und es tut mir leid, es geht mir so oft genau wie meinen Besuchern, die ratlos vor diesem Bild stehen, die mit den dahingekritzelten, zerstückelten Kantzitaten nichts anfangen können. Dass die Schnitzereien der Maori durchaus was mit unserer westlichen Erkenntnistheorie zu tun haben, kann ich mir ja vielleicht noch intuitiv denken, aber was genau? Keine Ahnung, bin eben kein Experte für indigene Kunst, und was das Ganze mit dem brennenden World Trade Center zu tun hat, weiß ich auch nicht so recht.«
»Meine Bilder sind eben komplex.«
Bleibt eigentlich nur Walter, ein früherer Nachbar und Hobbymusiker, mit dem er zahllose Konzerte besucht und Nächte durchgemacht hatte, der zwar mittlerweile völlig verspießert ist, ihm aber aus alter Verbundenheit die Treue hält. Zwar betrachtet er Karl, wie ihm durchaus bewusst ist, als eine Art moralisches Fossil, nimmt ihn auch nicht mehr sonderlich ernst, wirft ihm aber nicht ständig seine Lebensweise vor, sondern hilft ihm gelegentlich aus finanziellen Notlagen.
Die anderen haben ihn längst abgeschrieben, besser gesagt, er hat alles dafür getan, dass sie ihm aus dem Weg gehen und seine Gesellschaft als eher unangenehm empfinden. Smalltalk ist mit Karl unmöglich, weil er jedwede Bemerkung, so banal und alltäglich sie sein mag, zu einem weltbewegenden Beispiel für was auch immer macht. Eine harmlose Bemerkung über die herrlich wärmende Frühlingssonne regt ihn an zu Reflexionen über Klimaerwärmung und Hautkrebs, ein dahingesagtes Kompliment über den Kaffee löst ernsthafte Ermahnungen aus, sich Gedanken zu machen über ausbeuterische Strukturen des Welthandels und auch fair trade einer kritischen Analyse zu unterziehen. Und die Erwähnung des Papstbesuches führt ohne weitere Umschweife zu einem für die meisten wenig erbaulichen Vortrag über Kierkegaards transzendente Existenz und die Kreuzigung des Verstandes.
Er ist nun mal ein messerscharfer Analytiker und in einem Ausmaß gebildet, das zu seinem größten Bedauern selten seinesgleichen findet. Zudem, wenn er etwas seziert, bleibt von dem, was andere als schön, beglückend, erstrebenswert empfinden, nicht mehr übrig als geschredderte Träume, als in hässliche Einzelteile zerlegte Luftschlösser. Und, wenn er richtig in Form ist, ein Schlachtfeld dahingemetzelter Illusionen.
Für einen Grantler halten sie ihn, dabei geht es ihm doch nur um eine bessere Version des Homo sapiens, um eine sozialere, friedlichere Welt, und so betrachtet er sich als im Grunde seines Herzens ausgemachten Menschenfreund. Es dauert jedoch eine geraume Zeit, bis es den Leuten auffällt. Die meisten halten nicht so lange durch.
Julia liegt unschlüssig auf dem Sofa herum. Einfach so herumhängen, macht sie ohnehin schon nervös, und dann sind da noch immer die Nachwirkungen. Ihr Gehirn arbeitet in Zeitlupe. Im Sparmodus. Immer schön ein Gedanke nach dem anderen. Sie stellt sich noch einmal unter die Dusche, schließt die Augen und lässt heißes Wasser minutenlang an sich herunterlaufen.
Es fühlt sich gut an. Sehr gut. Sie streichelt ihre Haut, ihre Brüste, ihren Schritt. Seit drei Wochen läuft ihr kein passender Mann über den Weg. Zu lange für ihren Geschmack. Sie hätte gern einen, jetzt, hier, unter der Dusche.
Julia mag Sex. Wenn ihr danach ist, und das ist oft der Fall. Und sie liebt alle Spielarten. Sie hat nichts gegen Blümchensex, aber mit dem Richtigen darf es auch wild und heftig zugehen.
Sie weiß, was sie will und was nicht. Ihr Problem ist eher, dass sie danach die Lust an den Typen verliert und allein sein will; dass ihr das übliche post-koitale Gesülze auf die Nerven geht.
Julia stand auf und ging ins Bad. An der Tür drehte sie sich um. Er lag erschöpft auf dem noch erhitzten Laken. Sie betrachtete ihn und lächelte.
»Du hast einen schönen Schwanz.« Dann schloss sie die Tür.
Unnötig, sein Hochgefühl zu beschreiben – ebenso wenig den umso heftigeren Absturz, als sie kurz danach immer noch orgasmisch schön wieder erschien und ihm kurz und knapp beschied, er könne jetzt gehen.
Er war sprachlos. Als sie ihm seine Hose zuwarf und wortlos in der Küche verschwand, hatte er wohl verstanden und verließ ihre Wohnung.
So ist es ihr am liebsten. Leider glauben die meisten Männer, nur, weil sie es geschafft haben, eine Frau zum Orgasmus zu bringen, müsse sie ihnen nun verliebt zu Füßen liegen. Manche sind selbst dann noch von ihrer Unwiderstehlichkeit und Einmaligkeit überzeugt, wenn das Ganze ein verkrampfter Flop oder ein kurzes Abrubbeln, ein freudloser Kaninchenfick war.
Am erbärmlichsten findet sie die ihrer Erfahrung nach viel zu zahlreiche Spezies Männchen, die permanent aufgebaut und gelobt werden muss, aber sie hat einfach keine Lust auf diesen verbalen Oralsex, dieses Schwanzpinseln. Sie will Sex, möglichst guten, und wenn es mal wirklich etwas Besonderes ist, dann sagt sie es auch und fertig.
Aber dann liegen sie da und warten, während ihnen die Frage der Fragen auf der Zunge oder, besser gesagt, auf der Eichel brennt, und wenn sie dann allerdings auch noch direkt fragen, wie sie waren – wie dämlich kann Mann eigentlich sein? –, bekommen sie eine so klare Antwort, dass sie freiwillig auf ein zweites Mal freiweillig verzichten.
»Übrigens, ich habe nachts das Bett gerne alleine.«
»Was?«, fragte er überrascht, aber mit dem Versuch eines Lausbubengrinsens. »Soll das heißen, dass du mich aufs Sofa verbannst?«
»Nein, du hast schon verstanden. Du schläfst gar nicht hier.«
»Was?« – nun leicht verunsichert – »nach diesem herrlichen Abend willst du mich wirklich in meine viel zu weit von dir entfernte Wohnung, in mein kaltes, einsames Bett … «
»Du wirst die Laken schon warm kriegen.«
»Och. Und ich dachte, wir sollten das Ganze noch mal wiederholen, findest du nicht?«
»Wozu?«
Julias Beziehungen sind von kurzer Dauer. Länger als zwei Jahre hält sie es nie aus.
Früher fragte sie sich manchmal, ob der Vorwurf ihrer Freundinnen berechtigt ist, sie sei beziehungsunfähig und laufe vor der Verantwortung für einen anderen Menschen davon. Genauso wie vor Kindern. Aber das ist es nicht. Sie verliert einfach das Interesse. »The thrill is gone«, wie Luther Alison singt. Sie verliert buchstäblich die Lust. Irgendwann kehrt die unvermeidliche Routine ein, man kennt sich zu gut. So abwechslungsreich kann kein Sex mit demselben Menschen sein, dass er ihre Sehnsüchte stillen könnte. Und am erregendsten sind für sie immer noch die ersten Male, wenn man sich nicht kennt, sondern erkundet, ihre Körper noch unbekanntes Terrain sind und jede Berührung eine neue Erfahrung ist. Wenn noch nichts selbstverständlich ist.
Und was die Verantwortung betrifft, so soll sich jeder zunächst einmal um sich selbst kümmern, da hat er Verantwortung genug. Mit sich selbst ins Reine kommen ist für Julia schon schwer genug, ohne auch noch das Leben eines anderen Menschen zu schultern, und eines Mannes schon mal gar nicht. Sie ist bereit zu geben, viel zu geben. Wenn Freunde oder Freundinnen Hilfe brauchen, wenn es sich eben machen lässt, solange sie das selbst entscheiden kann, aber Ansprüche zu erheben auf Zuwendung, auf Kümmern, auf seelische Unterstützung, Hausarbeit, Geld, Karriere, allein weil man eine Weile einen Teil des Lebens miteinander verbringt, hält sie für die perfideste Form des Egoismus’. Und wer von seinem Partner ewige Treue verlangt, macht ihn zu seinem Eigentum. Vor allem Sätze wie »Ich brauche dich« oder »Ich kann nicht ohne dich leben« sind bei ihr absolut tödlich.
»Tut mir leid, Christian, das wirst du aber müssen.«
»Was? Aber … Wie meinst du das?«
»Ja, wie wohl? Genau so, wie ich es sage. Ich bin nicht deine Hebamme, nicht deine Mama, nicht deine Krankenschwester und schon gar nicht deine Altenpflegerin.«
»Aber das habe ich doch nicht gemeint, Julia. Ich meine, … ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals wieder so empfinden werde. So eine Beziehung, so wie wir, das ist so einmalig, so …«
»Jede Beziehung ist einmalig. Das ist überhaupt nichts Besonderes.«
»Und wir passen so gut zusammen, wir …«
»Eine Zeit lang, okay. Bis gerade eben.«
»Bitte, Julia, das kannst du doch nicht ernst meinen. Du bist einfach die Frau meiner Träume.«
»Dann bist du gerade aufgewacht.«
Julia springt auf. Sie muss raus, wenn der Tag beginnen soll, und in ihrem Zustand heißt das, als Erstes Bronx aufzusuchen, um endlich Magen und Hirn funktionstüchtig zu machen.
Sie greift sich ein paar zufällig herumliegende Kleidungsstücke, wuselt vor dem Spiegel durch ihr kurzgeschnittenes Haar und schleicht die Treppe hinunter und den Bürgersteig entlang.
Die drei Häuserblocks kommen ihr endlos vor.
Bronx’ Diner ist meist ihre erste Anlaufstation nach einer Nacht mit zu viel Alkohol. Bronx ist Amerikaner. Am Anfang wollte sie ihm nicht glauben, dass er wirklich so heißt, hielt es für eine Masche, um sich interessant zu machen. Angeblich haben ihn seine Eltern so genannt, weil er in einem Park in der Bronx gezeugt wurde. Er war vor zwanzig Jahren kreuz und quer durch Europa gereist und hatte so ziemlich überall als Koch gearbeitet, bis er sich hier in der Stadt unsterblich verliebte, wie auch in die Stadt selbst. Als sich seine himmlische Liebe dann doch als höchst irdisch erwies und ihn verließ, hatte er eine Zeit lang bei Julia Trost gefunden. Jetzt sind sie gute Freunde, und er ist ihre Rettung, wenn der Kater einfach keine Ruhe gibt.
Bronx sieht sie hereinkommen und lächelt. Die Ringe unter ihren Augen und ihr leicht gebeugter Gang, die Schultern zusammengezogen, die Hände tief in ihren Jeanstaschen, sagen alles. Er stellt ihr einen Teller mit selbst eingelegtem Hering hin, nach einem Rezept, das er aus Schweden mitgebracht hat, und ein Stück Baguette. Dann mixt er seinen »Tom-is-dead«, eine Mischung aus Rinderbrühe, Tomaten- und Selleriesaft, Tabasco, einem kleinen Schuss Wodka und zerstoßenem Eis.
Julia geht es sofort besser. Sie lächelt ihn an. Gerade mal ein Meter siebzig, mit einem dreieckigen Oberkörper: breite, muskulöse Schultern und Wespentaille. Er erinnert sie an eine Comicfigur aus der Sammlung ihres Vaters, an Wastl. Sie hat ihm mal ein Bild gezeigt, das er nicht gerade schmeichelhaft fand, aber sie lachten sich beide weg, nachdem sie ihm zwischen die Schenkel gegriffen und gesagt hatte: »Hauptsache hier bist du nicht dreieckig.«
Bronx betrachtet sie grinsend. »Cooles Outfit.«
Julia sieht an sich herunter und fragt sich, warum sie diese blauen Pumps trägt – zu der hautengen, aber leider viel zu grünen Jeans, die sie in einem Überschwang an Farbenfreude gekauft und zu entsorgen vergessen hat, und dazu ein dunkelgraues, reichlich verwaschenes T-Shirt der University of California, das ihr um die Hüften schlottert.
Sie sieht Bronx an, schüttelt leicht den Kopf und hebt entschuldigend die Hände. Mehr fällt ihr dazu nicht ein.
»Und jetzt? Wie wäre es mit einer Tasse Tee?«, fragt er. »Assam oder Darjeeling?«
»Egal.«
»Nicht egal, Honey. Willst du auf die harte Tour wach werden oder auf die elegante?«
»Gib’s mir«, sagt ihr Kater.
»Lieber noch einen Tom.«
Bronx zieht die Augenbrauen hoch. »War es so schlimm?«
»Schlimmer.«
10:00 Uhr. Frühstückspause. Peter schiebt die Papiere zusammen und stapelt akkurat seine Akten.
10:03 Uhr. Peter zögert. Er geht nur ungern in die Kaffeeküche, denn er steht nur dabei und hört zu. Er hätte auch nur selten etwas beizutragen. Er kennt die Serien nicht, die Computerspiele, hat an den Wochenenden nichts Nennenswertes unternommen, und die Namen von Fußballspielern kennt er schon gar nicht. Die Gespräche in der Kaffeeküche laufen ohne ihn ab. Selbst wenn er sich mal zu Wort meldet, werden seine kurzen, knappen Sätze in aller Regel ignoriert. Seine Kollegen reagieren auf seine Versuche, sich bemerkbar zu machen wie Wasserbüffel auf einen Mückenstich.
Wenn sich Gesprächskreise bilden, dauert es nicht lange, und er wird wie eine amorphe Masse nach außen gedrängt. Ob in der Kantine oder beim Büroausflug, immer findet sich für ihn nur ein Platz am Rand. Und wenn er sich in der Kantine zu jemandem setzt, hat er den Eindruck, die Leute essen sofort schneller.
Heute aber lässt es sich nicht vermeiden. Herr Mottke hat Geburtstag, da muss man gratulieren. Peter bleibt noch einen Moment sitzen.
10:05 Uhr. Er erhebt sich widerwillig. Schon auf dem Gang hört er Gelächter. Vor allem Frau Hönnig, die sich trotz ihrer vierzig Jahre immer noch anhört wie ein Schulmädchen. Heftiges Gekicher hinter vorgehaltener Hand. Und natürlich der Reuter, der sie alle übertönt. Laut und brüllend, fast aggressiv, raumgreifend, beherrschend, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt. Vor allem, wenn er selbst einen Witz macht, und das geschieht eigentlich am laufenden Band. Hält sich für einen begnadeten Komiker. Reuter bevorzugt sexuelle Witze und nutzt jede Gelegenheit für irgendwelche Anzüglichkeiten. Hält sich auch für einen Frauenhelden.
10:07 Uhr. Als er eintritt, beginnen sie gerade, Happy Birthday zu singen. Dann stoßen sie an. Sekt natürlich, obwohl es so früh ist. Dann Händeschütteln. Auch Peter gratuliert.
Plötzlich drückt ihm jemand ein Glas in die Hand und lächelt ihn an. Die neue Kollegin. Wie heißt sie doch gleich? Er bedankt sich und überlegt krampfhaft, was er sagen könnte. Aber da schieben sich schon andere dazwischen.
Ausgerechnet Kegeln. Natürlich fanden es alle eine gute Idee, den Betriebsausflug auf einer Kegelbahn zu beenden. Als sie über eine halbe Stunde zu spät ankamen, um 19:40 Uhr, war das Buffet schon aufgetragen worden. Alle stürzten sich sofort, als wären sie ausgehungert, auf die belegten Brote, Kartoffelsalat, Frikadellen und Mettwürstchen und spülten das Ganze mit ein paar Pils aus dem bereitgestellten Fass hinunter.
Eigentlich wollte er Mineralwasser, aber irgendjemand hatte ihm eine Tulpe in die Hand gedrückt, und da er das Bier hätte ablehnen und nach vorne zur Theke gehen müssen und er ohnehin halb verdurstet war, trank er es ziemlich schnell aus. Und dann noch ein zweites.
Er wartete, bis der erste Ansturm aufs Buffet vorbei war, und wollte sich gerade das letzte Mettwürstchen nehmen, da griff Reuter an ihm vorbei, schnappte es sich und biss, Peter angrinsend, hinein.
»Tja, mein Junge, schnell muss man sein«, lachte er laut auf und nötigte Peter, in seinen offenen, mit Mettwurst gefüllten Rachen zu schauen.
Im Laufe des Abends aß er nur wenig und trank zu viel. Ständig stand ein Glas Bier vor ihm. Irgendwann hörte er auf, es abzulehnen, was seine ohnehin schwächlichen Kegelkünste nicht gerade beflügelte. Der eine oder andere Kegel fiel.
Um kurz nach neun war er angetrunken genug, um mutig zu werden. Er stand neben Frau Derksen, die schon länger ihren Weg in seine Träume gefunden hatte, und die aufgrund ihrer Vorliebe für Mixgetränke schon nicht mehr ganz sicher auf ihren High Heels war. Dafür, dass sie ständig zur Seite knickte und gegen seine Schulter stieß, fand er jedoch eine andere Erklärung. Seiner ohnehin nicht besonders ausgeprägten Willenskraft und seines klaren Verstandes beraubt, fragte er sie plötzlich mitten in die Runde hinein, ob sie nicht Lust hätte, mit ihm mal einen Kaffee trinken zu gehen. Nach dem Büro.
Sie sah in zunächst völlig verblüfft an. Dann prustete sie los. »Nach’m Büro, ja? – Nee, Peter, wirklich, nee. Wir zwei? Und worüber willst du mit mir reden? Über deine Schäden, äh deine Schadensfälle, mein’ ich?«
Die ganze Runde stimmte in ihr schallendes Gelächter ein.
»Und hinterher«, grölte Reuter, »und hinterher, hahaha, und hinterher zeigt er dir seinen Hobbykeller. Da zeigt er dir dann, wo sein Hammer hängt.«
Frau Derksen wäre vor Lachen fast von den Stöckeln gekippt.
Reuter ist natürlich ganz in seinem Element, laut und großspurig und ständig neben der neuen Kollegin. Unvermeidlicherweise fängt er an, Witze zu erzählen. »Übrigens, gestern wollte ich auf eine Ü-30-Party. Aber der Türsteher hat mich nicht reingelassen. Und wisst ihr, warum nicht? Meiner war zwei Zentimeter zu kurz.«
Wie üblich vermag Peter nicht, in das allgemeine Gelächter einzustimmen.
»Mein Gott, Müller, seien Sie doch nicht so prüde! Oder haben Sie das etwa nicht verstanden? Ist Ihnen glatt zuzutrauen.« Reuter legt den Kopf in den Nacken und lacht hämisch, nicht minder laut, und alle lachen mit. Natürlich.
Außer der neuen Kollegin, die unsicher lächelnd in die Runde und dann fragend zu Peter hinüberblickt.
Pete
Pete klapperte erst einmal seine üblichen Informanten ab, Leute, die ihm noch was schuldig waren. Meist war es umgekehrt. Diesmal konnte er sogar bezahlen. Wie sehr ein paar Scheine doch die Zunge lockern. Vor allem von Kotzbrocken wie dem Schnauzer. Normalerweise mied er ihn wie der Dealer den Cop. Natürlich musste er erst noch ein paar seiner dämlichen Witze loswerden.
»Hör zu, gestern war ich auf einer Ü-30 Party, und der Türsteher, der hat mich einfach nicht reingelassen. Nu rate mal wieso?« Kunstpause. »Meiner war zwei Zentimeter zu kurz.«
Pete sah ihn ungerührt an. »Du weißt ja, die meisten Männer glauben, dass ihr Penis zu kurz ist. Du dagegen glaubst, dass etwas mit dem Lineal nicht stimmt.«
Informationen konnte Pete jetzt natürlich vergessen.
Ob er prüde ist, könnte Peter selbst gar nicht beantworten. Der so scheinbar selbstverständliche Ton, über Sex zu reden, erscheint ihm jedenfalls eher aufgesetzt, auch wenn er die anderen deshalb gleichzeitig beneidet, denn er geht davon aus, dass sie alle ein normales Leben führen, in dem Sex eine ganz normale Rolle spielt.
Aber Reuter nimmt er das nicht ab. Er erinnert ihn eher an einen etwas unterentwickelten Pavian, der an die begehrten Weibchen nicht herankommt, sich dafür aber umso oberaffiger aufführt.
Auch die neue Kollegin, Steffi, wie er Reuters Säuseln entnimmt, scheint sich unwohl zu fühlen. Nein, prüde kommt er sich eigentlich nicht vor. Schüchtern, ja. Weil er in dieser Hinsicht schlicht völlig unerfahren ist. Oder fast unerfahren. Aber für einen Siebenunddreißigjährigen würde Petting wohl kaum unter einschlägige Erfahrung fallen. Und wenn er daran denkt, wie das abgelaufen war! Er denkt nicht gerne daran.
10:20 Uhr. Peter hat das Gefühl, seiner Anstandspflicht genüge getan zu haben und verlässt die Küche – nicht, dass es jemand bedauert hätte – um sich in die Stille seines Büros zurückzuziehen.
Er ist seit drei Wochen allein. Kollege Hoffmann hatte einen Autounfall. Manchmal genießt Peter sein Eremitentum.
Auch seine Mutter hätte heute Geburtstag. Neunundfünfzig wäre sie jetzt. Peter denkt mit Wehmut an sie, aber nicht mit Trauer. Er bedauert ihren plötzlichen Tod, aber er vermisst sie nicht. Seinen Vater schon eher.
Die Erinnerungen an seine Mutter sind reduzierbar auf zwei Wörter: Erstens Migräne. Migräne stand ihr ins Gesicht geschrieben. Es war die Verkörperung von Migräne. Migräne beim Frühstück, Migräne, wenn er von der Schule kam, und vor allem Migräne, wenn sein Vater von der Arbeit kam.
Migräne im Alltag, Migräne im Urlaub, und wenn sie Besuch hatten, dann erzählte sie von nichts anderem und war hinterher ungenießbar.
Das zweite Wort war: Grab. Diese Migräne brachte sie ins Grab, ihr Mann brachte sie ins Grab, die viele Hausarbeit brachte sie ins Grab, und alles, worum sich sein Vater ja nie kümmerte. Und vor allem Peter brachte sie ins Grab, wenn er irgendwie »ungezogen« war, oder aus sonst einem nur für sie greifbaren Grund.
»Ja, ich weiß, ich bin euch lästig, alles wäre einfacher ohne eure Mutter, dann bräuchtet ihr endlich keine Rücksicht mehr zu nehmen, ich weiß. Deine …« – wahlweise – »Frechheiten, Vergesslichkeit, Gleichgültigkeit, Trägheit bringt mich noch ins Grab.«
Als Kind hatte er sich immer gefragt, wie das ginge, wie sie ihre Mutter dahin bringen konnten. Er hatte Gräber gesehen, auf dem Friedhof, erst, als sein Großvater, dann ein Onkel und irgendeine Cousine gestorben waren. An – wie er von in solchen Momenten gedämpften Stimmen vernahm – Herzversagen, Schnapsleber und einem Unfall – »schrecklich, schrecklich muss sie ausgesehen haben, der ganze Kopf, der Brustkorb, alles zerquetscht, schrecklich, ich wage es gar nicht, mir das vorzustellen, nein!«
Peter hingegen stellte sich die Ereignisse sehr wohl vor, und zwar auf äußerst plastische Weise. Aber wie kam jemand in dieses muffig riechende Erdloch, einfach weil man sich weigerte, Selleriesalat zu essen?
Als er Jahre später im Internet über Migräne las, wurde ihm klar, dass seine Mutter wohl wirklich unter unsäglichen Schmerzen gelitten haben musste, und seine Schuldgefühle drückten ihn mit noch größerer Last als früher, als er mit den Tränen ringend ihr gegenübersaß und damit fertig werden musste, dass er sie mit einer Drei in der letzten Klassenarbeit dem Grab wieder ein Stück nähergebracht hatte.
Peter versucht, sich an eine fröhliche Mutter zu erinnern, aber ihm will nichts einfallen. Nichts konnte sie versöhnlich stimmen. Zollte ihm sein Vater Lob für einen Aufsatz oder, weil er sein Zimmer so ordentlich aufgeräumt hatte, so machte ihre Nörgelei – und sie fand immer etwas auszusetzen – all seinen Stolz wieder zunichte.
In seinen Tagträumen stellte er sie sich manchmal mit einer fetten Warze auf der Nase und einem zähnefletschenden Kater auf dem krummen Buckel vor.
Aber jedes Mal schämte er sich schon im selben Augenblick dafür.
Sein Vater hörte sich ihre Klagen meist wortlos an, und wenn er etwas sagte, dann flüsterte er Entschuldigungen. Nie widersprach er ihr, selbst, wenn ihre Vorwürfe offensichtlich aus der Luft gegriffen waren.
Überhaupt, seinen Vater hat Peter vor allem als Mensch mit gesenktem Kopf in Erinnerung. Nur einmal, ein einziges Mal war es anders.
Sein Vater war vor zwei Tagen ins Krankenhaus gebracht worden. Warum, hatte man Peter nie gesagt. Erst, als auch sie gestorben war, fand er Unterlagen, die in nüchtern medizinischem Stil sein Krebsleiden deklarierten.
Peter stand hilflos neben dem Krankenhausbett. Sein Vater sah noch unscheinbarer aus als sonst. Er war nur noch ein knochiger, grauer Schatten zwischen weiß gestärkten Laken, geistesabwesend, ephemer. Seine Mutter hingegen schien seltsam lebhaft und redete ununterbrochen.
»Ihr Mann braucht jetzt erst einmal Ruhe, viel Ruhe. Es war eine schwere Operation, und auch die nächsten Wochen werden nicht einfach.«
»Ach, wissen Sie. Einfach ist das für mich auch nicht. Ich könnte auch einmal Ruhe brauchen. Sie könnten mir auch gleich ein Bett geben. Sie glauben gar nicht, was für eine Migräne ich ständig habe, vor allem, wenn das Wetter wechselt, und das tut es ja ständig, dann …«
Nachdem sie minutenlang ihr Leiden dramatisiert hatte, schloss sie mit einem angedeuteten Kichern und frauenverschwörerisch vorgebeugt: »Aber das Bett geben Sie mir am besten in einem anderen Zimmer. Er schnarcht so schrecklich. Das bringt mich noch ins Grab.«
Ein paar Wochen später war er wieder zu Hause, lag aber meistens im Bett oder auf dem Sofa. Er sah aus wie eine chinesische Teetasse: durchscheinend und zerbrechlich.
Seiner Mutter war er ein ständiges Ärgernis, immer im Weg, natürlich, weil er eben so ein Schwächling war, wie alle Männer, wehe wenn sie mal ein Wehwehchen hatten, dann ging gleich die ganze Welt unter, und der Jammer war groß. Ihr Leiden übertraf das seines Vaters bei Weitem.
»Ja, ich bin euch lästig, alles wäre einfacher ohne eure Mutter, dann bräuchtet ihr endlich keine Rücksicht mehr zu nehmen.«
Dann schlug der Blitz in Mutters Leben.
»Stimmt, Sophia«, sagte sein Vater, leise, aber bestimmt. »Da hast du mal wieder vollkommen recht.«
Seine Mutter erstarrte. Genauso wie Peter. Er blickte von einem zum anderen. Eine Ewigkeit lang, so schien es ihm, passierte gar nichts. So hatte Peter seine Mutter noch nie gesehen. Ihre Gesichtszüge wechselten fließend zwischen Zorn, Hilflosigkeit, Abscheu und Fassungslosigkeit.
Irgendwann schien sie zu begreifen, dass diese Worte absolut ernst gemeint waren. Sie stand wortlos auf und verließ den Raum. Danach sagte sie diesen Satz nie wieder.
Sein Vater starb zwei Monate später.
Hannah hört ihn die Treppe hinuntergehen. Sie wüsste immer, auch mit verbundenen Augen, dass es Robert ist, nicht nur wegen der klackenden Absätze, mit denen er auf sich aufmerksam macht. Sie würde ihn auch auf Socken erkennen. Es ist die Festigkeit, mit der er auftritt, die sie mehr spüren als hören kann.
»Guten Morgen, Robert.«
»Warum hast du den Wecker nicht ausgestellt, als du aufgestanden bist? Ich kann nun wirklich jede Minute Schlaf brauchen.«
»Entschuldigung, ich … Du schläfst doch sonst auch weiter.«
»Klar, wenn du ihn ausstellst, klingelt er einmal, und dann ist Schluss. Wenn ich das selbst mache, kann ich auch gleich aufstehen.«
Auf häufiges Anraten seines Arztes hat Robert sich nun doch angewöhnt, nicht nur zwei Tassen Kaffee, sondern auch etwas feste Nahrung zu sich zu nehmen. Lustlos verschlingt er ein Toastbrot mit Roquefort.
»Und – ist heute irgendwas Besonderes im Büro?«
»Was soll schon sein? Das Übliche.«
»Mmh.«
»Vergiss nicht, alles vorzubereiten für heute Abend! Ruf den Catering-Service auf jeden Fall noch mal an, damit alles klargeht. Beim letzten Mal hat das Fingerfood so gerade eben gereicht. Wie sieht das denn aus? Sag ihnen, sonst suchen wir uns jemand anderen. Gibt ja genug … Hast du gehört?«
»Hab ich. – Ich fahr vielleicht heute noch mal in die Stadt.«
»Ach ja? – Hauptsache, es geht alles klar für heute Abend, sodass du rechtzeitig zurück bist.«
Seine Wange flüchtig auf ihrer, und weg ist er.
Hannah räumt die Tasse in den Geschirrspüler. Sie geht durch Wohn- und Esszimmer und sammelt ein paar Gläser ein und Teller vom Abend. Zwar kommt Kathrin um zehn, aber dennoch räumt sie regelmäßig auf – ihre Beschäftigungstherapie, bevor sie überlegt, wie sie den Tag totschlagen kann.
Heute aber reicht das nicht. Sie ist unruhig, fast nervös. Als sie ins Wohnzimmer blickt, sieht sie noch einen Weinkelch, den sie glaubt, schon weggeräumt zu haben. Wahrscheinlich hat sie ihn schon in der Hand gehalten und wieder hingestellt? Der Rand ist mit Lippenstift verschmiert. Sie fragt sich, warum sie ihn immer noch aufträgt. Für wen? Reine Gewohnheit.
»Du hast so schöne, volle Lippen. Und ehrlich gesagt, ich finde Lippenstift schmeckt überhaupt nicht gut.«
Als sie damals im Park auf ihrer Bank saßen, hatte Mirko mittlerweile überall im Gesicht und am Hals rote Schmierflecken.
»Dafür siehst du jetzt ganz schön lustig aus.«
Nachdem er sie schließlich überredet hatte, verzichtete sie ihm zuliebe ganz auf Make-up.
Bis sie als Au-pair in den USA war. Norman, der älteste Sohn, hatte sie zum Dinner eingeladen und erlebte den Schock seines Lebens.
Hannah lächelt in sich hinein.
Nachmittags hatte er schon überrascht gefragt, ob sie sich die Haare selber machen würde, aber sie hatte der Bemerkung keine Bedeutung beigemessen. Dann war sie die Treppe hinuntergestiegen und in Normans fassungsloses Gesicht gesehen.
»Ähm … also … Du bist ja noch nicht fertig!«
Und als sie ihn nur verständnislos ansah: »Du willst doch nicht etwa so mit mir …«
Als ihr klar wurde, dass er sich ernsthaft weigerte, sie ungeschminkt ins Caesar’s auszuführen, bat sie ihre Gastmutter um Make-up. Die dann auch gleich selber Hand anlegte und ihr erklärte, was sich für ein gutes amerikanisches Mädchen gehört. Sie fügte sich dann auch in die guten Ratschläge und tauschte noch schnell die hautenge Jeans, die sie selbst ungeheuer sexy fand, gegen einen Rock und gleich auch noch eine weniger dekolletierte Bluse aus Mrs Waterman’s überbordendem Kleiderschrank. Im Spiegel sah sie nicht sich selbst, aber Norman war begeistert, und im Nachhinein war sie Frau Waterman dankbar, denn als sie am Restaurant ankamen und die beiden anderen Pärchen trafen, wäre ihr ihr vorheriger Aufzug ziemlich peinlich gewesen. Sie stellte sich das allgemeine pikierte Naserümpfen auch aller anderen Gäste vor. Sie wäre definitiv unangenehm aufgefallen.
Hannah geht zum Briefkasten, um die Zeitung zu holen. In der weiträumigen Diele fällt ihr Blick in den Spiegel. Sie geht noch einmal zurück.
Heute brauchst du erst recht Make-up. Und einen guten Hair-Stylisten. Du siehst aus wie eine Vogelscheuche. Eine verhärmte Vogelscheuche. Nein, Vogelscheuchen sind nicht so dick – und haben keine Waden wie Eichenmöbel.
Sie räumt ein wenig herum, pflückt verwelkte Blätter von den Topfblumen, die sie zwischen den Fingern zerbröselt, fühlt die poröse Substanz, betrachtet den feinen rieselnden Staub, eben noch tanzend im Sonnenlicht, dann gestaltlos und tot auf dem Parkett. Als feiner Blütenstaub durch die hitzig aufgeladene Luft der Provence wirbelt, betört sie der schwere Duft ebenso wie ihre Zweisamkeit.
Drei Wochen schwelgten sie in inniger Symbiose und schwebten auf Wolke sieben, acht, neun, wanderten Arm in Arm durch Pinienhaine und pittoreske Gassen, tranken Kir zwischen ihren Küssen und kühlen Weißwein zu Austern, versanken in ihren Augen und ihrem Schoß, saßen im Garten ihres Ferienhauses, bis in die Haarspitzen verzaubert von Zärtlichkeit, berauscht von ihrem Liebesspiel. Sie hielten sich an den Händen und streichelten die beiden Ringe, die Symbole ihrer Entscheidung, nun das gesamte Leben miteinander zu teilen.
In guten wie in schlechten Zeiten. Wie viel gute Zeiten hatten wir? Es gab gute Zeiten, ja. Diese Farben, dieses Licht. Wir glaubten tatsächlich, dieses magische Licht zu sehen, und ich habe dir begeistert beschrieben, wie Cezanne, van Gogh, Gauguin diese Szenerie gemalt haben. Ist es nicht wunderschön? Ja, wunderschön. Damals hast du noch zugehört. – Es gibt keine Wunder, du hast recht, es gibt nur hormongetränkte Illusionen. Aber warum nicht? Es waren glückliche Momente. Momente. Wieso konnten wir sie nicht festhalten, diese Momente? Warum retteten wir die Magie nicht in unseren Alltag? Sobald wir zurückkamen, warst du wie verwandelt – nicht verspielt und fröhlich, eher ernst und geschäftig. Zielstrebig. Aber deine Ziele galten nicht mir.
Hannah schaltet das Teewasser wieder aus, stellt den Joghurt zurück in den Kühlschrank. Die Luft erscheint ihr plötzlich abgestanden und stickig. Sie schlüpft in ein paar Sandalen und verlässt das Haus. Obwohl es noch relativ früh ist, ist der Park bereits belebt. Jogger und Skater drehen ihre Runden, während Hundebesitzer kleine rote Tüten in Mülleimer werfen. Sie kommt an dem Pappelrondell vorbei. Acht Pappeln hatte man vor langer Zeit im Kreis angepflanzt, dazwischen Parkbänke. Schon von weitem hört man den rhythmischen, hämmernden Bass, zu dem sich ein paar Leute auf die Kommandos eines Fitnesstrainers hin mehr oder weniger sportlich bewegen. Eine Frau mit deutlichem Schwimmring versucht, zwei dicke, lange Seile in Schwingungen zu versetzen, die aber kaum vom Boden abheben; andere ächzen bei einarmigen Liegestützen, wieder andere ziehen an um die Pappeln gewickelten Gummiseilen – oder umgekehrt.
Glaubt ihr wirklich, dass das eine gute Idee ist? Das soll gesund sein? Ihr holt euch ja doch nur Muskelkater und Zerrungen an Stellen, von denen ihr gar nicht gewusst habt, dass es die gibt. Und wie ertragt ihr eigentlich dabei diese grässliche Musik? Ihr seht lächerlich aus, so lächerlich!
»Hannah, du solltest lernen, deine weiblichen Rundungen zu lieben, also hör auf, dich schlecht zu reden. Du brauchst kein Fitnessstudio. Glaub es mir.«
Ach, nein? Monika hat gut reden. Was ist das denn? Ich glaub’ es nicht. Ohne Skier herumstöckeln ist wohl out. Gymnastik mit Nordic Walking-Stöcken! Ihr macht wohl alles mit? Ihr seid wirklich der Gipfel! Und für diesen Blödsinn zahlt ihr auch noch Geld? Wie ihr euch unansehnlich verrenken könnt, kann ich euch auch zeigen.
Hannah setzt sich auf ihre Bank. Wie viele Menschen fühlt auch sie sich vom Wasser angezogen, sitzt gerne am Ufer und lässt die Gedanken treiben. Aber für sie bedeutet es mehr als Abschalten und Entspannung. In ihren schwersten Lebensphasen war der See ihr bester Zuhörer und manchmal ihr Ratgeber und Therapeut. Der morgendliche Rundgang war zu einem Ritual geworden, das ihr überhaupt erst den Tag zu überstehen half, und der Blick über den See bis zur Kastanienallee auf der anderen Seite war der Moment innerer Sammlung und Kontemplation, ohne den sie an sich selbst verzweifelt wäre. Ob flirrende Hitze oder Nebel über dem Wasser hing, ob dicke Regentropfen die Oberfläche zerplatzen ließen oder Eisschollen sich immer weiter hinausdrängten, die stoische Präsenz des Sees gab ihr die Gewissheit, dass das Leben weitergehen würde, gab ihr die Kraft, es immer wieder zu versuchen, immer wieder einen Fuß vor den anderen zu setzen.
Ungezählte Stunden hatte sie darüber nachgedacht, sich scheiden zu lassen. Aber dann hatte sie erkannt, dass sie kein See war, dass sie sich selbst nicht genug war und sie sich ein Leben, ganz auf sich selbst zurückgeworfen, nicht vorstellen konnte. Das rechtliche Prozedere um Güterteilung und Versorgungsausgleich war schlimm genug, aber dann gäbe es auch all die zermürbenden, fruchtlosen Diskussionen um Fehler und Enttäuschungen und den Zwang, sich rechtfertigen zu müssen.
Vor allem aber erschreckte sie die Ungewissheit, wie es weitergehen sollte, und die schreckt sie bis heute ab.
Auf der Bank oben auf dem Hügel gegenüber sieht sie einen Mann sitzen, der ihr für die Jahreszeit zu warm angezogen erscheint. Für einen Treber sieht er eigentlich zu adrett aus, aber dann steht er auf, schultert einen Rucksack und geht, einen Handkarren hinter sich herziehend, die Wiese hinunter.
Hannah folgt dem Pfad am Ufer entlang.
Ich sollte wieder öfter hierherkommen, frühmorgens, wenn es noch ruhig ist. Vor Roberts Kaffee. »Was soll schon sein? Das Übliche.«
Das Übliche. Catering und Fingerfood.
Rechtzeitig da sein.
Warum eigentlich? Ich könnte auch die Kaffeemaschine einstellen, und eingießen kannst du auch selber. Ich sollte meine Tage anders beginnen. Hier am See. Darf man hier eigentlich schwimmen?
Hannah bemerkt plötzlich den Mann von eben vor sich. Trotz seiner Last geht er aufrecht. Er wendet sich nach rechts und verlässt den Park Richtung Innenstadt, und jetzt, aus der Nähe, sieht sie, wie verschlissen sein Mantel ist, wie ausgetreten seine Schuhe.
»Igitt, guck mal, wie sehen die denn aus?«
»Nicht so laut, Hannah. Und zeig nicht auch noch mit dem Finger auf sie.«
»Aber ich find sie eklig. Und guck mal, die trinken schon Bier, und du sagst doch immer: kein Alkohol vor sechs.«
Ihr Vater lachte. »Stimmt, da hast du recht. Ich finde das auch nicht gut. Aber weißt du, Hannah, wir wissen ja nicht, was denen passiert ist. Die hatten vielleicht schlechte Karten.«
»Schlechte Karten? Wieso Karten?«
»Wegen des Glücks. Das ist wie beim Mau-Mau-Spielen. Wenn du Pech hast, ziehst du einfach immer die falschen Karten, und dann verlierst du eben. Und wo wir geboren werden, darauf haben wir nun mal keinen Einfluss. Das ist der reine Zufall.«
»Mmh.« Sie sah ihren Vater immer noch fragend an.
»Na ja, wir können es uns nicht aussuchen, ob der Storch uns dahin oder hierhin bringt, womöglich sogar aus Versehen fallen lässt, und statt in einem Palast finden wir uns in einer Wellblechhütte wieder. Wir können nichts dafür, aber wir sollten dankbar sein, dass wir mehr Glück hatten als andere. Vergiss das nie!«
»Aber Papa, der Klapperstorch bringt doch gar nicht die kleinen Kinder!«
»Nein.« Ihr Vater lachte. »Nein, der bringt nicht die Kinder.« Er nahm sie in den Arm und drückte sie an sich.
Sie drehte sich noch mal zu den dreien um und sah dann ihren Vater an. »Du machst so was bestimmt nie, stimmt’s? Du bist nicht so eklig.«
»Ich? Nein, bestimmt nicht.«
Dankbar. Wofür? Einfach, weil ich nicht hungern muss und auf der Straße lebe? Dankbar für diese Ehe? Für einen Mann, in dem ich mich getäuscht habe? Für ein Leben, das ich mir nicht gewünscht habe?
Zurück in die Zukunft. Ist ja wirklich ein lustiger Film. Alles auf Anfang. Nein, auf 23 und bei Frau Westheim sitzen, irgendeinen ihrer aromatisierten Tees trinken. Was hatte sie für ein Sortiment, sämtliche Obst- und Kräutersorten, und lecker waren die nicht alle.
Sie hatte so eine hintergründige Ironie. Und wie sie mit den Männern umgesprungen ist. Hat sich nichts gefallen lassen. Aber ihre Retourkutschen waren immer humorvoll, immer augenzwinkernd. Aber unmissverständlich.
»Die einzigen Männer, mit denen eine halbwegs attraktive Frau testosteronfrei reden kann, sind Homosexuelle.«
Über ihren nächsten Artikel im Prometheus reden. Wie gern hab ich das gemacht. – Und ich hab mich nicht getraut. Dabei hat ihr meine Seminararbeit doch ehrlich gefallen. Aber einen Artikel schreiben, für so ein Fachmagazin? Ich? »Liebesmetaphorik bei Elke Laske-Schüler und Mascha Kaléko – ein Vergleich.«
Na ja. Ich glaube, ich sollte sie mal wieder lesen. Ob mir Kalékos Liebesgedichte immer noch gefallen? Dieses Theater um meine eigene kleine Bibliothek. Als hätten wir nicht genug Platz.
Aber die Kellerbar und dein Fitnessraum, das war von Anfang an klar. Und heute rosten die Teile vor sich hin. Ich könnte ja vielleicht mal …
Sie muss lachen bei der Vorstellung. Ein Jogger lacht zurück.
Paul verstaut das restliche Wasser und Brot in seinem Handkarren, in dem sich außerdem seine Kleidung und ein paar Hygieneartikel befinden. Darüber hat er seinen Schlafsack festgebunden. Seine wichtigsten Habseligkeiten – die Regenjacke, den warmen Pullover, ein Paar Wollsocken, ein Taschenmesser, seine Brille, seinen alten Walkman mit ein paar CDs – hat er im Rucksack. Seinen wertvollsten Besitz aber bewahrt er stets in seinem Brustbeutel auf: Melanies Brief.
Paul beginnt seine tägliche Runde durch den Park auf der Suche nach Pfandflaschen, die die nächtlichen Besucher hinterlassen haben. Er streift sich Gummihandschuhe über, bevor er beginnt, die Mülltonnen zu durchsuchen. Manche sind so nett, die Flaschen gleich neben den Bänken stehen zu lassen. Jetzt sucht er auch wieder nach Zeitungen, deren Lektüre ihm nach seinem zweiten tiefen Schock aus Angst vor dem, was er lesen könnte, lange Zeit nicht mehr möglich war. Ein paar Jogger und Skater sind schon unterwegs, und bei den Pappeln ertüchtigen sich ein Dutzend Männer und Frauen beim Workout.
»Willst du es nicht auch mal mit Joggen versuchen? Oder mit diesem Nordic Walking?«
»Fang nicht schon wieder an! Du weißt doch, Laufen ist nicht mein Ding. Und diesen neumodischen Quatsch, mit Ski-Stöcken spazieren zu gehen … nee, wirklich nicht. Ich finde, das sieht lächerlich aus.«
»Du hast aber auch für alles eine Ausrede. Aber irgendetwas solltest du machen, nicht nur weil Dr. Hartmann es dir immer wieder sagt. Du bist ständig nur im Stress, sitzt im Auto, sitzt bei den Besprechungen, trinkst Unmengen Kaffee. Und dann sitzt du in Hotelbars herum und trinkst Cognac. Keine gute Kombination.«
»Hör auf, bitte! Du weißt genau, dass ich es nicht mit Sport habe. Ich entspanne mich eben anders. Cognac und Mozart, das reicht mir.«
»Früher bist du wenigsten noch regelmäßig in den Chor gegangen. Hast du nicht immer gesagt, Singen macht fröhlich?«
»Das sage ich auch immer noch. Aber dafür muss man auch Zeit haben. Später kann ich ja wieder damit weitermachen, aber jetzt muss eine Arie unter der Dusche reichen.«
Als die Rückenschmerzen nicht mehr auszuhalten waren, landete er zuerst bei einem Physiotherapeuten und ging dann doch ein paar Wochen lang ins Fitnessstudio. Aber in der taffen, schweißgetränkten Testerosphäre, wie er es nannte, zwischen rollenden Bizepsen und strammen Bäuchen, kam er sich lächerlich und deplatziert vor.
Die Ausbeute ist heute nur sehr bescheiden. Er setzt sich auf eine Bank, hält das Gesicht in die Sonne und ruht sich aus.
Der Schmerz meldet sich zurück, eher sanft, kaum ein Krampf, eine Erinnerung, mehr nicht. Paul konzentriert sich auf den blühenden Klee, die Kugeln aus rosafarbenen Tropfen, auf den weiß leuchtenden Steinbrech an langen, filigranen Stängeln und die winzigen gelben Fruchtknoten, auf die Stauden zwischen den Bänken in Gelb und Violett, auf jedes einzelne einzigartige Blatt, bis er den Schmerz vergessen hat.
Er sieht noch einen Moment lang einem Bussard hinterher, der hoch oben seine majestätischen Kreise zieht, und hinter den Baumkronen verschwindet.
Er verlässt den Park, um seine magere Ausbeute in einen Supermarkt zu bringen. Es hat schließlich keinen Zweck, die Flaschen lange mit sich herumzutragen. Viel bringt das ohnehin nicht mehr ein, seit immer mehr Menschen sich auf diese Weise ein Zubrot verdienen wollen, und das sind längst nicht mehr nur Treber wie er. Paul mutet es erniedrigend an, dieser Konkurrenzkampf um Wegwerfalmosen, aber das ist immer noch besser, als zu betteln, was er nur tut, wenn ihm nichts anderes mehr übrigbleibt, und seine wenigen Versuche waren nicht sonderlich erfolgreich, da er es nicht über sich bringt, den vorbeigehenden Menschen in die Augen zu sehen und so ihr Mitleid hervorzulocken.
Niemand hätte sich vorstellen können, dass Paul einmal so enden würde; er selbst am allerwenigsten. Paul wusste immer, was er wollte, und seine Ziele verfolgte er konsequent, ohne sich beirren zu lassen, und er erreichte sie auch. Er hatte durchaus viele Interessen, probierte sich aus, aber nie verzettelte er sich, nie dauerte es lange, bis er Klarheit hatte, wo es langgehen sollte. Alles andere ließ er links liegen.
Seine schulischen Leistungen waren nicht überdurchschnittlich, weil er sich ganz auf das für ihn Relevante konzentrierte. Mathe, Physik und Musik waren seine absoluten Stärken, Fremdsprachen betrachtete er als notwendig, da er schon mit fünfzehn wusste, dass er Ingenieur werden wollte. Solange es im Deutschunterricht um Literatur ging, war er dabei, langweilte sich allerdings des Öfteren, da er einige Romane schon aus der Bibliothek seines Vaters kannte, eines Geschichtsprofessors.
In Sozialwissenschaften und Erdkunde reichte es nicht immer für ein ausreichend, und in Geschichte strengte er sich nur seinem Vater zu Liebe etwas mehr an. Der musste früh einsehen, dass seine Hoffnung, Paul könne einmal in seine Fußstapfen treten, sich nicht erfüllen würde. Da obsiegten eindeutig die Gene seiner Mutter.
Was er aber von seinem Vater geerbt hatte, war die Liebe zur klassischen Musik. Er hörte wenige der in der Schule populären Bands; vor allem die bei den Mädchen fanatisch verehrten Boygroups empfand er als seichte musikalische Belästigung, und wieso Nena, DAF und Ideal so erfolgreich waren, blieb ihm ein Rätsel. Metal, Hip-Hop und Techno waren ihm ein akustisches Gräuel. Die avantgardistischen Alben von Kraftwerk und Brian Eno hingegen faszinierten ihn eine Zeit lang, ebenso wie die verschiedenen Spielarten der Neuinterpretation klassischer Werke von Jacques Loussier über Nice und Exception bis Emerson, Lake and Palmers »Pictures at an Exhibition«, dessen Entdeckung er einem aufgeschlossenen Musiklehrer verdankte.
Seine Eltern machten ihn schon früh mit Opern bekannt; die Aufführung von »Hänsel und Gretel« war eines seiner unvergesslichen Kindheitserlebnisse, und die elterliche Wohnung war eigentlich immer erfüllt von Symphonien und Arien, von orchestralem Blütenzauber, der ihn betörte, von Stimmen, die ihn erschaudern ließen, und von Libretti, die ihn gefangen nahmen, deren Sinn sich ihm allerdings erst viel später erschloss.
Die Workout-Truppe lässt sich von basslastigem Getöse beschallen, aber sie machen ohnehin nicht den Eindruck, als hörten sie zu. Für sie ist es keine Musik; es ist einfach nur halb wahrgenommene Geräuschkulisse. Ewige Wiederholung als Kunstprinzip.
Paul versteht nicht, wie man immer denselben Rhythmus, immer dieselben Tonfolgen als angenehm, geschweige denn ästhetisch empfinden kann. Seine frühere Begeisterung für Kraftwerk versteht er selbst nicht mehr. Jetzt würde er gerne mal wieder ein Konzert erleben mit leibhaftigen, wahren Musikern, denen Partituren durch die Adern fließen.
Immerhin hat er seinen Walkman. Ein allerdings zwiespältiger, ja paradoxer Besitz. Er lässt ihn entfliehen in erhabenere Sphären, in die luftige Welt der Fugen und Kantaten, der Rondos und Suiten. Allerdings rufen die Violinen und Celli, die Oboen und Hörner, rufen Klavier und Pauke zu viele Erinnerungen hervor, die er eigentlich vergessen will.
Sie saßen in Vaters Zimmer, einem großen, holzgetäfelten Raum, in den er sich zum Lesen und Musikhören zurückzog. Außerdem gab es einen antiken Schachtisch mit passenden Sesseln, an dem er einmal die Woche mit einem Freund vor sich hinbrütete. Paul hätte ihnen auch länger zugesehen, wenn ihn das lange Schweigen nicht so verunsichert hätte. In die Bücherwand war eine Musikanlage integriert, das Beste, was Bang und Olufsen zu bieten hatten. Gegenüber stand ein großes, bequemes Sofa, in dem Paul und sein Vater saßen, die Augen geschlossen, versunken in der Welt der Zauberflöte.
Am Ende von Papagenos Vogelfänger-Arie hielt sein Vater die CD an.
»Weißt du, warum diese Arie so beliebt ist?«
»Ich weiß nicht, sie klingt irgendwie lustig. Und nicht so schwer wie andere.«
»Da hast du es schon gut getroffen. Diese Arie ist ein treffliches Beispiel für Mozarts Kompositionen. Schlichtes und Kunstfertiges fließen harmonisch ineinander und verzaubern uns. Vordergründig ist sie sehr einfach, ein Volkslied eben. Da ist diese eingängige Melodik, in Sekundenschritten, alles wird syllabisch deklamiert, es gibt keine Melismen, keine Mollabweichungen, alles scheint einfach gehalten. Aber gleichzeitig ist die Arie dreischichtig komponiert: Da gibt es zunächst die Violine und die Singstimme, dann die Begleitstimmen, und drittens den Bass und die Hörner, abtaktig, in 2-Takt-Gruppen. Zudem ist jeder 2-Takt anders gestaltet. Achte einmal darauf! Wir hören sie uns jetzt noch einmal an.«
Paul konnte seinem Vater nicht immer folgen, hatte aber dennoch das Gefühl, mit seiner Hilfe immer tiefer in die Musik einzudringen, sie besser zu verstehen, anders zu hören. Und so war er mit zwölf Jahren bestens vertraut mit den meisten Komponisten, mit Mozart, Brahms und Berlioz, und vor allem mit den Lieblingen seines Vaters, mit Bach, Tschaikowski und Wagner.
Für seine Eltern war es selbstverständlich, dass Paul auch ein Instrument lernen sollte, also bekam er Geigen- und Klavierunterricht, aber Paul, obwohl er beide Instrumente bald leidlich beherrschte, verlor schnell das Interesse; nicht aus genereller Abneigung – im Gegenteil, diese herrliche Musik auch selber produzieren zu können erfüllte ihn mit Stolz und innerer Zufriedenheit – sondern wegen des enormen Zeitaufwandes, den der Unterricht und die Übungen zu Hause in Anspruch nahmen, Zeit, die ihm für anderes wichtiger erschien.
Das Studium absolvierte er in der Regelstudienzeit, ohne sich in seiner Studentenbude verkriechen zu müssen. Er hatte ein paar Freunde und Bekannte, genoss das Nachtleben, verlor aber nie das Examen aus den Augen, das er so schnell wie möglich machen wollte. Lernen machte ihm Freude, aber er konnte es nicht erwarten, sein Wissen auch anzuwenden.
Genauso klar war für ihn, dass er mit Abschluss seines Studiums seine Jugendfreundin Tanja heiraten würde. Das erste Kind wollten sie erst, wenn er sich beruflich etabliert hatte. Ein Jahr, nachdem er die feste Anstellung bei Hoch- und Tiefbau Kröner bekommen hatte, kam Melanie zur Welt. Ein weiteres Jahr später scheiterten Tanjas Versuche, wieder schwanger zu werden, und als Paul sich mit seinem Statik-Büro selbständig machte, stellten sie das zweite Kind erst einmal zurück. Als sie es noch einmal versuchen wollten, schlug das Schicksal zu.