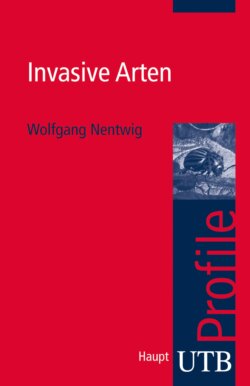Читать книгу Invasive Arten - Wolfgang Nentwig - Страница 7
ОглавлениеWarum invasive Arten?
Entstehung und Anpassung von Arten
Die Entstehung von Arten, gleich ob es sich um Mikroorganismen, Pilze, Pflanzen oder Tiere handelt, ist eine Geschichte der Anpassung an die belebte und unbelebte Umwelt. Dies ist aufgrund von zwei wichtigen Eigenschaften aller Arten möglich: Bei der sexuellen Fortpflanzung führt die Rekombination des Genoms schnell zu genetischen Unterschieden zwischen den Eltern und ihren Nachkommen, aber auch zwischen den Nachkommen. Zweitens produzieren alle Arten mehr Nachkommen, als im Lebensraum der entsprechenden Art Platz haben. Die genetischen Veränderungen sind ungerichtet, denn sie können sowohl vorteilhaft als auch nicht vorteilhaft sein. Bei den meisten Veränderungen wird ohnehin weder Vor- noch Nachteil erkennbar sein, das heißt, sie sind (vorerst) neutral. Schließlich sei auch noch erwähnt, dass die Umwelt einer Art nie konstant ist, sondern ständiger Veränderung unterliegt.
Die geringfügig verschiedenen Nachkommen eines Elternpaares haben in einer heterogenen Umwelt unterschiedliche Überlebenschancen. Wenn ein sich verändernder Lebensraum etwas trockener wird, weil ein Fluss seinen Lauf verändert oder der Niederschlag abnimmt, ist es denkbar, dass, um ein Beispiel zu nennen, bei einzelnen Käferindividuen eine bisher unbedeutende Veränderung in der äußeren Schutzschicht den Verdunstungsschutz erhöht. Sie haben daher eine bessere Überlebenschance, erreichen eher das Fortpflanzungsalter und werden über ihre Nachkommen diese Mutation weitergeben. Alle Individuen der gleichen Art ohne diese Mutation werden mehr Mühe haben, sich zu behaupten, vor allem aber wird ihre durchschnittliche Nachkommenzahl geringer sein. Innerhalb weniger Generationen werden daher alle Individuen dieser Käferart über den verbesserten Verdunstungsschutz verfügen.
Direkt vorteilhafte Mutationen haben also einen großen Selektionswert, das heißt, sie helfen dem betroffenen Individuum, sich in seiner dynamischen Umwelt zu behaupten. Ähnlich eindeutig verhält es sich mit nachteiligen Mutationen. Sie führen mehr oder weniger direkt zum Tod des Individuums. Von solch nachteiligen Mutationen abgesehen werden jedoch alle anderen Mutationen in der Population behalten und führen zu einer Erhöhung der Variabilität des betroffenen Merkmales. Je größer eine Population und je länger sie bereits in einem bestimmten Lebensraum vorkommt, desto unterschiedlicher werden die Ausprägungen vieler Merkmale sein. Da auch neutrale Merkmale in einer sich ändernden Umwelt von großem Selektionsvorteil sein können, sind sie eine Versicherung für die Zukunft.
Wir können also davon ausgehen, dass in einem beliebigen Lebensraum die dort vorkommenden Arten eine beträchtliche Anpassungszeit hinter sich haben und so gut wie möglich an ihren Lebensraum angepasst sind. Diese Anpassungszeit wird in Mitteleuropa meist auf die Wiederbesiedlung nach dem Rückgang der letzten Vergletscherung vor etwa 12 000 Jahren bezogen. Dies entspricht bei den meisten einjährigen Pflanzen und Insekten genauso vielen Generationen. Da die meisten heute hier vorkommenden Arten aber viel älter sind und die Eiszeiten in verschiedenen Rückzugsgebieten überdauern konnten, kann man deutlich längere Anpassungszeiten annehmen.
Einheimische Arten, Biodiversität und Koevolution
Die in einem Lebensraum entstandenen Arten bezeichnen wir als die dort einheimischen Arten, deren mannigfaltige Ausprägung auch mit dem Begriff Biodiversität umschrieben wird. Neben den vielen Arten eines Lebensraumes schließt die Diversität eines Lebensraumes auch die genetische Vielfalt der Arten ein. Somit ist in die Biodiversität eines Lebensraumes auch sein evolutives Alter bzw. das der in ihm lebenden Arten einbezogen.
Aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit konnten sich die in einem Lebensraum gemeinsam vorkommenden Arten so weit an ihre Umwelt anpassen, wie es erforderlich war, um dort zu überleben. Da neben der unbelebten Umwelt auch alle anderen Arten in diesen Lebensraum gehören, erfolgt auch eine Anpassung der verschiedenen Arten aneinander. Diese kann sehr unterschiedlich sein: Beutetiere können lernen, Räuber zu meiden, die ihrerseits immer besser im Aufspüren ihrer Beute werden. Pflanzenfressende Insekten passen sich immer stärker an ihre Futterpflanzen an, die ihrerseits immer wirksamere Verteidigungssubstanzen synthetisieren, um einige Arten unter ihren Fressfeinden loszuwerden.
Manche Arten gehen noch weiter gehende Beziehungen ein. Unter den Blütenbesuchern kann es zu engen Abhängigkeiten zwischen hoch spezialisierten Blütenpflanzen und ihren Bestäubern kommen. Manche Arten unter den Blattläusen, Zikaden oder Schmetterlingsraupen können nur in enger Beziehung zu bestimmten Ameisenarten überleben. Viele Parasiten haben sich auf eine oder wenige Wirtsarten spezialisiert und unternehmen gewaltige Anstrengungen, um genau diese zu finden. Extreme Abhängigkeitsverhältnisse liegen zum Beispiel bei manchen Bäumen oder Orchideen vor, bei denen eine Pilzart durch die Fotosyntheseprodukte der Pflanze versorgt wird, die ihrerseits vom Pilz Phosphor- und Stickstoffverbindungen bezieht. Kein Partner kann mehr ohne den anderen existieren.
Solche Abhängigkeiten zwischen Arten deuten auf eine lange gemeinsame Entstehungsgeschichte hin, die wir auch als Koevolution bezeichnen. Koevolution weist meist auf artenreiche Lebensräume hin, die sich über längere Zeiträume entwickeln konnten.
Natürliche Ausbreitung
Der Lebensraum von Arten kann unterschiedlich groß sein. Wir kennen Arten, die weit verbreitet beispielsweise über einen ganzen Kontinent vorkommen. Daneben gibt es aber auch viele kleinräumig anzutreffende Arten, die nur in einem Flusssystem, auf einer Insel oder auf einem Höhenzug vorkommen. Diese Arten wiesen in ihrer Vergangenheit eine unterschiedliche Ausbreitungs- und Besiedlungsgeschichte auf. Einzelne Arten haben sich kaum aus ihrem evolutionären Entstehungsgebiet entfernt, während andere sich stark ausbreiteten.
Prinzipiell ist die Ausbreitungsmöglichkeit jeder Art begrenzt. Meeresküsten sind für die meisten Arten des Festlandes Ausbreitungsgrenzen. Gleichermaßen wird die Ausbreitung von Meeresorganismen durch die Lage der Kontinente eingeschränkt. Fließgewässer oder Seen begrenzen das Vorkommen der in ihnen lebenden Arten. Große Gebirgszüge wie die Alpen stellen für viele Arten eine unüberwindbare Barriere dar, Ähnliches gilt für die ausgedehnten Trockenzonen der Sahara in Nordafrika. Zu kalte, nasse oder warme Jahreszeiten können genauso einschränkend wirken wie das Fehlen der Wirtspflanze von Herbivoren oder spezialisierten Blütenbesuchern. Solche Grenzen bezeichnen wir als biogeografische Barrieren, da sie die natürlichen Areale von Arten definieren.
Die Ausbreitung, zu denen Arten im Rahmen dieser Einschränkungen fähig sind, bezeichnen wir als natürliche Ausbreitung. Für unterschiedliche Arten kann sie sehr verschieden sein. Manche nur lokal vorkommenden Arten haben offenbar kein nennenswertes natürliches Ausbreitungsvermögen, d. h., sie breiten sich nicht aus. Andere sehr mobile und oft anspruchslose Arten hingegen konnten ihren Lebensraum über ganz Europa und auch darüber hinaus ausdehnen. Sieht man von besonders mobilen bzw. völlig immobilen Arten ab, ist die durchschnittliche natürliche Ausbreitungsgeschwindigkeit von Arten eher gering. Sie beträgt oftmals weniger als hundert Meter pro Generation, sodass die nacheiszeitliche Wiederbesiedlung Mitteleuropas viele Jahrtausende dauerte und für manche Arten bis heute noch nicht abgeschlossen ist.
Das Ausbreitungsvermögen einer Art ist keine Konstante, da es sich beispielweise mit der Qualität des Lebensraumes ändert. In erdgeschichtlichen Zeiträumen und vor allem bei der nacheiszeitlichen Wiederbesiedlung Europas vergrößerte sich für die meisten Arten mit den klimatischen Bedingungen ihr möglicher Lebensraum und damit auch ihre Ausbreitungsdynamik. Die Verfügbarkeit neuer eisfreier Gebiete nach dem Rückzug der Gletscher führte also bei vielen Arten zu einer Arealausdehnung, die somit als natürlicher Prozess anzusehen ist. Auch die neuzeitliche, fortschreitende Klimaerwärmung führt zur Veränderung der möglichen Siedlungsgebiete zahlreicher Arten. Diese finden nun neue geeignete Gebiete vor, sodass sich ihre Areale verschieben. Manche Arten verschwinden aber auch aus ungeeigneten Randgebieten, d.h., ihr Areal schrumpft. Beides sind natürliche Prozesse, auch wenn die aktuelle Klimaerwärmung überwiegend anthropogene Ursachen hat.
Die Arteninventare eines Lebensraumes und das Areal einer Art unterliegen also einer gewissen Dynamik. Hieraus kann gefolgert werden, dass Einwanderung per se natürlich ist, sofern diese Arten ihr neues Gebiet mit eigener Kraft erreichen, aus europäischer Sicht also bereits in Europa oder den angrenzenden Gebieten vorkommen.
Nicht-einheimische Arten
Im Gegensatz zur natürlichen Ausbreitung von Arten zeichnet sich die Ausbreitung von nicht-einheimischen Arten durch drei Merkmale aus: Sie erfolgt (1) erst durch den Menschen, (2) über biogeografische Grenzen hinweg und (3) innerhalb sehr kurzer Zeiträume. In dem Gebiet, in das diese Arten neu eingeführt werden, sind sie nicht-einheimisch. Dieser Prozess ist Gegenstand dieses Buches.
Als die Menschen im Laufe ihrer eigenen Entwicklungsgeschichte die Erde eroberten und immer neue Gebiete besiedelten, haben sie absichtlich oder unabsichtlich Pflanzen und Tiere mitgenommen, wodurch diese außerhalb ihres ursprünglichen Verbreitungsgebietes gelangten und dort Fuß fassen konnten. Ursprünglich bezog sich diese Verbreitung von Nutzpflanzen und Nutztieren auf die Nahrungssicherung des Menschen. Passiv wurden jedoch auch Schädlinge der Nutzpflanzen oder Parasiten und Krankheitserreger der Haustiere und des Menschen selbst verbreitet, Vorratsschädlinge und ein breites Spektrum von Arten, die in den Besitztümern der Menschen unerkannt mittransportiert wurden. Im Laufe der menschlichen Ausbreitungsgeschichte erhöhte sich die Zahl dieser Arten immer mehr.
Bei der Eroberung der Welt waren die Menschen, von der Neuzeit abgesehen, auf ihre eigene Kraft angewiesen, d. h., sie gingen zu Fuß. Australien und Amerika konnten nur in einer sehr speziellen eiszeitlich bedingten Phase eines niedrigen Meeresspiegels vor 60 000 bzw. vor 15 000 Jahren erreicht werden. Viele entfernte Inseln konnten gelegentlich mit Booten erreicht werden. Solche Fahrten waren aber gefährlich, und regelmäßige Verbindungen konnten meist nicht aufrechterhalten werden.
Diese Situation änderte sich in Europa mit hochseetauglichen Schiffen und guten Navigationskenntnissen, die ab dem 15. Jahrhundert verfügbar waren. Die frühere Entdeckung Nordamerikas durch die Wikinger (Leif Eriksson um 1000) hatte zu keiner dauerhaften Besiedlung geführt, und Kolumbus entdeckte daher Amerika 1492 zum zweiten Mal, 1498 fuhr Vasco da Gama um die afrikanische Küste bis Indien, wenige Jahre später umrundete Magellan die Erde (1519–1522). In den folgenden Jahrhunderten der Kolonialzeit kam es mit einem immer dichter werdenden Netz von Schiffsbewegungen zwischen allen Teilen der Erde zu immer intensiveren Handelsbeziehungen. Die Phase der Kolonialisierung wurde nach dem Zweiten Weltkrieg (1939–1945) durch die Globalisierung und den Beginn des zivilen Massenflugverkehrs abgelöst (Abb. 1).
Auch wenn erst in unseren modernen Zeiten Arten innerhalb von 24 Stunden weltweit transportiert werden können und sie somit globale Distanzen lebend überdauern, ist es wichtig, in Erinnerung zu behalten, dass die heutige Dynamik auf Kolumbus zurückzuführen ist, also rund 500 Jahre alt ist. Seit der Entdeckung der Neuen Welt 1492 nahm der weltweite Personen- und Warenverkehr langsam, aber stetig zu, genauso wie die Zahl der nicht-einheimischen Arten, die weltweit transportiert und ausgesetzt wurden. Daher wird dieses Datum, gelegentlich auch auf 1500 gerundet, global als Beginn des Erscheinens von nicht-einheimischen Arten gewertet.
Es ist sinnvoll, solch einen Nullpunkt zu setzen, da man das vergleichsweise neuzeitliche Phänomen der Verschleppung von nicht-einheimischen Arten von den früheren historischen Prozessen trennen möchte. Wenn auch die Römer mit ihren Getreidelieferungen die häufigsten Ackerunkräuter aus dem europäischen Mittelmeerraum in Germanien etablierten, so ähnelt dieser Vorgang doch nur vordergründig dem modernen Transport von Kleesaatgut aus Kanada nach Europa, mit dem ebenfalls die entsprechenden Unkrautarten Kanadas in Europa etabliert wurden. Die zeitliche Grenzziehung bei 1500 zu setzen, könnte willkürlich genannt werden, ist jedoch recht geschickt gewählt. Bei der zeitlichen Analyse des Auftretens nicht-einheimischer Arten stellt man für Europa eine erste Welle neuer Arten zur Zeit des römischen Imperiums fest. Während der nachfolgenden Klimaänderung, die die germanische Völkerwanderung des 4. bis 6. Jahrhunderts und den Zusammenbruch der römischen Weltordnung auslöste (Nentwig 2005), sowie während der fast 1000 Jahre dauernden christlich-feudal geprägten gesellschaftlichen Stagnation im Mittelalter erhöhte sich die Zahl nicht-einheimischer Arten kaum. Mit der dann einsetzenden Renaissance änderte sich die Situation jedoch grundlegend und führte kontinuierlich bis zum heute noch anhaltenden Boom von nicht-einheimischen Arten.
Abb. 1: Zunahme der Anzahl nicht-einheimischer Pflanzen in Abhängigkeit von der Zahl der dauerhaften Siedler auf den Galapagosinseln. Nach Myers & Bazely (2003).
Dem zeitlichen Nullpunkt von 1492 haftet allerdings etwas Künstliches an, und er entspringt eindeutig unserem eurozentrischen Weltbild. Wenn dieser Nullpunkt auch in den weitaus meisten Fällen seine Berechtigung hat und unser Bedürfnis nach begrifflicher Klärung erfüllt, so ist aus ökologischer Sicht eine funktionale Definition eindeutig vorzuziehen. Diese bezieht sich auf die biogeografischen Grenzen zwischen den Kontinenten und das Kriterium der natürlichen Ausbreitung bzw. eigenständigen Erreichbarkeit eines neuen Lebensraumes.
Der historische Transport von Arten erfolgte in benachbarte Regionen. Selbst römische Ansiedlungen von Nutztieren und Nutzpflanzen erfolgten meist noch innerhalb von Europa. Im Wesentlichen war es erst ab 1492 möglich, Arten in zunehmend kurzer Zeit über biogeografische Grenzen hinweg zu verbreiten, also etwa von Übersee nach Europa. Somit konnten erst ab 1492 Arten in Lebensräumen erscheinen, in die sie auf natürliche Weise nie gekommen wären. Daher ist es ein prinzipieller Unterschied, ob ein Ackerunkraut von den Römern aus dem Mittelmeerraum nach Mitteleuropa verschleppt wurde oder ob es aus Kanada stammt.
Aus der großen Bedeutung von biogeografischen Grenzen geht hervor, dass es oft wenig sinnvoll ist, das Auftreten einer Art im Nachbarland als nicht-einheimisch zu interpretieren. Politische Grenzen sind für Arten unbedeutend, und es ist, etwa bei großräumigen Landnutzungsänderungen oder bei Klimaänderungen, jederzeit damit zu rechnen, dass einzelne Arten ihr Areal neu in ein Nachbarland ausweiten. Von nicht-einheimischen Arten zu reden, ist daher erst gerechtfertigt, wenn eine wichtige biogeografische Grenze überschritten wurde. Dies trifft zweifellos auf eine nordamerikanische Art zu, die nach Europa verschleppt wird, und in der Regel stimmt es auch für eine mediterrane Art, die in Skandinavien erscheint. Es macht jedoch keinen Sinn, von einer nicht-einheimischen Arte zu reden, wenn diese sich von Holland nach Norddeutschland ausbreitet. Die Bezeichnung einer Art als nicht-einheimisch erfordert daher eindeutig eine große geografische Distanz, die hier (zumindest aus europäischer Sicht) meist mit außerkontinental gleichgesetzt wird.
Zusammen mit dem Überschreiten von natürlicherweise sonst unüberwindbaren Barrieren spielt die für das Zurücklegen des Weges benötigte sehr kurze Zeit eine wichtige Rolle. Das plötzliche Auftauchen einer bisher unbekannten Art aus einer anderen biogeografischen Region lässt keine evolutive Anpassung von einheimischen und nicht-einheimischen Arten zu. Sofern sich die nicht-einheimische Art in der neuen Umwelt etabliert, kann sich ihre Anwesenheit daher dramatisch auf die einheimischen Arten auswirken. Diese hatten sich ihrerseits über lange Zeiträume optimal an ihre Umgebung angepasst. Für eine Anpassung an die neu auftauchende und offensichtlich erfolgreichere nicht-einheimische Art fehlt aber nun die erforderliche Zeit, sodass einheimische Arten seltener werden oder sogar lokal verschwinden können.
Bei nicht-einheimischen Pflanzen spricht man von Neophyten, bei Tieren von Neozoen und bei Pilzen von Neomyceten. Der Oberbegriff für alle gebietsfremden Organismen lautet Neobioten. Arten, die vor 1492 eingeschleppt wurden, werden als Archaeophyten, Archaeozoen, Archaeomyceten und Archaeobioten bezeichnet.
Warum immer mehr nicht-einheimische Arten?
Die weltweit in den letzten Jahrhunderten gestiegene Mobilität und der globalisierte Handel führen immer häufiger zum Auftreten von nicht-einheimischen Arten (Abb. 2). Ein überwiegender Teil dieser Neobioten kann sich am neuen Standort nicht etablieren, sodass sie wieder aussterben. Häufig ist es auch so, dass wenige Individuen für längere Zeit an einem Ort überdauern, es aber kein erkennbares Populationswachstum gibt. Ein kleiner Anteil der nicht-einheimischen Arten verhält sich aber entgegengesetzt: Diese Arten vermehren sich stark, vergrößern ihr Areal und zeigen schnell negative Auswirkungen auf ihre Umwelt. Diese sogenannten invasiven Arten wirken sich nachteilig auf die einheimische Biodiversität aus, verursachen wirtschaftliche Schäden und/oder schädigen den Menschen gesundheitlich.
Abb. 2: Zunahme der neu nachgewiesenen, etablierten Arten nicht-einheimischer Pflanzen, Vögel, Amphibien und Reptilien pro Jahr, angegeben für Perioden von je 20 Jahren in Europa. Verändert nach Hulme et al. (2009 b).
Es ist eigentlich nicht erstaunlich, dass die meisten nicht-einheimischen Arten am neuen Standort nicht überleben können oder nicht als invasive Art in Erscheinung treten, das heißt, zahlen- und einflussmäßig unauffällig bleiben. Der Unterschied zwischen ursprünglichem Lebensraum, meist in einem anderen Kontinent, und dem neuen Gebiet ist oft groß. Außerdem erfolgt zumindest die unbeabsichtigte Verschleppung ohne Auswahlverfahren, also ohne «Eignungstest» für den neuen Lebensraum. Es sind daher viele Arten betroffen, für die der neue Lebensraum ungeeignet ist. Die Tatsache, dass einige eingeschleppten Arten nicht sofort invasiv werden, ist nur auf den ersten Blick beruhigend. Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass viele dieser Arten nach einer gewissen Verzögerungsphase invasiv werden können. Offensichtlich passen sie sich während einiger Jahre, Jahrzehnte oder Jahrhunderte an die neuen Lebensbedingungen an. Im Invasionsprozess lassen sich daher verschiedene Phasen unterscheiden (Abb. 3).
Abb. 3: Bei einem Invasionsprozess lassen sich vier Phasen mit verschiedener Wachstumsgeschwindigkeit unterscheiden.
Phase 1. Einfuhr einer nicht-einheimischen Art. In der Regel handelt es sich nur um wenige Individuen, sodass diese nur eine geringe Vermehrungsrate haben. Ihre Nachkommen haben noch keinen Einfluss auf einheimische Arten, und von ihnen geht noch keine Bedrohung aus.
Phase 2. Etablierung und Anpassung an den neuen Lebensraum. Nach wie vor ist die Individuenzahl gering, genügt aber, um eine langsam zunehmende Populationsdichte zu gewährleisten. Der Einfluss auf einheimische Arten ist ebenfalls gering, wirtschaftliche Schäden sind unbedeutend. Diese Eingewöhnungsphase der nicht-einheimischen Art ist je nach Situation verschieden und in ihrer Dauer schwierig abzuschätzen. Nach einer Analyse in Norddeutschland kann man von durchschnittlich 170 Jahren für Baumarten, 131 Jahren für Sträucher, 68 Jahren für ausdauernde Stauden und 32 Jahren für ein- oder zweijährige Arten ausgehen (Kowarik 2003). Auffällig ist die große Streuung solcher Daten–es gibt Baumarten, die über 400 Jahre unauffällig sind, während andere in 29 Jahren invasiv wurden. Für die Tropen gehen wir heute generell von viel kürzeren Zeiträumen als für die gemäßigten Breiten aus. Für Tiere sind Prognosen noch schwieriger. Viele Säugetiere weisen in Europa keine nennenswerte Eingewöhnungsphase und somit Zeitverzögerung auf, sondern vermehren sich von Anfang an maximal. Daneben gibt es Arten wie die Kanadagans (Branta canadensis), die in England 300 Jahre eher unauffällig war und dann erst invasiv wurde, während sie in Schweden diese Phase innerhalb von 40 Jahren erreichte. Diese Eingewöhnungsphase bzw. Zeitverzögerung ist also weniger ein brauchbares Prognoseinstrument als eine generelle Warnung: Daraus, dass eine nicht-einheimische Art Jahrzehnte oder Jahrhunderte unauffällig und selten blieb, kann man nichts ableiten. Die Situation kann sich morgen ändern, und in einem anderen Lebensraum oder für eine andere Art kann ohnehin alles ganz anders sein.
Phase 3. Invasion. In einem immer größeren Gebiet findet ein starkes Populationswachstum statt, das zur Ausbreitung in immer neue, noch nicht besiedelte Gebiete führt. Diese Phase wird als biologische Invasion bezeichnet. Der Einfluss auf einheimische Arten erhöht sich und kann ein großes Ausmaß annehmen. Es treten vermehrt wirtschaftliche Schäden auf.
Phase 4. Sättigung. Alle geeigneten Lebensräume im neu besiedelten Areal sind besetzt, es ist keine weitere Expansion mehr möglich. Der Einfluss auf einheimische Arten ist in der Regel groß, Ökosysteme können stark verändert und wirtschaftliche Schäden gravierend sein. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine eingeschleppte Art sich etabliert? Und wie viele der etablierten Arten breiten sich bis hin zu invasionsartigem Wachstum aus? Antworten auf diese scheinbar einfachen Fragen sind schwierig. Zum einen werden viele eingeschleppte Arten, die sich nicht etablieren, nie entdeckt. Die Zahl der etablierten Arten ist daher immer eine Mindestzahl. Zum anderen kann bei einer etablierten Art nicht abgeschätzt werden, ob sie sich noch in der Eingewöhnungsphase befindet und zukünftig invasiv wird, oder ob das nicht der Fall sein wird. Eine solche Zahl wird daher ebenfalls immer eine Mindestannahme darstellen.
Früher wurde aufgrund der Analyse von invasiven Pflanzen von einer allgemeinen zehnprozentigen Wahrscheinlichkeit des Übergangs von Phase 1 zu Phase 2 und anschließend zu Phase 3 gesprochen («Zehnerregel », Williamson 1996). Demnach würde nur etwa 1 % aller eingeschleppten Arten invasiv. Pflanzen weisen in der Tat eine sehr große Zahl von Einschleppungen auf, von denen bisher erst vergleichsweise wenige zur Etablierung und Invasion führten. Bei den meisten Tieren sieht das aber deutlich anders aus. Heute wissen wir, dass die «Zehnerregel» eine zu geringe Quote ergibt und dass die Etablierungs- bzw. Ausbreitungswahrscheinlichkeit für einzelne Organismengruppen und verschiedene Lebensräume sehr unterschiedlich sein kann. In Tabelle 1 sind die Bandbreiten angegeben, die sich aufgrund von verschiedenen Analysen ergeben haben. Solche Daten zeigen, dass für die meisten Tiergruppen mit Etablierungs- und Ausbreitungswahrscheinlichkeiten in der Größenordnung von etwa 50 % zu rechnen ist.
Tab. 1: Übersicht über die durchschnittliche Etablierungs- und Ausbreitungswahrscheinlichkeit (%) von nicht-einheimischen Arten. Nach Jeschke & Strayer (2005).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der anhaltende Import von nicht-einheimischen Arten dazu führt, dass immer mehr Arten in die Etablierungsphase gelangen. Zusammen mit der Unsicherheit über die Dauer dieser Eingewöhnungsphase und der relativ hohen Wahrscheinlichkeit, dass diese Arten die Ausbreitungs- und Invasionsphase erreichen, kann davon ausgegangen werden, dass die Zahl der invasiven Arten auch in Zukunft weiter zunehmen wird. Dies würde auch der Fall sein, wenn ab sofort keine neuen Arten eingeschleppt würden, da sich noch viele Arten innerhalb dieses Prozesses befinden.
Verschärfend kommt hinzu, dass sich in den nächsten Jahrzehnten die Umweltbedingungen für viele nicht-einheimische Arten zu ihren Gunsten verändern werden. Viele dieser Arten stammen aus wärmeren Regionen, und die fortschreitende Klimaerwärmung dürfte ihre Etablierungs- und Ausbreitungschancen erhöhen. Die Lufttemperatur stieg in Europa in den letzten 20 Jahren um 1 °C, die Wassertemperatur im Rhein bei Basel nahm in den vergangenen 55 Jahren sogar um 3 °C zu (Baur & Schmidlin 2007). Mit fortschreitender Klimaerwärmung werden sich also noch mehr Neobioten etablieren können.
Warum werden Arten invasiv?
Bei einem Vergleich der ökologischen Situation einer invasiven Art im Invasionsgebiet mit der in ihrem Ursprungsgebiet fällt oft auf, dass diese Art sich in beiden Arealen unterschiedlich verhält. Oftmals ist sie in ihrem Ursprungsgebiet wenig auffällig, manchmal sogar selten, erreicht eine geringere Körpergröße oder Nachkommenzahl und weist keine auffällige Auswirkung auf ihre Umwelt auf. Im Invasionsgebiet kann die gleiche Art häufig und groß sein. Warum verhält sich die gleiche Art in beiden Gebieten so verschieden? In einer großen Zahl von wissenschaftlichen Studien wurde versucht, durch detaillierte Analysen bestimmte Merkmale herauszufiltern, durch die sich invasive Arten auszeichnen.
Insgesamt waren die Ergebnisse solcher Studien meist wenig hilfreich. Merkmale erfolgreicher Neophyten sind beispielsweise eine große Samenzahl, effiziente Ausbreitungsmechanismen, rasches Wachstum und starke Konkurrenzkraft. Für Tiere sind in ähnlicher Weise eine hohe Nachkommenzahl und gute Ausbreitungsmöglichkeiten wichtig. Generell etablieren sich eher anspruchslose Arten, die zudem eine bestimmte Affinität zum Menschen aufweisen, leichter und werden dann auch häufiger invasiv. Dies trifft beispielsweise auf Nutz- und Gartenpflanzen zu, auf Nutz-, Jagd- und Heimtiere sowie auf alle sonst mit dem Menschen verbundenen Arten. Bestimmte Wachstums- oder Lebensstrategien, die durchschnittliche Populationsdichte, Körpergröße oder Lebensdauer, die Ernährungsweise oder bestimmte Verhaltenskomponenten haben hingegen kaum Bezug zur möglichen Invasionsfähigkeit einer Art.
Klimawandel und invasive Arten
Die aktuelle, durch den Menschen verursachte Klimaveränderung und die Ausbreitung von nicht-einheimischen Arten sind zwei hochdynamisch ablaufende Prozesse, die verschiedene Ursachen haben. Dennoch sind ihr Verhalten und ihre Auswirkungen nicht völlig unabhängig voneinander, denn es mehren sich Anzeichen, dass viele Aspekte der Klimaveränderung nicht-einheimische und invasive Arten fördern.
Die natürlichen Verbreitungsgrenzen mancher Arten haben sich als Folge der Klimaveränderung verschoben. Zwar sind Arten hiervon positiv wie negativ betroffen, da viele invasive Arten jedoch eher tolerant gegenüber ihrer Umwelt sind, ergeben sich für diese mehr Vorteile. In Europa ist mit höheren Durchschnittstemperaturen zu rechnen, und dies bedeutet für viele nicht-einheimische Arten, dass sie leichter in Europa Fuß fassen können und dort auf größere Gebiete treffen werden, die ihnen klimatisch zusagen. Auch all die nicht-europäischen Arten, die sich bereits im Mittelmeergebiet etabliert haben, können sich nun leichter nach Mitteleuropa ausbreiten. Natürlich ist es auch mediterranen Arten leichter möglich, ihr Areal weiter nach Norden auszubreiten.
Mildere Winter ermöglichen eine erfolgreiche Überwinterung an Orten außerhalb des bisherigen Verbreitungebietes, z. B. bei Pflanzen oder Wirbellosen, aber auch ein Überleben außerhalb der bisherigen wärmebegünstigten Vorkommen in Gewächshäusern oder anderen Gebäuden. Daher haben nun invasive Arten, die bisher die wärmeren Innenstädte als Inselpopulation nutzten, mehr Möglichkeiten, ihr Areal an die Peripherie der Städte auszudehnen. Wärmere Sommertage verlängern die Reproduktionsphase und erlauben ausgedehntere Verbreitungsflüge etwa bei Insekten (Walther et al. 2009).
In den letzten beiden Jahrzehnten haben Meldungen über das Auftreten neuer Pflanzenschädlinge wie Fransenflügler (Thysanoptera), Blattläuse (Aphidoidea) oder Schildläuse (Coccoidea) stark zugenommen. In ähnlicher Weise werden auch Dipteren, vor allem Sandmücken (Phlebotominae) und Stechmücken (Culicidae) oder Spinnentiere (z. B. Zecken, Ixodidae) nachgewiesen, die eine Reihe von Krankheiten auf den Menschen und seine Nutztiere übertragen. Die meisten dieser Arten sind wärmeliebend oder werden durch die klimatischen Veränderungen begünstigt.
Daneben gibt es aber auch einige von Neobioten leicht zu besiedelnde Lebensräume. In erster Linie werden hier «gestörte» Lebensräume genannt, also Standorte mit hohem menschlichem Einfluss wie die Agrarlandschaft, Randstrukturen an Straßen, Kanälen und Eisenbahnlinien sowie der gesamte urbane Siedlungsraum. Natürlich gestörte Lebensräume wie Flussufer gehören allerdings auch in diese Aufzählung. Solche Bereiche zeichnen sich durch geringere Konkurrenz, hohe Ressourcendynamik, Nährstoffreichtum und wenig natürliche Gegenspieler aus.
Rein theoretisch bietet die Feindfreiheit im Invasionsgebiet einen guten Ansatz, um das invasive Verhalten einer nicht-einheimischen Art zu erklären. Im eigenen Ursprungsgebiet ist jede Art Teil eines langen, koevolutiven Geschehens. Sie hat spezielle Krankheitserreger und Parasiten, Feinde und Konkurrenten. Ein beträchtlicher Anteil der verfügbaren Ressourcen geht in die Verteidigung gegen diese zahlreichen Gegenspieler, sodass weniger Energie in eigenes Körperwachstum und vor allem in die Vermehrung investiert werden kann. Der neue Lebensraum, das zukünftige Invasionsgebiet, zeichnet sich durch das Fehlen all dieser speziellen Gegenspieler aus, ist also feindfrei. Die verfügbaren Ressourcen können vollumfänglich für Wachstum und Reproduktion eingesetzt werden, sodass viele invasive Arten im neuen Gebiet größer sind und mehr Nachkommen haben als in ihrem Ursprungsgebiet. Diese erhöhte Fitness ist dann die Grundlage für ihre invasiven Eigenschaften.
Invasive Arten wurden gelegentlich als prinzipiell überlegen gegenüber den einheimischen Arten bezeichnet. In dieser extremen Form trifft das sicherlich nicht zu, viele invasive Arten sind jedoch bemerkenswert unspezialisiert, sodass sie in vielen verschiedenen Lebensräumen existieren können. Auch der Besitz von «neuen Waffen» kann für invasive Arten förderlich sein, wenn die Konkurrenz im neu eroberten Areal diese noch nicht kennt. Hierunter verstehen wir beispielsweise chemische Inhaltsstoffe, die, über die Wurzel abgesondert, das Wurzelwachstum benachbarter einheimischer Pflanzen hemmen (Allelopathie), oder die, in die Blätter eingelagert, Fraßfeinde abhalten (sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe). Mit solchen Waffen kann in der Tat der Erfolg einiger nicht-einheimischer Pflanzen erklärt werden.
Andere Erklärungsmuster setzen bei der Struktur des Lebensraumes an. In naturnahen Gesellschaften, so wird angenommen, sind alle ökologischen Nischen besetzt, die Artengesellschaft ist gesättigt und neue, nicht-einheimische Arten können sich nicht etablieren. Dieser Ansatz erklärt beispielsweise, warum Waldökosysteme weniger invasive Arten aufweisen als die oben erwähnten gestörten Lebensräume oder warum manche artenreiche Ökosysteme geschützter gegen biologische Invasionen sind als artenarme. In diesem Zusammenhang spricht man auch gerne vom biotischen Widerstand, der dem Invasionsdruck nicht-einheimischer Arten entgegenwirkt. Insgesamt geben die zahlreichen theoretischen Ansätze wichtige Hinweise auf die Frage, warum einige nicht-einheimische Arten invasiv werden, beziehen sich aber immer nur auf bestimmte Lebensräume und Arten. Als Prognoseinstrument helfen solche Ansätze jedoch nur begrenzt. Eine gute Übersicht zu den theoretischen Ansätzen findet sich in Hufbauer & Torchin (2007).
Artenzahlen einheimischer und nicht-einheimischer Arten
In Deutschland leben mindestens 70 000 einheimische Arten, hierunter etwa 14 000 Pilzarten, 8000 Pflanzenarten und 48 000 Tierarten (Tabelle 2). Die tatsächliche Zahl kann durchaus um etwa 10 000 Arten höher sein, da einige Gruppen (u. a. Pilze, Einzeller, Nematoden) nach wie vor nur ungenügend erforscht sind. Für Österreich liegt die Gesamtzahl bei rund 67 500, und für die Schweiz gibt es keine vergleichbare Auflistung der dort vorkommenden Arten.
Die Zahl der nicht-einheimischen Arten in Deutschland beträgt 1935, in Österreich 1381, in der Schweiz 824 (DAISIE-Datenbank von Oktober 2009, www.europe-aliens.org). Auch hier ist die Dunkelziffer groß, da in vielen Gruppen der Erforschungsgrad immer noch gering ist. So gibt die NOBANIS-Datenbank beispielsweise für Deutschland 2269 und für Österreich 2038 nicht-einheimische Arten an (www.nobanis.org). Auf die Artenzahlen in Deutschland bezogen, machen die nicht-einheimischen Arten rund 3 % aus, je nach Organismengruppe ergeben sich jedoch höhere Anteile. So sind 7 % der Ringelwurmarten nicht einheimisch, bei den Mollusken 14 %, bei den Gefäßpflanzen 21 % und bei den Wirbeltieren 24 %. Bei der größten Tiergruppe, den Insekten, die 48 % aller Arten ausmachen, beträgt der bekannte Anteil an nicht-einheimischen Arten lediglich 1,7 %, ein deutlicher Hinweis auf Erfassungslücken. Ähnlich ist die Situation bei den Pilzen: Sie umfassen 21 % aller bekannten Arten Deutschlands, unter den nicht-einheimischen Arten stellen sie aber nur 0,3 % dar.
Tab. 2: Anzahl nicht-einheimischer Arten im Vergleich zu einheimischen Arten, kombiniert nach Wittenberg (2005) und DAISIE (2009). Die NOBANIS-Datenbank gibt für Deutschland 2269 und für Österreich 2038 nicht-einheimische Arten an (www.nobanis.org), die Daten sind wegen unterschiedlicher taxonomischer Untergliederung jedoch nicht einfach miteinander verrechenbar.
DAISIE
Im EU-Projekt DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe) arbeiteten 182 Wissenschaftler von 2005 bis 2008 zusammen, um europaweit Daten über das Vorkommen und die Verbreitung von Neobioten zusammenzutragen. Bis heute umfasst diese Datenbank rund 11 000 Arten von Mikroorganismen, Pilzen, Pflanzen und Tieren, die in den terrestrischen, limnischen und marinen Lebensräumen Europas vorkommen. Die artenreichste Gruppe stellen mit 53 % Pflanzen, mit 23 % folgen Wirbellose. DAISIE listet das Vorkommen dieser Arten länderweise für Europa und die angrenzenden Meeresgebiete auf und enthält Angaben über den Status, also ob eine Art als etabliert oder unbeständig gilt oder ob sie inzwischen wieder erloschen ist. Zudem werden, sofern vorliegend, Berichte über Schäden zitiert, und dann gilt die Art als invasiv. Dies trifft für etwa 12 % der erfassten Arten zu.
Bei Gefäßpflanzen und Säugetieren ist der Kenntnisstand über die Verbreitung und den Status nicht-einheimischer Arten relativ gut, bei anderen Gruppen wie Pilzen, Milben und Würmern aber noch mangelhaft. Veränderungen in der Anzahl der vorkommenden Neobioten können deshalb derzeit nur für wenige Organismengruppen dargestellt werden. Über die Zeitspanne der letzten 100 Jahre betrachtet, zeigen die Artenzahlen der in Europa auftretenden nicht-einheimischen Moose und Flechten, Gefäßpflanzen, terrestrischen Insekten und Säugetiere eine exponentielle Zunahme (DAISIE 2009). Dies dürfte vermutlich auch für andere taxonomische Gruppen zutreffen.
Auf der Basis dieser zentralen Datenbank hat DAISIE 100 der schlimmsten invasiven Arten Europas mit einem Steckbrief, Fotos und einer Verbreitungskarte vorgestellt. Zudem wurde eine Expertendatenbank erarbeitet, die bisher rund 1700 Experten aus 90 Ländern mit ihrem Profil erfasst hat. Die Daten von DAISIE sind in der Projektdatenbank (www.europe-aliens.org) frei zugänglich, erste Auswertungen sind in DAISIE (2009) enthalten.
Neue Wissenschaft
Lange herrschte auch in Wissenschaftlerkreisen kein Unrechts- oder Gefahrenbewusstsein, wenn nicht-einheimische Arten in einem neuen Lebensraum ausgesetzt wurden. Schließlich wies der britische Ökologe Charles Elton als einer der Ersten 1958 in seinem wegweisenden Buch «The ecology of invasions by animals and plants» auf das große Gefahrenpotenzial hin, welches von invasiven Arten ausgeht (Elton 1958). Die Invasionsbiologie hat sich in den letzten Jahrzehnten als eigener Wissenschaftszweig etabliert und befasst sich mit den ökologischen Auswirkungen von invasiven Arten auf die einheimische Biodiversität und den Möglichkeiten, diese zu kontrollieren.
Konkret geht es bei den wissenschaftlich untersuchten Fragen beispielsweise um Analysen der Ausbreitungswege nicht-einheimischer Arten, ihren Einfluss auf andere Arten im gleichen Lebensraum und um hierdurch verursachte Veränderungen in der Struktur von Ökosystemen. Da es auch um Möglichkeiten der Früherkennung von invasiven Arten geht, interessieren die Eigenschaften invasiver Arten und die besonderen Umstände, unter denen sie invasiv werden. Sicherlich wirken sich gewisse Veränderungen unserer Umwelt direkt auf nicht-einheimische Arten aus. Daher stellen die Auswirkungen von Landnutzungsänderungen und moderner Klimaveränderung besondere Forschungsschwerpunkte dar. Durch genaue Untersuchungen zur Ökologie invasiver Arten hoffen die Wissenschaftler, Ansatzstellen für eine Bekämpfung dieser Arten zu finden. Schließlich werden auch im Sinne einer Erfolgskontrolle die Auswirkungen von Maßnahmen gegen diese Arten analysiert.