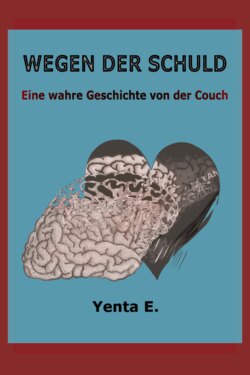Читать книгу Wegen der Schuld - Yenta E. - Страница 4
Teil I - Psychoanalyse
ОглавлениеIch nehme schräg vis-à-vis von Dr. Schneider Platz. Er ist das, was man einen gutaussehenden Mann nennt, Typ Lacoste, ungefähr so alt wie ich. Sieht sich meine Befunde an, fragt noch einmal nach meiner Vorgeschichte und will wissen, was ich beim Tod meiner Mutter empfunden hätte.
Meine Mutter war ein paar Tage vor Weihnachten auf einem Zebrastreifen von einem Auto überfahren worden und starb wenige Stunden später. Ich war damals knapp 17 Jahre alt, vollkommen unselbständig und ging noch in die Schule. Als am Abend der Anruf aus dem Spital kam, lag ich schon im Bett. Mein einziger Gedanke damals: Das ist nicht wahr. Und so hielt ich es auch weiter. Bei ihrem Begräbnis war ich davon überzeugt, dass alles nur ein Traum sei. War ich in der Schule, redete ich mir ein, sie sei zu Hause, war ich daheim, hielt ich an der Fantasie fest, sie sei eben zur Zeit außer Haus.
"Wie lange hat das gedauert?", fragt Dr. Schneider.
„Ein Jahr.“ Ich denke daran, dass ich Weihnachten nach diesem Jahr zum ersten Mal geweint habe und kämpfe schon wieder mit den Tränen.
Er erkundigt sich nach meinem Drogenkonsum.
Ich hatte Möglichkeiten, habe mich aber nie getraut.
Ob ich trinken würde.
Ich erzähle von Zeiten, in denen Alkohol zu meinen Grundnahrungsmitteln gehört hatte. Als ich zuerst nur mit Freunden trank, später auch vor dem Einschlafen. Ab dem Moment, als mir auffiel, dass Wein mein Schlafmittel geworden war, habe ich aufgehört, alleine zu trinken.
Wie ich meine Kindheit erlebt hätte?
„Beschissen“, und schon wieder steigen mir die Tränen auf.
Er geht nicht näher darauf ein und fragt, ob ich bereit sei, mich testen zu lassen. Ich stimme zu (habe nicht das Gefühl, vor die Wahl gestellt zu sein), er bringt mich zu einer Kollegin, mit der ich für die nächste Woche einen Termin vereinbare.
Während ich nach Hause gehe, denke ich über dieses Gespräch nach. Eigentlich hätte ich lieber mit einer Frau so eine Therapie gemacht. Ein bisschen jung der Bursche, bei dem ich da gelandet bin. Lernt wahrscheinlich selber noch. Und ein bisschen zu schön für meinen Geschmack – zu glatt. Aber für beides kann er eigentlich nichts. Für mich wird er wohl gut genug sein, denke ich mir schließlich.
Allerdings hat der Ort dieser Therapie einen Haken. In der gleichen Anstalt arbeitet auch Dr. Forens, ein guter Bekannter meines Mannes. Ich selbst kenne ihn nur von Erzählungen. Wahrscheinlich wird Dr. Schneider, sobald er mehr über mich weiß, auch mit Dr. Forens sprechen. Schon der Gedanke daran ist unangenehm.
Der Test dauert einen ganzen Vormittag. Beginnt noch einmal mit einer allgemeinen Befragung, auch nach meinem nächsten Ziel: Ich möchte endlich die Matura fertig machen.
Was nachher?
„Ich möchte die Matura fertig machen, dann will ich weitersehen.“
Interpretation des Rohrschach-Tests: Mir fällt zu jedem Bild nur eine Antwort ein. Einmal möchte ich sagen: ein Wurm, auf den man getreten ist. Mir kommt dieser Gedanke aber nicht über die Lippen, weil ich ihn brutal empfinde. Sekunden später habe ich ihn vergessen und sage, dass mir zu eben diesem Bild nichts einfällt. Zum Schluss werde ich noch gefragt, welches Bild mir das angenehmste war und welches das unangenehmste. Beim unangenehmsten zeige ich auf das Bild des „Wurms“.
„Warum?“
„Weil mir dazu nichts einfällt.“ Und in diesem Augenblick fällt mir wirklich nichts dazu ein.
Die Testerin fragt, ob ich dieses Bild bei mir zu Hause aufhängen würde. Ich denke kurz nach: „Ja, wenn‘s dazu passt.“
Sie fragt, wohin ich es bei mir daheim hängen würde.
„Bei uns passt es nicht dazu... In die Küche, dort ist es am hässlichsten“, korrigiere ich mich und sehe in ihr Gesicht, das sich schmerzhaft verzieht.
Sie gibt mir ein paar Mappen, setzt mich in den Flur an einen orangen Plastiktisch - niemand da außer mir – und erklärt mir die Aufgaben. Sagt, dass ich bei der Beantwortung der Fragen möglichst selten „ich weiß nicht“ wählen solle und lässt mich allein.
Weiter mit Bildfolgen, die logisch vollendet werden müssen. Ich finde das nicht besonders schwierig, habe aber Mühe, mich zu konzentrieren. Es sind Bilder in einer Plastikhülle, jemand hat unter jede Aufgabe eine Antwort graviert. Achtung, Falle!, denke ich und bemühe mich, das „Vorgedruckte“ nicht zu registrieren. Bis auf eine Folge durchschaue ich alle. Aber die eine? Hat kein System, ich finde es nicht. Drehe das Bild nach allen Seiten, nichts ist logisch. Nehme mir vor, später zu fragen.
Nächster Test: Essen Sie in Gesellschaft manierlicher als zu Hause? Sind Polizisten gute Menschen? Halten Sie Schiller für bedeutender als Goethe? Können Sie alles über Ihr Intimleben erzählen? (Können schon, die Frage ist doch, ob ich will! ) Gehen Sie gerne auf Partys? Fühlen Sie sich während dieses Tests geborgen?
Nächster Test: Je eine Zeile mit verschiedenen Wörtern, das orthographisch richtige ist anzustreichen: Rhythmus.
Nächste Frage: Machen Sie sich oft über unwichtige Dinge Gedanken? (Abstufungen von 1 bis 5). Langsam wird mir dieser Test zu blöd. Alles, worüber ich nachdenke, ist wichtig. Ich unterstreiche „nie“.
Sage, dass ich fertig bin. Sie wirft einen kurzen Blick auf den Bogen und sieht die markierten „ich-weiß-nicht“-Antworten:
„Diesen Test kann ich nicht auswerten.“
Sie bittet mich, die „ich-weiß-nicht“-Antworten noch einmal durchzusehen und mich nach Möglichkeit festzulegen.
Sind Polizisten gute Menschen? Ich kann weder Schiller noch Goethe lesen, treffe schließlich aber doch noch ein paar Entscheidungen - ihr zuliebe - und damit ist der Test verwertbar.
Zum Schluss frage ich nach der Ergänzungsantwort, die ich nicht gefunden habe.
„Das können Sie dann mit Dr. Schneider besprechen“, sagt sie und verabschiedet mich.
Dr. Schneider erkundigt sich nach meiner Beziehung zu Nina.
„Sie ist gesund.“
Er lacht, das klinge etwas lapidar.
„Das ist ja nicht selbstverständlich.“ Ich erzähle von der Angst, ein behindertes Kind zu bekommen: „Das hätte zu mir gepasst.“
UND IHRE EHE – GEHT WENIGSTENS DAS?
Ich hebe die Schultern. Sage, dass sich die Gewohnheit eingeschlichen hat. Und dass es für meinen Mann wichtig war, zu heiraten. Dr. Schneider nickt.
„Ich habe gewusst, das wird eine Ehe ohne Höhen und Tiefen. Und ich habe auch gewusst: Wenn jemand geht, so bin das ich. Das hat mir Sicherheit gegeben.“
Er erkundigt sich nach meinen finanziellen Verhältnissen. Mir bleiben zu meiner persönlichen Verfügung 1000 Schilling im Monat.
WIE OFT WOLLEN SIE IN DER WOCHE KOMMEN? ZEHN MAL?
Ich erschrecke: „Das sind ja jeden Tag zwei Mal!“
Er lächelt: DREI MAL IN DER WOCHE?
Er sagt, es sei weder für mich noch für ihn gut, wenn er die Therapie gratis machen würde und errechnet aus meinen 1.000 S den Stundensatz.
Das Honorar beträgt 100 S pro Stunde und wird auch berechnet, wenn ich von meiner Person her eine Stunde versäume.
Ich überlege, dass ich dann auch einen Babysitter bezahlen muss und bin einverstanden.
Dr. Schneider meint, er wisse nicht, wie er die Zeit unterbringen solle, eigentlich habe er keine, es werde aber irgendwie gehen. Er würde die Stunden von Woche zu Woche neu einteilen. Und ich habe das Gefühl, dass ich dankbar sein muss.
Ich erkundige mich schüchtern nach dem Test, er reagiert nicht, ich frage nicht mehr weiter.
Er erklärt, dass ich während der Therapie zu liegen hätte und alles sagen müsse, was mir einfallen würde.
„Und wenn mir nichts mehr einfällt?“
DAS IST EINES IHRER GRÖSSTEN PROBLEME, DASS IHNEN NICHTS MEHR EINFÄLLT.
Ich bin überrascht: „Warum?“
Er schaut weg: DAS IST SO MEIN GEFÜHL.
Die Umstellung beim ersten Kind könne sowohl für eine Frau als auch für einen Mann problematisch sein. Schwieriger noch für die Frau als für den Mann.
„Und beim zweiten Kind?“
BEIM ZWEITEN NICHT SO SEHR.
„Aber andere schaffen das ja auch.“
SIE SCHAFFEN ES JA AUCH.
Ich solle mir bis nach Ostern noch einmal überlegen, ob ich mit ihm könne. Er wäre nicht böse, wenn ich anriefe und sagte, ich käme nicht.
Ich betrachte diese Therapie als meine letzte Chance und habe mich bereits jetzt dafür entschieden.
In der Zeit bis zur ersten Stunde hole ich ein paar Bücher aus der Bibliothek zum Thema Analyse. Lese in Therapiebüchern, dass das zentrale Problem der Depressiven die Schuld sei, fühle, dass meine Verfassung mit meiner Kindheit zusammenhängt und weiß, dass die Therapie die Aufgabe hat, mir Dinge bewusst zu machen, die ich verdrängt statt erledigt habe.
Ich gehe auch in eine medizinische Buchhandlung und erkundige mich nach einem Buch über Auswertungen des Rohrschach-Tests, man bringt mir einen kiloschweren Wälzer. Ich frage erst gar nicht nach dem Preis und setze mich damit an einen Tisch. Die Materie wirkt kompliziert. Ich habe nicht viel Zeit und überfliege Abschnitte, denen ich zumindest inhaltlich folgen kann. Da steht etwas von der Notwendigkeit eines ausgewogenen Verhältnisses von Ganzheits- zu Teilantworten. Ich habe nur Ganzheitsantworten geliefert. Dann lese ich, wie viele Antworten Personen unterschiedlichen Bildungsniveaus anführen und stelle fest, dass ich nicht einmal auf die Anzahl des Hilfsarbeiters gekommen bin. Von den Vulgärantworten habe ich keine einzige ausgelassen. Das genügt, ich gebe das Buch zurück.
Ich möchte von Dr. Schneider wissen, wie meine Heilungschancen stehen.
DAS WEISS ICH NICHT.
Ich frage vorsichtig: „50 zu 50?“
DAS WEISS ICH NICHT, wiederholt er.
„Werden Sie mir sagen, was ich machen soll?“
Er antwortet, es sei mein Leben, er würde mir überhaupt nichts raten. Sagt noch einmal, dass ich mir nichts erwarten dürfe.
Zu Hause beginne ich mir vorzustellen, liegend alles zu erzählen und fühle mich jetzt schon ausgeliefert. Wem eigentlich? Mir selbst? Ich sage mir: Ich mache das für mich, ich will wieder gesund werden, nicht mehr ununterbrochen grundlos weinen.
Dass meine Handschmerzen mit meiner Verfassung zusammenhängen, kann ich eigentlich nicht glauben. Das wäre dann ja Einbildung. Allerdings, bis jetzt hat nichts gegen die Schmerzen geholfen, im Gegenteil: Es wird immer schlimmer. Ich wache bereits kurz vorher, gegen vier Uhr früh, auf und denke: Nein, heute bitte nicht. Und dann beginnen sie: Erst die linke Hand, krampft sich zusammen bis zum Ellenbogen, später auch die rechte. Ich beiße die Zähne zusammen, damit Peter neben mir nicht aufwacht. Manchmal wacht er auf und fragt: „Hast du wieder Schmerzen?“ Dann schläft er weiter und ich wimmere wieder. Ich habe Angst, dass Nina aufwacht, dass ich sie aus dem Bett nehmen muss und nicht kann, weil ich nur Schmerzen, aber keine Hände fühle. Jeden Morgen, nachdem ich aufgestanden bin, ist dann alles wieder vorbei. Der Rheumatest ist einmal positiv. Mein praktischer Arzt hat gesagt: „Wäre es Rheuma, müsste es auch tagsüber weh tun.“
Tagsüber ist alles um mich grau und ich spüre nur die Verpflichtung, für Nina, die jetzt ein halbes Jahr alt ist, da zu sein.
Immer wieder versuche ich für mich allein, die Therapie zu beginnen. Spüre, dass ich über bestimmte Dinge nicht reden kann, noch nie gesprochen habe. Alles, was mir im Moment einfällt, kann ich nicht sagen, nicht einmal, wenn ich alleine im Zimmer bin. Ich nehme ein großes Blatt, schreibe auf und versuche zu lesen. Einmal, zweimal. Streiche alles wieder durch und vernichte das Papier. Weiß, dass ich nicht darum herumkommen werde, wenn ich die Therapie machen will.
Ich überlege eine Strategie: Ich werde reden, als ob mich das Ganze nicht betreffen würde. Der hinter mir kann mir egal sein. Ich werde so tun, als ob ich über jemand Dritten berichten würde, und ich muss ja nicht gerade mit dem Schlimmsten anfangen...
Und dann liege ich zum ersten Mal auf der Couch: kleiner weißer Polster, hart. Schaue vorsichtig, ob mein Kleid verrutscht ist, lege die Beine übereinander, falte die Hände über dem Bauch und halte mich fest.
Hinter mir sitzt Dr. Schneider und erklärt noch einmal die Regeln.
ES WIRD EINE ZEITLANG DAUERN, BIS WIR WISSEN, WORUM ES GEHT. FANGEN SIE AN.
Ich beginne mit meinem Mann, mit dem ich seit zwei Jahren verheiratet bin. Den ich durch eine Annonce kennengelernt habe, weil ich anders nicht fähig bin, Kontakte zu Männern herzustellen. Ich empfinde das als Armutszeugnis und es kostet mich große Überwindung, darüber zu sprechen. Erzähle, wie ich ihn das erste Mal „mit einem gelben Buch“ getroffen habe, nach einer Geigenstunde. Verkrampft, er noch mehr als ich: starrer Gesichtsausdruck, viel Gestik. Er hatte mir auf einer hübschen Karte geschrieben, er wolle sich nicht anpreisen.
Gebe ihm widerwillig meine Telefonnummer und sage, dass ich für ein paar Tage wegfahre und mich melden werde, wenn ich wieder zurück bin. Denke mir: nein, der nicht. Steige ins Auto, sehe ihm nach und denke noch einmal: nein.
Der erste Anruf nach meiner Rückkehr ist von ihm. Mir ist langweilig: üben, Theater, Geigenstunde, üben. Dazwischen Heuriger, üben, Theater. Er kennt meine Adresse, kommt unangemeldet und bringt Obst. Ich bin verärgert und gerührt. Obst habe ich noch nie bekommen. Schmuck ja, aber Obst? Wir fahren an den Waldrand, er kennt dort einen hübschen Heurigen. Die Heurigen, die ich kenne, sind alle in der Innenstadt, nahe der Musikhochschule. Er trinkt Mineralwasser und ein Achtel Wein, nippt vorsichtig, ich bin längst mit meinem Viertel fertig. Zahlen. Er zahlt. Es ist mir unangenehm, wenn man für mich bezahlt. „Das nächste Mal zahle ich.“ Er nickt. Wir reden über Belangloses, ich empfinde immer nur seine Starrheit.
So geht es weiter, er ist mein hartnäckigster Verehrer. Alle anderen, die sich auf meine Anzeige gemeldet haben, habe ich nur einmal gesehen, gesagt, ich melde mich. Er meldet sich immer wieder. Ich bin hilflos. Kann nicht sagen, dass ich ihn nicht mehr sehen möchte, weiß nicht, wie ich ihm das anders deutlich machen könnte, will ihm nicht wehtun.
So vergeht der Sommer. Er bringt Bücher und Obst. Manchmal, wenn ich vermute, dass er anruft, lege ich einen Polster übers Telefon. Es läutet im Halb-Stunden-Abstand.
An einem Montag Abend – Montag ist mein freier Tag – stehen wir unten an der Ecke des Hauses. Seine Küsse sind immer brüderlich gewesen. Er fragt, ob er noch hinaufkommen kann. Der traut sich nie, bin ich überzeugt, und stimme zu.
Oben setzt er sich in den Sessel und wartet ab. Wie kriege ich ihn wieder hinaus? Es ist schon spät. Er sagt, "wir könnten ein Stück Weges gemeinsam gehen", macht mir einen Heiratsantrag. Ich grinse innerlich: Vorher wollte mich noch nie jemand heiraten. Er erzählt, dass er vor mir vier Freundinnen gehabt hat, ich habe längst aufgegeben, meine Männer zu zählen. Ich reiße mein Bett auf, jede Geste abweisend - er traut sich doch. Die Matratze ist schmal, ich schlafe schlecht. Mache schnell ein Frühstück, erkläre, dass ich üben muss und bin froh, als er wieder geht.
So verbleiben wir weiter: Ich halte mich auf Distanz. Ein paar Freundinnen haben ihn gesehen, sie sagen nichts. Peter ist nicht besonders attraktiv, nicht besonders gewandt im Gespräch, nicht besonders witzig.
Ich frage ihn nach der Narbe auf seiner linken Brustseite: „Ich war schwer verletzt, wäre fast gestorben.“ Mitleid.
Wenn wir zum Heurigen gehen, hole jetzt ich die Gläser, weil seine linke Hand von diesem Unfall schwächer geblieben ist und leicht zittert.
Es ist Herbst, wir sind bei mir daheim. Ich habe mir fest vorgenommen: Heute sage ich ihm, dass ich nicht mehr will. Heute. Aber wie? Sitze auf einem Sessel, mit dem Gesicht zum Fenster. Er, neben mir auf dem Bett, fragt: „Würdest du mir etwas Schlimmes zutrauen?“
Ich erkläre, dass ich grundsätzlich jedem alles zutraue und spüre seinen Ärger.
Nun erzählt er von sich: Hat ein Mädchen umgebracht, anschließend Selbstmord versucht, wurde gerettet.
Ich bin wie gelähmt: Um Gottes Willen, ich habe doch selbst so viele Probleme!
Muss in einer halben Stunde ins Theater, spiele rein mechanisch, weiß nicht, was. Denke immer nur darüber nach, wie man jemanden umbringen kann.
12 Jahre Gefängnis.
Schluchze, während ich das Dr. Schneider erzähle. Meine Bekannten und Verwandten wissen nichts über Peter. Wie sollen wir Nina einmal erklären, wer ihr Vater ist? Und wann?
DA HAT SICH EINIGES ANGESTAUT, NICHT? Dr. Schneiders Stimme klingt ganz normal. WAS HAT DENN ZU DIESER TAT GEFÜHRT?
„Das weiß ich nicht, er spricht nicht darüber.“
Jetzt erzähle ich noch von meinem Vater, der mich einmal ins Bett geholt und sich auf mich gelegt hat, als ich 14 Jahre war. Ich habe damals nur etwas Hartes gespürt. Er entließ mich mit der Ermahnung: „So etwas darfst du aber nicht mit Buben machen.“ Als ich aus dem Zimmer kam, stand meine Mutter neben der Türe vor einem offenen Kasten.
Die Erinnerung ist nur schemenhaft.
Wer weiß, ob mir das geglaubt wird, überlege ich und denke daran, dass Freud solche Erzählungen als Fantasien qualifiziert hat.
WEISS IHR MANN VON IHREM VATER?
„Nein.“
Ich habe bis jetzt noch nie mit jemandem darüber gesprochen, kann mit niemandem darüber sprechen. Habe mir gedacht, in einer anderen Kultur wäre das alles nicht so schlimm, und: Es ist ja nichts passiert.
Während ich daliege, erinnere ich mich, dass meine Mutter eine Zeitlang mit meinem Bruder und mir in den Wald spazieren gegangen war. Mein Bruder war damals drei Jahre, ich sechs. Unsere Mutter war immer ein Stück voraus, ich bemühte mich, Schritt zu halten, mein Bruder war der Letzte. Bei diesen Spaziergängen hatte ich oft das Gefühl, wir beide seien Hänsel und Gretel, meine Mutter wolle uns aussetzen.
Einmal hat sie meinen Bruder verloren. Es war an einer felsigen Stelle, sie rief ihn sehr laut und hatte offenbar Angst. Ab diesem Zeitpunkt habe ich gewusst, dass wir nicht Hänsel und Gretel waren.
WIE HEISST DENN IHR MANN?
„Peter.“
WEISS PETER, WIE ES IHNEN GEHT?
„Nein.“
Dass Dr. Schneider nun „Peter“ sagt, ist für mich eine Vertraulichkeit, die ihm eigentlich nicht zusteht. Für ihn ist Peter „mein Mann“ und so würde ich es auch lieber belassen. Vielleicht ist es aber auch nur Wortklauberei. Für jemanden, der nicht besonders gerne spricht, bedeutet „Peter“ im Vergleich zu „mein Mann“ immerhin die Ersparnis eines Wortes.
"Peter war in einer Sonderanstalt. Er hätte dort Psychoanalyse machen können, wollte aber nicht."
Ich gebe mir einen Ruck:
„Peter sagt, alle Psychologen sind Idioten.“
Jetzt wird ihn Schneider schon im Vorhinein nicht mehr mögen.
Schneider sagt nichts.
„Er hat sich einmal darüber gewundert, dass alle seine früheren Freundinnen depressiv waren.“
WARUM WAR DAS SO?
„Wegen der Schuld.“
JA.
Peter ist begnadigt worden. Ich habe ihn gedrängt, das Gesuch dafür einzureichen, er wollte nicht und hat auch nicht geglaubt, dass es bewilligt würde. Dr. Forens hat ihn dabei unterstützt und gesagt, falls er nicht gerade Chef der VOEST werden wolle, sei seine Tat nun vergessen. Anfangs war ich über diese Begnadigung sehr froh. Dass es überhaupt keinen Unterschied macht, ob Peter sie hat oder nicht, habe ich zu spät erkannt.
Die Stunde ist vorüber, ich verabschiede mich und gehe.
Zweite Stunde. Heute komme ich nicht darum herum: ALLES erzählen, alles.
Ich sage, dass ich nicht kann.
WARUM?
„Weil ich eine andere Vorstellung von mir habe als der Inhalt dessen ist, worüber ich reden soll.“
SIE MACHEN DAS NUR FÜR SICH.
Ich weiß das, und ich bin wütend über mich. Schneider hat doch sowieso schon alles gehört, ihm kann das doch egal sein. Liege ganz verkrampft da und versuche in Gedanken das, was ich hervorbringen will, zu buchstabieren.
Schneider will helfen und fragt, ob es darüber Statistiken gibt.
„Das weiß ich nicht.“
Nach zirka einer Viertelstunde habe ich den Satz heraußen:
„Ich habe mich prostituiert.“ Geschafft.
Schneider will Einzelheiten wissen, ich erzähle:
„Oldie“ war 84 Jahre, ehemaliger (deutscher) Politiker und gab mich als seine Sekretärin aus.
Ich war mit ihm in Kanada, er besaß dort ein paar Wälder. Legte sich auf mich (ich musste mich vorher ausziehen) und sagte dann: „Du bist mein Pferdchen, musst alles machen, was ich sage."
Ich war auch bei ihm zu Hause und musste seine Memoiren tippen. Er hatte ein liebe Frau, mit der ich mich gut verstand. Und er hatte eine geschiedene Tochter, die Alkoholikerin war und den größten Teil des Jahres in einer Nervenheilanstalt verbrachte. Ihre zwei Söhne wuchsen bei ihm und seiner Frau auf, für die Tochter musste er ebenfalls aufkommen. Die Toleranz, die er ihrer Krankheit entgegenbrachte, passte nicht zu seinem übrigen Wesen und machte mich misstrauisch.
Einmal erzählt er von ihren Briefen, dass sie immer das Gleiche schreibe, sie gehe ihm auf die Nerven. Als er mittags schläft, suche ich die Briefe. Sie schreibt aus dem Krankenhaus, dass sie den Ärzten gerne von seiner Vergewaltigung erzählen würde, sie traue sich aber nicht.
Ich schreibe den Brief ab und schicke ihn ihrem Arzt. Man überreicht ihr diesen Brief mit der Versicherung, niemand hätte ihn gelesen.
Ich erhalte von Oldie ein Schreiben, in dem er mich wüst beschimpft: Er habe immer schon gewusst, welch mieser Charakter ich sei, ich solle ihm die Adresse meiner Verwandten mitteilen. Ich schreibe zurück, er könne die Anschrift dem Telefonbuch entnehmen, meine Angehörigen seien vermutlich sehr interessiert.
Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört.
Mir fällt etwas anderes ein und ich rede schnell weiter.
Meine Schwester hat mir meinen Erbteil ausbezahlt (und dabei gut abgeschnitten). Es war dies ihre Idee und ich war froh drüber. Ich hatte damals gerade mit dem Studium begonnen, musste mich alleine erhalten und dachte, dass dies der Grund sei, weshalb ich nichts weiterbrachte. Einmal sorglos leben, nicht unterm gestohlenen Weihnachtsbaum mit meiner Freundin Keks und Senf bei + 5 Grad essen, weil die Sicherungen von meinem Vater herausgedreht wurden und die Heizung streikt. Mit den 360.000 Schilling sich fühlen wie Rothschild, zumindest drei Jahre lang.
Mit dem Rest des Geldes ziehe ich nach Wien. Was nun? Mit dem Studium bin ich noch lange nicht fertig, ich möchte aber immer noch nur Musik machen. Sehe mir Anzeigen in Zeitungen an: Studentinnen suchen großzügige Unterstützung. Warum nicht auch ich?
WAS IST DENN IN IHRER ANZEIGE GESTANDEN?
Die Frage erschreckt mich so, dass ich mit dem ganzen Körper zusammenzucke.
„Muss ich das sagen?“
DAS MÜSSEN SIE SELBST ENTSCHEIDEN:
Ich entscheide mich dafür, dass ich es nicht sagen muss.
Die Stunde ist zu Ende. Ich bin froh darüber, setze mich auf, schlüpfe in meine Schuhe und verabschiede mich, ohne Schneider anzusehen.
In der dritten Stunde muss ich vom zweiten Mann erzählen.
Er schreibt mir, er sei Witwer. Wir treffen einander am Bahnhof, wo er seine Geschäftspost aufgibt und fahren nach Grinzing. Er ist sehr dick, glatzig, an der linken Hand fehlen ihm vier Finger.
Ein alter Nazi. Erzählt von seiner Frau, die – viel jünger als er – voriges Jahr an Krebs gestorben ist. Weint. Mitleid.
Hat eine neue Wohnung genommen, weil ihn die alte an so viel erinnert. Er bittet mich, ihm Vorhänge montieren zu helfen. Das Gespräch beim Heurigen und das Aufhängen der Vorhänge bringen 4.000 S. Damit kann ich einen Monat leben.
Die Besuche beim Heurigen sind mir zuwider, weil er sich jedes Mal besäuft. Er will mich an seiner Handelsvertretung beteiligen, fährt an manchen Tagen mit mir in Geschäfte und zeigt mir, wie man verkauft.
Seine Impotenz erklärt er mit seiner Zuckerkrankheit.
Als ich den Job beim Theater bekomme, möchte ich diese Beziehung beenden, weil ich von seinem Geld nicht mehr abhängig bin und sehe ihn nur noch manchmal, Montag abends. Die Heurigen gehen mir auf die Nerven, seine Kriegslieder noch mehr.
Er will mich heiraten, sagt, ich könne Männer daneben haben, so viele ich wolle. Geld spiele keine Rolle, er könne mir ein angenehmes Leben bieten.
Er tut mir leid, darauf kann ich nicht eingehen.
Einmal ruft er mich nachts an, ich schlafe längst:
„Brauchst du 4.000 S?“
„Nein, brauche ich nicht“.
„Wir sehen uns vielleicht nie mehr“, stottert er besoffen durch die Leitung.
„Aber ja, wir sehen uns sicher wieder.“ Ich lege auf und ärgere mich, dass er mich aufgeweckt hat.
Nach Wochen ruft mich sein Geschäftspartner an. Ich frage ihn höflichkeitshalber, wie es R. gehe, von dem ich schon lange nichts mehr gehört habe. „Der hat sich umgebracht“, erzählt der nunmehrige Ex-Partner und ist sehr erstaunt, dass ich das nicht weiß.
„Am Abend davor hat er sich noch von einer Frau mit zwei Kindern 4.000 S ausgeborgt.“
DIE WÄREN FÜR SIE GEWESEN.
„Ja.“ Ich spüre einen Brechreiz und frage, wo die nächste Toilette ist.
SIE VERACHTEN SICH.
„Ja.“
„Ich habe den Männern kein Glück gebracht.“
Nun habe ich es hinter mir, nun gibt es nichts mehr, das ich fürchte.
„Jetzt kann nicht mehr viel sein“, sage ich und lege die Beine zum ersten Mal nebeneinander, aber nur kurz.
WER WAR DENN SCHULD AM TOD IHRER MUTTER?
„Sie selbst, sie war ein Verkehrshuhn.“
EIN VERKEHRSHUHN
„Wenn sie über die Straße gegangen ist, haben links und rechts die Bremsen gequietscht.“
SELBER SCHULD.
Schneider fragt, was ich wohl meine, wie er über mich dächte.
„Sie haben sich das alles wohlwollend anzuhören und müssen so tun, als würden Sie alles verstehen.“
NATÜRLICH VERSTEHE ICH ES, sagt er empört.
Oje, jetzt habe ich ihn beleidigt.
„Ich verstehe das ja selber alles nicht.“
Ich erlebe meinen ersten bunten Traum. Bis jetzt habe ich nicht gewusst, dass man färbig träumen kann.
Ich stehe in einer Telefonzelle und telefoniere. Vor der Zelle steht Oldie. Als ich wieder hinausgehe, sehe ich ihn gerade noch weglaufen. Dann gehe ich über eine grüne Wiese mit Blumen, die Farben sind viel intensiver als in Wirklichkeit. Ich gehe an einer Pferdekoppel vorbei und über die Brücke eines Baches.
IHRE TRÄUME WERDEN SCHON BUNT.
„Und wie kriege ich das ins Leben?“
Schneider gibt keine Antwort.
Ich denke an die Zeit, als ich mir alle meine damaligen materiellen Wünsche hätte erfüllen können: Es ging mir schlecht und mir gefiel überhaupt nichts.
„Zur Zeit teile ich mein Leben in zwei Abschnitte: Den, bevor ich das Geld hatte und den, nachdem ich keines mehr hatte."“
SIE MEINEN DIE ABLÖSE VOM HAUS.
Daheim geschieht alles mechanisch. Ich muss dauernd über mich nachdenken, sehne die Stunden herbei, in denen Nina schläft. zwinge mich zu jedem Handgriff, bin verwirrt und erzähle von meiner Verwirrtheit.
BEI UNSERER BEZIEHUNG?
Beziehung? Ich habe keine Beziehung zu ihm, ich möchte keine Beziehung. Ich will Therapie machen.
Manchmal beginnen sich meine Gedanken zu überschlagen und ich habe das Gefühl, als ob ein ganzer Lichterbaum in mir aufginge.
Meine zwei besten Freundinnen haben geheiratet und sind ins Ausland gezogen, alle haben mich verlassen.
Was für eine Enttäuschung muss ich als drittes Mädchen für meine Eltern gewesen sein.
Warum habe ich den Brief von Oldies Tochter weitergeleitet? Das wäre mich doch nichts angegangen.
Ich habe Peter geheiratet, weil ich mir gedacht habe, der ist noch schlechter als ich.
VIELLEICHT MÜSSEN SIE SO LEIDEN. MANCHES WIRD SO STIMMEN, WIE SIE ES SEHEN, MANCHES WERDEN SIE REVIDIEREN MÜSSEN. DA IST JA NOCH VIEL UNBEWUSST. WIR HABEN VIEL ZEIT.
Während ich daliege und erzähle, verkrampft sich oft mein ganzer Körper. Ich bin verspannt bis in die Zehenspitzen, bin mir selbst unangenehm, habe immer die Uhr im Auge.
Ich ging noch in die Volksschule und war an einem späten Nachmittag auf dem Weg vom Turnverein nach Hause. Es war schon finster und ich hatte Angst. An der letzten Straßenecke war mir, als ob ich einen Schatten gesehen hätte, der hinter dem Sandstreukasten verschwunden war. Die Straße war schlecht beleuchtet, weit und breit kein Mensch. Ich überlegte: Um den Weg an diesem Kasten vorbei zu meiden, gab es zwei Möglichkeiten: Eine Abzweigung durch den Wald, und eine Abzweigung durch die Stadt, die allerdings wesentlich länger war. Im Wald war es noch finsterer als hier, diese Lösung war nur eine theoretische. Während ich noch überlegte, kam jemand vorbei und fragte, ob ich Angst hätte, ob er mit mir gehen solle. Ich hätte damals nie zugegeben, Angst zu haben und entschloss mich für den Umweg durch die Stadt. Als ich dann endlich die Gartentür öffnete, um das letzte, vollkommen dunkle Stück zum Haus zu gehen, war die Angst vergessen. Und während ich über die Gartentreppen zur Haustür ging, sprangen hinter einer Mauer meine Schwester und deren Freundin von beiden Seiten gleichzeitig mit einem „Hu“ hervor.
Ich war zuerst steif vor Schreck und konnte mich überhaupt nicht rühren. Dann lief ich ins Haus und die Treppen hinauf in die Küche.
Und während ich das erzähle, habe ich wieder das zugeschnürte Gefühl von damals in der Brust und bekomme keine Luft.
Oben, in der Küche, wo meine Mutter und meine Großmutter saßen, schrie ich dann. Ich schrie so lange, bis ich nicht mehr konnte.
SIE HABEN EINEN SCHOCK GEHABT.
Meine Mutter las und blickte kaum auf. Getröstet hat mich damals niemand.
Schneider hat gesagt, er hätte wenig Zeit. Der letzte Rest meines Stolzes besteht darin, dass ich peinlich darauf bedacht bin, keine Minute länger zu bleiben als mir zusteht.
Schneider hat gesagt, ich sei sehr empfindlich.
Ich habe einen schlimmen Traum: Peter vergewaltigt Nina, so wie sie jetzt ist, als Baby. Ich liege daneben, weine und bettle, dass er aufhört. Er macht weiter, dreht sich zu mir und sagt, ich soll nicht so empfindlich sein.
Ich weine, als ich das erzähle. „Mein Mann kann da nichts dafür.“
NEIN. Schneider meint, dass Nina ich selbst sei.
JETZT VERFLGT SIE DAS SCHON BIS IN DEN TRAUM. UND IHRE MUTTER HAT AUCH NICHT AUF SIE AUFGEPASST.
„Ich habe eine Katze gehabt.“ Schon wieder rinnen mir die Tränen herunter.
Ich hatte sie in der Auslage einer Tierhandlung gesehen. Sie war die einzige rote in einem Knäuel von jungen Katzen, es war Liebe auf den ersten Blick. Mit meinem Theatervertrag hatte ich das Gefühl, dass ich nun sesshaft und „reif“ genug für ein Haustier war. Ich hatte „Tiger“ gerade eine Woche, als ich in die Wohnung kam und ihn wie gelähmt, kläglich miauend, vor der Tür fand. Vollkommen ratlos packte ich das Tier in den Transportkorb und fuhr damit zum Arzt. Dieser stellte schwere Rachitis fest und verpasste eine Injektion und hochwertige Nahrung.
Tiger genas zu einer Prachtkatze, wir tolerierten einander absolut. Er schlief in meinem Geigenkasten, während ich übte und ich fand es selbstverständlich, dass nur der Samt dieses Kastens würdig war, seine Krallen zu schärfen.
Als ich zu Peter zog, war die Katze kein Thema. Er hatte zwar öfter gesagt, er finde dieses Tier reichlich verwöhnt, nachdem es aber mein Tier war, sah ich darin kein Problem. Die Schwierigkeiten begannen bald nach meinem Umzug: Es stellte sich heraus, dass meine männlichen Mitbewohner aufeinander eifersüchtig waren. Wenn ich daheim war, hatte Tiger die Oberhand. Kam Peter in seine Nähe, musste er immer damit rechnen, einen Kratzer abzukriegen. Wenn ich nicht da war – sagte Peter – war die Katze „wie vom Erdboden verschwunden“. Als ich einmal krank im Bett lag, saß Tiger, der das nicht registriert hatte, den ganzen Abend unter dem Tisch und knurrte.
Eines abends kam ich heim, Peter empfing mich mit unheilvoller Miene, keine Spur von meinem Kater, der mich sonst jedes Mal begrüßte. Peter klagte, das Tier habe seine Lieblingsvase, eine unersetzliche Antiquität, zerbrochen und zeigte mir die Scherben. Ich ging durch die Wohnung und fand in einer Ecke meine völlig verschüchterte Katze. Nach und nach kam es heraus: Peter hatte Tiger racheerfüllt mit dem Besen durch die Wohnung gehetzt. Dabei verlor Tiger offenbar aus Angst auf seiner Flucht Kot. Peter wurde darauf noch wütender und verfolgte ihn umso mehr. Er gab auch zu, ihn geschlagen zu haben.
In dieser Nacht schlief ich in einem anderen Bett und fasste den Entschluss, wieder in meine Wohnung zurückzukehren. Als ich am nächsten Tag mit einer Freundin darüber sprach, fragte sie verwundert: „Du stellst ein Tier über einen Menschen?“ Sie erzählte, wie sehr sie den Hund ihres Mannes gehasst hatte, vor dem sie nur dann keine Angst hatte, wenn sie ihn füttern musste.
Darauf beschloss ich, die Angelegenheit anders zu lösen. Mit Peter wollte ich Tiger nie mehr alleine lassen. Ich brachte den Kater zu meiner Schwester, „zu guten Leuten aufs Land“. Dort verweigerte er ein paar Tage die Nahrungsaufnahme, entdeckte schließlich die Natur und führte ein kurzes, aber aufregendes Katzenleben.
Mit Peter habe ich darüber nicht mehr gesprochen, verziehen habe ich ihm das nie.
ES WIRD SCHON EINEN GRUND HABEN, WESHALB SIE SOLCHE ANGST VOR AGGRESSIONEN HABEN.
Ich sitze daheim am Küchentisch und denke nach. Grüble über meinen Vater, über die Therapie. Plötzlich geschieht etwas, das ich vorher noch nie erlebt habe:
Ich steige aus mir heraus und lasse mich am Tisch sitzen. Vor mir habe ich ein Kreuz, dann bin ich Gott. Unter mir nur Schutt und Asche. Ich sehe alles. Nein, sage ich mir, genug, bis hierher und nicht weiter. Nun bin ich wieder da und sitze am Küchentisch. Bin noch verwirrter als vorher und habe Angst. Verstehe nicht, wieso mir so etwas passieren kann. Mir, die an nichts glaubt, am allerwenigsten an Gott. Nicht denken, nicht denken ...
Am nächsten Tag muss ich vor meiner Therapie bei Schneider noch in die Gruppe. Ich habe beide Therapien ungefähr gleichzeitig begonnen. Schneider hat gemeint, man könne nur eine Therapie machen, ich habe darauf Dr. Huber angerufen und wollte mich von der Gruppe abmelden. Dr. Huber wiederum sagte, die Gruppentherapie sei ohnehin bald zu Ende, ich solle Schneider fragen, ob ich sie fertig machen könne.
Die Gruppe hat ursprünglich aus 12 Personen bestanden, ziemlich viel Elend auf einem Platz. Nach und nach sind es immer weniger geworden. An einem Tag sind wir nur noch drei. Ich habe meinen Platz neben einer Frau, die altersmäßig meine Mutter sein könnte und Probleme mit ihrem Sohn hat. Ich fühle mich auch in der Gruppe nicht wohl und habe das Gefühl, dass ich nichts Positives beitragen kann. Muss jedes Mal mitweinen, wenn jemand weint und werde Verweigerer genannt, weil ich kaum den Mund aufbringe.
Ich erzähle über mein Erlebnis in der Küche. Meine Befürchtungen, dass man mich auslachen wird oder sagen, ich sei verrückt, gehen nicht in Erfüllung. Helfen kann mir aber auch niemand.
„Was geschieht mit der Schuld?“, frage ich Dr. Huber. „Nimmt sie der Therapeut auf sich? Und was macht er damit?“
Und in diesem Augenblick sehe ich Charlie Chaplin im Film „Der große Diktator“ vor mir, als er die Weltkugel tanzen lässt und stelle mir vor, dass Schuld etwas ist, womit man jonglieren kann, zumindest theoretisch.
Dr. Huber beantwortet meine Frage nicht. Er fragt an diesem letzten Tag, was ich von der Gruppe profitiert hätte. Ich denke kurz nach und sage, dass ich, weil ich neben dieser Frau sitze, wohl noch immer meine Mutter suche.
Dr. Huber sagt, dass ich die Einzige gewesen sei, die sich abgemeldet habe, und dass ich die Gruppe in ihrem Rest zusammengehalten hätte. Er hoffe, dass mir die Gruppe nicht mehr geschadet als genutzt hätte (ich fühle mich nicht geschädigt).
„Das, was man über andere sagt, erzählt man über sich selbst. Was man von der Vergangenheit erzählt, ist auch heute noch aktuell. Die analytische Situation kann man jedoch nicht im Alltag anwenden. Sie sind bei Dr. Schneider in guten Händen.“
Der Rest der Gruppe will anschließend noch in ein Lokal gehen. Ich habe Angst und verlasse den Raum, ohne mich zu verabschieden.
„Ich habe gestern halluziniert“, sage ich, während ich auf der Couch liege.
DAS IST ABER SCHLECHT, kommt die Antwort von hinten.
Ich erzähle das Ganze noch einmal und spüre wieder die Angst. Ich glaube, dass ich schnell ein Medikament brauche. Ich habe so ein unsicheres Gefühl über mich selbst.
STEHEN SIE AUF.
Schneider bietet mir den zweiten Sessel an, sperrt seinen Schreibtisch auf und sagt, er wolle sich noch einmal meinen Test ansehen.
ICH HABE SIE ABER BEIM VORGESPRÄCH GEFRAGT, OB SIE STIMMEN HÖREN.
„Ich höre keine Stimmen“, sage ich verärgert.
Er sieht den Test flüchtig durch und legt die Blätter wieder in die Mappe zurück.
DAS WAR HALT EIN BISSCHEN VIEL AUF EINMAL, DIE ERSTEN DREI STUNDEN.
Ich erzähle, dass ich von der Gruppe weggelaufen bin.
HIER HER?
Nein, das nicht. Es kostet mich jedes Mal ziemliche Überwindung, dieses Zimmer zu betreten, wo ich jemanden hinter mir habe, und vor mir ein Bücherregal, in dem von einem nummerierten Band die Teile 1 bis 4 fehlen.
WO DIE BÜCHER SIND, WEISS ICH, NUR DEN ANFANG KENNE ICH NICHT.
Schneider sagt, ich solle einen Augenblick warten und geht aus dem Zimmer. Auf seinem Schreibtisch liegt ein umgedrehter Befundbericht, auf dem „Sexualneurose“ steht.
Die habe ich wahrscheinlich auch.
Wenig später kommt er wieder und sagt, er hätte für mich einen Termin bei Dr. Müller vereinbart, ich solle gleich hinübergehen.
Dr. Müller lässt sich noch einmal alles über die Halluzination erzählen. Er meint, ich sei beunruhigt und verschreibt mir ein Medikament, während er erklärt, dass auf der Station jederzeit ein Bett für mich bereit stehe.
„Dr. Schneider ist wirklich sehr gut“, sagt er, als er mich entlässt.
Das Medikament wirkt schnell und die Angst verschwindet.
Daheim stöbere ich alle Bücher durch, die Sexualneurosen sind kaum vertreten. Wahrscheinlich habe ich die falschen Bücher. Ich gehe wieder in die Bibliothek, dort finde ich auch nichts, was mich weiterbringt. Was ist eine Sexualneurose?
Schneider nennt meine Halluzination „psychotisches Erlebnis“ und ich habe vor, die Tabletten nicht länger zu nehmen, als es unbedingt sein muss.
„Wer weiß, wie mich das Zeug manipuliert.“
Zu Beginn der Therapie hat er gesagt, es werde „eine Zeitlang dauern, bis wir wissen, worum es geht“.
„Wer ist wir“, frage ich und denke an eine Studie, bei der ich als Schreibkraft mitgearbeitet habe, in der Patienten für eine Behandlung ausgewählt wurden, ohne zu wissen, dass sie gleichzeitig Forschungsobjekte waren.
WIR, DAS SIND WIR BEIDE. WAS HABEN DENN SIE GEDACHT?
Ich sage, dass ich das Gefühl habe, hier für Studienzwecke zu liegen.
SIE MEINEN, DASS ICH DAS NICHT KANN, UND SIE MEINEN, DIE THERAPIE MANIPULIERT SIE.
Bei der ersten Deutung hat er sich vertan, ich sage nichts. Aber dass mich die Therapie manipulieren könnte, daran habe ich auch schon gedacht.
SIE HABEN KEIN VERTRAUEN.
„Ich kann alles sagen, was mir einfällt. Aber ich kann nicht sagen, dass ich Ihnen vertraue. Ich habe noch nie jemandem vertraut.“
In den Büchern, die ich gelesen habe, steht, dass sich der Therapeut vor Beginn der Behandlung zu Stillschweigen gegenüber dritten Personen zu verpflichten hat.
„Sie haben nicht gesagt, dass Sie nichts weitererzählen werden.“
DAS HÄTTEN SIE MIR DOCH SOWIESO NICHT GEGLAUBT.
Wahrscheinlich hat er recht.
„Peter geht es zur Zeit auch nicht gut.“
NEIN.
„Und sein Selbstbewusstsein ist auch nur Fassade.“
JA.
„Im Theater hat man mir immer Zuckerln angeboten und ich habe das Zeug jedes Mal genommen, obwohl ich so etwas gar nicht mag. Ich habe damals von allen Seiten Süßigkeiten bekommen, dabei war ich nicht einmal die Jüngste.“
DAS HAT MIT DEM ALTER NICHTS ZU TUN. ES IST KEIN WUNDER, DASS JEMAND IN IHRER LAGE NOCH ZUSÄTZLICH ETWAS NEHMEN MUSS.
„Bin ich eifersüchtig auf Nina?“
EIFERSÜCHTIG? SIE SIND AUSGEHUNGERT.
Ich erzähle, dass Dr. Müller gesagt hat, ich könne jederzeit auf die Station übersiedeln. Davor habe ich die größte Angst.
DR. MÜLLER HAT NICHT DEN GLEICHEN INFORMATIONSLEVEL WIE ICH.
„Er hat auch gesagt, ich soll nicht so viel ‚warum‘ fragen.“
Schneider lacht.
„Er hat gesagt, er verschreibt mir ein Medikament, auf das ich mir dann auch nicht mehr überlege: Warum bin ich jetzt so ruhig?“
SIE HABEN NOCH NICHTS ÜBER IHRE KINDHEIT ERZÄHLT.
„Kindheit hin, Kindheit her“, ich bin ungehalten, „irgendwann wird jeder erwachsen und ist für sich selbst verantwortlich.“
„Habe ich eine Sexualneurose?“
WIE KOMMEN SIE DARAUF?
Ich erzähle von dem umgedrehten Befundbericht auf dem Schreibtisch.
SIE HABEN KEINE SEXUALNEUROSE. Dann, nach einer Weile:
WOHER HABEN SIE GEWUSST, DASS ES EIN BEFUNDBERICHT WAR? Die Stimme klingt lauernd.
„Von Professor S.“
Es entsteht wieder eine Pause.
„Den kennen Sie aber schon“, sage ich, weil Prof. S. einen seiner Mitarbeiter hierher geschickt hat und ich diesen auch schon durch den Gang gehen gesehen habe.
VOM HÖREN.
Wenigstens das streitet er nicht ab, ich erzähle von Prof. S.:
In einem Anfall von akutem Geldmangel hatte ich mich auf mehrere Inserate beworben, Prof. S. bestellte mich zu einem Vorstellungsgespräch: Die Arbeit sei für 20 Wochenstunden vorgesehen, die Entlohnung mäßig, Voraussetzung sei selbständiges Arbeiten. Er führte mich durch einen Gang, erklärte mir die Personen auf den Gemälden und setzte mich schließlich in eine von drei winzigen Kabinen, wo ich einen Befund vom Tonband zu tippen hatte. Ab diesem Zeitpunkt erlosch mein Interesse an dieser Arbeit. Abschließend sagte Prof. S., er würde sich wieder melden.
Wenig später bekam ich den Theatervertrag und vergaß das Ganze. Wieder einige Wochen später rief Prof. S. wieder an und lud mich zu einem weiteren Gespräch. Bei dieser Besprechung teilte er mir mit, ich sei die Dritte in der Auswahl gewesen, die beiden anderen vor mir hätten medizinische Kenntnisse gehabt. Die erste habe von ihrem Chef ein wesentlich besseres Gehalt bekommen, nachdem sie von ihrem neuen Arbeitsplatz erzählt hätte, die zweite sei in ihrer Firma geblieben, nachdem ihr Prof. S. keine Lebensstellung hätte bieten können, das Projekt sei vorläufig auf ein Jahr begrenzt. Nun wende er sich also an mich, ich könne gleich anfangen.
Der Ernst der Situation überrascht mich. Ich habe eigentlich nicht vor, zusätzlich etwas zu arbeiten. Mit dem, was ich verdiene, komme ich aus. Wenn ich jetzt jeden Vormittag hier sitzen muss, wird mir die Zeit zum Üben zu knapp. Ich drehe und winde mich. Dass ich nicht will, kann ich nicht sagen, der Mann ist sympathisch. Und obwohl ich in der Auswahl nur die Dritte bin, fühle ich mich geschmeichelt, weil ich in gewissem Sinn auch die Erste bin.
Ich sage also, dass ich nicht bei ihm arbeiten kann, weil ich vormittags üben muss, nachmittags Privatschüler habe und abends im Theater spiele. Meine einzigen verfügbaren Tage seien Samstag und Sonntag, und ich bin ganz zufrieden, wie ich das dargelegt habe.
Da huscht ein freudiges Lächeln über Prof.S.' Gesicht , er hätte eigentlich auch nur Samstag und Sonntag Zeit.
Jetzt fällt mir noch ein, dass ich nicht mit einer zweiten Lohnsteuerkarte arbeiten will, weil mir dann überhaupt nichts mehr bleiben würde.
Worauf Prof. S. sagt, ich könne das Ganze auf Werkvertragsbasis machen.
Während ich ein weiteres Argument suche, erklärt er, dass ich auch etwas davon haben solle und bietet mir für die beiden Tage monatlich um 1.000 S weniger an, als ich für meinen Orchesterjob bekomme. Da sage ich zu.
Prof. S. führt mich in ein Zimmer, das eigens für den Zweck dieser Studie adaptiert wurde und auf einmal finde ich das alles gar nicht mehr so schlecht.
„An meinem ersten Arbeitstag erfuhr ich dann, woran ich arbeitete: Es war eine Hodentumorstudie.“
Ich denke an die Sexualneurose und muss lachen.
Ich hatte die Werte der Befunde nach verschiedenen Kriterien zu sortieren, sie in eine Kartei zu übertragen und Prof. S. diktierte dazu die Diagnosen. Wenn er mich auf die Station mitnahm, musste ich einen weißen Mantel anziehen und war „Frau Doktor“. Mir war das ziemlich unangenehm, Prof. S. machte keine Anstalten, meinen Status zu berichtigen. Ich selbst war zu feig dafür.
„Der hatte einen Überschuss an Schlafmangel,“ ich bin stolz auf meine Wortkombination.
„Gebabt“, sage ich bekräftigend.
WAS HEISST DAS?
„Begabt“, erkläre ich milde.
Wenn Prof. S neben mir saß und diktierte, fielen ihm regelmäßig die Augen zu. Ich wartete dann eine Weile und wenn es mir zu lange dauerte, drückte ich die Leertaste der elektrischen Schreibmaschine. Prof. Schläfrig fuhr dann jedes Mal erschrocken auf und das Spiel wiederholte sich ein paar Minuten später von Neuem.
"Manchmal setzte er sich so nahe zu mir, dass ich mit dem Sessel zur Seite rücken musste und kaum noch Platz hatte.“
WOLLTE ER SICH MIT IHNEN ETWAS ANFANGEN?
„Nein, sicher nicht.“ Meine Stimme klingt gereizt.
HAT ER SIE AUCH SEKKIERT?
„Ja“, sage ich und denke: Schau her, so gut kennt Schneider ihn.
„Prof. Schläfrig hatte eine eigene Therapie entwickelt. Jedes Mal, wenn er den Namen dieser Therapie diktierte, buchstabierte er jedes einzelne Wort. Ich habe mir damals oft gedacht: Vielleicht glaubt er, ich bin so blöd."
VIELLEICHT WAR ER SO BLÖD. SOZIAL, MEINE ICH.
Zeitweise wurde mein Gehalt zum Stipendium, weil Prof. Schläfrigs Arbeitslust bald rapide abnahm. Zuerst rief er mich am Wochenende mindestens fünf Mal täglich an: entweder, um mir zu sagen, dass er noch nicht wisse, wann er Zeit hätte, oder er musste mir mitteilen, dass er mich gleich wieder anrufen würde, wann ich kommen solle. Sein letzter Anruf, in dem er mir bekannt gab, dass es heute wohl nichts mehr würde, kam dann meistens gegen 22 Uhr.
Ich hatte damals ein ziemlich schlechtes Gewissen, weil ich Geld bekam, für das ich kaum Leistung erbracht hatte und traute mich bald keine Fragen mehr zu stellen, weil Prof. Schläfrig, wenn er etwas erklärte, die Zeit vollkommen vergaß und ich an unsere Chemielehrerin denken musste, die wir, um eine ruhige Stunde zu haben, in schwierige Fragen verwickelten, welche sie mit missionarischem Eifer löste.
Nachdem ein paar Wochenenden so vergangen waren, konnte ich Prof. Schläfrig schwer abschlagen, wenn er mich bat, noch nach dem Theater zu ihm zu kommen. Später hatte er auch an jenen Tagen, an denen ich vormittags Probe hatte, noch Dias für Vorträge zu schreiben, rein zufällig. Ich war dann pünktlich um 6 Uhr früh bei ihm – und kam gerade rechtzeitig, um ihn aufzuwecken. Dass er mir im Schlafanzug öffnete, schien ihn nicht zu stören, mich ärgerte es. Ich fühlte mich missachtet.
Als ich ihm dann sagen musste, dass ich schwanger war, war ihm das offensichtlich nicht recht: „Werden das Zwillinge?“, fragte er einmal unfreundlich, während er auf meinen Bauch starrte.
Mit fortschreitender Schwangerschaft wuchs auch Prof. Schläfrigs Arbeitslust. Der Sommer 1981 war heiß und ich fühlte mich schwerfällig. Ausgerechnet jetzt waren plötzlich stapelweise Krankengeschichten sehr dringend und möglichst rasch durch das Areal zu transportieren. Und während ich durch die Höfe hetzte, hatte ich einmal so starkes Seitenstechen, dass ich vor Verzweiflung weinte.
Prof. Schläfrig war damals der Ansicht, ich hätte in Anbetracht meiner geleisteten Stunden mindestens zwei Monate nach der Entbindung unentgeltlich für diese Studie zu arbeiten, danach würde der Vertrag verlängert. Ich wagte zwar nicht zu widersprechen, hielt diesen Zeitraum sogar für durchaus angemessen, empfand den Vorschlag aber trotzdem als Anmaßung. Schließlich war die Arbeit durch seine Schuld so in Verzug geraten.
Ich hatte Prof. Schläfrig versprechen müssen, ihn sofort nach der Geburt „über den Erfolg“ zu benachrichtigen. Ich wartete, bis die Geburtsanzeigen fertig waren und saß einen ganzen Nachmittag über dem Text, den ich ihm zukommen lassen wollte.
Wie sollte ich ihn anreden? Auf seinen Professorentitel war er stolz, den wollte ich weglassen. ‚Sehr geehrter Herr Dr. Schläfrig‘ wäre plump gewesen. Schließlich ließ ich die Anrede überhaupt weg, teilte ihm knapp mit, wie groß und wie schwer „der Erfolg“ gewesen war und setzte meinen Namen ohne irgendwelche Grüße darunter.
"Es war eine seltsame Geburtsanzeige, Prof. Schläfrig hat sich darauf nicht mehr gemeldet."
JEMAND ANDERER HÄTTE GESCHRIEBEN: HOCH VEREHRTER HERR PROFESSOR SCHLÄFRIG! RUTSCHEN SIE MIR DEN BUCKEL RUNTER. ERGEBENST IHR ... UND SIE HABEN DAS EBEN SO GEMACHT, WEIL SIE NICHT MEHR VON IHM ABHÄNGIG WAREN. ABER DASS SIE DAFÜR EINEN GANZEN NACHMITTAG VERBRACHT HABEN, DAS WAR ER WOHL NICHT WERT.
„Und manchmal war er dann wieder richtig nett. Irgendwo ist er ein armer Hund. Er wohnt mit seiner Mutter und bedeckt sie mit seiner ärztlichen Kunst.“
Schneider hat das Thema wieder auf Prostitution gebracht.
„Jedes Mal, wenn Sie mir das vorhalten, empfinde ich es als Ohrfeige.“
ABER DAS IST JA IHR PROBLEM.
„Das ist ein ziemlich harter Job.“ Und jetzt bemitleide ich alle Prostituierten dieser Welt. „Das Schlimmste war jedes Mal, wenn ich zum Schluss das Geld dafür genommen habe.“
WIEVIEL HABEN SIE DENN GENOMMEN?
„Das, was ich dafür bekommen habe.“
IHRE PROSTITUTIONSVERSUCHE ... er sagt das mitleidig wie ein Vater zu seinem Kind, das die Schule explodieren lassen wollte und nur ein Fenster eingeschlagen hat.
Prostitutionsversuche klingt harmlos, nach Versuch. Das Wort gefällt mir. Auch wenn ich weiß, dass es keine Versuche sondern Durchführungen waren.
Mir fällt ein, wie ich schwimmen gelernt habe:
Ich war 12 Jahre, als meine älteste Schwester zu Besuch kam und beschloss, mich schwimmen zu lehren.
SIE HAT SIE INS WASSER GESCHMISSEN, stellt Schneider fest.
„Nein, sie hat mir erklärt wie es geht, dann ist sie gegangen und hat gesagt, ich soll üben. Ich wollte meiner großen Schwester gefallen und plagte mich, doch es ging nicht.
„Ich habe ja Angst gehabt.“
JA
Da habe ich eine Idee: Ich hole sie und sage ihr, dass ich schwimmen kann. Schließlich weiß ich theoretisch wie es geht und kann dann immer noch behaupten, ich hätte es gekonnt. Sie kommt mit, wir gehen ins Wasser. Ich rudere mit Händen und Füßen so schnell ich kann, strenge mich ungeheuer an – und kann schwimmen.
„Damals habe ich mich selbst besiegt.“
SIE BESIEGEN SICH IMMER SELBST. WAS KÖNNTEN SIE ERST LEISTEN, WENN MAN LIEB ZU IHNEN WÄRE.
Schneider fragt, ob es noch etwas gibt, das er nicht wisse. Ich verstehe nicht, was er meint und verspreche, dass ich darüber nachdenken werde.
Mir fällt das Auto ein, das ich von Oldie bekommen hatte. Seit dem Erwerb meines Führerscheins waren einige Jahre vergangen, ich wollte damals eigentlich kein Auto.
„Mein Fahrlehrer hat mir aufs Knie gegriffen“, erinnere ich mich nebenbei.
Ich nahm das Geld, das ich von Oldie bekommen hatte und gab nur einen Teil davon für ein benzinfressendes Monstrum aus.
„Ich konnte mir damals kein Auto leisten, ich hatte oft nur die Wahl zwischen Benzin und Essen. Dann kaufte ich Benzin und fuhr in mein Elternhaus essen."
Schneider lacht. Er macht den Vorschlag, die Therapie unentgeltlich weiterzuführen.
„Das möchte ich nicht“, lehne ich ab und denke daran, wie wenig Geld ich zur Verfügung habe. Ich will nicht abhängig werden, nicht Dankbarkeit zeigen müssen, obwohl ich meine Abhängigkeit längst spüre, daheim dauernd an die Therapie denke, an meine Trägheit, meine Ohnmacht, meine Unfähigkeit mich zu ändern, meine Scham.
„Sie haben selbst gesagt, dass das weder für Sie noch für mich gut wäre.“
SO HABE ICH DAS DAMALS NICHT GEMEINT.
ICH MÖCHTE NICHT, DASS SIE WEGEN DER THERAPIE IRGEND EINE DUMMHEIT MACHEN.
Was meint er damit?, frage ich mich und beruhige ihn: „Wir verhungern schon nicht.“
ICH GLAUBE NICHT, DASS SIE DENKEN, ICH WÜRDE SIE VERGEWALTIGEN, ABER VIELLEICHT DENKEN SIE, ICH WÜRDE IHNEN DIE HAND AUFS KNIE LEGEN?
„Vielleicht wäre mir das nicht einmal so unangenehm.“
JA.
Peter fährt sieben Tage auf eine Konferenz. „Du solltest den Schlafanzug mitnehmen“, sage ich, „wenn du jemand zweiten ins Zimmer bekommst ...“
„Jemand zweiter hält mich sowieso nicht aus“, Peter schließt den Koffer.
„Hast du dir schon einmal überlegt, wie ich es mit dir aushalte?“
Peter ist verblüfft: „Du hältst es gut mit mir aus.“
SIE SIND GANZ SCHÖN AGGRESSIV, SIE HOLEN SICH HIER DIE ANLEITUNG FÜR DAHEIM. Der Tadel ist unüberhörbar.
Ich gehe mit Nina spazieren, die inzwischen zum Ambulanzbaby geworden ist, weil die Schwestern während meiner Therapie auf sie aufpassen. Ich überlege, was Schneider noch nicht weiß, was er wissen möchte. Wahrscheinlich soll ich von meinen anderen Männern erzählen? Ein katholischer Pfarrer war dabei, ein Schwarzer, einige verheiratete Männer ...
Dann suche ich nach Gemeinsamkeiten und Querverbindungen meiner „Prostitutionsversuche“ und mir fällt auf, dass mir beide Männer ein Auto aufgedrängt haben.
„Das zweite Auto hat Lady Chatterly geheißen, den Namen hat ihm eine Freundin gegeben.“
HABEN IHRE FREUNDE DAVON GEWUSST? Er klingt besorgt.
„Nein“, ich muss lachen. „Die hätten mir das anders reingerieben.“
Abends sitze ich in der Küche, während Peter mit Nina spielt. Ich denke über meine Situation und mein Leben nach. Ich würde so gerne noch einmal ganz von vorne beginnen, zu spät. Aber ich könnte meine jetzige Situation ändern. Wenn ich mich von Peter trenne, muss ich ihm Nina lassen. Ich bin alleine nicht fähig, ein Kind großzuziehen. Ich gehe auf die Toilette weinen.
DANN WERDEN EBEN SIE SICH UM DAS KIND KÜMMERN. WENN DAS ALLES IMMER MIT EINEM OPFER VERBUNDEN IST, WÜRDE ICH MIR DAS AUCH ÜBERLEGEN.... ABER DAS WAR JA NUR EINE FANTASIE.
Meine unglückliche Liebe zur Geigerei beschäftigt mich immer wieder. Vor Jahren hatte ich in einer Provinzstadt über den Sommer Operette gespielt. Hinter mir saß „der Herr Professor“, der mich mit ausgesuchter Höflichkeit behandelte und mir den Sessel jedes Mal vor Beginn der Vorstellung zurechtrückte. Einmal lud er mich auf eine Bootsfahrt ein. Ich hätte damals gerne gerudert, er ließ mich nicht.
„Der war widerlich.“
ÄUSSERLICH ODER INNERLICH?
„Innerlich.“
Ines und Josefa, die auf der Bühne mitwirkten, hatten die Situation viel schneller als ich durchschaut. „Sei nicht so dumm“, sagte Ines, „der bringt dich in sein Orchester“.
„Damals habe ich gesagt: Ich bin ja nicht für die Geige da, die Geige ist für mich da. Und außerdem, Dinge, die man so bekommt, ist man auch schnell wieder los. Im Theater weiß man von jedem, wie er seinen Job bekommen hat… Aber in Wirklichkeit war trotzdem immer ich für die Geige da.“
Peter wollte mir einmal ein Maturazeugnis „zum Geschenk“ machen. Was er damals dazu brauchte, waren die leeren Zeugnisformulare. Er stellte den Briefkopf einer Schule her, schrieb, man solle dem Überbringer die Formulare aushändigen und fertigte einen Stempel für diese Bestellung an. Darauf zog er seinen besten Anzug an und ging zum Bundesverlag. Er stellte sich der Frau an der Theke als Lehrer des Gymnasiums auf dem Briefkopf vor und sagte, an seiner Schule sei gerade Matura, es hätte sich herausgestellt, dass zu wenig Zeugnisse vorhanden seien.
„Wie viele brauchen Sie?“, fragte die Frau.
Peter musste nachdenken. „Zwanzig“, sagte er schließlich.
Die Frau holte die Zeugnisse und bereitete alles für die Übergabe vor. Plötzlich zögerte sie und sagte: „Wir schicken die Zeugnisse noch heute express.“
Damit war das Unternehmen gescheitert. Peter bedankte sich und ging.
„Ich hätte das Zeugnis aber schon genommen.“
SIE HÄTTEN ES GENOMMEN?
„Heute bin ich froh, dass das damals nicht geglückt ist. Wenn ich nämlich etwas damit gemacht hätte und er einmal böse auf mich ist, würde er wahrscheinlich sagen: Der habe ich das Maturazeugnis gemacht.“
SIE WISSEN DAS ALLES GANZ GENAU UND TROTZDEM MACHEN SIE SOLCHE DINGE… WER WEISS, WIE SEHR ES IHN STÖRT, DASS ER SELBST DIE MATURA NICHT HAT?
„Das glaube ich nicht, Peter weiß sehr viel. Ihm würde das nichts bedeuten.“
Wir sind bei Peters Mutter und machen einen Spaziergang durch das Dorf. Dabei kommen wir an einem Neubau vorbei, der sich wohltuend von den anderen Bauwerken dieser Gegend abhebt. Peter erzählt, dass die Besitzerin dieses Hauses seine Jugendfreundin war.
„Da könntest du jetzt drinnen wohnen“, gebe ich zu bedenken.
„Die wäre zu alt für mich.“
So eine Frechheit, schließlich ist er genauso alt wie diese Frau.
„Du könntest dir ja nebenbei eine junge Freundin halten“, schlage ich vor.
„Dafür bin ich zu anständig“, sagt er bestimmt.
Am Abend holt meine Schwiegermutter Fotos aus Peters Kindheit hervor. Er sieht sich ein Sommerfoto an und dreht es um. Auf der Rückseite steht mein Geburtsjahr. „Damals war ich erst 12 Jahre“, sagt er.
Und ich war noch überhaupt nicht auf der Welt, denke ich mir.
SIE HABEN GEWONNEN, sagt Schneider trocken.
Ich muss lachen.
Es ist Samstag. Peter ist wie jeden Samstag zeitig in der Früh aufgestanden, um auf dem Markt einzukaufen. Zeitig deshalb, damit er noch die größte Auswahl hat. Er kommt dann mit zwei schweren Taschen zurück. Irgend etwas verdirbt jedes Mal, weil wir nicht so viel essen können. Peter ist böse, wenn er sieht, dass ich Dinge von seinen Einkäufen wegwerfe. Meistens mache ich das heimlich, um einer Auseinandersetzung aus dem Wege zu gehen. Manchmal sieht er im Mistkübel nach, was ich weggeworfen habe und nimmt wieder Sachen heraus, von denen er glaubt, er könne sie noch brauchen. Anfangs hat mich dieses Verhalten belustigt, ich habe ihn dabei fotografiert und ihn teils liebevoll einen der letzten Miststierer genannt. Er hat einen Eichhörnchentrieb, er sammelt und sammelt.
Ich füttere Nina, sitze vor Peters Schreibtisch und mein Blick fällt auf seinen Kalender. Heute ist Hochzeitstag und ich habe darauf vergessen. Es ist mir unangenehm, weil Peter sich das sogar aufgeschrieben hat. Während Nina trinkt, überlege ich, was ich machen soll. Vielleicht wartet er, ob ich daran denke? Wenn ich nicht daran denke, vielleicht „vergisst“ er dann auch? Das wäre mir am liebsten.
Als er nach Hause kommt, bringt er einen großen Strauß Blumen und ich entschuldige mich, weil ich nichts habe.
Am Nachmittag gehen wir spazieren. Während er den Kinderwagen schiebt, versucht er ein Gespräch über den Tag unserer Hochzeit in Gang zu bringen, ich lenke jedes Mal ab.
Außer unseren Trauzeugen hat niemand von der Hochzeit gewusst. Peter hätte diesen Tag gerne mit großem Pomp gefeiert. Im Theater war gerade Urlaubssperre, weil wir ein Werk spielten, das für einen Substituten zu schwer gewesen wäre - für die Geige ein Stück mit Höhen- und Gefahrenzulage. Mein Ehrgeiz war, bei der letzten Vorstellung alle Noten zu spielen (es gelang mir nicht), gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dringend Urlaub zu brauchen. Wenn ich heiratete, musste ich Urlaub bekommen.
Wir haben geheiratet, nachdem wir ein dreiviertel Jahr zusammen gewohnt hatten. Für Peter war der Gang zum Standesamt wichtig. Auch dann, wenn ich danach meinen Mädchennamen behalten würde. Meinen Namen anzunehmen hätte für ihn bedeutet, seine „Identität auszuradieren“. „Du bekennst dich nicht zu mir“, sagte er, wenn wir über dieses Problem sprachen.
Meine Trauzeugin war meine Orchesterkollegin Choung Sim.
Choung Sim kam aus Korea und spielte Cello. Sie war mir erst aufgefallen, nachdem sie mich einmal verlegen um meinen zweiten Geigenbogen gefragt hatte, weil sie ihren Cellobogen vergessen hatte. Seit diesem Tag hatte ich sie gemocht.
Manchmal saß sie ganz blass da, ein paar Mal verließ sie den Orchestergraben für kurze Zeit, kam wieder und spielte weiter.
Einmal erzählte sie mir, sie sei deswegen in der Anstalt bei einer Ärztin gewesen. Auf einmal sei sie in einem Hörsaal gestanden und hätte von ihren Schwierigkeiten beim Cellospielen erzählen sollen. Für sie sei das so überraschend gewesen, als sie die vielen Leute sah, dass sie gesagt hätte, sie könne nicht vor so großem Publikum sprechen.
DAS WAR AUF DER ANDEREN ANSTALT, unterbricht mich Schneider schnell.
Die Ärztin war ziemlich ungehalten, Choung Sim ist nicht mehr in die Anstalt gegangen.
Während wir mit unseren Trauzeugen vor dem Zimmer des Standesbeamten saßen, wurde mir übel.
„Du kannst es dir noch überlegen“, bot ich Peter an, der erstaunt reagierte: „Aber nein, warum denn?“
Es wundert mich, dass Schneider nicht sagt „Sie wollten gar nicht heiraten“.
Meine Handschmerzen scheinen endgültig weg zu sein. Dafür geht es mir schlechter als zuvor. Manchmal glaube ich, dass die physischen Schmerzen das kleinere Übel waren.
Es gibt nichts, worauf ich mich freue und meine täglichen Pflichten sind nichts als Lasten. Die Therapiestunden sind meine einzige Abwechslung, aber auch dorthin gehe ich nicht gerne. Ich gehe hin, weil ich gewohnt bin, Termine pünktlich einzuhalten. Irgendwann müsste es mir doch auch wieder einmal besser gehen. Ich bin froh, wenn der Tag zu Ende ist. Schlafen. Nichts wissen und nichts spüren. Ich empfinde mein Leben als total verpfuscht und sehe keine Möglichkeit, irgend etwas rückgängig zu machen. Weiß nicht, was ich an meiner jetzigen Situation ändern könnte, alles scheint festgefahren, alles zu Ende.
Und ich möchte mir selbst helfen können, nicht nur auf diese Therapie angewiesen sein, mich nicht als die Maschine meiner Einfälle fühlen müssen. Ich möchte wissen, was ich habe, wie diese Krankheit heißt und wie diese Therapie funktioniert.
Mir ist aufgefallen, dass Schneider immer wieder einzelne Worte wiederholt, wenn ich etwas erzähle.
Ich frage ihn, ob er das für mich tut, oder für sich. Er sagt, er könne nicht ausschließen, dass er es auch für sich täte, an und für sich würde er die Worte aber für mich wiederholen. Darauf vergehen ein paar Stunden, ohne dass er etwas wiederholt und das macht mich noch aufmerksamer. Wochen später erkenne ich, was er damit bezweckt, weil er, nachdem er ein Wort wiederholt hat und ich etwas dazu gesagt habe, AHA sagt.
Wenn er ein Wort wiederholt, weiß er nicht genau, was ich damit meine und möchte, dass ich noch etwas dazu sage. Ab nun sage ich nichts mehr zu seinen Wiederholungen, wenn es mir früh genug auffällt.
Ich frage Schneider, was ich habe. Er sagt, es gäbe kein Lehrbuch, nach dem er mich behandle, kein Schema nach dem er vorgehe.
Ich bin überzeugt, dass er mir etwas verheimlicht. Er will, dass ich bestimmte Sachen nicht weiß, will mich beherrschen.
Ich sage, dass ich manchmal nicht verstehe, wovon er spricht, dass ich oft das Gefühl habe, dass er etwas ganz anderes meint, als er mit Worten ausdrückt, dass er manchmal Dinge sagt, die ich nie gesagt habe, dass er mehr über mich weiß, als er zugibt. Und ich würde immer noch gern wissen, wie dieser Test, den ich zu Beginn gemacht habe, aussieht.
Schneider sagt, ich könnte genauso gut daheim bleiben, wenn ich bei ihm nichts Neues über mich erfahren würde, und dass er immer nur so viel über mich wissen könne, wie ich ihm über mich verraten würde.
Ich spüre, dass ich so nicht weiter komme und nehme mir vor, mehr zu lesen. Ich muss hinter dieses System kommen, muss meine Krankheit beim Namen nennen können, muss mich irgendwo einordnen können. Wenn ich weiß, was ich habe, kann ich auch damit umgehen.
Bis jetzt weiß ich, dass es sich in diesen Stunden nur um Übertragung handelt. Und um Gegenübertragung. Das mit der Übertragung ist mir klar: Ich erzähle meine Erlebnisse, Schneider spielt die Personen, die darin vorkommen und soll alles „zu einem besseren Ende führen“.
Aber die Gegenübertragung? Was ist Gegenübertragung? In allen Büchern wird dauernd mit diesen beiden Begriffen gearbeitet. Warum aber kann kein Autor für einen Laien verständlich erklären, was Gegenübertragung ist?
Ich begebe mich auf Psychotrip und lese alles, was ich über Psychoanalyse finde. Fühle mich je nach Abschnitt ein bisschen hysterisch, ein bisschen zwanghaft, von allem etwas. Da gibt es eine Abhandlung über Masochismus. Die überblättere ich. Das ist das Einzige, das auf mich nicht zutrifft. Erinnere mich, wie ich geprügelt wurde, an die Striemen und an die Schmerzen. Wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich zuerst an Prügel.
Prügel für jedes Nichtgenügend auf Prüfungen und Schularbeiten. Mit dem Hosenriemen meines Vaters. Nicht zimperlich, jeder Schlag ein Streich. Ich hatte ihn dafür gehasst, biss die Zähne zusammen und war stolz, wenn ich nicht weinen musste.
Meine Großmutter bettelte manchmal für mich, hatte aber nie Erfolg damit. Zu solchen Zeiten gab ich mir besondere Mühe, die Schmerzen zu verbergen. Meine Mutter war mit diesem Verfahren einverstanden, offenbar hielt sie es für eine unterstützende Begleitmaßnahme.
Auch meine Freundin wurde von ihrem Vater geschlagen, sie zeigte ihre blauen Flecken um die Schulter. Man war beeindruckt, geholfen hat ihr niemand.
Ich sprach mit niemandem. Die Striemen waren nicht ohne weiteres sichtbar. Hätte man sie gesehen, ich hätte mich bemüht, sie zu verstecken.
Am Tag, bevor ich in der dritten Klasse durchfiel, erklärte meine Mutter, falls das Zeugnis negativ ausfallen würde, bräuchte ich nicht mehr nach Hause kommen. Ich besorgte mir Zugfahrpläne, ging aber nach der Zeugnisverteilung nicht zu den Gleisen, sondern ein paar Stunden durch den Wald. Als ich schließlich doch nach Hause kam, wusste sie es schon. Die Prügel waren wie immer.
Bevor ich in der vierten Klasse durchfiel, holte mich unser Klassenvorstand, den wir in Mathematik hatten, zu einem Gespräch unter vier Augen. Die Lehrerin sagte, man käme nicht an mich heran, meine Mutter täte ihr leid. Ich musste versprechen, noch am gleichen Tag für die Chemieprüfung den Hochofen zu lernen – und fiel in Mathematik und Geschichte durch. Die Prügel waren wie immer.
Meine Schwester Hanna ruft an. Sie möchte wissen, wie es mir geht, was mit den Handschmerzen ist.
„Das hängt mit Papa zusammen.“
„Wieso?“
„Er hat mich sexuell missbraucht“, am Telefon sagen sich solche Dinge leichter.
„Soso“, sagt sie ironisch. „Dieses Lied singen wir alle.“
Ich bin überrascht. Sie auch, meine älteste Schwester auch? Und ich habe nichts davon gewusst. Hanna möchte mit mir reden. Zu meinen beiden Schwestern habe ich keine Beziehung, sie sind mir immer fremd geblieben. An diesem Nachmittag spüre ich zum ersten Mal eine Vertrautheit und möchte wissen, wie das bei ihr war.
Sie erzählt, dass er sie immer zu sich ins Bett geholt hat, wenn unsere Mutter im Garten arbeitete. Dass sie ihn dafür gehasst hat, ihn hätte umbringen können. Es hätte gedauert, bis sie 18 war.
Ich frage, was sie über unsere älteste Schwester weiß, sie hat mit ihr nicht darüber gesprochen, weiß nur, dass sie herhalten musste, nachdem mein Bruder und ich mit unserer Mutter nach T. gezogen waren.
Hanna hat ihrem Mann vom Missbrauch erzählt. „Ich habe einen Mann geheiratet, von dem ich weiß, dass er so etwas nicht tut.“ Und ich denke an meine Stiefmutter, die ich immer für eine böse Gerüchtevertreiberin gehalten habe, wenn sie sagte, Hannas Tochter sehe ihrem Vater überhaupt nicht ähnlich. Er hätte nämlich Drüsenkrebs gehabt und könne gar kein Kind zeugen, sie wisse das von einem Arzt. Jetzt scheint mir das zum ersten Mal möglich.
Hanna sagt auch, dass unser Bruder sie sehr an Vater erinnert, sie ihn deshalb nicht mag und auch nicht will, dass ihre Tochter mit ihm spielt.
WISSEN SIE, WAS DAS FÜR DAS KIND BEDEUTET?
„Man war so abhängig“, sagt Hanna.
„Wie meinst du das?“, möchte ich wissen.
„Naja, er hat uns ja dafür Kleider gekauft.“
„Aso.“
„Er hat auch immer wieder gesagt, dass er dir Geld gegeben hat. Wir haben uns dann gedacht: Aha, dafür.“
Ich spüre Wut aufsteigen. Ich habe von meinem Vater nie Geld bekommen, weder „dafür“, noch sonst. Er hat mich eine Zeitlang mitverpflegt, das war alles und dafür hat er das Kindergeld genommen. Für den Rest musste ich alleine aufkommen. Ich würde ihn am liebsten mit beiden Händen aus der Erde graben, ihn bei den Schultern nehmen, schütteln, und vor Hanna fragen, wie viel Geld er mir wofür gegeben hat.
WAHRSCHEINLICH IST IHREN SCHWESTERN NICHTS ANDERES ÜBRIGGEBLIEBEN.
So eine Therapie ist doch reine Augenauswischerei, denke ich mir immer öfter und sage zu Schneider:
„Wenn mein Vater Handschmerzen hätte und zu Ihnen käme, Sie würden ihm beweisen können, dass er ein anständiger Mensch ist.“
ICH VERTEIDIGE IHREN VATER NICHT.
Hanna ruft jetzt öfter an und will, dass ich sie regelmäßig besuche. Ich habe Angst, dass ich etwas sage, womit ich ihr Gleichgewicht störe. Ich könnte ihr nicht helfen, kann mir selbst nicht helfen. Meine Mutter hat angeblich von allem nichts gewusst. Ich kann mir das nicht vorstellen und habe das Gefühl, dass meine Familie aus lauter Asozialen besteht.
Wir sprechen über unsere Eltern, als Hanna sagt: „Die schönste Zeit meiner Kindheit ist die, an die ich mich nicht erinnern kann.“
„Und bei mir ist das genauso“, sage ich zu Schneider.
ABER IHR NACHBARBUB.
Ja, das stimmt. Schneider muss ein sehr gutes Gedächtnis haben. Ich habe einmal kurz von diesem Nachbarbuben erzählt, mit dem ich in die Volksschule gegangen bin, dass wir zusammen in den Felsen klettern waren und dass sich um ihn auch den ganzen Tag niemand gekümmert hat ...
Als mich Hanna einmal - scheinbar nebenbei - fragt, wie es mir in der Therapie gehe, sage ich, um sie in ihrer Fragerei einzubremsen: „Über dich bin ich auch schon losgezogen.“
Sie sieht mich ganz erschrocken an: „Warum?“
„Weil du mich damals im Dunkeln erschreckt hast.“
„Daran habe ich auch schon gedacht“, sagt sie schuldbewusst und erzählt, dass unsere Mutter damals sehr mit ihr geschimpft hat.
Dann erfahre ich, dass sie mich als Neugeborene immer zwickte, weil sie mich nicht schlafen lassen wollte.
Und sie erinnert sich, dass ich mir im Garten barfuß etwas eintrat, als ich gerade gehen lernte. Ich sei ein paar Tage mit einem eitrigen Fuß herumgelaufen, eine Nachbarin hätte mir diesen Fuß schließlich mit Zugsalbe verbunden. „Das muss damals ganz schön weh getan haben.“
Ich bin ziemlich enttäuscht über die Gleichgültigkeit meiner Mutter.
Hanna sagt auch, dass meine Mutter gerade wieder arbeiten gehen wollte, als sie mit mir schwanger wurde.
Nun weiß ich es also genau. Warum hat sie mich eigentlich nicht abgetrieben? Für die, die es zahlen konnten, hat es diese Möglichkeit doch schon immer gegeben. Meine Mutter hatte wohlhabende Eltern, die sehr gegen ihre Heirat mit meinem Vater waren. Das Geld für diese Abtreibung hätten sie sicher liebend gern zur Verfügung gestellt.
Hanna würde so eine Therapie nicht machen: „Was hat denn das für einen Sinn? Du bist diesem Menschen doch vollkommen egal, sobald du die Türe hinter dir geschlossen hast.“
WENN SIE DAS ERZÄHLEN, SO HEISST DAS, SIE DENKEN; DIE THERAPIE HAT KEINEN SINN. WIR MACHEN THERAPIE, DAMIT SIE NICHT AUS DEN SCHUHEN KIPPEN, WENN SIE ZURÜCKDENKEN.
Ich vergleiche mich mit meinen Schwestern und finde, dass ich in allen Bereichen am schlechtesten abschneide.
Beide haben ihre Ausbildung fertig gemacht und den ersten Mann, den sie kennengelernt haben, geheiratet. Ihre Männer sind ungefähr gleichaltrig. Und ich habe mit Sicherheit die meisten Prügel bezogen …. allerdings wurden die beiden wesentlich öfter von meinem Vater missbraucht.
DAS WAR NOCH DAS BESTE, WAS SIE DAHEIM BEKOMMEN KONNTEN.
Das ist wohl nicht sein Ernst. „Habe ich vielleicht zu wenig davon bekommen?“, frage ich höhnisch. „Halluzinationen haben sie auch keine gehabt.“
SIE WOLLTEN DAS DAMALS NICHT SAGEN UND ICH HABE IHNEN ZUGEREDET. HÄTTEN SIE GANZ ZU BEGINN ETWAS ÜBER IHRE BEZIEHUNGEN ERZÄHLT, WÄRE DAS WAHRSCHEINLICH NICHT PASSIERT.
„Sie haben mich nichts über meinen Mann gefragt“, verteidige ich mich.
SO VIELE MÖRDER RENNEN NICHT HERUM.
Der Satz schmerzt, brennt wie eine Ohrfeige, ich sage nichts.
UND AUSSERDEM: IHR MANN IST NUR DER I-PUNKT IN IHREM LEBEN.
Manchmal, wenn ich über meine Mitmenschen nachdenke und wenn ich mich mit ihnen in Bezug setze, werde ich unsicher. Sicher, ich bin diejenige, die behandelt wird. Aber warum nur ich? Und außerdem: Liegt es wirklich an mir, oder sind das die anderen?
AN WEN DENKEN SIE DA?
Ich überlege. Eigentlich habe ich an niemand Speziellen gedacht.
„Prof. Schläfrig zum Beispiel. Als damals die Affäre mit den Pharmakonzernen an die Öffentlichkeit kam und berichtet wurde, dass Ärzte Geld von Firmen genommen hatten, um als Gegenleistung die Medikamente dieser Firmen zu verordnen, führte eine Wochenzeitschrift in einem Artikel u.a. auch Prof. Schläfrig namentlich als einen der „Nehmer“ an. Unmittelbar auf diesen Artikel erschien ein Rundschreiben des Gesundheitsstadtrates, in dem Prof. Schläfrig aufgefordert wurde, sich ausdrücklich von diesem Artikel zu distanzieren.
Prof. Schläfrig diktierte mir lächelnd den Distanzierungs-Brief, während neben mir die Kontoauszüge lagen, auf denen von denselben Firmen das Geld eingegangen war, von denen er sich soeben distanzierte.
UND SIE HABEN DIE KONTOAUSZÜGE NICHT GLEICH AN DIE ZEITUNG GESCHICKT?
Offenbar spielt er jetzt auf Oldies Tochter an.
„Nein, das hat mich damals nicht betroffen. Und er hat das Geld ja nicht für sich verwendet.“
MERKEN SIE NICHT, WIE UNANGENEHM ES IHNEN IST, DAS ZU ERZÄHLEN?