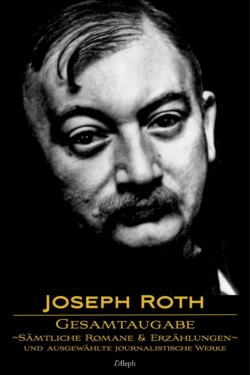Читать книгу Joseph Roth: Gesamtausgabe - Sämtliche Romane und Erzählungen und Ausgewählte Journalistische Werke - Йозеф Рот - Страница 176
На сайте Литреса книга снята с продажи.
~Erster Teil~ I
ОглавлениеIch erinnere mich noch an die Zeit, in der Paul Bernheim versprach, ein Genie zu werden.
Er war der Enkel eines Pferdehändlers, der ein kleines Vermögen erspart hatte, und der Sohn eines Bankiers, der nicht mehr zu sparen verstand, aber vom Glück begünstigt wurde. Pauls Vater, Herr Felix Bernheim, trug ein sorgloses und hochmütiges Angesicht durch die Welt und hatte viele Feinde, obgleich ihn ein normaler Grad von Torheit befähigt hätte, von seinen Mitbürgern geschätzt zu werden. Sein ungewöhnliches Glück erweckte ihren Neid. Als hätte es das Schicksal darauf abgesehen, sie vollends zur Verzweiflung zu bringen, bescherte es ihnen eines Tages einen Haupttreffer.
Einen Haupttreffer pflegen die meisten geheimzuhalten wie einen Schandfleck in der Familie. Herr Bernheim aber, als hätte er Angst, man würde sein Glück nicht mit der nötigen Gehässigkeit zur Kenntnis nehmen verdoppelte seine demonstrative Geringschätzung für die Mitwelt, verringerte die ohnehin kleine Zahl der Grüße, die er täglich auszuteilen pflegte, begann, jenen, die ihn grüßten, mit verletzender und gleichgültiger Zerstreutheit zu erwidern. Nicht genug an all dem, ging er, der bis jetzt nur die Menschen herausgefordert hatte, auch daran, die Natur herauszufordern. Er bewohnte das geräumige Haus seines Vaters, nicht weit von der Stadt, an der großen Landstraße, die zum Tannenwald führte. Mitten in einem alten Garten lag das Haus, zwischen Obstbäumen, Eichen und Linden, gelb gestrichen, mit einem steilen, roten Dach und von einer mannshohen, grauen Mauer umgeben. Die Bäume, die am Rande des Gartens standen, überragten die Mauer, und ihre Kronen überwölbten die Landstraße bis zur Mitte. Seit alten Zeiten lehnten an der Mauer zwei breite, grüne Bänke, auf denen die Müden rasten konnten. Schwalben nisteten im Hause, in dem Laub der Bäume zwitscherte es an Sommerabenden – und die lange Mauer, die Bäume und die Bänke waren im heißen Staub der sommerlichen Straße ein guter und kühler Trost und versprachen an bitteren Wintertagen zumindest eine menschliche Nähe.
Eines Tages im Sommer verschwanden die grünen Bänke. Entlang der Mauer und höher als diese erhob sich ein nacktes Holzgerüst. Im Garten wurden die alten Bäume umgelegt. Man hörte, wie sie splitterten und krachten und wie ihre Kronen zum letztenmal rauschten, indem sie zum erstenmal die Erde berührten. Die Mauer fiel. Und durch die Löcher und Sparren des hölzernen Gerüsts sahen die Leute den kahl gewordenen Garten der Bernheims, das gelbe Haus, der brütenden Leere preisgegeben, und ein Unmut erfaßte sie, als wären es ihr Haus und ihre Mauer und ihre Bäume gewesen.
Einige Monate später stand an der Stelle des alten, gelben, giebeligen Hauses ein neues, weißes, strahlendes, mit einem steinernen Balkon, den ein Atlas aus Kalk auf seinen Schultern trug, mit einem flachen Dach, das an den Süden erinnern sollte, mit modischem Verputz zwischen den Fenstern, Engelsköpfchen und Teufelsfratzen abwechselnd unter dem First und einer geradezu pompösen Rampe, die würdig gewesen wäre, zu einem Oberlandesgericht, einem Parlament, einer Hochschule hinanzuführen. Statt der steinernen Mauer erhob ein dichtes Gitter aus weißlichgrauem Eisendraht scharf geschliffene Zinken gegen den Himmel, die Vögel und die Diebe. Langweilige runde und herzförmige Beete sah man im Garten, künstliche Rasen von einem dichten, kurzen, beinahe blauen Gras und dünne, hinfällige Rosenstöckchen, gestützt von hölzernen Latten. In der Mitte der Beete standen Zwerge aus gemaltem Ton, mit rötlichen Kapuzen, lächelnden Gesichtern, weißen Bärten, Spaten, Schaufeln, Hämmern, Gießkannen in den winzigen Händchen, ein ganzes Sagenvolk aus der Fabrik Grützer und Compagnie. Kunstvoll verschlungene Pfade ringelten sich wie Schlangen zwischen den Beeten, kiesbestreut und schon beim Anblick knisternd. Keine Bank weit und breit. Und obwohl man ohnehin draußen stand, wurde man in den Beinen müde vom Anblick dieser rastlosen Pracht, als wäre man stundenlang in ihr herumgewandert. Umsonst lächelten die Zwerge. Die dünnen Rosenstöckchen zitterten, die Stiefmütterchen sahen aus wie gemaltes Porzellan. Und selbst wenn der lange Schlauch des Gärtners zartes Wasser zerstäubte, verspürte man keine Kühlung, sondern wurde eher an die feinen und schwülen Flüssigkeiten erinnert, die der Billetteur im Kino über die entblößten Köpfe der Zuschauer rieseln läßt. Über dem Balkon ließ Herr Bernheim in goldenen, zackigen und schwer leserlichen Buchstaben die Worte »Sans souci« anbringen.
An manchen Nachmittagen sah man Herrn Bernheim zwischen den Beeten herumgehen und gemeinsam mit dem Gärtner die Natur vergewaltigen. Dann hörte man das zischende Schnappen der Gartenschere und das Krachen der kleinen Hecken, die frisch gepflanzt und kaum, daß sie zu wachsen begannen, schon ihr Dienstreglement kennenlernten. Niemals standen die Fenster des Hauses offen. Meist waren sie verhängt. An manchen Abenden sah man durch die gelben, dichten Vorhänge wandelnde und sitzende Schatten von Menschen, die Umrisse und die Lichtknoten eines Kronleuchters, und man ahnte, daß im Hause Bernheim ein Fest gefeiert wurde.
Die Feste der Bernheims verliefen in einer gewissen kühlen Würde. Der Wein, den man in ihrem Hause trank, verfehlte seine Wirkung, obwohl er von ausgewählter Herkunft war. Man trank ihn und wurde nüchtern. Herr Bernheim lud mit Vorliebe Gutsbesitzer aus der Umgebung ein, einige Herren vom Militär, immer Leute mit einem feudalen Einschlag und sehr gewählte Mitglieder der Industrie und der Finanz. Der Respekt vor seinen Gästen und die Angst, Haltung zu verlieren, hinderten ihn, fröhlich zu sein. Seine Gäste fühlten die Befangenheit ihres Wirtes und blieben den ganzen Abend, was sie beim Eintritt gewesen waren, nämlich korrekt. Frau Bernheim verstand Situationswitze nicht und fand Anekdoten nicht witzig. Sie war übrigens jüdischer Herkunft – und da die meisten Anekdoten, die unter ihren Gästen kursierten, mit den Worten begannen: »Ein Jude saß einmal in der Eisenbahn …«, fühlte sich Frau Bernheim auch verletzt, und sie geriet, sobald jemand Anstalten machte, eine kleine Geschichte zu erzählen, in ein trübes und verwirrtes Schweigen – aus Furcht, es könnte die Rede auf einen Juden kommen. Von seinen Geschäften mit den Gästen zu sprechen hielt Herr Bernheim für unpassend. Sie wieder hielten es für überflüssig, ihm von der Landwirtschaft, dem Militär, den Pferden zu berichten. Manchmal spielte Bertha, die einzige Tochter des Hauses und eine gute Partie, Chopin auf dem Klavier, mit der üblichen Virtuosität eines besser erzogenen Fräuleins. Manchmal tanzte man im Hause Bernheim. Eine Stunde nach Mitternacht gingen die Gäste nach Hause. Hinter den Fenstern die Lichter erloschen. Alles schlief. Nur der Wächter, der Hund und die Zwerge im Garten blieben wach.
Paul Bernheim ging, wie es in Häusern mit guten Kinderstuben üblich war, um neun Uhr abends schlafen. Mit seinem jüngeren Bruder Theodor teilte er das Zimmer. Paul blieb länger wach, er schlief erst ein, als es im ganzen Hause still geworden war. Er war ein empfindsamer Junge. Man nannte ihn »ein nervöses Kind« und schloß aus seiner Sensibilität auf seine besondere Begabung.
Diese zu zeigen, bemühte er sich in jungen Jahren. Als der Haupttreffer zu den Bernheims kam, war Paul, der Zwölfjährige, mit dem Verstand eines Achtzehnjährigen ausgestattet. Die rapide Verwandlung des gutbürgerlichen Hauses in ein reiches mit feudalen Aspirationen erhöhte seinen natürlichen Ehrgeiz. Er wußte, daß Reichtum und gesellschaftliche Geltung des Vaters den Sohn zu einer mächtigen »Position« führen können. Er ahmte den Hochmut seines Vaters nach. Er forderte Kollegen und Lehrer heraus. Er hatte weiche Hüften, langsame Bewegungen, einen vollen, roten, halboffenen Mund und weiße, kleine Zähne, eine grünlich schimmernde Haut, helle und leere Augen, beschattet von langen, tiefschwarzen Wimpern und lange, aufreizende, sanfte Haare. Lässig, zerstreut, lächelnd saß er in der Bank. Seine Haltung verriet den ständig wachen Gedanken: Mein Vater kann die ganze Schule kaufen. Ohnmächtig und klein standen die andern da, der Übermacht der Schule ausgeliefert. Er allein setzte ihr die Macht seines Vaters entgegen, seines Zimmers, seines angelsächsischen Frühstücks, des Ham-and-Eggs mit ausgelöffelten Orangen, seines Hauslehrers, dessen Nachhilfestunden er jeden Nachmittag zugleich mit Schokolade und Keks einnahm, seines Weinkellers, seines Wagens, seines Gartens und seiner Zwerge. Er roch nach Milch, Wärme, Seife, Bädern, Zimmergymnastik, Hausarzt und Dienstmädchen. Es schien, daß die Schule und ihre Aufgaben nur einen unwichtigen Teil seines Tages einnahmen. Mit einem Fuß stand er schon in der Welt. Das Echo ihrer Stimmen im Ohr, saß er wie ein Gast in der Klasse. Er war kein ganzer Kamerad. Manchmal holte ihn sein Vater ab. Im Wagen und eine Stunde vor Schulschluß. Am nächsten Tag brachte Paul ein Zeugnis vom Hausarzt.
Dennoch sah es manchmal so aus, als sehnte er sich nach einem Freund. Aber er fand keinen Weg. Immer stand sein Reichtum zwischen ihm und den andern. »Komm heut nachmittag zu mir, wenn mein Hauslehrer da ist – und er macht uns beiden die Arbeit«, konnte er manchmal sagen. Aber nur selten kam einer. Er hatte »mein Hauslehrer« betont.
Er lernte leicht und erriet vieles. Er las fleißig. Sein Vater hatte ihm eine Bibliothek eingerichtet. Er sagte manchmal, wenn es überflüssig war: »Die Bibliothek meines Sohnes!« oder zum Dienstmädchen: »Anna, gehen Sie in die Bibliothek meines Sohnes!« – obwohl es im Haus keine andere gab. Eines Tages versuchte Paul, seinen Vater nach einer Photographie zu zeichnen. »Mein Sohn hat ein frappierendes Talent«, sagte der alte Bernheim – und er kaufte Skizzierbücher, Farbenstifte, Leinewände, Pinsel und Öl, nahm einen Zeichenlehrer auf und begann, einen Teil des Dachbodens in ein Atelier umzubauen.
Zweimal in der Woche, am Vorabend, von fünf bis sieben, übte Paul mit seiner Schwester auf dem Klavier. Man hörte sie vierhändig spielen – immer wieder Tschaikowsky –, wenn man am Haus vorbeiging. Manchmal sagte ihm einer am nächsten Tag: »Ich habe dich gestern vierhändig spielen gehört!« »Ja, mit meiner Schwester! Sie spielt noch viel besser als ich.« Und alle ärgerten sich über das kleine Wörtchen »noch«.
Die Eltern nahmen ihn in Konzerte mit. Er summte dann Melodien, nannte Werke, Komponisten, Konzertsäle und die Dirigenten, die er nachzuahmen liebte. In den Sommerferien fuhr er in die weite Welt – damit er »nichts verlerne«, mit einem Hofmeister. Er fuhr in Berge, über Meere, an wildfremde Küsten, kam schweigsam und stolz zurück und begnügte sich mit hochmütigen Andeutungen, als setzte er die Kenntnis der Welt bei allen anderen voraus. Er hatte Erfahrungen. Alles, was er las und hörte, hatte er schon gesehen. Nützliche Assoziationen schuf sein flinkes Gehirn. Aus »seiner Bibliothek« bezog er überflüssige Details, mit denen er blendete. Sein Zettel mit »Privatlektüre« war der ausführlichste. Seine Lässigkeit wurde ihm »nachgesehen«. Sie warf keinen Schatten auf sein »sittliches Betragen«. Es wurde angenommen, daß ein Haus wie das Bernheimsche eine genügende Gewähr für gute Sitte böte. Widerspenstige Lehrer zähmte der Vater Pauls durch Einladungen zu einem »bescheidenen Abendessen«. Eingeschüchtert durch den Anblick des Parketts, der Bilder, des Dienstpersonals und der hübschen Tochter kehrten sie zurück in ihre kargen Behausungen.
Die Mädchen konnten Paul Bernheim keineswegs einschüchtern. Er wurde mit der Zeit ein flotter Tänzer, ein angenehmer Plauderer, ein wohldressierter Sportsmann. Im Laufe der Monate und Jahre wechselten seine Neigungen und seine Talente. Ein halbes Jahr galt seine Leidenschaft der Musik, einen Monat dem Fechten, ein Jahr dem Zeichnen, ein Jahr der Literatur und schließlich der jungen Frau eines Bezirksrichters, deren Bedarf an Jünglingen in dieser nur mittelgroßen Stadt kaum gedeckt werden konnte. In der Liebe zu ihr vereinigte er alle seine Talente und Leidenschaften. Für sie malte er Landschaften und weiße Kühe, für sie focht er, komponierte er, dichtete er Lieder über die Natur. Schließlich wandte sie sich einem Fähnrich zu, und Paul versenkte sich, um »sie zu vergessen«, in die Kunstgeschichte. Ihr beschloß er nun sein Leben zu widmen. Er konnte bald keinen Menschen sehn, keine Straße, kein Stückchen Feld, ohne einen berühmten Maler und ein bekanntes Bild zu zitieren. In der Unfähigkeit, etwas unmittelbar aufzunehmen und einfach zu bezeichnen, übertraf er schon in jungen Jahren alle Kunsthistoriker von Rang.
Aber auch diese Leidenschaft erlosch. Sie machte einem gesellschaftlichen Ehrgeiz Platz. Sie hatte vielleicht nur zu diesem übergeleitet. Sie war die Hilfswissenschaft einer gesellschaftlichen Karriere. Einen gewissen selig naiven, charmanten und fragenden Augenaufschlag mochte Paul Bernheim ganz bestimmten Heiligenbildern abgeschaut haben. Es war ein Blick, der halb den Menschen traf und ein wenig den Himmel streifte. Die Augen Pauls schienen das Licht des Himmels durch ihre langen Wimpern zu filtrieren.
Mit derlei Reizen ausgestattet, mit einem an der Kunst und ihren Kommentaren geschulten Geschmack stürzte er sich in das gesellige Leben der Stadt, das in der Hauptsache aus den Bemühungen der Mütter bestand, ihre heranwachsenden Töchter zu verheiraten. In allen Häusern, in denen Mädchen lebten, war Paul gerne gesehen. Er konnte jeden Ton anstimmen, der gerade verlangt wurde. Er glich einem Musikanten, der alle Instrumente des Orchesters beherrscht und der es versteht, mit Anmut falsch zu spielen. Eine Stunde lang konnte er gescheite (erdachte und erlesene) Dinge sagen. Eine Stunde später zeigte er einen warmen, lächelnden Plaudereifer, trug er zum zehntenmal eine platte Anekdote vor, stattete sie immer wieder mit einem neuen Zug aus, liebkoste er mit der Zunge einen banalen Aphorismus, hielt ihn noch eine Weile zwischen den Zähnen, schmeckte ihn mit den Lippen nach, brachte er mit leichtem Gewissen Witze vor, die andern gelungen waren, machte er sich schamlos lustig über abwesende Altersgenossen. Und die Mädchen kicherten, ein nacktes Kichern, sie entblößten nur ihre Zähne, aber es war, als enthüllten sie ihre jungen Brüste, sie schlugen nur die Hände zusammen, aber es war, als spreizten sie die Beine, sie zeigten ihm Bücher, Bilder und Notenhefte, aber es war, als schlügen sie ihre Betten auf, sie richteten sich das Haar, aber es war, als lösten sie es. Um jene Zeit fing Paul an, ins Bordell zu gehn, zweimal in der Woche, mit der Regelmäßigkeit eines alternden Beamten, um dann von der Köstlichkeit erfundener Mädchenkörper zu erzählen, die er natürlich mit berühmten Bildern verglich. Er berichtete Geheimnisse von der und jener Haustochter und beschrieb Brüste, die er gesehen und gefühlt haben wollte.
Immer noch malte, zeichnete, komponierte und dichtete er. Als seine Schwester sich verlobte – mit einem Rittmeister übrigens, – machte er ein längeres Gelegenheitsgedicht, vertonte, spielte und sang es. Später – weil sein Schwager Interesse für Maschinen hatte – begann auch Paul, sich für die Technik zu interessieren und den Motor seines Autos – es war eines der ersten in der Stadt – eigenhändig zu zerteilen. Schließlich nahm er Reitstunden, um seinen Schwager in der Reitallee im Tannenwäldchen zu begleiten. Die Bürger der Stadt fingen an, nachsichtiger dem alten Herrn Bernheim gegenüber zu werden, weil es ihm gelungen war, der Heimat ein Genie zu schenken. Manch einer von den Feinden Bernheims, der sich lange Zeit verletzt gefühlt hatte, begann, weil in seiner Familie indessen eine heiratsfähige Tochter heranwuchs, Felix Bernheim wieder untertänig zu grüßen.
Um jene Zeit verbreitete sich das Gerücht, daß Herrn Bernheim eine große Auszeichnung bevorstehe. Einige sprachen von einer Erhebung in den Adelsstand. Es war lehrreich, zu beobachten, wie diese Aussicht auf den Adel Bernheims die Gehässigkeit seiner Gegner beruhigte. Der zukünftige Adel Bernheims erschien als eine ausreichende Erklärung für den Hochmut des Bürgerlichen. Man kannte nunmehr die wissenschaftliche Grundlage seines Stolzes und fand ihn also berechtigt. Denn nach der Meinung der Stadt war die Arroganz die Zierde des Adligen, des Geadelten und sogar noch desjenigen, der bald geadelt werden sollte.
Es ist unbekannt, welche wirklichen Grundlagen jenes Gerücht hatte. Vielleicht wäre Herr Bernheim nur ein Geheimer Kommerzienrat geworden. Aber da ereignete sich etwas Unerwartetes, Unwahrscheinliches. Eine Geschichte, die so banal ist, daß man sich schämen würde, sie zum Beispiel in einem Roman zu erzählen.
Eines Tages kam ein Wanderzirkus in die Stadt. Während der zehnten oder elften Vorstellung geschah ein Unfall: Eine junge Akrobatin fiel vom Trapez, gerade in die Loge, in der Herr Felix Bernheim saß – allein (denn seine Familie hielt Zirkusvorstellungen für vulgäre Spektakel). Man erzählte später, Herr Bernheim hätte die Künstlerin »geistesgegenwärtig« in den Armen aufgefangen. Aber das ist nicht genau festzustellen – ebensowenig, wie jenes Gerücht noch zu kontrollieren ist, das wissen will, er hätte sich seit der ersten Vorstellung für das Mädchen interessiert und ihr Blumen geschickt. Sicher ist, daß er sie ins Krankenhaus brachte, sie besuchte und sie nicht mehr mit dem Zirkus abreisen ließ. Er mietete ihr eine Wohnung und hatte den Mut, sich in sie zu verlieben. Er, der Stolz des Bürgertums, der Anwärter auf den Adelsstand, der Schwiegervater eines Rittmeisters, verliebte sich in eine Akrobatin. Frau Bernheim erklärte ihrem Mann: »Du kannst deine Mätresse ins Haus nehmen, ich fahre zu meiner Schwester.« Sie fuhr zu ihrer Schwester. Der Rittmeister ließ sich in eine andere Garnison versetzen. Das Haus der Bernheims war nur noch von den zwei Söhnen und den Dienstboten bewohnt. Die gelben Gardinen hingen monatelang vor den Fenstern. Der alte Bernheim allerdings veränderte sein Gehaben nicht. Er blieb hochmütig, er trotzte aller Welt, er liebte ein Mädchen. Von seiner Auszeichnung war keine Rede mehr.
Es war vielleicht die einzige mutige Tat, die Felix Bernheim in seinem Leben gewagt hatte. Später, als sein Sohn Paul eine ähnliche hätte wagen können, dachte ich an die des Vaters, und es wurde mir wieder einmal an einem Beispiel klar, wie die Tapferkeit sich im Ablauf der Geschlechter erschöpft und um wieviel schwächer die Söhne sind, als die Väter waren.
Das fremde Mädchen lebte nur ein paar Monate in der Stadt. Als wäre sie nur zu dem Zweck vom Himmel gefallen, um Felix Bernheim noch in den letzten Jahren seines Lebens zu einer mutigen Handlung zu verführen, ihm noch einen flüchtigen Schimmer Schönheit zu schenken und seine echte Erhebung in den natürlichen Adelsstand zu vollziehen. Eines Tages verschwand das Mädchen. Vielleicht – wenn man einen romanhaften Abschluß dieser romanhaften Geschichte will – kam der Zirkus wieder in die Gegend, und das Mädchen sehnte sich schon nach ihrem Trapez. Denn auch die Akrobatik kann eine Berufung sein.
Frau Bernheim kehrte zurück. Das Haus belebte sich mäßig. Paul, den das Abenteuer seines Vaters traurig gemacht hatte, weil die erwartete Auszeichnung ausgeblieben war und weil der Rittmeister verschwand, erholte sich später schnell und fand sogar eine Freude an der Tatsache, daß »sein Alter doch ein Kerl« sei.
Im übrigen bereitete er seine Abreise vor.
Bald durfte er ein neues Leben beginnen.