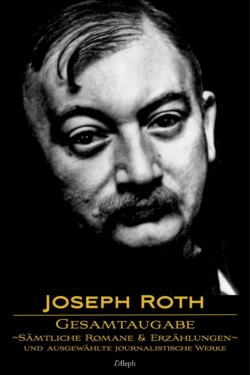Читать книгу Joseph Roth: Gesamtausgabe - Sämtliche Romane und Erzählungen und Ausgewählte Journalistische Werke - Йозеф Рот - Страница 180
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
ОглавлениеPaul Bernheim hätte seine Wiederkehr gerne telephonisch angekündigt. Aber es war nicht leicht, mit Frau Bernheim zu telephonieren. Sie konnte nichts begreifen, wenn der Sprecher nicht in ihrer Sichtweite war. Sie mußte sich ihn zumindest vorstellen. Erst wenn sie sich ein Bild von ihm gemacht hatte, begann sie, den Sinn der Frage zu begreifen. Es war, als ob die Worte, als ob die menschliche Sprache in der Welt der Frau Bernheim nur ein sehr mangelhaftes Verkehrsmittel wären und lediglich zur Unterstützung der Gesten und der Blicke dienten. Vielleicht kam daher der Leichtsinn, mit dem sie manche gewichtigen Worte bei falschen Gelegenheiten anbrachte.
Paul telegraphierte also. Auch Telegramme konnten Frau Bernheim aus der Fassung bringen. Ihrer Meinung nach war der Telegraph eigens dazu erfunden worden, um plötzliche Unglücksfälle rasch und sicher mitteilen zu können. Allmählich, seitdem sie Witwe geworden war, und besonders seit dem Ausbruch des Krieges, hatte sie auch angefangen, »sich einzuschränken« – wie sie zu sagen liebte – und bei jedem Telegramm, das Paul ihr schickte, nachzurechnen, wieviel es gekostet haben mochte. Ihre Freude über die Ankunft Pauls entsprach, als sie sein Telegramm las, ungefähr dem Schrecken, der sie ergriffen hatte, als es angekommen war, und ihrem Schmerz über die verschwendeten Spesen. Und es dauerte verhältnismäßig lange, ehe sie den Sinn der Botschaft, befreit von dem Schrecken und dem Trieb, die Worte zu zählen, in seiner ganzen freudigen Bedeutung erfaßte.
Sie wußte von Pauls langer Krankheit ebenso wie von seiner Verwundung. Da er ihr aber niemals mitgeteilt hatte, daß er zur Infanterie gegangen war, blieb der Optimismus, mit dem sie der Kavallerie stets vertraute, von Anfang bis zu Ende unverändert. Und selbst, als sie von der Verwundung Pauls erfuhr, kam es ihr nicht einen Augenblick in den Sinn, daß er auch hätte sterben können. Bei der Kavallerie verwundet werden bedeutete ihr ungefähr soviel, wie sich mit dem Taschenmesser in den Finger schneiden. Auch Typhus war ihrer Ansicht nach für einen Berittenen nicht lebensgefährlich. »Paul ist Offizier«, sagte sie, »er wird bestimmt sorgfältig gepflegt.« Nicht eine Stunde während des Krieges hatte ihre Sorge ihrem Sohn gegolten, aber Tag und Nacht dem Geld. Sie hatte Angst vor der Armut. Sie sah, daß man die ganze Zeit wenig Einnahmen und viele Ausgaben buchte. Herr Merwig, ein alter Mitarbeiter ihres Mannes, kam jeden Monat zu ihr und berichtete über den Gang der Geschäfte. Der Ausgang des Krieges, die Revolution, die Krüppel auf den Straßen und die Überzahl der Bettler, die nach ihren Worten »das Haus einrannten«, beschäftigten sie so sehr, daß ihr die Rückkehr Pauls kaum ein paar Minuten freudiger Aufregung brachte. Am Abend, als Theodor nach Hause kam, zeigte sie ihm das Telegramm. Er legte es, säuberlich gefaltet, ohne ein Wort zu sagen, auf den Tisch und begann, die Zeitung zu lesen. Frau Bernheim ergriff das Lorgnon, das immer an ihrer Hüfte hing und an eine Waffe erinnerte, ließ die Gläser hörbar aufschnellen, führte sie an die Augen und betrachtete ihren Sohn, als schaute sie auf die Bühne. Sie liebte es, das Lorgnon zu gebrauchen, wenn sie ungehalten war. Sie hatte die Erfahrung gemacht, daß die Dienstboten vor den Gläsern erschraken. Theodor hörte ihr Geräusch und neigte den Kopf noch tiefer über die Zeitung.
Frau Bernheim ließ das Lorgnon wieder fallen. Nach einigen Sekunden sagte sie: »Du hast ebensowenig Herz, wie dein Vater gehabt hat. Aber er war wenigstens klug. Er hatte einen genialen kaufmännischen Geist.
Du aber bist auch noch ein Taugenichts. In diesen ganzen Jahren hast du nichts gelernt. Wenn es diese famosen Notprüfungen nicht gegeben hätte, wärest du ewig in der Schulbank geblieben oder ein Schuster geworden. Du erinnerst mich ganz an den seligen Vetter Arnold. Er hat Schulden gemacht und ist im Irrenhaus gestorben. Und das hat auch Geld gekostet, sonst hätten wir die Freude gehabt, ihn im Kriminal zu sehen.«
Sie wartete ein paar Minuten. Dann, als Theodor noch immer in der Zeitung las, schrie sie plötzlich: »Wir haben kein Geld mehr, Theodor, hörst du? Wir haben kein Geld mehr, um Taugenichtse vor dem Kriminal zu retten! Du wirst in Eisen sitzen müssen, hörst du?!«
Theodor legte beide Hände an die Ohren und las weiter in der Zeitung. »Leg die Zeitung sofort weg, wenn deine Mutter mit dir spricht«, fuhr Frau Bernheim leiser fort.
Theodor nahm sofort die Hände von den Ohren, hörte aber nicht auf zu lesen.
Manchmal gelang es ihm, so lange zu schweigen, bis sie das Zimmer mit einem lauten Seufzer verließ. Heute aber schien sie nicht weichen zu wollen. Sie machte sich wieder ans Reden. Sie begann, mit einer Stimme, deren Eintönigkeit aufreizte, langsame, gleichmäßig langsame Sätze wie Garn abzuspulen. Bei jedem Satz hatte Theodor das Gefühl, daß er niemals aufhören werde. Als wüßte Frau Bernheim, daß diese Art zu sprechen auf ihren Sohn Eindruck machte, unterstützte sie die Eindringlichkeit ihrer Rede durch gleichmäßige, glättende Bewegungen auf dem Tischtuch. Unaufhörlich und in dem langsamen Tempo, in dem sie sprach, wischten ihre flach ausgestreckten Hände nach links und rechts die Kanten des Tisches. Obwohl Theodor in die Zeitung versenkt war, stahlen sich die weißen, bläulich geäderten Hände der Mutter in sein Blickfeld, und allmählich ergriff ihn vor diesen schwachen Händen der alten Frau eine Angst wie vor Mörderhänden. Er rührte sich nicht. Er hörte auf zu lesen. Die Kolonnen der Zeitung verschwammen vor seinen Blicken. Aber er ließ nichts erkennen, und zum Beweis dafür, daß er nur mit der Lektüre beschäftigt sei, blätterte er langsam die Zeitung um, in demselben Tempo, in dem die Rede seiner Mutter rann, und gebannt von ihrem Rhythmus.
»Wenn ein Bruder aus dem Krieg nach Haus kommt«, sagte Frau Bernheim, »hat ein anständiger Mensch sich zu freuen. Dir aber tut es leid, daß Paul nicht umgekommen ist. Glaubst du nicht, daß eine Mutter alles von ihren Kindern weiß? Gott ist mein Zeuge, unser seliger Vater weiß es auch, er hat es mir nie glauben wollen, und ich habe ihm immer gesagt, was du für ein tückisches Kind bist, boshaft wie eine Spinne und falsch wie eine Katze und dumm wie ein Esel. Eine ganze Naturgeschichte bist du, und die ganze Erziehung war umsonst, man kann, hab’ ich immer zu Felix gesagt, keine Kinder erziehn, wenn sie es nicht von der Geburt mitbekommen haben, die Seele, glaub’ ich, und das ist es auch, du hast keine Seele. Wenn du nicht Angst hättest, würdest du deine alte Mutter schlagen, du möchtest mich schon als Leiche sehn, schrecklich, als Leiche. Aber ich werde nicht ruhig sterben, bis ich nicht weiß, daß du ein anständiger Mensch geworden bist, du kannst es aber nicht werden, was machst du denn die ganzen Tage, du gehst mit deinen lieben Freunden herum, die mir alle nicht gefallen, Paul hat in deinem Alter schon getanzt, er war ein wundervoller Tänzer und hat schon hübsche junge Damen charmiert und hat nicht den ganzen Tag in den Wäldern gelegen und hat nicht herumgeschossen wie du, ich habe Angst vor deinen Raubmessern und Mordpistolen, Anna will nicht mehr dein Zimmer aufräumen, soll ich es vielleicht selber tun …?«
Eine dunkle, fast bläuliche Röte überzog das Angesicht Theodors. Hastig schmiß er die raschelnde Zeitung auf den Boden. Er erhob sich, warf mit einem Fuß hinter sich den Stuhl um, seine kleinen, rollenden Augen hinter der dunkel geränderten Brille schienen auf dem langen und breiten Tisch nach einem Gegenstand zu suchen, den man nach der Mutter werfen könnte. Da er gar nichts fand, begann er, sinnlos zwanzigmal hintereinander zu schreien:
»Heb sie auf, die Zeitung, heb sie auf, heb sie auf, heb sie auf, Mutter, heb die Zeitung auf, Mutter, Mutter!«
Er war im Nu wieder blaß geworden.
Sein flaches, gelbes, dünnes Angesicht erinnerte an ein ungegorenes, im Ofen eingefallenes Brot. Es war mehr nach innen gewölbt als nach außen. Die Nase schien bis zur Spitze, die zart, blutleer und stumpf hinaufragte, noch zu den Wangen zu gehören. Die Lippen waren dünn und schlossen nicht ganz über den langen Zähnen. Das Kinn streckte sich nach vorne wie bei Menschen, die ihren Kopf zwischen hochgezogenen Schultern zu tragen pflegen. Die Ohren waren gelb, groß und durchsichtig wie aus Pergament und randlos, als hätte ihre Substanz für die Ränder nicht mehr ausgereicht. Über der noch kurzen, knabenhaften Stirn, die aber wie die Stirn eines Alten von vier, fünf Längsfalten durchquert war und zwei dicken, vertikalen Strichen über der Nasenwurzel, erhob sich dünnes, wasserblondes Haar, krampfhaft aufwärts gekämmt. Die wasserhellen Augen hinter den funkelnden Gläsern hatten einen erschreckten Ausdruck. Sie waren wie die Augen eines, der in ein plötzlich ausgebrochenes Feuer blickt. Die Stimme wurde hell und kläglich. Man hätte glauben können, Theodor rufe seine Mutter zu Hilfe, während er ihr zurief, sie möge die Zeitung aufheben. Er begann zu beben. Um seine Zähne nicht klappern zu lassen, biß er sie aufeinander. Und so, die Zunge hart an den Zähnen, versuchte er eine Art von lispelndem, schwerverständlichem Schreien:
»Heb die Zeitung auf, heb ssie auf, heb ssie auf!«
Frau Bernheim, die derlei Ausbrüche Theodors nicht ohne eine gewisse Schadenfreude genoß, hob wieder das Lorgnon. Sie schätzte diese Augenblicke. Es waren die einzigen, in denen sie sich wirklich überlegen fühlen konnte – und in denen ihre Logik auf einmal wach wurde, wie angeregt von der vollkommenen Sinnlosigkeit des andern. Obwohl ihr Mund sich nicht verzog, leuchtete in ihren harten Augen schon der Widerschein eines Lächelns, während sie mit ruhiger Stimme den Augenblick ausfüllte in dem Theodor atemlos und stumm dastand:
»Du hättest es nicht nötig gehabt, die Zeitung auf den Boden zu werfen. Aber sogar wenn es notwendig gewesen wäre, brauchte deine Mutter sie dir nicht aufzuheben. Bück dich, es wird dir guttun. Es ist ebenso gesund, wie in den Wäldern herumzulaufen. Bück dich, mein Sohn, bück dich!«
Sie sprach diese Sätze mit einer sanften, mütterlichen Stimme, in der die Bosheit eingepackt war wie ein Instrument aus dünnem Stahl in weicher Watte.
Theodor verließ das Zimmer. Frau Bernheim sah noch einen Augenblick auf die Tür, die er zugeschlagen hatte. Sie wartete, bis das Echo des Knalls sich verzog.
Dann bückte sie sich, hob die Zeitung auf und begann zu lesen.
Theodor begab sich in den Korridor.
Er lächelte. Er bemühte sich, leise aufzutreten. Seine Kurzsichtigkeit machte ihn vorsichtig. Er streckte den Kopf. Er drehte ihn nach allen Seiten. Er näherte sich dem breiten Wandschrank gegenüber der Garderobe. Im zweiten Fach links oben stand die Büchse aus Blech, eine Sammelbüchse. Sie war Frau Bernheim einmal von einem Wohltätigkeitsverein gebracht worden und sollte einmal im Monat entleert werden. Aber Frau Bernheim wollte mit eigenen Augen sehn, wohin ihr Geld kam. Quittungen behagten ihr nicht. Sie bewahrte daher in jener Büchse das Kleingeld für die regelmäßigen Bettler, die an einem bestimmten Tag in der Woche kamen.
An der Büchse hing ein winziges Schloß. Theodor hatte schon hie und da versucht, es mit einem der vielen Schlüssel, die er besaß, zu öffnen. Er wußte, daß man Frau Bernheim keinen größeren Kummer zufügen könnte, als wenn man dieses Geld, das ihr schon leid tat, wenn sie es verschenken durfte, auch noch stahl.
Zuerst nahm er die Büchse in sein Zimmer. Er schloß die Tür ab, versuchte einen der kleinen Schlüssel nach dem andern, dachte nach, ergriff ein Messer und begann, vorsichtig den Spalt auseinanderzustemmen. Er hatte Herzklopfen vor Schreck und Freude … Ein paar Augenblicke ließ er die Büchse ruhig stehn und versuchte, sich die Aufregung seiner Mutter vorzustellen. Sein Mund sagte plötzlich laut: »Kanaille!« Er horchte. Da sich nichts rührte, kehrte er die Büchse um. Aber sie schepperte lauter, als er erwartet hatte. Er lauschte wiederum. Er machte die Türe auf und überzeugte sich, daß niemand da war. Dann begann er, mit unendlicher Sorgfalt eine Münze nach der andern herauszuholen. Viele rollten gehorsam und glatt durch den Spalt. Andere blieben hartnäckig drinnen. Er wurde müde, setzte sich, er hatte die Leidenschaft eines Jägers. Er arbeitete bis tief in die Nacht. Es waren schließlich nur noch wenige scheppernde Münzen in der Büchse. Dann drückte er vorsichtig die Spaltsäume zusammen, schlich hinaus und stellte die Büchse wieder an ihre Stelle.
Er zählte das Geld. Es ergab gerade den Monatsbeitrag für den Verein »Gott und Eisen«, dem er seit zwei Jahren angehörte.
Diesen Verein hatte ein junger Mann namens Lehnhardt begründet. Außer ihm, dem Gründer, der ein Bürgerlicher war, sollten nur Adelige aufgenommen werden. Deren gab es aber nach zwei Monaten nur vier. Deshalb wurden die Statuten dahin verändert, daß nur »Blonde aus arischen Familien« aufgenommen werden durften. Bei näherem Zusehn ergab es sich aber, daß die Haarfarbe des Gründers selbst eher braun als blond war. Immerhin wies man den schwarzhaarigen Sohn des Landesgerichtspräsidenten ab. Dieser Junge beklagte sich bei seinem Vater. Er behauptete, Lehnhardt und Theodor Bernheim hätten ihn einen Juden genannt. Sehr indigniert lud der Landesgerichtspräsident die beiden ein und bewog sie, seinen Sohn aufzunehmen. So blieb schließlich das Statut, das den Juden den Zutritt verbot.
Sie halfen einander mit Büchern, Geld und Waffen aus. Sie schwuren, nachdem sie die Notprüfung abgelegt hatten, immer in Verbindung zu bleiben. Vorläufig meldeten sie sich zur freiwilligen Sanität. Sie hatten »Dienst«, gingen zu den Verwundetentransporten, schleppten Tragbahren, saßen neben den Chauffeuren der Krankenwagen und pfiffen aus schrillen Pfeifen in den Straßen der Stadt, um die anderen Gefährte aufzuhalten. Jeden Tag erwachten sie in der Erwartung, die Mobilisierung ihres Jahrgangs angekündigt zu sehn. Als aber schließlich der Friede kam, schwuren sie der Republik Rache, suchten und fanden Beziehungen zu den geheimen Organisationen und marschierten zweimal wöchentlich zu den Übungen vor die Stadt.
Bei diesen Übungen tat sich Theodor nicht hervor. Er war zu körperlichen Anstrengungen ungeeignet. Die Fahlheit seiner Haut, seine hastigen, kurzen Schritte, seine Sprache, die oft tonlos wurde, die Aufregung, in der er gleichgültige Dinge mitzuteilen pflegte, die Heftigkeit der Bewegungen erweckten den Eindruck, daß man seinen hastigen Puls hörte. In seiner Brust schien das zappelnde, kleine, aufgeregte Herz eines Vogels eingebaut. Er konnte einem mit dem Ausdruck eines Menschen entgegentreten, der soeben eine überraschende Neuigkeit erfahren hat, um dann eine schlichte Mitteilung etwa von dieser Art zu machen:
»Wissen Sie schon? Habe ich es Ihnen nicht schon gesagt? – Ich habe gestern einen Brief von Gustav bekommen.«
Er verlieh den unbedeutendsten Ereignissen eine gefährliche und geheime Wichtigkeit, ja besonders eine geheime. Es war sein Ehrgeiz, irgend etwas früher zu wissen als die andern; aber es auch unter dem Siegel der Verschwiegenheit irgend jemandem erzählen zu können. Auf diese Weise nährte er fortwährend den Glauben an seine Bedeutung. Aber fortwährend zitterte er auch um sie.
Er besaß einen Sinn für die Dinge der Öffentlichkeit und für die großen Worte: Ehre, Freiheit, Nation, Deutschland. Um jeden Preis wollte er irgendeine Wirkung üben. Seine Angst, er könnte krank werden, Angina bekommen, eine Lungenentzündung, eine Rippenfellentzündung, machte ihn ungeduldig. Er konnte kaum ein Buch zu Ende lesen. Aber er brauchte nur zehn Seiten, um über die Maßen begeistert zu sein oder um es »einen Dreck« zu nennen. Denn er liebte die starken Ausdrücke – und das war vielleicht das einzige deutliche Anzeichen seiner Jugend.
Er hielt sich für außergewöhnlich vornehm. Manchmal träumte er davon, eine Geschichte seiner Familie zu schreiben, dem Stammbaum der Bernheims nachzuforschen und den Beweis zu erbringen, daß es eine alte, adlige Rasse war. Die jüdische Abkunft seiner Mutter störte ihn. Und nicht einmal vor seiner Krankheit hatte er soviel Angst wie vor der Möglichkeit, seinen Kameraden einmal über die Familie seiner Mutter Auskunft geben zu müssen. Er beschloß, um jeden Preis zu lügen. Dieser Entschluß war so stark, seine Furcht so groß, daß er allmählich zu der Überzeugung kam, er hätte nichts zu verbergen. Alle Ausreden, die er fand, wurden im Lauf der Zeit für ihn pure Wahrheiten. Die Überzeugung, daß er vornehm sei, äußerte sich in einem Hochmut, den die Kameraden nur deshalb ertrugen, weil er hie und da mit Intimitätenaustausch und Vertraulichkeiten, ja Schmeicheleien abwechselte. Theodor konnte einem seiner Genossen sagen: »Unter uns, Sie sind ja der einzige unter den Burschen, der weiß, was er will!« Oder: »Das war glänzend, bewundernswert, wirklich eine Tat!«
Es ist anzunehmen, daß Theodor all das glaubte, während er es aussprach. An den gemeinsamen Ausflügen und Übungen nahm er nicht gerne teil. Nicht nur, weil er um seine Gesundheit besorgt war, sondern auch, weil ihm manche groben Äußerungen, manche Zudringlichkeit, eine geschmacklose Wendung beleidigten. Er hatte sich seine Vornehmheit so erfolgreich suggeriert, daß er sogar vornehme Empfindlichkeiten erwarb. Das Marschieren, das Schießen, das Kampieren im Freien machten ihm keine Freude. Nur die Tatsache, daß es eine geheime Verbindung war, die Gefahren barg, und die Möglichkeit, ein Verschwörer zu sein, aber auch von Gesinnungsgenossen gehört zu werden, hielt ihn in der Gesellschaft seiner Freunde. Er liebte die großen Stiefel nicht und nicht die Wickelgamaschen. Die Naturnähe des Wandervogels hielt er für ordinär. Er erwartete viel mehr von der »Technik«. »Für die Zukunft« – ein Wort, das er besonders schätzte. Er hatte den ehrlichen Willen, das deutsche Volk in der Welt triumphieren zu sehen, aber mit modernen Mitteln. Mit Flugzeugen, Boxern, guten und billigen Automobilen, chemischen Apparaten, merkwürdigen Maschinen. Übungen in den Wäldern nannte er im stillen und nur für sich romantisch. Nur mußte er vorläufig diese Romantik mitmachen, um durch sie zu einer realen Macht, mindestens zu einem Einfluß zu gelangen. Es machte ihm wenig aus, daß er vorderhand log. Es gehörte zu seinen Prinzipien.
In dieser Nacht konnte er lange nicht einschlafen. Über die leere Büchse würde sich nicht nur seine Mutter zu Tode ärgern – ja, zu Tode, denn wäre sie nicht vorhanden, so hätte man eine von den Ängsten weniger –, der Inhalt ersparte auch eine Ausgabe von dem Taschengeld, das man selten erhielt.
Seine Freude wurde nur durch die Gedanken an Pauls Rückkehr getrübt. Ich sehe schon, sagte er sich gegen zwei Uhr morgens, ich werde wieder einmal eine schlaflose Nacht verbringen. Zum Überfluß fängt es noch an zu regnen.
In der Tat fing es an, in der Rinne zu wimmern, die hart neben dem Fenster Theodors angebracht war. Er entzündete die Lampe am Nachttisch, fand, daß sie wenig Licht gab, stand auf, um den großen Kontakt an der Wand anzuknipsen, legte zuerst die Brille an, denn er fühlte sich unsicher im Halbdunkel, und blieb, als es hell geworden war, im Vorübergehen vor dem Schrankspiegel stehn. Er sah nicht ohne Befriedigung, daß sein Pyjama einen guten Eindruck machte. Es hatte einen seidigen Schimmer, Borten dick und geflochten nach Art der Litewkas der Kavalleristen, seine Farbe war die eines abendlichen, opalenen Sommerhimmels. Theodor liebte Pyjamas, gute Wäsche, seidene Strümpfe. Er hielt es für ein Zeichen der Vornehmheit, in der Nacht tadellos gekleidet zu sein. Krawatten gut und flott zu binden machte ihm jeden Morgen ein Vergnügen. Und für die Aufnahme des schwarzhaarigen Landesgerichtssohnes war er nicht zuletzt deshalb eingetreten, weil der Junge auf Herrenmodezeitschriften abonniert war, die er Theodor manchmal lieh.
Um einschlafen zu können, nahm Theodor Veronal. Es konnte allerdings seinem »Herzen schaden«. Er litt unter der Vorstellung, daß der Apotheker sich geirrt und ihm statt einer Medizin ein Gift gegeben hatte. Diese dummen Apotheker, dachte er, vergiften einen Menschen wie eine Ratte. Wenn ich so einem Pharmazeuten unsympathisch bin, denkt er an meinen Tod. Man muß die Kerle höflich behandeln. Morgen werde ich mit ihm liebenswürdig sein. Er nannte alle Männer »Kerle«. Er unterschied zwei Arten von Kerlen: die er bewunderte und die er verachtete.
Sein Bruder Paul gehörte zu den Kerlen, die er verachtete und beneidete. Morgen kommt also dieser Kerl daher! Er ist reich, jung und gesund, ein niederträchtiges Sonntagskind. Ob er mir einen Pfennig gibt? Bestimmt nicht. Er ist ein Geizkragen. (Denn es gehörte zu Theodors Eigenheiten, sowohl den verachteten als auch den geschätzten »Kerlen« einen »Geiz« anzudichten.) Morgen kommt er daher und ergreift Besitz vom ganzen Haus. Er und die Mutter werden jetzt gegen mich zusammenhalten. Ich werde ihn sehr hochmütig empfangen. So wie ich das kann.
»So wie ich das kann«, wiederholte er flüsternd. Angst hatte ihn wieder ergriffen. Das Veronal half nicht, es verursachte Herzklopfen, die Dachrinne hörte nicht auf zu wimmern, die Windstöße streuten in unregelmäßigen Abständen dicke Wassertropfen wie Kieselsteine gegen die Fenster. Theodor begann in einem Buch zu blättern, das er in Pauls Bibliothek gefunden hatte. Es war der »Rembrandt-Deutsche«. Er stieß auf einen Satz, der ihm gefiel, beschloß, ihn sich zu merken und morgen, wenn er mit Lehnhardt sprach, zu zitieren. Das ermüdete und schläferte ihn ein.
Der Morgen erfüllte fahl das Fenster.