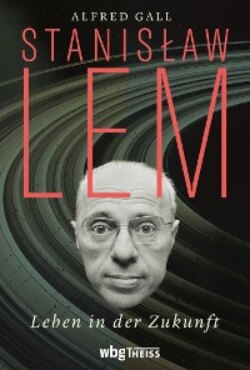Читать книгу Stanislaw Lem - Alfred Gall - Страница 9
Die Familie Lem in Lwów – Das Hohe Schloß (1966)
ОглавлениеStanisław Lems Vater, Samuel Lem, studierte Medizin und war in Lemberg als Laryngologe tätig. In dieser Stadt lernte er auch Sabina Wollner, seine spätere Ehefrau, kennen. Die beiden verband ein inniges Liebesverhältnis, das noch vor dem Ersten Weltkrieg durch eine Verlobung bekräftigt wurde, obschon Samuel Lems weitere Verwandtschaft die Beziehung als Mesalliance betrachtete. Für sie war es schwer zu akzeptieren, dass der akademisch gebildete Mediziner eine Frau ohne höhere Bildung und mit deutlichem Altersunterschied zu ihrem künftigen Ehemann heiraten wollte. Die Hochzeit wurde durch die politische Entwicklung verzögert. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde Samuel Lem als Militärarzt für den Kriegsdienst mobilisiert. Zunächst an der Grenze zu Italien stationiert, wurde er bald wieder nach Galizien in die Festungsstadt Przemyśl verlegt, wo er nach der Eroberung durch russische Truppen am 22. März 1915 in Kriegsgefangenschaft geriet und in einem Lager in Zentralasien interniert wurde. Als Kriegsgefangener erlebte Samuel Lem auch den Ausbruch der Oktoberrevolution. Als Folge des Friedens von Brest-Litowsk wurde er aus der Kriegsgefangenschaft entlassen, so dass er sich auf den Heimweg nach Lemberg machen konnte. In den Wirren des russischen Bürgerkriegs entging er, bereits in der Ukraine angekommen, mit Glück der Hinrichtung durch die Bolschewiki, die ihn als Klassenfeind – er war österreichischer Offizier und bürgerlicher Akademiker – schon zur Liquidierung bestimmt hatten. Noch vor dem Ende des Ersten Weltkriegs traf Samuel Lem in Lemberg ein, wo er mit einem Orden – dem Goldenen Verdienstkreuz in Gold mit der Krone – ausgezeichnet wurde; für den Filius ein dankbar genutztes Spielzeug in der Kindheit. Die Habsburgermonarchie befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Stadium der Erosion. Ihren Zerfall bei Kriegsende beklagte Stanisław Lem keineswegs mit nostalgischer Trauer. Zwar gestand er in den Gesprächen mit Stanisław Bereś bereitwillig, eine gewisse Schwäche für die österreichische Literatur zu haben, das Reich der Habsburger bezeichnete er jedoch als „schreckliche Monarchie“, die ein „schlechtes Ende genommen“ habe (Lem über Lem, 163).
Die Eltern von Stanisław Lem ließen sich von den unsicheren Verhältnissen bei Kriegsende keineswegs abschrecken und feierten am 30. Mai 1919 Hochzeit. Sie wohnten an der Brajerowska-Straße 4 (heute Bohdan Lepkyj-Straße). Das Gymnasium, damals nach dem Publizisten und Historiker Karol Szajnocha benannt, befand sich an der Podwale 2 (heute Pidvalna 2). Zunächst 1818 als deutsches Gymnasium gegründet und bis 1918 für die Kinder der österreichischen Beamtenschaft bestimmt, wurde es auf Beschluss der polnischen Regierung 1919 zu einem polnischen Gymnasium und die Unterrichtssprache Deutsch durch Polnisch ersetzt, Deutsch blieb freilich ein Unterrichtsfach. An diesem Gymnasium war bis zu seiner Ernennung zum Universitätsprofessor auch der Philosoph Roman Ingarden als Lehrer tätig. Ein Absolvent dieses Gymnasiums war auch Stanisław Lem. Auch wenn er aus einer assimilierten jüdischen Familie stammte, die sich zur polnischen Nation bekannte, besuchte er den obligatorischen Religionsunterricht in jüdischer Religion.
Abb. 2: Stanisław Lem als Gymnasiast, Lemberg 1930
Lem hat sich selten über seine Eltern geäußert. Mit Sicherheit auch deswegen, weil er seine jüdische Herkunft stets sehr diskret behandelte und sie in der Öffentlichkeit kaum einmal ansprach. Auch scheint er die Kindheit, wenngleich er sie in seinen Erinnerungen Das Hohe Schloß (1966) als glücklich bezeichnete, doch auch sehr zurückgezogen, wenn nicht gar einsam zugebracht zu haben. Aus den wenigen Bemerkungen über die Mutter, die als Hausfrau die Familie versorgte, und den Vater, der in einer Klinik als Laryngologe arbeitete, daneben eine Privatpraxis in der Familienwohnung führte und zusätzlich noch für eine Krankenkasse tätig war, ergibt sich das Bild einer materiell abgesicherten, aber auch isolierten Kindheit. Selbstironisch stellte Lem seine Erinnerungen denjenigen von Norbert Wiener, dem Begründer der Kybernetik, zur Seite. Wo der amerikanische Mathematiker und Philosoph seine Autobiographie – ironisch angehaucht – mit der Geschichte eines Ex-Wunderkinds gleichsetzt (Ex-Prodigy. My Childhood and Youth, 1953), zögert Lem nicht, sich als Monster zu bezeichnen:
Norbert Wiener begann seine Biographie mit den Worten I was a child prodigy – ich war ein Wunderkind; ich könnte nur behaupten I was a monster – ich war ein Ungeheuer.
(Das Hohe Schloß, S. 35)
Ein Bezug zum Wunderkind wäre aber nicht an den Haaren herbeigezogen gewesen, schließlich förderte ein im Vorkriegspolen durchgeführter Intelligenztest an Oberschülern zutage, dass Stanisław Lem mit einem Intelligenzquotienten von 180 das intelligenteste Kind Südostpolens war.
Die Memoiren Das Hohe Schloß (1966) enthalten einige für den Werdegang des Schriftstellers bemerkenswerte Kindheitserfahrungen. Prägnant scheint sich das Stadtbild Lembergs in das junge Gedächtnis eingeprägt zu haben. Lem zeichnet in der Erinnerung die Routen der Spaziergänge mit seinem Vater und der Fahrten mit der Droschke nach, so dass nach und nach die Topographie der Stadt erkennbar wird. Ausgehend von der Brajerowska-Straße führten die Routen über die Mickiewicz-Allee zur Marszałkowska-Straße, vorbei an der Jan Kasimir-Universität weiter zum Jesuitengarten, zum Stryjer Park mit dem angrenzenden Turm der für ihre Liköre, Schnäpse und Weinbrände bekannten Firma Baczewski oder auch zum Smolka-Platz. Die Einsamkeit des Kindes, die auch durch Lems Kränklichkeit verursacht wurde, änderte nichts daran, dass sich Lem in Lwów zu Hause gefühlt hat. Jahrzehnte später hielt er fest, in Krakau, wo er nach dem Zweiten Weltkrieg lebte, keineswegs daheim zu sein. Lemberg bezeichnete er als Heimat und fügte – in deutscher Sprache und Kursivsetzung – an, dass er ein Vertriebener sei:
Vor Kurzem hat mich Krzysztof Myszkowski gefragt, was mir Lemberg bedeutet. Ich antwortete kurz: Meine Heimat. […] Ich wohne seit einem halben Jahrhundert in Krakau, aber als der Stadtpräsident mich bat, etwas auf die Kugel auf dem Rathaus zu schreiben, lehnte ich höflich mit der Erklärung ab, dass ich hier nur ein Asylant sei. Ich bin ein Vertriebener – ich bin auch ein Vertriebener […]. (Świat na krawędzi, S. 71, Übers. AG)
Lem spielte als Kind vor allem mit sich selbst. Der Autor erinnert sich daran, wie er als Kind seinem Zerstörungswahn nachgegangen sei und seine Spielzeuge demontiert oder mit dem Hammer zertrümmert habe:
Ich besaß auch pickende Vögel, Karussells, die sich drehten, Rennautos, Puppen, die Purzelbäume schossen – all das zerlegte ich erbarmungslos, indem ich die Rädchen und Sprungfedern unter den leuchtenden Farben hervorholte. (Lem, Das Hohe Schloß, S. 30)
Die Rechtfertigung, die Dinge nur auseinandergenommen zu haben, um ihr Funktionieren zu verstehen oder verbessern zu können, will der spätere Verfasser der Memoiren nicht gelten lassen, könnte aber in diesem Zusammenhang zur Minderung des dämonischen Eindrucks einer solchen Spielweise auf eine Autorität wie Hegel verweisen, der in der Enzyklopädie der Wissenschaften Eltern sogar rät, Kindern das Demontieren von Spielzeug zu erlauben, da so dessen Aufbau begriffen werde.
Daneben genoss Lem als Kind – und auch noch in späteren Jahrzehnten – leidenschaftlich Süßigkeiten. Der Besuch von Konditoreien und die Belohnung mit Naschwerk aller Art erfreuten Herz und Gaumen des jungen Lem. Ein frühes Interesse für Technik deutete sich in einer zweiten Leidenschaft, der Liebe für Elektrizität und Maschinen an. Als eifriger Bastler und Tüftler kaufte sich Lehm einen Rühmkorff-Funkeninduktor, eine Wimshurstmaschine und einen Tesla-Generator. Er entwarf zahlreiche Erfindungen wie ein Flugzeug in Form eines Hohlspiegels und mit Dampfantrieb oder widmete seine Zeit dem Projektieren neuer Geräte oder gar vorsintflutlicher Tiere. Auch mit Ideen für ein Perpetuum mobile hat sich Lem abgemüht. Begeistert war er auch von Automobilen. Er bewunderte seinen zwanzig Jahre älteren Cousin Marian Hemar, der den jungen Lem vor allem mit seinem Bugatti beeindruckte. Geboren als Jan Marian Hescheles erlangte Hemar in der Zwischenkriegszeit als Dichter, Journalist und Satiriker Bekanntheit.
Als dritte Leidenschaft ist Lems spielerischer Aufbau eines ausgeklügelten bürokratischen Systems für ein Phantasieland zu nennen. Ausweise, Diplome, Vollmachten und Passierscheine für dieses Land, das man auf einer Landkarte vergeblich suchen würde, hat der junge Lem mit bewunderungswürdiger Ausdauer und ebensolchem Erfindungsreichtum angefertigt, dazu kamen auch chiffrierte Aufträge oder Ernennungen für höchste Ämter in dieser verästelten bürokratischen Welt. Die Begeisterung für Technik sowie die kunstvolle Beschäftigung mit bürokratischen Dokumenten und Verfahren mögen dem Alleinsein eines gelangweilten Kindes entsprungen sein. Sie weisen aber auch voraus auf zwei in den literarischen Werken des älteren Lem öfters vorkommende Phänomene: die Welt der Technologie in ihrer Verzahnung mit autoritär-bürokratisch organisierten Herrschaftsformen.
Im Blick auf die Kindheit und Jugend eines Schriftstellers darf nicht unterschlagen werden, dass Lem auch ein Bücherwurm war. Der Kanon der polnischen Literatur und populärwissenschaftliche Bücher aller Art zählten ebenso zur Lektüre wie die medizinische Fachliteratur des Vaters. Besonders die anatomischen Atlanten mit ihren farbigen Abbildungen von Skeletten, Schädeln, Gehirnen und präparierten Eingeweiden sind im Gedächtnis haften geblieben. Allerdings stand dem jungen Lem der Sinn weniger nach der polnischen Literatur des 19. Jahrhunderts, die ihm der Vater nahezubringen versuchte, als nach Abenteuerliteratur von Karl May oder Horrorliteratur, wie sie etwa Stefan Grabiński verfasste. Den Besuch des Theaterstücks Die Befreiung von Stanisław Wyspiański hinterließ im Gedächtnis des Schriftstellers jedenfalls den auf seine Weise unvergesslichen Eindruck schrecklicher Langeweile. Aber auch Jules Verne und Władysław Jan Umiński (der polnische Jules Verne und gemeinsam mit Antoni Lange sowie Jerzy Żuławski Wegbereiter einer polnischen Science-Fiction-Literatur), der unumstrittene Meister der polnischen Komödie Aleksander Fredro oder der für seine historische Epik mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Henryk Sienkiewicz boten dem lesehungrigen Lem abwechslungsreiche sowie prägende Lektüreerfahrungen, die dann bereits im besetzten Lemberg auch um H. G. Wells Krieg der Welten erweitert werden sollten.
Auffallend an den Erinnerungen in Das Hohe Schloß ist die Beschränkung auf das Private. Privat ist diese Kindheit, fast abgetrennt von den damaligen Verhältnissen scheint Lem als Kind in einer eigenen Welt gelebt zu haben. Das öffentliche Lemberg, die Stadt und die Region mit ihren sozialen und politischen Verhältnissen rücken kaum einmal in den Fokus. Aber selbst dem Maturanden Lem entging in einem Schulungslager auf dem Lande nicht die entsetzliche Not der Huzulen. Dem Privaten ist im Rückblick aber auch der Schmerz von Verlusten beigemengt, insbesondere wenn sich der Autor an Verwandte und Bekannte erinnert, die in Krieg und Okkupation ihr Leben verloren.
Die Eltern waren angesehene Bürger der Stadt. Samuel Lem genoss hohes Ansehen. Der Vater hatte Kontakt zu Ludwik Fleck, der damals in Lemberg wirkte und als Mikrobiologe, Immunologe sowie Wissenschaftstheoretiker zu Weltruhm gelangen sollte. Es liegt sogar eine gemeinsame Veröffentlichung von Samuel Lem mit Fleck aus dem Jahr 1928 in der Zeitschrift Medizinische Nachrichten vor: Rzadzki przypdadek wtórnej wakcyny na języku (An Unusual Case of Secundary Vaccine on the Tongue). Für die Wissenschaftsstadt Lemberg sind daneben mindestens zwei weitere Aktivitäten mit internationaler Ausstrahlung hervorzuheben.
Zu nennen ist zum einen die Tätigkeit des polnischen Biologen Rudolf Weigl, der an der Lemberger Universität als Fleckfieber-Spezialist wirkte und mit seinen bahnbrechenden Forschungsarbeiten – etwa auch der Entwicklung eines Anti-Flecktyphus-Impfstoffs – Weltgeltung erlangte. In der Zeit der deutschen Okkupation hat sich Rudolf Weigl dadurch hervorgetan, dass er zahllose polnische Wissenschaftler, darunter viele Juden und Vertreter des polnischen Widerstands, als unabkömmlich für seine kriegswichtigen Forschungen bezeichnete und so vor Verfolgung und Tod rettete. Unter diesen Geretteten befanden sich die Mikrobiologen Paula und Henryk Meisel, die Mathematiker Bronisław Knaster und Stefan Banach sowie zeitweise auch Ludwik Fleck. Wurde Weigl für seine Arbeit im „Institut für Fleckfieber und Virusforschung“ nach dem Krieg von den kommunistischen Machthabern noch der Kollaboration mit den Deutschen bezichtigt, findet seine humanitäre Heldentat seit 1989 uneingeschränkte Anerkennung: In Yad Vashem wird ihm seit 2003 als Gerechtem unter den Völkern gedacht. Der polnische Regisseur Andrzej Żuławski hat seinem Film Der dritte Teil der Nacht (1971) die Arbeit von Weigls Institut zugrunde gelegt und so die Verschränkung von Besatzungsterror, Widerstand und Wissenschaft eindrücklich in alptraumhafter Bildfolge festgehalten.
Zum anderen verdient auch die Lemberg-Warschau-Schule Erwähnung, die im Bereich der Logik sowie der Mathematik Wegweisendes geleistet hat und auf das Betreiben von Kazimierz Twardowski an der Lemberger Jan Kasimir-Universität zurückging. Mit der Wiederherstellung der polnischen Eigenstaatlichkeit wechselten zahlreiche Vertreter dieser Schule nach Warschau – daher rührt auch die Doppelbezeichnung. Zu ihren führenden Vertretern gehörten Jan Łukasiewicz, Stanisław Leśniewski, Tadeusz Kotarbiński und Kazimierz Ajdukiewicz, der vielleicht bekannteste Vertreter dürfte Alfred Tarski gewesen sein.
Die aufblühende Wissenschaft mit ihrer Strahlkraft ins Ausland darf jedoch den Blick auf die sozialen Spannungen nicht verstellen. Arbeiterunruhen, die in Lemberg 1936 angesichts der Folgen der Weltwirtschaftskrise ausbrachen, wurden mit Gewalt niedergeschlagen und forderten zahlreiche Tote. Auch den Gymnasiasten Lem befiel bei diesem Ereignis ein mulmiges Gefühl, das sich jedoch bald wieder in den alltäglichen Verrichtungen auflöste. Im Sommer 1939, frisch nach der Matura, träumte Stanisław Lem davon, am Polytechnikum in Lemberg sein Studium zu beginnen. Als erfolgreicher Gymnasiast mit sehr guten Noten schienen ihm alle Wege offen zu stehen. Noch völlig außer Betracht fiel die Karriere als Schriftsteller. Auch wenn das Polytechnikum 1938 nach den Ghettobänken zusätzlich eine Begrenzung für jüdische Studierende eingeführt hatte, machte sich Lem große Hoffnungen, mit seinem guten Maturazeugnis diese antisemitische Schikane überwinden und z. B. als Ingenieur sein Lebensglück finden zu können. Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs machte ihm jedoch einen dicken Strich durch die Rechnung.