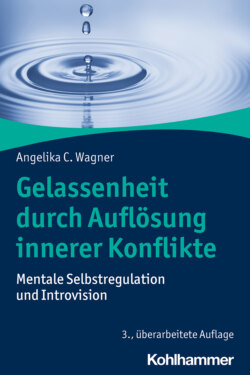Читать книгу Gelassenheit durch Auflösung innerer Konflikte - Angelika C. Wagner - Страница 69
Warum es im Folgenden vor allem um akute Konflikte geht
ОглавлениеGrundlagen und Vorgehen der Introvision werden in diesem Buch überwiegend am Beispiel von akuten Konflikten erläutert werden. Nun wäre es zwar auch denkbar, mit kleineren Beispielen zu beginnen – der Reduktion leichter Anspannungen etwa oder der Optimierung der Problemlösefähigkeit. Aber die Erfahrung zeigt, dass es zweckmäßiger ist, als Beispiele akuten Ärger, chronische Angst oder anhaltende Entscheidungsprobleme zu verwenden.
Der Grund dafür liegt in dem, was die Verfasserin nur bedingt scherzhaft (in Anlehnung an Walter Breitenbach) das »Theorem der dicken Klöpse« genannt hat. Dieses Theorem besagt, dass den meisten Menschen als Erstes diejenigen Konflikte einfallen, die für sie psychisch besonders belastend sind – jedenfalls dann, wenn es darum geht, Beispiele für die Anwendung der Introvision zu finden.
In den ersten Jahren hat die Verfasserin viel Mühe darauf verwandt, in Vorträgen und Seminaren über die Entstehung und Auflösung von Konflikten die Zuhörerschaft darin zu ermutigen, zunächst einmal kleine, harmlose Probleme auszuwählen, um das Grundprinzip der Introvision zu verdeutlichen. Schließlich ist es ein altbewährtes pädagogisches Prinzip, vom Einfachen zum Schwierigen vorzudringen. Deshalb wäre es schön, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst die Introvision bei der Auflösung kleinerer, d. h. weniger belastender Konflikte üben würden, bevor sie dann das Gelernte auf Konflikte anwenden, die mit starken Emotionen verbunden sind.
Die Erfahrung zeigte jedoch, dass dieses Vorhaben gründlich misslang. Trotz entsprechender Aufforderungen, am Anfang einen »kleinen« Konflikt auszuwählen, zeigte die Imperativanalyse rasch, dass sich dahinter in aller Regel subjektive Kernimperative verbargen – und damit »schlimme« Bilder, Gedanken oder Gefühle. (Im Nachhinein lässt sich dieses Phänomen auf dem Hintergrund der Theorie der Mentalen Introferenz leicht erklären; ( Kap. 2; Kap. 7).
Nun gut, so die nächste Überlegung damals, wenn das auch bei der praktischen Anwendung schwierig ist, dann könnte man wenigstens im Vortrag selber die Grundprinzipien zunächst an einfachen, kleinen, »harmlosen« imperativischen Vorstellungen erläutern – etwa am Beispiel des Wetters. Wenn es – was in Hamburg öfter vorkommt – wieder einmal regnete, dann wurde dies genutzt, um daran die Grundstruktur eines Ärger-Konflikts zu veranschaulichen: »Es regnet jetzt – und das darf nicht sein!«
Die Folge war jedoch, dass sich im Durchschnitt etwa nach zehn Minuten jemand zu Wort meldete und leicht ärgerlich verlangte, dass wir uns doch, bitte schön, endlich mit ernsthaften Konflikten beschäftigen sollten.
Also tun wir das auch hier: Nach einer Einführung in die Introferenztheorie ( Kap. 2) und das konstatierende aufmerksame Wahrnehmen (KAW; Kap. 3) geht es dann um akute Konflikte wie z. B. Angst, Ärger und Depression ( Kap. 4–6). Gleichzeitig wird dann auch gezeigt ( Kap. 5.3; Kap. 6.2), wie sich dasselbe Prinzip (»Blitzintrovision«) auch auf kleinere alltägliche Irritationen anwenden lässt – beim Lernen, im Beruf und im Sport. Nachdem die praktische Anwendung der Introvision in Kapitel 5 ausführlich beschrieben worden ist, enthält Kapitel 6 dann viele praktische Beispiele für Introvision in unterschiedlichen Anwendungsfeldern – von Stress und Beziehungsproblemen über Flugangst und Sucht bis hin zu Juckreiz und Ohnmachtsanfällen.
Für theoretisch interessierte Leserinnen und Leser folgt in Kapitel 7 eine zusammenfassende Darstellung der Theorie der Mentalen Introferenz, die sich als eine allgemeine grundlegende Theorie der mentalen Selbstregulation dazu eignet, auch andere Phänomen zu erklären. Zum Beispiel die Frage der Willensfreiheit, die heute breit diskutiert wird (Singer, 2006; Roth 2008). Aus Sicht der TMI lassen sich die neuen Forschungsergebnisse (Libet, 2004), die dem zu widersprechen scheinen, als Beleg dafür auffassen, dass wir in der Tat in der Lage sind, in unsere eigenen mentalen Prozesse einzugreifen ( Kap. 7.3) – insofern stellt die TMI auch eine Theorie der Volition, d. h. des willentlichen Handelns dar. Allerdings ist diese Fähigkeit einzugreifen, begrenzt: Zum einen »kostet« sie (Energie, Unruhe, Datenverlust) und zum anderen scheint es in manchen Situationen – fast – unmöglich zu sein. Weshalb das so ist, warum das mit Emotionen verbunden ist und was sich dann tun lässt, wird in diesem Buch ausführlich aus Sicht der TMI erklärt.