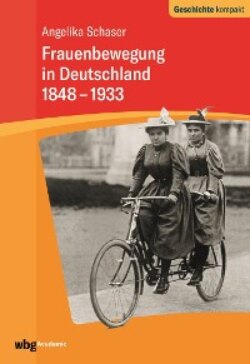Читать книгу Frauenbewegung in Deutschland 1848-1933 - Angelika Schaser - Страница 12
3. Eheleute als Arbeitspaar
ОглавлениеMittelpunkt der vormodernen Familienwirtschaft des „ganzen Hauses“ war das Ehepaar.
Für die Gründung eines eigenen Haushaltes war die Ehe in der Regel Voraussetzung. Ehemann und Ehefrau waren als Hausherr und Hausfrau aufeinander angewiesen, sie bildeten ein „Arbeitspaar“. Das Verhältnis dieses Arbeitspaares konnte unterschiedlich ausgestaltet sein. Heide Wunder hat gezeigt, dass in der frühneuzeitlichen Gesellschaft zwar prinzipiell Ungleichheit zwischen Männern und Frauen festgeschrieben war, es aber „keine generelle Unterordnung aller Frauen“ gab. Es galt für Eheleute der Grundsatz, dass „Freud und Leid zu teilen“ seien. Dabei wurden Rechte und Pflichten nicht schematisch verteilt. Es ging vielmehr darum, gemeinsam einen angemessenen sozialen Status zu erreichen und zu erhalten, was weder Mann noch Frau als Einzelperson gelingen konnte. Es galt, „Gleichheit von Ehefrau und Ehemann im Sinne von Gleichwertigkeit“ herzustellen, und dafür waren beide aufeinander angewiesen (Heide Wunder).
Abb.1 D.W. von Sanden: Fayence-Tablett mit Liebespaar, Frankfurt 1687 (Reiß-Museum, Mannheim).
Diesen Sachverhalt der wechselseitigen Abhängigkeit der Ehepartner symbolisierte der Straßburger Johann Fischart (1546–1590) in seinem „Ehezuchtbüchlein“ von 1578 in folgendem Gedicht:
Quelle
Es soll der Mann sein wie die Sonn Und die Frau soll sein wie der Mon, Die Sonn hat wol ein klärern schein, Doch hat der Mon gleichfalls das sein, Und gleich wie nicht die Sonn zerstöret, dem Mon sein schein, sonder den mehret: Also soll auch ein rechter Man, Seiner Männin jr ehr thun an, Dieweil die ehr ist doch gemein, Und auch das gut keins hat allein: Und wa man nicht solch gmeinschaft behalt, Und jedes Licht sein schein erhalt, So kan es gleich so wenig bestohn Als wann die Sonn verstis den Mon, Oder der Mon verstis die Sonn.
Ausdifferenzierung des Familien- und Erwerbslebens
Diese Gleichwertigkeit der Geschlechter, die auf vielen Ebenen im „ganzen Haus“ austariert werden konnte, wurde gegen Ende der Frühen Neuzeit durch einen Prozess infrage gestellt, den man unter den Schlagworten „Privatisierung und Emotionalisierung“ zusammenfassen kann. Denn mit zunehmender Trennung des Privat- und Erwerbslebens kam die Vorstellung auf, dass der Ehemann seine Frau nach außen zu vertreten habe, der Gattin im Gegenzug dafür die unumschränkte Herrschaft zu Hause zustand. Der ursprünglich enge Zusammenhang von Privat- und Arbeitsleben im „ganzen Haus“ wurde dadurch im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts immer weiter in einen Erwerbs- und einen Familienbereich ausdifferenziert. Der Mann arbeitete zunehmend außer Haus und erhielt dafür Lohn oder Gehalt, während die Frau am Erwerb nicht mehr unmittelbar beteiligt war, sondern nun für das Funktionieren des Haushalts, für die Aufsicht über das Gesinde, für die Erziehung der Kinder und die emotionale Geborgenheit aller Familienmitglieder zuständig war. Der öffentliche Bereich wurde zugleich immer mehr aufgewertet, der häusliche abgewertet. Diese Entwicklung führte dazu, dass die in der einen oder anderen Form seit jeher existierende Geschlechtsvormundschaft immer restriktiver ausgelegt wurde.
Quelle
Die klare Unterordnung der Ehefrau in Zedlers Universal Lexicon 1735
aus dem Artikel „Frau“ in: Grosses Universal Lexicon aller Wissenschaften und Künste von Johann Heinrich Zedler, Band 9, Halle und Leipzig 1735, Sp. 1767.
Frau, oder Weib ist eine verehelichte Person, so ihres Mannes Willen und Befehl unterworfen, die Haushaltung führet, und in selbiger ihrem Gesinde vorgesetzt ist. Sie mag auch noch so geringen Standes und Herkommens seyn, so tritt sie doch zugleich mit in die Würde ihres Mannes, geniesset gleiche Jura mit ihm, und kan vor keinen andern Ort belanget werden, als wo ihr Mann hingehöret.
Mit Geschlechtsvormundschaft ist die rechtliche Unselbstständigkeit der Frau gemeint, die in der Regel dem Vater, dem Ehemann oder einer anderen männlichen Person unterstand und beispielsweise nicht allein vor Gericht erscheinen konnte, sondern dort einen selbst gewählten oder auch aufgezwungenen Vormund präsentieren musste. Diese Geschlechtsvormundschaft existierte in verschiedenen Abstufungen in den deutschsprachigen Gebieten bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, in der Sonderform der ehelichen Vormundschaft währte sie in Deutschland bisin das 20. Jahrhundert. So wurde noch 1957 in der Bundesrepublik in einem Reformgesetz der Ehefrau nur dann die Erwerbstätigkeit gestattet, wenn „dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist“.
Der Zerfall des „ganzen Hauses“ und damit die Infragestellung der Gleichwertigkeit der Ehepaare waren insbesondere im Bürgertum des 18. Jahrhunderts zu beobachten. Hier hing der Lebensunterhalt bald mehr als in anderen Gesellschaftsschichten von der persönlichen Qualifikation und beruflichen Leistung des Mannes ab. Der Mann konnte im Idealfall selbstständig eine Familie ernähren, die Arbeitskraft der Frau spielte in dieser Form der Ehe keine so große Rolle mehr, und andere Persönlichkeitsmerkmale von Frauen gewannen nun an Bedeutung. „Was die Frau im Haushalt und Familie an wirtschaftlicher Bedeutung verlor, gewann sie an emotionaler Bedeutung für den Mann“ (Barbara Stollberg-Rilinger). Die Liebe trat nun als ausschlaggebende Basis einer guten Ehe auf den Plan. Während Liebe bis dahin als wünschenswertes Element einer Ehe galt, die sich im günstigen Fall im Laufe einer Ehe entwickeln konnte, so wurde die Liebe nun zur Voraussetzung für eine glückliche Ehe erklärt. Das Bürgertum übernahm damit eine Vorreiterrolle für die Transformation des „ganzen Hauses“ in die moderne Kleinfamilie, die in den unteren Schichten bald Nachahmung finden sollte.
Querelle des Femmes
Der zweite Prozess, der die Geschlechterordnung entscheidend verändern sollte, war die Infragestellung der ständischen Ordnung, die das 18. und 19. Jahrhundert ebenso kennzeichnete wie die Ausdifferenzierung des Familien- und Erwerbslebens. Die ständische Ordnung, in der jeder Mensch seinen ihm durch Geburt zugewiesenen Platz einzunehmen hatte („Schuster bleib bei deinen Leisten“), wurde von aufgeklärten Geistern zunehmend infrage gestellt. Die Gleichheit der Menschen, Denk- und Schreibfreiheit wurden gefordert. In diese Debatte floss auch die sogenannte Querelle des Femmes ein. Mit „Querelle des Femmes“ ist der in der Literatur vom 15. bis zum 18. Jahrhundert dokumentierte Streit über das Wesen und den Wert der Frauen gemeint, der schon lange vor der Französischen Revolution entbrannt war. Im weiteren Sinne ist diese „Querelle des Femmes“ als Menschenrechtsdebatte anzusehen. Bald sollte sich zeigen, dass die Forderungen nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit nur auf den männlichen Teil der Bevölkerung zielten. Frauen blieben davon ausgenommen, zunehmend wurde nun ihr „natürlicher Geschlechtscharakter“ diskutiert und zementiert. Der „Individualisierungsschub des 18. Jahrhunderts … klammerte Frauen ausdrücklich aus“ (Martina Kessel). Während sich Männer immer mehr mit ihrem Beruf identifizierten, wurden für Frauen die Mutterpflichten zur heiligen Pflicht erklärt und Frauen zunehmend für das emotionale Gleichgewicht ihrer Familien verantwortlich gemacht.