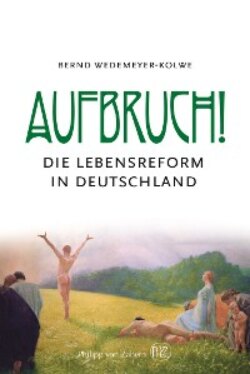Читать книгу Aufbruch! - Bernd Wedemeyer-Kolwe - Страница 7
Vorwort
ОглавлениеIm Jahre 1918 fertigte der Maler und Schriftsteller Ludwig Fahrenkrog das Ölgemälde „Die heilige Stunde“ an, das für dieses Buch als Titelbild ausgewählt wurde: Vor einer bewaldeten hügeligen Gegend streckt eine nackte Männergestalt, auf einer blumigen Wiese stehend, die ausgebreiteten Arme der Sonne entgegen; hinter ihm und um ihn schart sich in andächtiger, ja religiöser Haltung eine Gruppe Männer, Frauen und Kinder, einige von ihnen ebenfalls nackt, andere in fließende historisierende Gewänder gekleidet.
Mit den Motiven auf seinem zwischen Jugendstil und Symbolismus angesiedelten Gemälde verwies Fahrenkrog auf damals aktuelle und breit diskutierte gesellschaftliche Thematiken wie religiöse Naturverehrung und antimoderne Zivilisationskritik, und er verschaffte damit dem zentralen Protagonisten dieser zeitgenössischen Themen, der Lebensreformbewegung, einen populären bildlichen Ausdruck. Die Lebensreformbewegung entstand zeitgleich mit den Modernisierungs- und Industrialisierungsschüben des späten Kaiserreichs, die sie mit tiefem Unbehagen zur Kenntnis nahm. Auf den rasanten gesellschaftlichen, sozialen, technischen und wirtschaftlichen Fortschritt antwortete die Lebensreform mit zivilisationskritischen Ideologien, gegenkulturellen Naturentwürfen und körperlichen Achtsamkeitsstrategien. Ihre „Zurück zur Natur“-Konzepte umfassten unter anderem Vegetarismus und Ernährungsreform, alternative Heilverfahren, (Frei)Körperkultur und das Siedeln in ländlichen Kommunen. Die Lebensreformbewegung forschte nach individuellen Wegen eines neuen Zusammenlebens fern der Modernisierung, ihr Ziel war eine Gesellschafsreform durch Selbstreform.
Die Lebensreformbewegung war nicht unpolitisch. Zwar gab es dezidiert privat-unpolitische Haltungen und apolitisch-alternative Einstellungen, aber Weltverbesserung kommt kaum ohne politische Stellungnahmen aus. So gab es sozialdemokratische, ja ausgesprochen linke Gruppen jedweder Couleur, die über lebensreformerische Projekte gesellschaftliches Elend im Ganzen bekämpfen wollten, und es gab völkische und rassistische Gruppierungen, die einem gesellschaftlichen „Zurück zur Natur“ein verengtes germanophiles „Zurück zur deutschen Natur“entgegensetzten; darauf wird in diesem Buch immer wieder zurückzukommen sein. Ludwig Fahrenkrog gehörte zur letzteren Kategorie – unter anderem war er der Begründer der völkisch-rassistischen „Germanischen Glaubens-Gemeinschaft“–, und wenn auch viele Betrachter seiner „heiligen Stunde“, die er auch erfolgreich als Grafik und Bildpostkarte vertrieb, lediglich allgemeine lebensreformerische Aspekte wie Nacktheit, Natur und Sonnenbaden wahrnahmen, bemerkten seine Anhänger die dezidiert gemalte deutsche Landschaft, die nackten blonden Arier, die pseudogermanische Bekleidung der Frauen und Kinder und die besondere Körperstellung des nackten Lichtanbeters, die einem nordischen Runenzeichen entsprach. Auch sein noch erfolgreicherer Vorgänger, der Jugendstilmaler Hugo Höppener genannt Fidus, der 1890 seine erste Version des „Lichtgebets“zeichnete –eine androgyne nackte Gestalt in Rückenansicht, die auf einem Berggipfel die Arme gen Himmel streckt –und der damit und mit seinen zahllosen Folgegrafiken und Bildpostkarten in der Lebensreformbewegung zur Stilikone wurde, war als Vegetarier, Freikörperkulturler und Anhänger der Naturheilkunde zwar ein waschechter Lebensreformer, über seinen fatalen Hang zu völkischen Naturvorstellungen aber gehörte er ebenfalls der – schmalen – Gruppe rechtsextremer Naturreformer an, die ihr Heil in einer rein germanischen Variante der Selbstreform suchten.
Mit ihren Naturkonzepten bewegte sich die Lebensreform im Wilhelminischen Kaiserreich zwar noch in einem ausgesprochenen Außenseiterstatus, in der experimentierfreudigen und politisch unsicheren Zeit der Weimarer Republik aber wurden ihre Ingredienzien – gesunde Ernährung, Körperkultur, Naturheilkunde, selbstversorgender Gartenbau – aus verschiedenen Gründen gesellschaftlich so breit adaptiert, dass sie zu Lebensstilelementen der Mittelschicht gerannen und nachfolgend auch in der Arbeiterklasse breite Beachtung fanden. Die Elemente der Lebensreform hatten sich durchgesetzt, ohne dass jedoch der bürgerliche Rezipient jener Elemente als Lebensreformer gelten musste.
Gesellschaftlich war die Lebensreformbewegung damit lange Zeit kein Thema mehr. Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg blieben ihre wenigen noch existierenden Protagonisten Außenseiter in einer Gesellschaft, in der Ökologie, Naturkonzepte, Zivilisationskritik und Selbstreform keine bürgerlichen (Selbstfindungs-) Themen mehr waren. Dies änderte sich ab den 1970er Jahren mit der Entstehung einer neuen – zunächst randständigen und lange Zeit verspotteten – Ökologiebewegung, mit einer neuen – auch inneren – Rückbesinnung auf alte Naturkonzepte und mit der gesellschaftlichen Rückwendung zu jenen naturbezogenen Themen und Konzepten, die 70 Jahre zuvor schon einmal Kommentatoren und Begleiter extremer Modernisierungsschübe gewesen sind; Schübe, die in der damaligen bürgerlichen Gesellschaft als „Krisen“ – persönliche und soziale – wahrgenommen wurden.
Was zunächst (wieder) als Außenseiterkultur weniger überspannter Protagonisten galt, hat sich bemerkenswerterweise erneut gesellschaftlich etabliert: „Natur“. Analog zu neuen gesellschaftlichen (bürgerlichen) Unsicherheitsgefühlen und zu einer neuen, extrem raschen sozialen und wirtschaftlichen Veränderung (Globalisierung, Digitalisierung), die für viele unüberschaubar, weil nicht mehr selbst gestaltbar geworden ist, ist wieder eine Hinwendung zum „Natürlichen“, ein Interesse am „Achtsamen“, eine Neigung zum„Gesunden“und ein Rückzug zum selbstbestimmten und selbst bearbeitbaren Körper zu beobachten, inklusive ihrer Selbst-optimierungtendenzen und ihres Potentials als Mittel der sozialen Abgrenzung. Ehemalige Außenseiterpraktiken sind heute wieder bürgerlich etabliert: Naturheilverfahren, Vegetarismus und Veganismus (bisweilen als „bewußte Mangelernährung der Mittelschicht“verspottet), Fitness- und Gesundheitsbewusstsein und naturnaher Obst- und Gemüseanbau auf dem eigenen Grundstück für den Eigenbedarf; eingeschlossen politisch korrektem Lebensstil („Greenwashing“) und absurd anmutender Kommerzialisierung, die von Barfußschuhen über„vegetarische“Decken und Kissenbezüge bis zu Kunstobjekten reicht, die mit CO2-neutral-Stickern versehen sind.
Und auch „naturpolitisch“ist eine Rückwendung zu einem historisch als überlebt bewerteten Phänomen zu beobachten: die völkisch-lebensreformerischen Siedler, die seit einigen Jahren als „Ökobauer, Schmied oder Imker (…) Höfe in dünn besiedelten Gebieten Deutschlands“kaufen, als „sogenannte völkische Siedler (…) rechtsextremes Gedankengut (verbreiten) und (…) als braune Ökologen (…) Dorfstrukturen unterwandern“und die eigentlich international angelegte ökologische „Zurück zur Natur“-Idee wieder einmal national verengt als „Zurück zur deutschen Natur"-Ideologie missbrauchen: die „Bio-Nazis“.1
Geschichtsschreibung hat oft einen aktuellen Bezugspunkt, und die gegenwärtige Rückwendung zu globalen wie regionalen Naturkonzepten im zeitlichen Zusammenhang mit neuen Modernisierungsschüben provoziert Fragen nach historischen Vorläufern, deren Beantwortung möglicherweise den Blick schärfen kann für aktuelle Bezüge und gegenwärtige Entwicklungen. Wenn hier auch die Analyse der historischen Lebensreform der vorletzten Jahrhundertwende zwischen Sozialutopie, Selbstreform und Lebensstil im Mittelpunkt steht, so sollte und könnte sie doch auch als historische Reflektion über die Aktualität heutiger Daseinskonzepte gelesen werden.
Dass diese Studie entstehen konnte, ist vielen Kolleginnen und Kollegen zu verdanken, die mich ermuntert und unterstützt haben. Zu großem Dank verpflichtet bin ich Uwe Puschner und Ulrich Linse sowie Judith Baumgartner, Cornelia Regin, Justus H. Ulbricht, Christiane Barz, Christoph Knüppel, Andreas Schwab, Stefan Rindlisbacher, Johannes Graul, Anna Schrickel, Olivier Hanse und Klaus Völkening. Dank schulde ich der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, die das Buch in ihr Verlagsprogramm aufgenommen hat, namentlich sei hier Daniel Zimmermann genannt, der das Entstehen dieser Studie als Lektor betreut und begleitet hat.
Bernd Wedemeyer-Kolwe
Göttingen, im Dezember 2016