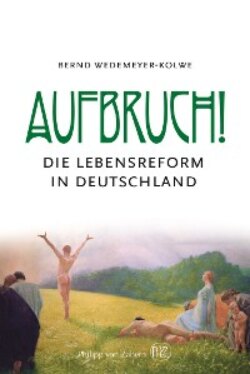Читать книгу Aufbruch! - Bernd Wedemeyer-Kolwe - Страница 9
Begriffe, Motive und Stichwortgeber
ОглавлениеDer Lebensreform immanent war ein ganzes Bündel an Leitbegriffen und Motiven, mit denen sich die Protagonisten und Gruppen selbst definierten oder die ihnen extern von den Zeitgenossen zugeschrieben wurden und über die sie dann auch von der modernen Forschung definiert werden sollte. Dabei wurden die damaligen Leitbegriffe in der zeitgenössischen Selbst– und Fremddeutung jedoch nicht übereinstimmend definiert und verwendet, sondern sie weichen je nach den verschiedenen, auch politischen, Strömungen in der ohnehin äußerst heterogenen Lebensreformbewegung voneinander ab. Denn das Ziel der zeitgenössischen Deutungsvarianten waren in der Regel keineswegs wissenschaftlich-rationale Definitionen, sondern – besonders bei den völkischen Gruppen der Lebensreformer – ideologisch orientierte Wertungen oder politische Agitationen; eine Tendenz, die zu spekulativen Assoziationen und logisch löchrigen Deutungen von Leitbegriffen und Motivlagen führen musste. Dennoch lässt sich anhand einer näheren Betrachtung ihrer Begriffe und Motive die Lebensreformbewegung zumindest in Umrissen charakterisieren.
In ihrer zeitgenössischen Selbstbeschreibung verorteten sich die Anhänger und Gruppen der Lebensreform als Teil der sozialreformerischen Bewegungen des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, und wenn ihre Protagonisten diese Zuordnung auch selten präzise zu definieren vermochten, sondern vielmehr aufzählend und umschreibend formulierten, so trafen sie im Wesentlichen den Kern der Sache. So notierte die Zeitschrift „Körperkultur“ 1909: „Wir begegnen heute den verschiedenartigsten Versuchen einzelner Menschen und ganzer Gruppen von Menschen, die in ihre gesamte Lebenshaltung, in Kleidung, Ernährung, usw. neue und ungewöhnliche Bedingungen einführen, da sie die altgewohnte Weise als Unzuträglichkeit empfinden.“1 Zwar gebe es daher keine „genaue Abgrenzung unserer Bewegung“ und auch keine „einzige Grundwurzel“. Dennoch, oder vielleicht auch deshalb, habe, so notierte der völkische Nudist Richard Ungewitter 1911 selbstzufrieden, „unsere Bewegung“ doch rasch so „erfreuliche Fortschritte gemacht", dass all diese Vereinigungen, wie 1904 der „Naturarzt“ berichtete, „sich zu einer gewaltigen Reformbewegung entwickelt (haben), die alle Fragen des individuellen und sozialen Lebens in den Kreis ihrer Erörterung zieht“.2
Dabei werde, so die Zeitschrift „Kraft und Schönheit“ im Jahre 1920, „der Sinn des Wortes Reform meistens verkehrt aufgefaßt, denn das lateinische Wort Reform bedeutet eigentlich Zurückbildung einer augenblicklich bestehenden Einrichtung, auf ihrer frühere Form, während die meisten Menschen darunter eine Neubildung oder Verbesserung verstehen. Diese gewünschten Verbesserungen bedeuten aber in den meisten Fällen nur eine Rückbildung zu den ursprünglichen gesunden Verhältnissen.“3 Diese „Rückbildung“ könne jedoch nicht durch politische Reformen oder gar Revolutionen eingeleitet werden, sondern läge ausschließlich in der Verantwortung des einzelnen Menschen, der als Vorreiter eines „dritten Weges“ zwischen Kapitalismus und Kommunismus vorangehe. Denn das „ist die Forderung der Selbstreform von jedem Anhänger: Was du für gut und erstrebenswert hältst, das verwirkliche. Erwarte die Aenderung nicht als Geschenk von dritter Seite, nicht von aussen – erwecke die in deinem Innern schlummernde Kraft zur Selbsterlösung! Beginne! Begib dich auf den Weg.“4 So könne nur durch Selbstreform, die selbstverantwortliche Änderung des eigenen Lebens, die „soziale Frage in einer Generation von selbst gelöst“ werden.5 Anschaulich illustriert wurde die Gedankenfigur der Selbstreform in einem von dem bekannten lebensreformerischen Maler Fidus angefertigten Titelblatt für die Zeitschrift „Deutsche Volksstimme. Organ der Deutschen Bodenreformer“, die eine beschilderte Weggabelung zeigt, bei der der erste Weg in den Abgrund (Kapitalismus), der zweite Weg in ein unwirkliches umwölktes Gebirge (Kommunismus) und der dritte Weg in ein sonniges Land führt (Bodenreform).6
Wegkreuzung Reform. Vignette von Fidus für die Zeitschrift „Deutsche Volkstimme“.
Diese Selbsteinschätzung als „sozialreformerische Bewegung“ (Krabbe 1974) wurde von der Forschung im Wesentlichen übernommen und zunächst weder diskutiert noch definiert. Erst 1988 legte der Politikwissenschaftler Joachim Raschke eine historischsystematische Definition des Begriffs der „sozialen Bewegungen“ vor, in die er die Lebensreformbewegung mit einschloss. Danach charakterisierte Raschke „soziale Bewegung“ – und mit ihr die Lebensreformbewegung – als heterogenen, variablen, durch ein ausgeprägtes „Wir-Gefühl“ und einen ausgesprochenen Suchcharakter geprägten Zusammenschluss von Personen oder Gruppen, der auf eine kulturelle, gesellschaftliche und soziale Veränderung des Lebens und der Gesellschaft bzw. auf die Verhinderung von Veränderung ausgerichtet ist und über eine Negativanalyse der bestehenden Verhältnisse eine gesellschaftliche, soziale oder religiöse Utopie verfolgt. Dabei sollte die Umsetzung der gesellschaftlichen Ziele (der Lebensreform) über individuelle Veränderung, persönliche Aufklärung und beispielgebende Projekte und Institutionen, d. h. über den sogenannten „Dritten Weg“ zwischen Kapitalismus und Kommunismus, erfolgen und nicht über eine Revolution oder einen Regierungserlass. Auch Raschke versteht hier unter Lebensreform die in der Literatur so bezeichneten – und oben schon behandelten – „spezifischen“ und „peripheren“ lebensreformerischen Teilströmungen, während er die Jugendbewegung, die Arbeiterbewegung, die Friedensbewegung und die Frauenbewegung als zeitgenössische, der Lebensreform benachbarte soziale Bewegungen des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts (bei ihm die „industrielle Phase“) bezeichnet. Insgesamt gelten, nach Raschke, soziale Bewegungen als moderneimmanent, d. h. sie sind Produkt und Produzent sowie Ursache und Wirkung des sozialen Wandels.7 Die Definition Raschkes wurde in der Folge von Teilen der Forschung übernommen, während in anderen Studien der Begriff weiterhin definitorisch nicht eingegrenzt wurde.8
Unter den zentralen Schlüsselbegriffen, die die Lebensreformbewegung – und neben ihr auch die mit ihr personell, organisatorisch und ideologisch benachbarte Reformpädagogik und Jugendbewegung – gebetsmühlenhaft postulierten, dürfte der Begriff der „Natur“ das am meisten strapazierte Schlagwort gewesen sein.9 Dabei litt eine präzise Begriffsdefinition auch hier unter der Tatsache, dass „Natur“ vornehmlich als ideologischer – und je nach politischer Richtung entsprechend ideologisch variabler – Kampfbegriff eingesetzt werden konnte. Die Verwendung des Naturbegriffs in der Lebensreformbewegung ist Legion, und ohne die Fülle an zeitgenössischen Belegen – die auch Selbstbezeichnungen wie „Naturheilkunde“ oder auch „Bund der Vereine für naturgemässe Lebens- und Heilweise“ mit einschlössen – unnötig strapazieren zu müssen, sollten hier Hinweise genügen, um die Allgegenwärtigkeit des Naturbegriffes in der Lebensreformbewegung hinreichend zu demonstrieren; etwa der Titel des 1896 erschienenen zentralen Werkes des bekannten Naturheilkundlers Adolf Just: „Kehrt zur Natur zurück!“ sowie der in etlichen Traktaten und Zeitschriften erhobene und auf Jean-Jacques Rousseaus Naturvorstellungen und John Frank Newtons Verteidigungsschrift „Return to nature“ von 1811 zurückgehende „Schlachtruf: Zurück zur Natur!“10
Trotz der Kompromisslosigkeit suggerierenden Formel des „Zurück zur Natur“ ging es der Lebensreform natürlich nicht darum, in eine Art prähistorisches ursprüngliches Stadium einer Existenz ohne jegliche Artefakte zurückzukehren, dazu wurde der Naturbegriff viel zu differenziert und reflektiert verwendet, wenn auch der Blick häufig durch ideologische und politische Sichtweisen getrübt werden konnte. Der lebensreformerische Begriff der „Natur“ stand vielmehr in der Tradition der bürgerlichen Natürlichkeitsdiskurse seit der Aufklärung und bezeichnete, wie Thomas Rohkrämer prägnant zusammenfasst, „die Natur in uns, die Natur um uns herum und die Natur als Norm oder Essenz“, wobei sich die Definitionen aufgrund der ihnen innewohnenden Gesellschaftskritik stets in Opposition zu den Parametern der verhassten Industriegesellschaft und zu ihren Schlagworten wie Kultur und Zivilisation bewegten.11
So ging es bei dem Ideal der „Natur um uns“ in der Regel um eine Bestandsaufnahme der Überreste eines physischen Umwelt- und Lebenszustandes, der angeblich noch vor der Industriegesellschaft vorhanden gewesen, nun aber im Rückschritt begriffen sei, und um die Forderung nach einer Art „naturgemäßen“ Existenz innerhalb dieser Natur unter modernen Bedingungen. Dazu gehörten die schonende Nutzung „natürlicher“ Ressourcen, die Nutzung der „Natur“ als Erholungsraum und eine entsprechende, die Umwelt schonende „natürliche Lebensweise“, zu der im Idealfall vegetarische Ernährung, handgefertigte Kleidung aus Naturstoffen, naturheilkundliche Genesungsverfahren, „natürliche“ Körperpflege und gesunde Körperkultur sowie ein naturnahes, die Umwelt schonendes selbstversorgendes Leben auf dem Lande zählten.
Der große Teil der Lebensreformer war sich dabei bewusst, dass ein solches Dasein ohne ein notwendiges Minimum an moderner Technik (wie etwa der Einsatz von Transportmitteln, Kommunikationsnetzen oder Güterproduktion) nicht umgesetzt werden konnte. „Natur um uns“ bezeichnete damit auch immer eine kritische Kooperation mit der Moderne. Allerdings schien dies nicht für die zwar wenigen, doch von den Medien als typische Vertreter der Lebensreform präsentierten „Kohlrabiapostel“ wie Gusto Graeser, Gustav Nagel oder August Engelhardt gegolten zu haben, die sich von der Moderne, ihrer Lebensweise und ihrer Technik vehement distanzierten, wenngleich einige von ihnen über den Verkauf von Bildpostkarten, Flugschriften und anderen Traktätchen am modernen Verlagswesen auch finanziell partizipierten.12
Die von Rohkrämer so bezeichnete Kategorie der „Natur in uns“ folgte zwangsläufig aus der Praxis einer die Umwelt schonenden und dem Menschen angeblich gemäßen „natürlichen Lebensweise“. Der Rückgriff auf die Naturgesetze dieser naturgemäßen Lebensweise führe, so die Argumentation in der Lebensreform, automatisch zu einer umfassenden geistigen Gesundung des Einzelnen und dadurch der gesamten Gesellschaft, denn: „Je weiter (sich die Menschen) von der Natur entfernen, umso kränker und elender müssen sie notwendigerweise werden. Abkehr von der Natur bedeutet Schwächung, Rückkehr zur Natur ist Kräftigung des ganzen Einzel- wie Volkskörpers. Die schweren sozialen Erschütterungen, die wir und die ganze Kulturwelt eben durchmachen, sind nichts weiter wie das letzte Glied dieser Abkehr von der Natur“, führte die Zeitschrift „Kraft und Schönheit“ 1920 aus.13 Dabei konnte mit „geistiger Gesundung“ eine ganze Palette verschiedener Handlungsmöglichkeiten gemeint sein, die von der instinkthaften Erweckung der eigenen „natürlichen“ Elemente und des „ursprünglichen Arztes in uns“ bis hin zur bewusst hergestellten Einheit mit der äußeren Natur reichte. Diese Verhaltensänderung bewirke dann schließlich – im Umkehrschluss –, dass der Mensch respektive der Lebensreformer wie selbstverständlich auf die als „natürlich“erkannten Lebensweisen, Artefakte, Normen und Werte zurückgreife und die künstlichen Surrogate automatisch meide;14 eben: „Durch Natur zurück zur Natur“15. Diese Strategie galt dann ebenso für gesunde Ernährung, naturgemäße Heilweise und natürliche Körperkultur wie für nicht industriell produzierte Kleidung oder von Hand gefertigte Wohnungseinrichtung.
Die Rückkehr zur Natur und die anschließende Symbiose von Mensch und Natur spiegeln sich in den an religiöse Motive angelehnten stereotypen Erweckungsgeschichten vieler Protagonisten der Lebensreform wider. Im Mittelpunkt dieser Erzählung steht in der Regel eine angeblich bereits seit der Geburt vorhandene Schwäche oder eine – laut Selbstdiagnose durch „Zivilisationsschäden“ oder „unnatürliche“ Lebensweise hervorgerufene – chronische Erkrankung, die durch konventionelle Methoden nicht geheilt werden konnte, sowie – nach einem symbolischen Schlüsselerlebnis – die anschließende Gesundung durch „natürliche“ Heil- oder Kräftigungsmethoden der Lebensreform.16 So bezeichnete sich der Nudist Richard Ungewitter als „schwächlich veranlagter Knabe“, der in Vegetarismus, Abstinenz und Körperkultur seine Heilmittel fand. Auch der Lebensreformer Theodor Siebert „war (…) von Jugend auf zart und schwächlich“, dazu kam noch ein „Lungenspitzenkatarrh“, der durch eine „große Lernbegier“ mit unnatürlicher sitzender Lebensweise ausgelöst wurde; ein Los, das er bemerkenswerterweise in genau dieser Kombination mit Sebastian Kneipp teilte, bis Siebert als natürliche Heilmethode Körperkultur und gesunde Ernährung entdeckte, während Kneipp erfolgreich zur Wasserkur griff. Beim belgischen Lebensreformer Van Son, der „mit einer sehr ersten Erschütterung (s)einer Herzfunktionen“ im Bett lag, versagten die konventionellen Ärzte, ehe Van Son über Rohkostdiät zur natürlichen Heilweise fand. Der Naturheilkundler Adolf Just griff dagegen „in äußerster Not, bei schweren Nervenleiden“ zur Heilerde.17
Und auch Fidus und sein Meister, der Maler und Lebensreformer Diefenbach, waren in ihrer Jugend angeblich durch Zivilisationskrankheiten krank und schwach geworden, bis sie durch natürliche Heilmethoden zumindest teilweise kuriert wurden. Dem Schweizer Naturisten Werner Zimmermann und dem „Naturmenschen“ Gustav Nagel, ebenfalls äußerst einflussreiche Protagonisten der Bewegung, erging es – ihren eigenen Erzählungen zufolge – nicht anders. Besonders bemerkenswert dürfte der Fall des „Wasserdoktors“ Vinzenz Prießnitz sein, der angeblich auf die Idee kam, Wasser als Heilmittel einzusetzen, als er ein verletztes Reh beobachtete, das erfolgreich seine Wunden im Wasser eines Tümpels kühlte. Prißnitz verkoppelte das lebensreformerische Erweckungsmotiv damit noch zusätzlich mit dem mystischen Naturerlebnis einer tierischen Selbstheilung, einer Kombination, die in der Bewegung doppelt wog.18
Es wäre weder gewinnbringend noch ertragreich, derartigen Heilserzählungen noch weitere von unüberprüfbaren Behauptungen durchzogene lebensreformerische Erweckungserlebnisse hinzuzufügen. Im Gegenteil: Die Fülle an „Belegen“ würde die in der Bewegung sorgsam ignorierten Fälle verdecken, in denen die hochgehaltene Symbiose von Natur und Mensch durch eine naturgemäße Heilweise weniger gut funktionierte – vereinzelt auch zum Tode geführt hat – und etwa mit dem Rat des entsprechenden Naturheilexperten endete, auf lebensreformerische Heilweise lieber zu verzichten.19 So musste Diefenbach eine persönliche Niederlage hinnehmen, als sein naturheilkundiger Ratgeber, der „Sonnendoktor“ Arnold Rikli, ihm schrieb, Diefenbachs schlechte Gesundheit sei wohl auf seine vegetarische Kost zurückzuführen, so dass er wieder Fleisch essen und Wein trinken solle. Auch Fälle wie der des frühen Vegetariers und Lebensreformautors Gustav Schlickeysen, der 1893 aufgrund von kalten Abreibungen mit Wasser an Unterkühlung starb, oder der des auf die Südseeinsel Kabakon ausgewanderten fanatischen „Kokosnußpredigers“ August Engelhardt, der die einseitige vegetarische Ernährung mit Kokosnüssen nicht überlebte, wurden zwar publiziert, dienten aber als singuläre Beispiele für die Verirrung einzelner Lebensreformer und nicht zur selbstkritischen Überprüfung der natürlichen Lebensweise,20 ganz zu schweigen vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt lebensreformerischer Werbeslogans wie „Iß roh, so wirst Du froh, iß kalt, so wirst Du alt“.21
Titelblatt für„Die Neue Zeit“.
Trotz dieser gelegentlichen, wenngleich spektakulären Niederlagen blieb das Motiv der „Natur um uns“ ebenso wirkmächtig wie durchschlagend, verband es sich doch mit einem elitären Lebensgefühl, dass der Nudist Magnus Weidemann 1924 mit der Bemerkung „Es ist unser stiller Stolz, ganz anders zu sein“22 treffend zum Ausdruck brachte, wenn es auch nicht notwendigerweise immer über den Naturbegriff funktionieren musste. So konnten im semantischen Umfeld der emphatischen Auffassung von „Natur in uns“ immer wieder gleichwertige Begriffsmotive wie Wahrhaftigkeit, Reinheit, Klarheit, Harmonie, Schönheit, Echtheit, Einfachheit, Ehrlichkeit und Veredelung in der Eigenliteratur auftauchen, die in der Regel aber alle denselben „natürlichen“ Idealzustand des Menschen und seiner Umgebung meinten.23 Dies wurde auch so formuliert: So schrieb die Lebensreformerin Elfriede Pausewang, die Mutter der 1928 in einer Reformsiedlung geborenen Schriftstellerin Gudrun Pausewang, 1979 rückblickend über „meinen Aufbruch“ im Ersten Weltkrieg: „Einfach leben, naturverbunden eben, ehrlich leben, das bedeutete schon einen gewaltigen Einbruch in die Plüschwelt der Wilhelminischen Gesellschaft.“24 Auch der Nudist Magnus Weidemann bekannte 1924: „Natürlichkeit, Echtheit, Schlichtheit, Gesundheit. Und das ist zugleich Schönheit, Freude und Güte.“25 Andere empfanden ebenso.
Die Hoffnung auf eine derartige „naturgesetzliche“ Bewusstseins- und Verhaltensänderung des Menschen führe dann zu dem, was in der ebenfalls floskelhaften Worthülse der „Einheit von Körper (Geist) und Seele“ zum Ausdruck kam: „Und in der menschlichen Dreieinigkeit von Körper, Seele und Geist muß erst der Körper gesund, stark und widerstandsfähig gemacht werden, damit sich in seiner Hülle die inneren Fähigkeiten der Seele und des Geistes voll entwickeln können.“26 Diese „Innerlichkeit“, „Ganzheitlichkeit“27 oder „Authentizität“, von dem Vegetarier Eduard Baltzer als „mit (sich) selbst identisch“-Sein umschrieben, konnte sowohl, wie der Schweizer Nudist Werner Zimmermann notierte, als „Streben nach Wahrheit und Tugend, nach Gesundheit und Glückseligkeit“ aufgefasst werden, als auch ganz konkret die „persönliche Steigerung des körperlichen und geistigen Wohlbefindens“ meinen.28
In der Konsequenz des letzteren Zugangs (und unter Rückgriff auf die Schriften der Philanthropen der bürgerlichen Aufklärung) konnte auch ganz profane Gymnastik bzw. das Streben nach körperlicher „Fitness“ – der Begriff ist zeitgenössisch –in der Lebensreformbewegung zum Teil der Naturideologie verklärt werden. Denn wenn ein als so bezeichneter dysfunktionaler und disharmonischer Körper als unnatürlich galt und eine gesunde natürliche Lebensweise, wozu auch Gymnastik gehöre, zur natürlichen Gesundung führe – wobei das Ziel der Natur der sich bewegende, funktionierende und harmonische Mensch sei –, dann sei die Natur vernünftig und zweckmäßig und ein über Sport und Gymnastik gestalteter gesunder und zweckmäßiger Körper trotz seiner technischen Bearbeitung eben automatisch natürlich.29 Selbstverständlich liegt dieser Argumentation, und das war den Zeitgenossen auch klar, neben dem ursprünglich aufklärerischen Impetus auch die moderne soziale Aufstiegsideologie des „eigenen Glückes Schmied“ mit ihren Seitenpfaden der sozialen, gesundheitlichen und auch rassenideologischen Ausgrenzung potentiale zugrunde. Aber auch dieser argumentativ heikle Interpretationsstrang konnte durchaus in den dehnbaren Naturbegriff der Lebensreform integriert werden.
Die Naturauffassung der „Natur in uns“ berührt sich mit der dritten Naturkategorie der „Natur als Norm oder Essenz“, in der die Naturdefinition zu sozialen, gesellschaftlichen und politischen (Ideal-)Vorstellungen und Utopien in Bezug gesetzt wurde. So konnte „Natur als Norm“ eine romantisch-idealistische Ebene bezeichnen und in „religiöser Überhöhung eine Heilskategorie (meinen), der Ort, wo das wahre Wesen des Menschen sich finden und allererst bilden kann“. Auf der anderen Seite wurde „Natur als Norm“ aber auch als konkretes wirtschaftspolitisches Programm aufgefasst, wie die von dem Vegetarier und Bodenreformer Silvio Gesell 1916 entworfene „Natürliche Wirtschaftsordnung“, die die Entwertung von Sachkapital, Geldwert und Zins vorsah, durch die sich der Sozialorganismus weltweit „in die harmonische Gesamtordnung der Natur einfügen kann“.30 Diese Naturdefinition konnte gegen historische Gegebenheiten ausgespielt werden, eine kritische Funktion übernehmen oder als Leitmotiv für eine neue Gesellschaftsordnung dienen. Vor allem über assoziative Begriffe und idealistische Vorstellungen wie „Überschaubarkeit“, „Volk“ und „Gemeinschaft“ – ebenfalls Stichworte (nicht nur) in der Lebensreform, deren Ideal die regionale kleinräumige Siedlung war – konnten „Natur als Norm“-Entwürfe durchaus zum Rückzug aus pluralistischen Gesellschaftssystemen führen und gegen die als sozial und kulturell „unnatürlich“ bezeichnete Industriegesellschaft mit ihren angeblich „krankmachenden“ bestehenden Verhältnissen ausgespielt werden.31
Verbanden sich derlei lebensreformerische Vorstellungen mit einer dezidiert völkischen Haltung, dann konnte „Natur als Norm“ zu einem national ausgerichteten Naturkonzept verengt werden, das organizistisch und damit sozial und gesellschaftlich determiniert angelegt war und dichotomisch angelegte Begriffspaare wie Natur und Kultur, Gefühl und Logik oder Rhythmus und Takt in völkische und antisemitische Kategorien überführte. Solche Denkfiguren wiesen bestimmte geographische Landschaften und Tierwelten den angeblich darin verwurzelten Völkern zu, deren innere Einstellung und äußeres Erscheinungsbild als Fortsetzung der ihnen entsprechenden Umgebung gelesen wurden. Im Rahmen damals gängiger Stereotype wurde dann eine geographisch abwechslungsreiche nordeuropäische Landschaft mit Tälern, Bergen, Heide, Wäldern, Seen und Flüssen mit dem tiefsinnigen, mystischen, wurzelhaften nordischen Menschen überblendet und die karge, flache, abstrakte Wüste dem intellektuellen, rationalen jüdischen Menschen zugeteilt. Die Eigenschaften der jeweiligen Natur entsprachen somit denen der jeweils zugehörigen Bevölkerung.32
Dass eine intellektuelle (demokratische) und zivilisationsaffine Bevölkerung kaum lebensreformerisch denken und leben konnte, verstand sich nach dieser völkischen Naturauffassung von selbst. Nur „reinrassige“ Deutsche konnten daher auch reine Lebensreformer mit „natürlicher Leibeszucht (…), Nacktheit, Pflanzenkost und Nüchternheit“ sein, wie der völkische Lebensreformmaler Fidus sich 1922 ausdrückte, und auch für den völkischen Reformer Christian Dußel gewährleistete der Zusammenhang zwischen „Mensch, Tier und Pflanze“ den „Höhepunkt arischen, germanischen Seelenlebens“, der schwerer wiege als „sozialdemokratischer Weltverbrüderungswahnsinn“.33 Für die Vertreter dieser rassischen Naturkonzepte galten daher „multikulturelle“ – was Flora und Fauna betrifft – Zustände mit allen Konsequenzen als „widernatürlich“; eine völkisch-lebensreformerische Denkfigur, die der geographischen und ethnischen Trennung von „Völkern“ –der Begriff in dieser Konsequenz ist ohnehin ein reines Gedankenkonstrukt – das Wort redete.34 Ähnliche problematische Naturkonzepte fanden sich auch bei den völkischen Vertretern der politisch ebenfalls breit aufgestellten Heimat- und Naturschutzverbände, die die „Deutsche Heimat in ihrer natürlichen und geschichtlich gewordenen Eigenart“ schützen wollten.35
Die in der Lebensreformbewegung verwendeten Schlüsselworte „Natur“, „Gemeinschaft“ und „Volk“ kamen gewöhnlich ohne ein kontrastierendes oppositionelles Gegenüber nicht aus. Als Gegenbegriffe – das wurde schon angedeutet – bediente man sich Reizwörtern wie etwa „Kultur“, „Zivilisation“, „Degeneration“, „Masse“ und „Gesellschaft“ – umstrittene und oft mäandernd definierte, zumeist jedoch negativ besetzte Begriffe, die in den Debatten jener Zeit allein schon deshalb einen schweren Stand hatten, weil ihre abwertenden Zuschreibungen historische Kontinuität besaßen.36 Wenn der lebensreformerische Siedler Gustav Adolf Küppers im Jahre 1924 rückblickend bemerkte: „Die Natur erschien uns in dem Sumpf der Überzivilisation als das schlechthin Vollkommene, Reine, Große und Schöne“,37 so benutzte er damit in der Szene altbekannte gegensätzliche Topoi, die einer weiteren Erläuterung nicht bedurften.
Im Rahmen einer allgemeinen Kritik der jeweiligen Zeitumstände dienten derlei Begriffe als negatives Charakteristikum von moderner Technik und städtischer Kultur, Kapitalismus und Industrialisierung, intellektueller und rationaler Wissensvermittlung, pluralistischer Gesellschaft und internationaler Demokratiebemühungen; kurz: von Fortschritt und Veränderung im Sinne einer rationalen, aufgeklärten Moderne. Sie symbolisierten auch damit einhergehende individuelle Entfremdungsgefühle und ein krisenhaftes Empfinden persönlicher Unbehaustheit. Wenn die Zeitschrift „Kraft und Schönheit“1907 davon sprach, dass „gerade in unserer heutigen Zeit mit ihrem ungeheuren geistigen Durcheinander viele Menschen vollständig aus dem Geleise kommen“38, so gab sie dem vagen Gefühl der Zergliederung einen konkreten Ausdruck, der von vielen Zeitgenossen geteilt wurde. Allerdings konnte diese Art des „Kulturpessimismus“, auf die nationale Spitze getrieben, zu völkischem Denken führen39 – wie das schon früh Fritz Stern und Kurt Sontheimer als Lehre aus der jüngsten Geschichte bemerkten. 40
So galt bei völkischen Lebensreformern als Feind der Natur das gegenwärtige „Zeitalter“ mit seiner „kosmopolitisch-demokratisch-kapitalistisch-industriellen Entwicklung“.41 1906 beklagte der Kulturreformer und spätere völkische Kulturpolitiker Paul Schultze-Naumburg in seinem Aufsatz „Die Großstadtkrankheit“ genretypisch die „unerträglichen Zustände“ in den modernen Städten, die das Leben „immer künstlicher und aufreibender“ werden lassen, das „tägliche Hetzen“ und die „Verkehrsbelästigungen“, und beschrieb die „Unglücklichen, die gezwungen sind, in diesem Steinhaufen ihr Leben zu verbringen“: „(Man) kann stundenlang so die Großstadt durchirren: was (man) sucht, Ausspannung der Nerven und die Wohltaten der Natur, wird (man) nicht finden.“42 Die Großstadt und ihre „Masse“ – als Verkörperung der „Zivilisation“ – galt dabei als Synonym für psychische und physische „Degeneration“ schlechthin: soziale Kälte, physischer Verfall, Armut, Prostitution, Krankheit, Alkoholismus, Kriminalität, Massenkonsum, Entfremdung, kurz „Unnatur“.
Bei den völkischen Vertretern (der Lebensreform) kam noch die Vorstellung von der Stadt als „Rassengrab“ hinzu, und zwar sowohl hinsichtlich des Verfalls der eigenen Nation durch das urbane Umfeld als auch hinsichtlich der allgemeinen körperlichen und geistigen „Degeneration“ aufgrund der „Durchmischung“ verschiedener „Rassen“ in den Großstädten.43 „In der Großstadt stand meine Wiege“, so notierte Gustav Adolf Küppers rückblickend 1918, „der Hahn unserer Schnapsflasche stand nie still. Das Wechselgeld hörte nicht auf zu klingeln. (…) Ich sah das grausige Zeitalter des Warenhauses heraufsteigen, wo man den armen geblendeten Menschen mit der Ware Steine statt Brot gab. Ich sah den Hunger, den die Ware zu stillen bestimmt war, durch eben die Ware ins Unendliche steigen. Das mußte die letzten Brücken zerreißen, die noch von Menschenherz zu Menschenherz gespannt waren.“44 Andere Vertreter seiner Generation, denen ebenfalls die „auf Irrwege geratene Zivilisation“ ein Dorn im Auge war, teilten seine Meinung.45
Wenn der Begriff der Zivilisation in diesem Kontext ausschließlich negativ konnotiert war, so nahm „Kultur“ als Reizwort, je nach Definition, eher eine ambivalente Stellung ein. Auf der einen Seite wurde, und dies war gesellschaftlich breit anschlussfähig, der negativ besetzte Zivilisationsbegriff einem positiv konnotierten Kulturbegriff gegenübergestellt, dem Faktoren wie Religion, Familie, Innerlichkeit, Naturverbundenheit, Gemeinschaft, dörfliches Leben – letztlich „Deutschtum“ schlechthin – zugewiesen wurden. Als Klassiker einer derartigen Gegensatzdebatte galten unter anderem die vielgelesenen und unterschiedlich rezipierten Bücher des Soziologen Ferdinand Tönnies: „Gemeinschaft und Gesellschaft“ von 1887 sowie des Kunsthistorikers August Julius Langbehn: „Rembrandt als Erzieher“ von 1891.46 In diesen Debatten wurde der Naturbegriff zum großen Teil mit dem Kulturbegriff überblendet, da beide als Gegenbegriffe zu „Zivilisation“gebraucht wurden.
Auf der anderen Seite wurde auch die deutsche „Kultur“ selbst kritisiert, und zwar immer dann, wenn man bemängelte, dass sie aufgrund des hohen sozialen Drucks dem gefürchteten globalen gesellschaftlichen Wandel von außen nichts entgegensetzen könne und sich den negativen Eigenschaften der verhassten „Zivilisation“ zu nähern beginne. In der Folge wurde dann eine einstmals hohe (deutsche) „Kultur“ beschworen und, falls keine Rückbesinnung erfolge, ihr künftiger Untergang prophezeit („Kulturverfall“). In diesem Sinne notierte der Schriftsteller und Philosoph Oswald Spengler 1931, die „Zivilisation ist selbst eine Maschine geworden, die alles maschinenmäßig tut oder tun will“, wobei sich die „Kultur, der Inbegriff künstlicher, persönlicher, selbstschaffender Lebensformen, (…)zu einem Käfig mit engen Gittern“ entwickelt habe.47 In diesem Kontext konnte ein nun negativer Kulturbegriff gegen den positiven Naturbegriff ausgespielt werden. Dabei meinte man mit Zivilisationskritik und Kulturkritik häufig mehr oder weniger dasselbe, nämlich eine sensibilisierende Reflexion auf die Zumutungen der Moderne.48 Beide Begriffe wurden bei den Zeitgenossen – und auch in der Sekundärliteratur – oft synonym verwendet, wenn auch die Bezeichnung „Kulturkritik“ für beide Begrifflichkeiten überwiegen mag.49
Zwar war sich die Lebensreformbewegung mit den Kulturkritikern, was den negativen Befund anging, einig, in der konkreten Therapie hingegen ging man getrennte Wege. Dabei finden sich die terminologische Uneinheitlichkeit, die abweichenden Positionen und die gelegentliche Begriffsgleichsetzung auch in der Lebensreformbewegung wieder. Als Beispiel für die erste Position, die dichotomische Beziehungsauffassung von Zivilisation und Kultur, mag der Lebensreformer Curt Schwantes dienen, der Zivilisation für „etwas Äußerliches (hält), darum erlernbar wie ein Handwerk; man kann sie einem anderen Volke absehen und nachahmen“.50 Kultur dagegen war für ihn ein individueller authentischer Ausdruck einer Gruppe von Menschen und eine legitime Ersatzhandlung anstelle der unerreichbaren Ursprungsnatur: „Mehr und mehr haben wir uns (…) von der Natur abgewandt; wir leben nicht mehr mit Wald und Heide und Wiese und Acker (…); wir haben dafür die Kunst und die Wissenschaft.“ Daher umfasse „Kultur (…) die Art des Verkehrs mit der Natur“.51
In Folge dieser – am Mythos der Ganzheitlichkeit orientierten –Position konnte die Zeitschrift „Kraft und Schönheit“ als Leitidee formulieren: „Wir fordern im Rahmen unserer fortschreitenden Kultur eine ‚Menschheitskultur', die uns nicht geistige oder technische Fortschritte auf Kosten unserer körperlichen Entwicklung bringt, sondern uns mit diesen zu immer höherer persönlicher Entfaltung gelangen läßt.“52 Die zweite Position, die Gleichsetzung des Kultur– und Zivilisationsbegriffs, findet sich ebenfalls in der Zeitschrift „Kraft und Schönheit“: „Kultur oder Zivilisation (führen) zu einer schweren Schädigung des Einzelmenschen wie der Gesamtheit“, wobei – und nun wurde „Kultur“ ins Positive gewendet – die „Körperkultur (als) Grundlage der Lebensreform“ der Ausweg aus der Misere sei.53 „Kultur“ konnte je nach Position und Begriffsumfeld etwas ganz Verschiedenes meinen.
Die dritte Position, der ausschließlich und in drastischen Formulierungen geäußerte negative Kulturbegriff, findet sich häufig bei völkischen Lebensreformern. So sei, wie der völkische Lebensreformer Willibald Hentschel 1914 beispielhaft notierte, die Kultur der „Totengräber der Menschheit“, da sie durch Hygiene und Fortschritt „lebensunwertes Leben“ erhielte und die „konstitutive Tüchtigkeit “der Rasse verringere; nur die Natur, als dessen Meisterstück der „reinrassige Arier“ galt, könne „die Ansprüche des Lebens (…) aus dem Rassenprozeß“ ausschalten, alle „lebensfälschenden Sitten und Bräuche“ ersticken und den Menschen „zur Vollkommenheit“ führen.54 Bemerkenswerterweise waren auch innerhalb des völkischen Blocks der Lebensreform Begriffszusammensetzungen wie „Freikörperkultur“ oder „Körperkultur“ von negativen Kulturdispositionen ausgenommen und galten als positiv besetzt, genau wie in der gesamten überwiegend nichtvölkischen Lebensreformbewegung.55 Derartige Widersprüche mussten in den zeitgenössischen Debatten zur Verwirrung führen. Der mäandernden, diffus verwendeten Terminologie war jedoch kaum beizukommen und dürfte neben einem Mangel an gedanklicher Reflexion und unscharfen Definitionen auch der ideologischen Auseinandersetzung und den Grabenkämpfen der in sich zersplitterten Bewegung geschuldet sein, die erbittert um Deutungshoheiten kämpfte.
Zur Legitimierung und Rechtfertigung ihrer Gedankenkonstruktionen und Schlüsselbegriffe bediente sich die Lebensreformbewegung prominenter kulturkritischer Stichwortgeber aus Politik, Gesellschaft und Philosophie. Neben etlichen, weniger bedeutenden Vordenkern wurden dabei vor allem bekannte Zeitgenossen wie Richard Wagner, Julius Langbehn, Friedrich Nietzsche, Ludwig Klages und Paul de Lagarde oder andere bekannte „geistige Führer der Gegenwart (Oswald) Spengler, (Herrmann Graf) Keyserling, (Stefan) George“ ins Spiel gebracht.56 Sie waren deshalb so einflussreich, weil viele von ihnen „eine (den Reformbewegungen verwandte) verallgemeinernde, ethisch orientierende und an die Persönlichkeit appellierende Gesamtdeutung der Welt“ lieferten und häufig Diagnosen mit „Auswegszenarien“anboten, wobei sie „wissenschaftliche Befunde mit metaphorischen und pauschalen Behauptungen“ durchsetzten und insgesamt die akademischen Disziplinen eher ignorierten.57 Ihre kultur- bzw. zivilisationskritischen, z. T. auch völkischen Texte und Konzepte wurden freilich nicht immer dem Original entnommen, sondern oft über populäre „allgemeinverständliche Darstellungen“ der „Volksaufklärer“ jener Zeit rezipiert – im Stile von Traktaten wie „Was muss man von Friedrich Nietzsche wissen?“ oder, an Julius Langbehn angelehnt, „Nietzsche als Erzieher“ – und anschließend an die Ideologie der Lebensreform angepasst.58
Zwar lässt sich konstatieren, dass eine Rezeption nicht nur deshalb Aussicht auf Erfolg gehabt haben dürfte, weil die Stichwortgeber interpretatorisch Raum für jeden Interessierten (Lebensreformer) lieferten – selbst für ihre auch in der Szene als abseitig bis schrullig bezeichneten Vertreter.59 Noch wichtiger war es, wenn man die Vordenker mit den Anschauungen der Lebensreform in Beziehung setzen konnte – sei es, dass sie, wie Richard Wagner und sein Bayreuther Umfeld, gelegentlich naturheilkundlichen60 und vegetarischen Neigungen nachgingen61 oder vivisektionskritische Ideen formulierten, dass sie, wie Hermann Graf Keyserling mit seiner „Schule der Weisheit“, einen mit fernöstlichem Gedankengut eingefärbten reformerischen Debattenkreis initiierten oder dass sie, wie Friedrich Nietzsche, angeblich Körperkultur und Naturheilkunde das Wort redeten.62 Dennoch sind die subtilen wie direkten Rezeptionsebenen außerordentlich komplex, längst nicht erforscht und daher auch nur in Stichworten darstellbar; dieser Befund gilt auch für die mit der Lebensreform verzahnte Jugendbewegung.63
Angesichts der Komplexität und Problematik der bislang nur ungenügend aufgearbeiteten Rezeptionsgeschichte müssen an dieser Stelle ein paar Hinweise genügen. Dabei gilt es zu unterscheiden zwischen den gedanklichen und begrifflichen Parallelen von Vordenkern und Lebensreformern, die indirekt auf einen Einfluss hinweisen könnten, und den tatsächlich individuell nachweisbaren Belegen für eine Rezeption. So sollte die Beobachtung, dass sich etwa in Langbehns „Rembrandt als Erzieher“ und in der lebensreformerischen Literatur, quantitativ gesehen, zahlreiche begriffliche Überschneidungen finden – darunter Schlichtheit, Wahrheit, Einfachheit, Schönheit und Natur, von den zivilisationskritischen Formulierungen ganz zu schweigen –, nicht zu vorschnellen Schlussfolgerungen verleiten. Auf der anderen Seite sollte aber auch die Bemerkung, es sei trotz dieser begrifflichen Überblendung „höchst schwierig, einen eindeutigen Verweis auf eine bestimmte Stelle des Rembrandtbuches und die korrelative lebensreformerische Forderung aufzudecken“, ohne Überprüfung der Quellen weder bestätigt noch verallgemeinert werden.64
Denn tatsächlich ließen sich etliche Protagonisten der Lebensreformbewegung ganz konkret von bestimmten Stichwortgebern beeinflussen. So hat Fidus, einer der wesentlichen visuellen und ikonographischen Muliplikatoren der Bewegung, Werke von Nietzsche und Langbehn gelesen und sich mit Wagner befasst.65 Der einflussreiche Gymnastiker Rudolf Bode hat sich mit der Rhythmus- und Ausdruckslehre von Ludwig Klages hinsichtlich einer brauchbaren Theorie der Gymnastik und zudem noch mit den nationalen Entwürfen und kulturkritischen Aspekten von Langbehn, Lagarde, Spengler und Nietzsche auseinandergesetzt.66 Der belesene Nudist Magnus Weidemann stellte den „Rembrandt-deutschen“ 1926 sogar ausführlich vor.67 Andere Wortführer der Bewegung tummelten sich ebenfalls im selben literarischen und publizistischen Umfeld68 oder- wie die Ausdrucktanzprotagonisten Rudolf von Laban und Mary Wigman, die immerhin für kurze Zeit auf der berühmten Lebensreformkolonie Monte Verità wohnten – setzten die Texte von Vordenkern wie Nietzsche, insbesondere „Zarathustra“, künstlerisch um.69 Die Rezeption war zwar in der Regel positiv, kam jedoch nicht immer ohne Kritik an den Vordenkern aus. So wurde etwa Oswald Spengler für seinen negativen Determinismus vom unausweichlichen „Untergang des Abendlandes“ gegeißelt, denn gerade die Lebensreform wies ja im Gegenteil einen Ausweg aus der Krise.70
Welche Aspekte lassen sich – bei aller Vorsicht – zu den Grundlinien der Rezeption rechnen? Bei Friedrich Nietzsche dürften es – neben der Kulturkritik – vor allem dessen biologische Anthropologie und sein lebensphilosophischer Ansatz gewesen sein. Seine Ablehnung des Bildung mit „Vielwisserei“ verwechselnden und zur Kritik unfähigen „Bildungsphilisters“71 veranlasste ihn zu seinem Gegenentwurf von Kultur als „Einheit des künstlerischen Stils in allen Lebensäußerungen eines Volkes“; eine Art Ganzheitsgedanke, der die Idee einer organischen und natürlichen Entwicklung in sich trägt. An diesem „Primat des Lebens“anknüpfend plädiert Nietzsche für eine Befreiung „lebendiger Kräfte aus den Fesseln der Vergangenheit“. Diesen zukunftsbejahenden Vitalismus sah Nietzsche in der Jugend und ihrem Ziel des „Neuen Menschen“ verkörpert; daher fühlten sich vor allem Reformpädagogik und Jugendbewegung von Nietzsches Konzept angesprochen.72
Der Lebensreformmaler Fidus vor der Staffelei (Postkarte, 1895/1932).
Diese lebensphilosophische Reform Nietzsches schloss auch eine neue Spiritualität mit ein, die angesichts der Sinnkrise der Zeit, der Darwin'schen Überwindung der religiösen Ursprungsmythen („Gott ist tot“) und der damit einhergehenden Wissenschaftsgläubigkeit den Sinn des Lebens in alternativen Daseins- und Glaubensentwürfen fand. Eine derart „naturgesetzlich fundierte Reform des Lebens“, die ebenso Selbstfindung wie Selbsterlösung meinen und genauso eine neue (säkulare) Weltanschauung wie auch eine (pagane) Naturreligion bedeuten konnte, sollte individuell, schöpferisch, ästhetisch, lebensbejahend, überzeitlich und ganzheitlich sein.73 Hier trifft sich Nietzsche mit der Lebensreform, zufällige Missverständnisse und instinktive Überanpassungen, gewollte Fehldeutungen und bewusste Uminterpretationen inbegriffen – einschließlich der von Nietzsche nie gewollten lebensreformerischen Profanisierung, „sofern sie sich (ausschließlich) an Fragen der Hygiene, Ernährung und Gesundheit von Körper und Seele orientiert“, von Rückgriffen auf bildungsbürgerliche Askese, Eugenik und Rassenideen ganz zu schweigen.74 Der Lebensreformer Walter Hammer fasste 1913 in einem Aufsatz in der „Vegetarischen Warte“ diesen Nietzscheanismus für alle Lebensreformer prägnant und selbstbewusst zusammen: „Nietzsche hat eine Art Vergöttlichung des Leibes gelehrt. Ich bin der Meinung, daß man all unsere modernen Körperkulturbewegungen, zu denen ja auch die vegetarische Bewegung zu rechnen ist, mehr oder weniger auf Nietzsche zurückführen darf. Eine wesentliche Befruchtung durch ihn ist jedenfalls unverkennbar.“75
Neben Nietzsche fielen geringere Geister wie Langbehn, Lagarde oder Klages natürlich ab, wenngleich sie dennoch eine gewisse Bedeutung besaßen, die jedoch mehr den Zusammenhang von lebensreformerischem Naturverständnis und völkischem Denken betraf. So stieß Langbehns nationalistisch-germanischer Entwurf eines idealen deutschen Volkes, das französische Aufklärung und englischen Marktliberalismus – also „Entfremdung“ und „Entwurzelung“ – zugunsten von deutscher Ursprünglichkeit, Einfachheit, Natur und Mystik ablehnt, (nicht nur) in der Lebensreform auf Anklang:76 „Das Volk muß nicht von der Natur weg, sondern zu ihr zurückerzogen werden. Durch wen? Durch sich selbst. Und wie? Indem es auf seine eigenen Urkräfte zurückgreift.“ Langbehn ermahnte die „Deutschen, ihrer Natur (eines männlichen Volkes) treu (zu) bleiben“, ihr „Geistesleben“ dürfe „nicht mehr um die Sonne Homers, sondern um die deutsche Erde zirkuliren“ und „muß sich wieder an den heimatlichen Boden binden“.
Es waren diese Floskeln, die das Herz eines Lebensreformers höher schlagen lassen konnten, und wenn er dazu noch entsprechende Elemente der späteren erweiterten Auflagen von Langbehns Buch „Rembrandt als Erzieher“ isoliert aus dem Zusammenhang nahm – etwa dass, so die Ausgabe von 1890, zur Persönlichkeit „körperliche Kraft, Gesundheit, Lebensfreude“ und ein „nackter männlicher Körper“, dazu noch ein Schuss „Spiritualismus gehöre“, dass der Mensch, so die Ausgabe von 1922, „sein eigener Arzt sein“ solle, der „Volksarzt“ den „Menschen im ganzen und als Ganzes“ mit „Massage, Terrainkur, Kaltwassermethode, schwedische(r) Gymnastik“ zu behandeln habe –, so war es ohne weiteres möglich, Langbehn zu einem der Ahnherrn der Lebensreform zu machen und sich gleichzeitig durch ihn zu adeln.77 Auf all diese Aspekte verweisend, stellte der rührige Lebensreformer und Maler – und ehemalige protestantische Pfarrer – Magnus Weidmann 1926 in einem programmatischen Aufsatz über Langbehn fest: „Köstlich und wunderbar aber ist, daß der Geist dieses großen Deutschen (…) der Geist ist, den wir instinktiv in uns tragen und in die Welt hineintragen: Die Neudeutschen, die Jugendlichen, die Lichtgläubigen, die Nordisch-Germanischen.“78
Die Kulturkritik von Paul de Lagarde79 und Ludwig Klages blies in ein ähnliches – zum Teil strikt antisemitisches – Horn; während auf Lagardes organizistisch-völkisches Denken zum Teil nur mottoartig verwiesen wurde, um inhaltliche Übereinstimmung zu suggerieren,80 wurde dagegen der Chemiker, Schriftsteller, Lebensphilosoph und Graphologe Ludwig Klages von lebensrefor-merisch ausgerichteten Gymnastikprotagonisten mit völkischem Einschlag wie Rudolf Bode breit rezipiert. Dabei gab Klages mit seiner kulturkritischen Unterscheidung von Takt (Kultur, Zivilisation) und Rhythmus (Natur) – „der Rhythmus ist eine allgemeine Lebenserscheinung, an der als lebendes Wesen (…) der Mensch teilnimmt, der Takt dagegen ist eine menschliche Leistung“81 –eine Kulturtheorie für die Rhythmische Gymnastik vor, deren Vertreter das rhythmische Körperprinzip als natürliche Erscheinung verstanden, auf deren Grundlage ganzheitliche und der Natur immanente Körperbewegungen und entsprechende Lebensweisen möglich waren. In der völkischen Variante wurde dann dem „Deutschen“ ein natürlich-rhythmisches Lebensgefühl, dem „Engländer“ dagegen nur der materialistische Takt zugeschrieben. Dieser, an Klages angelehnte, Existenzentwurf wurde in der Lebensreform aufgegriffen und angenommen.82
Trotz aller ideologischen Gewichtung auf Ludwig Klages, Julius Langbehn oder Friedrich Nietzsche war die lebensreformerische Rezeption, was Begriffe, Motive und Vordenker anging, oft auf einen Pragmatismus ausgerichtet, der mehr rechtfertigen als politisieren wollte. Und wenn gerade die lebensreformerischen Gymnastiker ihre Ideen aus einer breiten Palette von Zivilisationskritikern und Naturphilosophen auswählten, die von Wilhelm Wundt über Karl Bücher, Carl Gustav Carus und Melchior Palagyi bis zu Georg Simmel, Hans Driesch oder Henri Bergson reichen konnte,83 so wäre dies nur eine weitere Bestätigung dafür, dass im lebensreformerischen Rezeptionssystem weniger auf definitorische Schärfe, inhaltlich stimmige Ideologie oder argumentative Stringenz geachtet wurde, sondern eher auf einen eingängigen Verweiszusammenhang, bei dem man den oberflächlichen Bezug zur Lebensreform billigend in Kauf genommen haben mochte. Denn derartige Vordenker standen nicht nur für unterschiedliche Zugänge, sondern sie sicherten über ihre Popularität immer auch eine gewisse Seriosität. Die rezipierten Stichwortgeber, die popularisierten Schlagworte und Motive, die die Schlagworte und Motive vieler Zeitgenossen waren und daher auch instinktiv verstanden wurden, dienten nur zum Teil einer Standortbestimmung. Sie trafen in ihrer definitorischen Schwammigkeit auch bei denjenigen auf Zustimmung, die nicht unbedingt zum engeren Kreis der Lebensreform zählten.