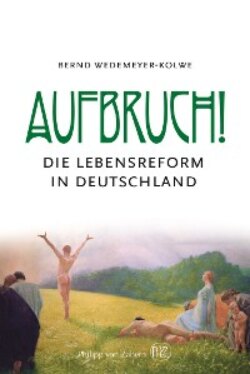Читать книгу Aufbruch! - Bernd Wedemeyer-Kolwe - Страница 8
Einleitung
Оглавление1974 veröffentlichte Wolfgang Krabbe unter dem Titel „Gesellschaftsveränderung durch Lebensreform. Strukturmerkmale einer sozialreformerischen Bewegung im Deutschland der Industrialisierungsepoche“seine 1972 an der Universität Münster eingereichte Dissertation. Darin befasste er sich mit einer damals als subkulturelles Phänomen verstandenen sozialen Protestströmung des ausgehenden 19. Jahrhunderts: der Lebensreformbewegung; eine als „unbürgerlich“, bisweilen auch als „antibürgerlich“charakterisierte Zeiterscheinung, die im Laufe der Jahrzehnte allerdings starke Spuren in der „offiziellen“bürgerlichen Kultur hinterlassen hat und sie intensiv prägen sollte. Unter dem Motto „Zurück o Mensch, zur Mutter Erde“und mit dem Slogan „Zurück zur Natur“setzte die Lebensreformbewegung, die sich im Umfeld der zeitgenössischen sozialen Reform- und Protestbewegungen positioniert hatte, der negativ gedeuteten, durch Verstädterung und Kapitalismus geprägten modernen Industriegesellschaft ein positives soziales Utopia entgegen. Die Lebensreformbewegung strebte keine Revolution an, sondern sie setzte auf eine selbständige bewusste Veränderung des Individuums, deren „Selbstreform“die gesamte Gesellschaft renovieren sollte. Das Ziel der Lebensreform war ein selbstbestimmtes, gesundes und naturbewusstes Leben in einer überschaubaren, sich selbst versorgenden Gemeinschaft, die eine als „natürlich“charakterisierte Umwelt ihre Heimat nennen konnte. Zu den Ingredienzien der Lebensreform gehörten neben vielen anderen Zutaten eine gesunde Ernährung (Vegetarismus), natürliche Heilmittel (Naturheilkunde), ein natürliches Körperbewusstsein und ein gesunder Körper (Körperkultur) sowie eine natürliche Wohnumgebung (ländliche Siedlung).
Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sich die historischen Wissenschaften kaum mit derartigen subkulturellen Bewegungen auseinandergesetzt; es gab zwar einige Vorarbeiten, sie sind jedoch nicht im universitären Umfeld entstanden, geschweige denn als Qualifizierungsarbeit angelegt worden.1 Lediglich die die Lebensreform flankierende Jugendbewegung und Reformpädagogik hatten schon immer das Interesse der historischen Forschung geweckt; diese Bewegungen hatten sich früh selbst historisiert, und aus ihnen waren im Laufe der Zeit bedeutende politische, pädagogische und wissenschaftliche Persönlichkeiten hervorgegangen, so dass beide Strömungen als etabliert genug für eine wissenschaftliche Beschäftigung galten. Dies traf auf die Lebensreformbewegung nicht zu. Ihre Protagonisten waren in der Regel keine gesellschaftlich anerkannten Persönlichkeiten gewesen, ihre Publikationen besaßen keine literarische Qualität im Sinne einer Literatur der „Hochkultur“, und ihre Ideologie galt als zu verschroben, um (wissenschaftlich) ernst genommen zu werden. Wenn auch die gegenwärtige historische Forschung in diesem Sinne keine „Scheuklappen“mehr kennt, so bedeutete es für einen Historiker der frühen 1970er Jahre jedoch noch ein Wagnis, sich mit „kulturellem Bodensatz“zu befassen; Themen wie Nacktkultur oder Vegetarismus galten in der damaligen Forschung nicht unbedingt als seriöse Sujets.
Daher war Wolfgang Krabbe damals gezwungen, sein Thema und die Wahl seiner Quellen zu rechtfertigen. Er tat dies, indem er sich auf die Perspektive einer ideologiefreien Wissenschaft berief, die sich einzig an der Relevanz des Gegenstands zu orientieren habe. Die Funktion seiner, Krabbes, Studie sei dabei primär die „Ausbreitung eines weitgehend unbekannten Faktenmaterials“, wenn auch, und hier zitierte Krabbe den Historiker Heinz Gollwitzer, das Quellenreservoir „geschichtsästhetischer Eigenschaften größtenteils entbehrt“. Krabbe rechtfertigte sich jedoch, erneut mit Gollwitzer, über den Hinweis, dass „der Wert eines historischen Verfahrens nicht nach dem geistigen Rang der zu Grunde liegenden Quellen bemessen“werden sollte, sondern allein nach Erkenntnisgewinn, Relevanz, Methode und Zielsetzung.2
Es war damals mit Sicherheit nicht abzusehen, dass Wolfgang Krabbe mit seiner Studie ein neues Paradigma in der historischen Forschung begründen und es forschungsgeschichtlich hoffähig machen sollte, wenn auch die vollständige Etablierung des Themas Lebensreform in der universitären Forschung und Lehre noch etliche Jahre andauern sollte. Bis in die 1980er Jahre hinein wurde die wegweisende Forschung zur Lebensreformbewegung in der Regel außerhalb des deutschen Hochschulmilieus durchgeführt – hier sei auf Persönlichkeiten der Forschung wie Ulrich Linse, Janos Frecot und Harald Szeemann oder auf Jost Hermand, George Mosse und Peter Gay verwiesen; letztere drei leb(t)en und lehr(t)en jedoch in Nordamerika. Ab den frühen 1990er Jahren setzte dann allmählich ein interdisziplinärer Forschungsboom ein; das Thema erhielt seinen akademischen „Ritterschlag“. In kurzer Folge wurden Qualifizierungsarbeiten und andere universitäre Studien zu einzelnen Phänomenen der Lebensreformbewegung vorgelegt, so zur Freikörperkultur,3 zur Naturheilkunde,4 zum Vegetarismus,5 zur Reformhaus geschichte,6 zur Siedlungstätigkeit7 oder zur Körperkultur;8 die Zahl der außeruniversitären und nichtwissenschaftlichen Publikationen ist ebenfalls gewachsen.9 Dabei erfreuten sich einzelne Strömungen wie etwa Freikörperkultur oder – dem gegenwärtigen gesellschaftlichen Boom entsprechend – Vegetarismus und Veganismus einer ganz besonderen publizistischen Beliebtheit.
1998 konnten dann schließlich wesentliche Forschungserkenntnisse in einem konzisen „Handbuch der deutschen Reformbewegungen“zusammengefasst werden, und zur Jahrtausendwende erfolgte dann programmgemäß eine umfassende Ausstellung mit einem zweibändigen dickleibigen Katalog.10 Heute ist die Zahl an Publikationen, die sich mehr oder weniger mit Lebensreform befassen, kaum noch zu überblicken; publizierte Hausarbeiten oder Bachelorarbeiten, die in der Regel nichts Neues bringen, inbegriffen.11 Letzteres Phänomen weist zudem deutlich darauf hin, dass das Thema in der universitären Lehre (und Forschung) zu einem festen Bestandteil etlicher historischer Disziplinen geworden ist.12 Und der Hinweis auf das Themenheft „Jugendbewegung und Lebensreform“des Geschichtsmagazins der Wochenzeitung „Die Zeit“von 2013 mag die Popularität und Aktualität des Themas auch im außeruniversitären Umfeld hinreichend belegen.13
Die frühe Forschung zur Lebensreformbewegung begriff ihr Untersuchungsfeld zunächst noch als außenseiterische Kulturerscheinung – als Subkultur, Protestbewegung, säkulare Sekte oder Rückzugsmilieu –, obwohl sie auch gelegentlich als „bürgerlich“bezeichnet wurde. Dabei stützte sie sich auf einen Quellenfundus, der aus einem subkulturellen Milieu stammte und damals außerordentlich schwer recherchierbar und beschaffbar war, auch da er wegen seines Untergrundcharakters in Universitätsbibliotheken nicht gesammelt wurde; Krabbe musste seine Quellenwahl deshalb noch rechtfertigen. Dementsprechend definierte er die Lebensreformbewegung auch als Außenseiterkultur. Neben ihren praktischen Zutaten wie Vegetarismus, Naturheilkunde und Freikörperkultur seien ihre ideologischen Merkmale die Ausbildung von monomanen Heilslehren, ein gnostisches Sendungsbewusstsein und eine eschatologisch-sektiererhafte Verhaltensweise gewesen; Merkmale, die andere zeitgenössische sozialreformerische Bewegungen so nicht gehabt hätten.14 Selbstreform, Sozialutopie und Erlösungsphantasien: dies waren die grundsätzlichen Ingredienzien der damaligen Definition der Lebensreformbewegung, und diese Definition traf nur auf einen begrenzten Kreis von Protagonisten und Strömungen zu.
Zwar wurden in der Forschung der 1970er und frühen 1980er Jahre die als genuin erkannten Strömungen dieser so definierten Lebensreformbewegung nicht immer übereinstimmend auch so übernommen. Als „spezifische Lebensreformbestrebungen“galten dennoch in der Regel immer Vegetarismus, Naturheilkunde und Nacktkultur sowie die auch in der Jugendbewegung sich konsolidierenden Siedlungsbestrebungen. Dieser Vierklang sollte für einen Großteil der Forschung das Bild der spezifischen Lebensreformbewegung bestimmen.15
Titelblatt der Zeitschrift Die Lebensreform. Monatsschrift für neue Lebensgestaltung (1926).
Im Laufe der Zeit erweiterte sich jedoch das Bild. Zwar zählte Eva Barlösius 1997 neben Vegetarismus und Naturheilkunde noch peripher die Siedlungsbestrebungen – aber nicht die Freikörperkultur – hinzu, stellte aber resümierend fest, dass sich aufgrund der zahllosen Überlappungen etlicher damaliger sozialreformerischer Strömungen die Lebensreform nicht eindeutig identifizieren lasse. Dies läge zum einen an der personellen, inhaltlichen und ideologischen Überlappung innerhalb der verschiedenen Strömungen der diversen Reformbewegungen, die eindeutige Zuweisungen erschwerten, und zum anderen an der unterschiedlichen Radikalität und Handlungsbereitschaft einzelner Protagonisten hinsichtlich ihres lebensreformerischen Lebensentwurfes: „Lebensreformer, die eher dem sympathisierenden Rand zugehörten, wählten (Lebensweisen) aus, die keine konsequente (…) Veränderung der Lebensführung verlangten und durch die man nicht sofort als ‚lebensreformerischer Sonderling' (gemeint waren hier „Barfüßige Propheten“wie Gusto Graeser oder Gustav Nagel, BWK) identifiziert wurde.“Wenn auch Barlösius, wie schon Krabbe, letztlich die Idee der Selbstreform durch „konsequente methodische Lebensführung“als Grundmerkmal der Lebensreform definierte, so setzten sich nach Barlösius nur wenige Lebensreformer auch tatsächlich einer radikalen Veränderung ihrer Lebensweise und damit einer „latenten sozialen Desintegration“aus.16 Das Gros der Reformer schien letztlich doch die Gesellschaftsfähigkeit gesucht zu haben.
Ein zweiter Aspekt der Definitionsschwierigkeit des Begriffs sei hier genannt. In den zeitgenössischen Selbstbeschreibungen verwiesen die Lebensreformer selbst häufig auf die Breite und Unübersichtlichkeit ihrer Bewegung. So zählte man gelegentlich das „mächtig umgreifende Interesse an den Schrebergärten, (den) wachsende(n) Wandertrieb, die Wandervogelbewegung unserer Jugend, das Aufblühen der (…) Sportvereinigungen (…), endlich die lebhafte Nachfrage nach kleinen Grundstücken weit vor der Stadt“zur Lebensreform hinzu. In diesem Sinne ordnete der Lebensreformer Magnus Weidemann „ohne Anspruch auf Vollständigkeit“großzügig noch „große Kreise deutschen Geisteslebens“ wie Sittlichkeitsvereine, Reformpädagogen, Gründer alternativer Religionen und Reformkünstler zur Bewegung dazu.17 Nicht nur Weidemann allerdings war ein großer und geschickter Agitator der Bewegung. Und so ist es anhand derartiger selbstbewusster Äußerungen nur schwer zu beurteilen, ob die Selbsteinschätzungen durch Profilierung und Selbstüberschätzung getrübt waren, ob hier gezielte Werbung eine Rolle gespielt hat, oder ob Weidemann und seine lebensreformerischen Zeitgenossen mit ihren Urteilen Rezeption mit Ursache verwechselt haben: Denn Sportvereine, Schrebergärten oder Sittlichkeitsvereine waren keineswegs lebensreformerische Strömungen, noch nicht einmal peripher, das wusste der Lebensreformer Weidemann sehr genau, aber durch die gesellschaftliche Rezeption der einstmals außenseiterischen Lebensreform in der Weimarer Republik hatten reformerische Elemente durchaus auch Sport- und Schrebergartenvereine erreicht.18
Durch diese und andere (z. T. ungeprüft übernommene) Selbst- und Fremdbezeichnungen sowie durch die gestiegene Popularität als Forschungsthema wich eine enge Definition einer breiteren Zuschreibung von „Lebensreform“, und ein Resultat dieser thematischen Ausweitung war eine definitorische Beliebigkeit, deren Erkenntnisgewinn sank. Ein prominenter Auslöser dieses „Paradigmenwechsels“dürfte der zweibändige Katalog zur Ausstellung „Die Lebensreform“im Jahre 2001 gewesen sein. In seiner Einführung verließ Klaus Wolbert die enge Auslegung von Lebensreform als selbstreformerische Bewegung, die durch spezifische Naturauffassungen, eschatologische Verhaltensweisen, säkularreligiöse Erlösungsphantasien und monomane Heilslehren gekennzeichnet war, und legte im Gegenteil eine „Definition von Lebensreform zugrunde, die weit über das Gebiet der traditionell als genuin reformerisch bezeichneten Aufgabenfelder hinausgreift“und deren Charakteristikum ein „zeitübergreifendes, interdisziplinäres Epochenpanorama (sei), dessen weit aufgespannter Bogen ein bislang noch niemals in ähnlicher Breite und Vielgestaltigkeit wahrgenommenes Spektrum an Erneuerungsprogrammen, an Visionen, Sinngebungen und Orientierungen (…) erschließt“.
Wolbert spannte die Lebensreformbewegung in „Bezüge und Verweise, durch die selbst extreme Entfernungen in bezug auf inhaltliche Ansätze, politische Einstellungen, ideologische, denkerische oder künstlerische Positionen sowie auch soziale Zuordnungen überbrückt werden“. Die Lebensreformbewegung sei so wirkmächtig gewesen, dass sie verantwortlich sei für „Veränderungen des Menschenbildes, die Kunst, die Literatur und die Philosophie, die Weltanschauungslehren, die Lebensgestaltung und die Alltagspraxis – bis hin zu den selbstverständlichsten Dingen des Alltags“.19 Wolberts definitorische Unschärfen korrespondierten mit entsprechend thematisch breitgefächerten Katalogbeiträgen, die von Psychologie, Anthropologie, Ideengeschichte und Religion über Architektur, Malerei und Städtebau bis hin zu Güterproduktion, Alltagsverhalten, Lebensgestaltung und Sport reichten. Durch die nahezu beliebige Kontextausweitung des engen Forschungsfeldes „Lebensreform“entstand der Eindruck, jedwede kulturelle zeitgenössische Erscheinung um und ab 1900 – inklusive der Kontinuitätslinien bis heute –habe mit der Lebensreform in engem Bezug gestanden.
So erfrischend diese panoramaartige Fernsicht auf die Lebensreform auch sein mag, ihre definitorische Beliebigkeit geht letztlich doch auf Kosten einer scharfen wissenschaftlichen Nahsicht auf ein ursprünglich klar umrissenes Kulturphänomen. Ein einstmals fassbares Thema verlor seine Fassbarkeit, und das hatte Folgen. Wenn Wolbert eine angeblich zentrale Bedeutung der Lebensreform für moderne Kunstströmungen wie Symbolismus, Jugendstil, Expressionismus und Abstraktion konstatierte – alles rücke „näher zusammen, als dies von der Kunstgeschichte üblicherweise gewollt ist“20 –, und 15 Jahre später in einem Katalog zum Thema „,Brücke' und die Lebensreform“dann verkündet wird, dass „die moderne Kunst in Deutschland grösstenteils im Kontext der Lebensreform entsteht“21 – eine Behauptung, die in ihrer Unbedingtheit zu belegen wäre –, so zeigt sich hier ein fataler Rezeptionsstrang, der aus Unkenntnis entsprechender Quellen und Fachliteratur an historischer Beliebigkeit und sachlicher Ungenauigkeit nicht zu überbieten ist. In der Folge entstanden immer wieder Studien mit einer vergleichbar großzügigen Kontextverbreiterung des Phänomens „Lebensreform“, deren Forschungsergebnisse aufgrund von Definitionsunschärfen, schmaler Quellenbasis und ungenauen Rezeptionsanalysen entsprechend konturlos ausfielen.22
„Lichtgebet“ von Fidus (Postkarte, o. J.).
Das Forschungsfeld „Lebensreform“ist als ehemalige Außenseiterthematik endlich in den historischen Wissenschaftsdisziplinen und in Forschung und Lehre angekommen; das ist positiv zu vermerken. Gleichzeitig jedoch ist der Gegenstand mittlerweile so unübersichtlich wie breit gefächert, er scheint definitorisch so konturlos wie thematisch beliebig. An genau diesen Punkten setzt diese Studie ein: Die Aufnahme des Themas „Lebensreform“in den wissenschaftlichen Kanon und die interdisziplinäre Akzeptanz des Themas in Lehre und Forschung – begleitet von einer schier unüberschaubaren Fülle an Qualifikationsarbeiten, Forschungsstudien und außeruniversitären Publikationen zum Thema bis hin zum Magazin Zeit-Geschichte der Wochenzeitung „Die Zeit“ – sind der Anlass gewesen, ein Fazit zu ziehen und ein Kompendium zur Lebensreformbewegung zu erstellen. Als Handreichung, die das Thema auf seinen ursprünglichen Forschungskanon zurückführt, soll diese Übersichtsstudie eine bündige Zusammenfassung für Forschung und Lehre bieten.
Dabei wird hier unter „Lebensreformbewegung“die Grunddefinition der frühen Studien übernommen, die, wie gezeigt, im Wesentlichen immer noch ihre Gültigkeit haben: Lebensreform war in ihren Ursprüngen demnach eine sozialreformerische Bewegung des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die im Rahmen eines weitreichenden Naturbezugs eine Veränderung der als negativ gedeuteten Industriegesellschaft anstrebte und über eine „Selbstreform“zu einer Gesellschaftsreform gelangen wollte. Das eigentliche Endziel war ein selbstversorgendes Leben in kleinen Gemeinschaften in ländlicher Umgebung. Im Zentrum lebensreformerischer Praktiken standen Vegetarismus, Naturheilkunde, Körperkultur und Siedlungstätigkeiten. Ihre ideologischen Merkmale waren die Ausbildung monomaner Heilslehren und ein gnostisches Sendungsbewusstsein. Selbstreform, Sozialutopie und Erlösungsphantasien: Diese drei Grundpositionen unterschieden die Lebensreform von flankierenden zeitgenössischen Reformbewegungen trotz zahlreicher Berührungspunkte und Überschneidungen zu benachbarten Strömungen.
Im Zentrum dieser Studie stehen die Grundpositionen der Lebensreformbewegung. Nach einer Analyse der wesentlichen Grundbegriffe, Motive und Stichwortgeber der Bewegung werden die vier obengenannten wesentlichen Praktiken – auch hinsichtlich der Verbindungen untereinander – dargestellt; dabei wird immer auch über die Rezeptionskraft und die Wirkungsgeschichte lebensreformerischer Elemente sowie über die Parallelströmungen der Lebensreform zu sprechen sein. Im anschließenden Ausblick werden die Interpretationspositionen und Deutungsversuche der mittlerweile über 40-jährigen Forschung zur Lebensreformbewegung erläutert und es wird versucht, die Lebensreform historisch und forschungsgeschichtlich einzuordnen. Ein ausführliches Literaturverzeichnis schließt diese Studie ab.
Der Lebensreformer Richard Ungewitter am Schreibtisch.