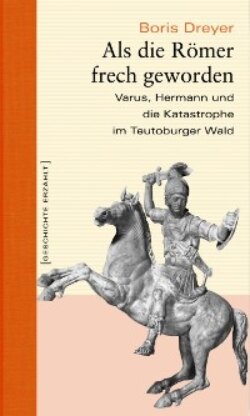Читать книгу Als die Römer frech geworden - Boris Dreyer - Страница 7
Оглавление[Menü]
Das Komplott – Varus und seine falschen Freunde
Plötzlich aus des Waldes Duster
Brachen kampfhaft die Cherusker;
Mit Gott für Fürst und Vaterland
Stürmten sie von Wut entbrannt
Gegen die Legionen.1
Der Schrecken war groß: Wohin fliehen? Wo waren die eigenen Reihen? Wo der Feind? Überall Tote und kein Heil in Sicht. Noch vor wenigen Minuten hatten sich die römischen Truppen in Freundesland gewähnt, schwer beladen und mit einem langen Tross in lockerer Ordnung erstreckte sich der Heereswurm über Dutzend Kilometer hinweg. Jetzt sah man sich auf allen Seiten angegriffen, von Germanen, die man eben noch für Verbündete hielt.
Wie konnte es dazu kommen? Auf diese Frage suchte schon der römische Historiker und Politiker Cassius Dio eine Antwort. Er berichtet ausführlich über die Reaktion der Germanen auf den verschärften Herrschaftskurs des neuen Statthalters Varus ab 7 n. Chr.:2
Dies wollten sie [die Germanen] nicht ertragen, vielmehr verwiesen die Fürsten auf ihre frühere königliche Abkunft, und die Masse zog den gewohnten Zustand der ausländischen Herrschaft vor. Aber sie fielen nicht offen ab, weil sie sahen, dass viele Römer sich in der Nähe des Rheins aufhielten und viele in ihrem Gebiet.
Die Germanen nahmen Varus auf und gaben sich willfährig. Nichts deutete darauf hin, dass sie etwas anderes im Sinn hätten, als sich dem Willen der Römer bereitwillig zu unterwerfen. Sie lockten Varus weit weg vom Rhein ins Land der Cherusker an der Weser. Varus fühlte sich mit seinen Truppen wie in einem befriedeten Freundesland und glaubte sich sicher:
Folglich hielt er nicht die Legionen, wie es üblich war im Feindesland, zusammen; vielmehr verteilte er viele von ihnen an schwache Gemeinden, die sie anforderten, angeblich für die Bewachung von bestimmten Plätzen, für die Ergreifung von Räubern und für die Begleitung von Verpflegungstransporten.
Zum engsten Verschwörerkreis gehörten Arminius und Segimer, die den Anschlag auf Varus und seine Armee bis ins Kleinste planten. Es gelang ihnen, das Vertrauen des römischen Befehlshabers zu gewinnen.
So ahnte Varus nicht nur nichts Schlimmes, sondern glaubte auch allen, die argwöhnten, was vor sich ging, und die rieten, auf der Hut zu sein, in keiner Weise. Vielmehr tadelte er sie, dass sie sich umsonst aufregten und jene schlecht redeten.
Varus im Sommerlager
Im Sommer des Jahres 9 n. Chr. hielt sich Varus mit der gesamten niederrheinischen Armee im rechtsrheinischen Gebiet auf. Wenn Cassius Dio schreibt, dass Varus an der Weser stand, so wird dies in der Nähe der Heerstraßen, nicht weit von den befestigten Lagern entlang der Lippe-Linie, gewesen sein.
Ein Schwachpunkt der Eroberungen im rechtsrheinischen Raum von Beginn an war, dass die Elbe sich als Grenze längst nicht in dem Maße eignete wie zuvor der Rhein. Die Elbgermanen, die Semnonen, drohten immer wieder, die Elbe nach Westen zu überqueren und zusammen mit den Langobarden die labile Ordnung zu stören. Sie waren aber auch heftig umworben, in den Anhang des Marbod zu wechseln: Ein Wechsel in Marbods Gefolgschaft hätte dessen germanisches Königreich im Böhmischen Kessel weiter stabilisiert. Schon im Jahr 6 n.Chr. war der römische Zangenangriff gegen Marbod fehlgeschlagen, was zu dessen Renommee in nicht geringem Maße beigetragen hatte.
Im Sommer des Jahres 9 stand darüber hinaus die Entscheidung im pannonischen Aufstand an. Dieser hatte zwischen 6 und 9 n. Chr. teilweise bis zu zehn Legionen gebunden und die finanziellen Mittel des Kaiserreiches stark in Mitleidenschaft gezogen. Marbod sollte durch die schlagkräftige Veteranenarmee des Varus davon abgehalten werden, noch kurz vor dem römischen Sieg in Pannonien (heute Ungarn) zugunsten der Aufständischen einzugreifen.
Und noch eine Aufgabe sollten die Veteranenlegionen unter Varus erfüllen: eine beschleunigte Eingliederung der anvisierten rechtsgermanischen Provinzen in ein geregeltes Provinzialregime, das die konsequente Anwendung der römischen Rechts- und Prozesspflege einschloss. Der Historiker Velleius Paterculus, ein altgedienter Soldat aus Germanien und glühender Anhänger des Princeps Tiberius (14–37 n. Chr.), berichtet von derartigen Absichten:
Mit diesem Vorsatz ging er [Varus] ins Innere Germaniens wie zu Menschen, die sich an der Annehmlichkeit des Friedens freuten, und zog die Sommerkampagne hin mit Rechtsprechen und formvollendeter Verhandlungsführung.3
Doch weiß Velleius Paterculus auch von einer Opposition zu berichten, die sich gegen die verschärfte römische Gangart im Verborgenen regte. Und er benennt den Führer der germanischen Opposition, der besondere Qualitäten hatte, selbst in den Augen eines Römers, der sich den germanischen Barbaren prinzipiell überlegen empfand.
Die Leute dort sind aber – wer es nicht erfahren hat, wird es kaum glauben – bei all ihrer Wildheit äußerst verschlagen, ein Volk von geborenen Lügnern. Sie erfanden laufend Streitfälle. Bald schleppte einer den anderen vor Gericht, bald bedankten sie sich dafür, dass das römische Recht ihren Händeln ein Ende mache, dass ihr ungeschlachtes Wesen durch diese neue und bisher unbekannte Einrichtung allmählich friedsam werde und, was sie nach ihrer Gewohnheit bisher durch Waffengewalt entschieden hätten, nun durch Recht und Gesetz beigelegt würde.
[…] Es gab damals einen jungen Mann aus vornehmem Geschlecht, der tüchtig im Kampf und rasch in seinem Denken war, ein beweglicherer Geist, als es die Barbaren gewöhnlich sind. Er hieß Arminius und war der Sohn des Segimer, eines Fürsten jenes Volkes. In seiner Miene und in seinen Augen spiegelte sich sein feuriger Geist.
Vom Kollaborateur zum Verschwörer
Als junges Mitglied einer adligen Familie – einer Königssippe, wie der Politiker und Historiker Tacitus (ca. 55–113 n. Chr.) schreibt (Ann. 11,16) – bei den Cheruskern, die mit den Römern kooperierte, war Arminius wie sein Bruder mit dem römischen Namen Flavus in römischen Dienst eingetreten. Sie waren in die Stammeskontingente, welche die unterworfenen Germanenstämme den Römern zu stellen hatten, eingegliedert. Diese Kontingente erfüllten zwei Funktionen: Sie verstärkten die römischen Einheiten durch ortskundige Truppen und stellten die Treue des Stammes sicher, aus dem die Kontingente stammten. Dem Cheruskerstamm, der in einem Gebiet vom Quellgebiet von Ems und Lippe im Westen bis hin zur Elbe und darüber hinaus im Osten siedelte, war in den (mindestens zwei) neuen anvisierten Provinzen im rechtsrheinischen Gebiet eine privilegierte Stellung zugedacht, ebenso wie sie im gallischen Siedlungsraum die Haeduer seit Caesar genossen hatten. Die mit Rom kooperierenden Familien aus dem Cheruskerstamm waren bereits für die herausragenden Funktionen der Provinzverwaltung vorgesehen. Die jungen germanischen Adligen in diesen Stammeskontingenten wurden – über die lateinischen Kommandos hinaus – mit der römischen Lebensart und Kultur bekannt. Sie sollten sich so an die Vorzüge des römischen Lebens gewöhnen.
Arminius schien sich der Lebensart der neuen Herren nicht nur bereitwillig zu fügen, er machte sie sich auch zu eigen und schaffte es gar bis in den römischen Ritterstand. Damit gehörte er nach römischen Kriterien zum Establishment. Vielleicht ist wie im Falle seines Bruders Flavus sein Name lateinischer Herkunft, zumindest aber die latinisierte Form eines Namens germanischer Herkunft.
Während seiner militärischen Laufbahn hatte Arminius die Stärken der römischen Armee und auch ihre Schwächen – beim Einsatz im pannonischen Aufstand (6–9 n. Chr.) – gründlich studiert. Damals waren die römischen Truppen mehrfach, bedingt durch die Infrastruktur und die kalten Jahreszeiten, in erhebliche Bedrängnis geraten. Erst der Einsatz von zehn Legionen und erheblichen finanziellen Mitteln verhalf den Römern letztendlich zum Sieg. Diese Erkenntnis nahm Arminius mit und nutzte sie für seine Taktik gegen Varus und gegen die Armeen des Germanicus. Dabei ging der Germane systematisch vor, wie Velleius berichtet:
Erst weihte Arminius nur wenige, dann mehrere in seinen Plan ein. Die Römer könnten bezwungen werden, behauptete er – und er war überzeugend. Er ließ den Beschlüssen Taten folgen und legte den Zeitpunkt für den Hinterhalt fest.
Doch in dem stolzen germanischen Adel war die Führung des Arminius nicht konkurrenzlos. Es gab streng romtreue Fraktionen, angeführt vom Schwiegervater des Arminius, Segestes: Der erfuhr von den Plänen des Arminius und verriet den Hinterhalt – allerdings:
Varus wollte es nicht glauben und beharrte darauf, die offensichtlichen Freundschaftsbezeugungen der Germanen gegen ihn als Anerkennung seiner Verdienste zu betrachten. Nach diesem ersten Warner blieb für einen zweiten keine Gelegenheit mehr.4
Ein wesentlicher Bestandteil des Aktionsplans der Verschwörer unter der Führung des Arminius war, dass man Varus von den herkömmlichen Trassen, die die römischen Armeen entlang der Lippe-Linie für Hin- und Rückmarsch zu nehmen pflegten, weglockte. Dazu sollten sich Stämme, die weit entfernt siedelten, zum Schein erheben. Diese Stämme mussten sich außer Reichweite jeder anderen römischen Armee befinden, also weiter im Norden, sodass nur Varus dafür infrage kam, die Rebellen mit einem Umweg auf dem Weg nach Xanten wieder zu unterwerfen.
Zuvor schon hatte Varus bereitwillig Truppen auf Anfrage ausgesandt. Während diese versprengten Einheiten massakriert wurden, gaben die Anführer der Verschwörer dem Statthalter gegenüber vor, sie würden den Heerbann nur verlassen, um die Auxiliar- und Bundesgenosseneinheiten der Stämme zur Unterstützung heranzuführen.
Das taten sie auch, doch in feindlicher Absicht. Als der erste unerwartete Angriff tief im unwegsamen Waldgebiet auf die orientierungslose römische Armee erfolgte, war es zu spät. Die Falle war zugeschnappt.